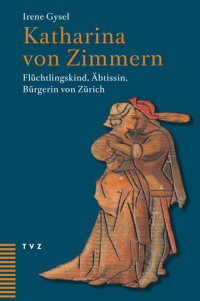
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Theologischer Verlag Zürich
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vor 500 Jahren übergab die Äbtissin Katharina von Zimmern das Fraumünsterstift der Stadt Zürich in der Hoffnung, den Frieden zu fördern – und versetzte damit der Reformation einen entscheidenden Schub. Wer war diese bemerkenswerte Frau, die sich mit Weitblick in die Politik von Kirche und Staat einbrachte? Irene Gysel beschreibt ihre Lebensumstände und skizziert anhand historisch belegter Tatsachen ein lebendiges biografisches Porträt von Katharina von Zimmern: einer Frau, deren Familie vor dem Kaiser fliehen musste, die als Mädchen ins Kloster gegeben wurde und als 18-jährige Chorfrau zur Äbtissin des Fraumünsterstifts gewählt wurde. Als Äbtissin war Katharina von Zimmern viele Jahre verantwortlich für die umfangreiche Wirtschaft der Abtei, für ihre bauliche Ausstattung, aber auch für ihre Chorfrauen, die gelegentlich erheblichen Gefahren ausgesetzt waren und deren Zusammenleben sich nicht immer einfach gestaltete. Nach der Übergabe des Klosters und dessen Ländereien an die Stadt heiratete sie mit 47 Jahren den Söldnerführer Eberhard von Reischach, mit dem sie wohl bereits zu ihrer Klosterzeit eine Tochter hatte, und führte fortan ein Leben als Ehefrau und Mutter, zuletzt als Witwe und Patin in fünf Zürcher Familien. Die von der Autorin neu aufgespürten und neu erschlossenen Dokumente ermöglichen Einblicke in ein faszinierendes Frauenleben und in eine Zeit, die geprägt war von ungeahnten Aufbrüchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort der Stadtpräsidentin
Einleitung
Das Flüchtlingskind
Schloss Messkirch (1478–1487)
Bedroht
Die Mutter
Der Vater
Verjagt
Weesen (1490–1491)
Aufgenommen
Heirat oder Kloster
Einkauf in die Abtei
Fraumünster Zürich (1491)
Untergebracht
In der Abtei
Hans Waldmann
Unterbrechung
Eingekleidet
Einsiedeln
Der wilde Bruder
Wahl und Weihe (1496)
Umstritten und doch gewählt
Geweiht
Die Äbtissin
Im Amt (1496)
Eingesetzt
Turbulenzen
Kaplanisse
Prozessionen
Wallfahrten
Belästigt
Fordernd
Gestaltend
Zwischen den Fronten
Familie Göldli
Chorfrauen
Heimlichkeiten
Das grosse Fest
Die Klosterstadt
Die Bauherrin (1506–1508)
Der grosse Bau
Die Sprüche
Die Flachschnitzfriese
Die Devise
Das rote Barett
Die Fischsirene
Familie, Freunde, Chorfrauen (1509–1515)
Der späte Erbverzicht
Der Söldnerführer
Eine neue Chorfrau
Wichtige Weichen (1516–1518)
Erasmus
Zwingli
Der Freund
Ein dramatisches Jahr (1518–1519)
Die Chorfrau auf der Münsterbrücke
Der Reformator
Eberhard verurteilt
Die Pest
Streit
Anfänge (1520–1522)
Aufbruch
Die Schule
Noch hoffnungsvoll
Einschnitte
Allein
Unruhen (1523–1524)
Die Auseinandersetzungen werden militanter
Streit im Kloster Oetenbach
Die Cousine in Königsfelden
Umworben
Zerstörungen
Ängste
Der Ittinger Sturm
Veränderungen (1524)
Feste und Feiern
Regula verheiratet
Der Herzog in Zürich
Zur Übergabe bereit
Entgegennahme des Rats
Eine gemischte Schenkung
Befreit und traurig?
Die Bürgerin
Noch in Zürich (1525)
Sich neu zurechtfinden
Täufer
Frauenklöster
Schaffhausen und Diessenhofen (1525–1531)
Verheiratet
Forderungen
Diessenhofen
Eine Anschuldigung
Katharinenthal
Die Königsfelderinnen
Brief an die Brüder
Zurück in Zürich (1529–1531)
Eberhard wieder in Zürich
Katharina wieder in Zürich
Die Cousine heiratet den Freund
Heiratsgut gefordert
Vor dem Krieg
Die Katastrophe
Ein weiteres Unglück
Im Oberdorf
Patin
Am Neumarkt
Das Erbe
Die Nachkommen
Literatur
Nachschlagewerke
Archive und Bibliotheken
Bildnachweis
Orientierungsmarken
Table of Contents
Irene Gysel
Katharina von Zimmern
Flüchtlingskind, Äbtissin, Bürgerin von Zürich
Publiziert mit freundlicher Unterstützung von Stadt Zürich Kultur, der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich, der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Zürich, der Katholischen Kirche im Kanton Zürich, des Fonds für Frauenarbeit der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz und der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen.
Der Theologische Verlag Zürich wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Umschlaggestaltung
Simone Ackermann, Zürich
Bild: Flachschnitzereien in der oberen Stube der Fraumünsterabtei Zürich, 1507/08, Schweizerisches Nationalmuseum
Druck
gapp print, Wangen im Allgäu
ISBN 978-3-290-18635-7 (Print)
ISBN 978-3-290-18636-4 (E-Book: PDF)
ISBN 978-3-290-18762-0 (E-Book: ePUB)
© 3. Auflage 2024 Theologischer Verlag Zürich
www.tvz-verlag.ch
Alle Rechte vorbehalten
Vorwort der Stadtpräsidentin
Die Tür geht auf. Katharina von Zimmern betritt den Raum. Der Blick ist klar. Entschieden ist der Gang. Grandezza und Macht sind plötzlich präsent. Im alten Rathaus von Zürich wird im Jahr 1523 disputiert. Die Hauptdarsteller der Disputation sind für einen Moment auf die Plätze verwiesen. In diesem kurzen Moment erhält Macht ein neues Geschlecht und einen neuen Namen. Zürichs Stadtherrin und Äbtissin ist anwesend.
Im November des darauffolgenden Jahrs übergibt Katharina von Zimmern die Schlüssel für das Fraumünster mitsamt Vermögen und Ländereien dem reformationsfreundlichen Bürgermeister Zürichs. Sie tut es mit grosser Geste. Zu Katharinas Grandezza und Macht gesellen sich Weitblick und Gewissheit. Der Generalvikar ist bei der Schlüsselübergabe anwesend. So unterschiedlich die Reaktionen der zwei Männer sind, so teilen sie in diesem Moment eine Gemeinsamkeit: Sie sehen, wie die Frau im Raum der Reformation Schub verleiht und das Schicksal Zwinglis besiegelt. Katharina von Zimmern macht Geschichte.
Mit diesen zwei Szenen aus Stefan Haupts Spielfilm «Zwingli – Der Reformator» wird der Name Katharina von Zimmern einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Nun ist Geschichte kein Spielfilm und epochenmachende Transformationen sollten nie ausschliesslich den Taten einzelner (vermeintlich) grosser Persönlichkeiten zugeschrieben werden. Das gilt für Frauen wie für Männer. Und doch stellt die Übergabe des Fraumünsterstifts einen Wendepunkt in der mittelalterlichen Stadtgeschichte Zürichs dar.
Die Übergabe des Fraumünsterstifts begründete Katharina von Zimmern mit der Vermeidung «von Unruhe und Ungemach» für die Stadt sowie mit dem «Lauf der Zeit».1 In formeller Hinsicht beendete die Schlüsselübergabe die Herrschaft der Äbtissin als Reichsfürstin über die Stadt Zürich.
Der Fraumünsterstift war gut dotiert. Durch die Übergabe gelangten grosse Vermögenswerte und Ländereien in die Hand des Rats von Zürich. Das Gelingen der Reformation war fortan nicht ausschliesslich eine theologische Frage, sondern auch mit handfesten ökonomischen Interessen verknüpft. Beispielsweise finanzierte der Rat von Zürich mit den Vermögenswerten aus der Stiftsübergabe den Aufbau einer sozialen Fürsorge.
Darüber hinaus ist in Anbetracht der Quellenlage davon auszugehen, dass die Stiftsübergabe mitentscheidend dafür war, dass die Reformation in Zürich ohne Bürgerkrieg möglich wurde. Schliesslich gab die Übergabe des Fraumünsters der folgenden Kirchenreform einen entscheidenden Schub. Kurz nach der Übergabe beschlossen der Kleine und Grosse Rat von Zürich, alle weiteren Klöster in der Stadt und auf dem Land aufzuheben und in Staatsbesitz zu überführen.
Der Rat von Zürich erkannte die Bedeutung und historische Dimension von Katharina von Zimmerns Entscheidung. Er sprach ihr eine lebenslange Rente sowie das Wohnrecht im Fraumünster zu. Und Katharina von Zimmern durfte ein unbevogtetes Leben führen. Für eine Frau im 16. Jahrhundert ein einmaliges «Privileg».
Katharina von Zimmerns Verdienste sind anerkannt. Davon zeugt das Denkmal im Stadthaus-Kreuzgang. Und doch ist ihre Persönlichkeit einer breiten Öffentlichkeit zu wenig bekannt. Reformationsgeschichte ist in unserer Erinnerung allzu oft allein Männergeschichte.
Das soll sich ändern. Im Jahr 2024 jährt sich die Stiftsübergabe zum fünfhundertsten Mal. Diverse zivilgesellschaftliche Organisationen nutzen das Jubiläumsjahr, um Katharinas Tat zu würdigen. Die zahlreichen Veranstaltungen und Anlässe – wie beispielsweise Stadtrundgänge, Ausstellungen oder eine architektonische Kunstinstallation – laden uns während dem Jubiläumsjahr ein, Zürichs Geschichte aus einer neuen Perspektive zu erkunden. Und Irene Gysel liefert das Buch zum Jubiläumsjahr.
Die beschriebenen Filmszenen fanden selbstredend nicht genau so statt. Und doch zeigen sie treffsicher die starke Persönlichkeit Katharinas, wie sie auch im vorliegenden Buch zum Ausdruck kommt. Irene Gysel nähert sich den Lebensumständen von Katharina von Zimmern in einer verwirrenden und widersprüchlichen Zeit an. Die Autorin legt – anhand von akribisch recherchierten und historisch belegten Tatsachen – ein packend geschriebenes Porträt Katharina von Zimmerns vor. Dank der detektivischen Quellenarbeit von Irene Gysel dürfen wir mit diesem Buch in ein aussergewöhnliches Frauenleben eintauchen. Bekannt ist, dass Katharina von Zimmern als junge, erst 18-jährige Chorfrau zur Äbtissin gewählt wurde. Oder dass sie ihr Herz einem Söldnerführer schenkte, den sie nach der Stiftübergabe heiratete und mit dem sie vermutlich bereits zu ihrer Klosterzeit ein uneheliches Kind hatte. Nun erfahren wir in Irene Gysels Buch weitere Begebenheiten und Details – aus Katharina von Zimmerns Kindheit, aus ihrer Zeit als Äbtissin und zuletzt aus ihrem Leben als «normale» Bürgerin von Zürich nach der Stiftsübergabe.
Bei Irene Gysel bedanke ich mich dafür, dass sie uns eine eindrückliche weibliche Persönlichkeit aus dem 16. Jahrhundert näherbringt. Dank ihrer Arbeit können wir mittelalterliche Stadtgeschichte neu entdecken. Uns allen wünsche ich, dass wir uns vom Pioniergeist dieser Zeit inspirieren lassen und den Mut finden, unsere heutigen Herausforderungen ebenso mit Weitblick und Entschlossenheit anzugehen. Ihnen, geschätzte Lesende, wünsche ich viel Freude bei der Lektüre.
Corine Mauch, Stadtpräsidentin
Einleitung
Die Freude am Forschen und die noch offengebliebenen Fragen bei der Recherche für das 2019 herausgekommene Buch verleiteten mich, die Lebensgeschichte von Katharina von Zimmern nochmals aufzugreifen. Und da sich 2024 die Übergabe der Abtei zum fünfhundertsten Mal jährt, lag es nahe, aus der Fülle des nun vorliegenden Materials ein weiteres Mal etwas zu gestalten. Entstanden ist eine Schrift, die ausschliesslich auf die Biografie von Katharina von Zimmern und ihr Zürcher Umfeld fokussiert. Es gibt ja nur wenige schriftliche Zeugnisse von ihr, aber einiges darüber, was ihr zugestossen ist, was ihr entgegenkam, welche Probleme und Fragen sie zu lösen hatte, ist bekannt. Wie sie es tat, sagt viel aus über sie, und streng chronologisch nacherzählt, entsteht plötzlich ein nochmals etwas deutlicheres Bild ihrer Person.
Neben den unzähligen Arbeiten, aus denen ich zitieren kann, ältere und neuere, steht an erster Stelle das Buch «Die Äbtissin, der Söldnerführer und ihre Töchter», das Christine Christ-von Wedel im Hinblick auf das Reformationsjubiläum von 2019 geschrieben hat und für das ich mitrecherchiert habe. Entstanden ist eine veritable Zürcher Reformationsgeschichte, verfasst aus einer neuen Perspektive, reich an Informationen über theologische, politische und gesellschaftliche Zusammenhänge unter Einbezug des ganzen süddeutschen Raums. Marlis Stähli verfasste den Anhang mit vielen neu erschlossenen Quellen und neu transkribierten Dokumenten und Briefen.
Aber auch die sorgfältige Beschreibung des damaligen Abteihofs von Regine Abegg, die Aktensammlung von Peter Kamber zur Reformation als bäuerliche Revolution, die verschiedenen Arbeiten von Peter Niederhäuser und Martin Illi und die Arbeit über die Fraumünster-Verwaltung von Christa Köppel sind reiche Fundgruben. Zusätzlich habe ich weitere bisher kaum bekannte Dokumente gefunden, vor allem aus Katharinas Zeit als Äbtissin. Sie geben unter anderem Einblick in Probleme mit den Kolleginnen, ihren Mit-Chorfrauen. Einige Ereignisse aus der Geschichte der Stadt Zürich, in der Katharina die meiste Zeit ihres Lebens verbrachte und die ihr Handeln beeinflusst haben werden, sollen die Eindrücke aus der damaligen Zeit ergänzen.
Zu danken habe ich dem Verein Katharina von Zimmern und seiner Präsidentin Jeanne Pestalozzi für ihre Unterstützung, Christine Christ-von Wedel für das Durchsehen des Textes, Marlis Stähli für die neuen Transkriptionen und Übersetzungen und das Durchsehen des Textes, Reinhard Bodenmann und Meinrad Suter für Übersetzungen, Johannes Krämer vom Erzbischöflichen Archiv in Freiburg, Pater Gregor Jäggi vom Archiv des Klosters Einsiedeln, Esther Hüppi vom Ortsmuseum Altstetten, Rainer Brüning vom Generallandesarchiv Karlsruhe, Bernd Fischer vom Fürstlich Leiningenschen Archiv für Recherche und Auskünfte und Corinne Auf der Maur für ihre motivierende Begleitung und Lektoratsarbeit.
Das Flüchtlingskind
Schloss Messkirch (1478–1487)
Bedroht
Katharina von Zimmern war neun Jahre alt, als sie 1487 zusammen mit ihren sieben Geschwistern und ihrer Mutter Margarete von Oettingen vom benachbarten Grafen Hugo von Werdenberg gewaltsam aus dem Schloss Messkirch vertrieben wurde. Der Vater, beim Kaiser in Ungnade gefallen, war bereits geflohen. Die Mutter – mit ihren acht Kindern, mit Hensle, dem unehelichen Sohn ihres Manns und dem leicht behinderten Verwandten Junghans noch im Schloss – widersetzte sich der Ausweisung mit allen Mitteln.
Abb. 1: Stadtansicht von Messkirch, 1575; links neben der Kirche steht das Schloss
Aber ihr Bitten und Flehen, sie mit ihren Kindern im Schloss bleiben zu lassen, half nichts. Graf Hugo gewährte ihr noch eine Frist bis zum Abend. Sie aber sperrte sich mit ihren Kindern ein und verriegelte alle Zugänge zu ihren Gemächern. Da brachen der Graf und seine Leute die Türen auf, drangen mit Gewalt ein, öffneten die Fenster und warfen den ganzen Hausrat in den Schlossgarten – Betten, Tücher, Truhen, alles, was sie in die Hände bekamen. Der mutigen und gleichzeitig verzweifelten Mutter warf er zynisch an den Kopf, was sie denn jetzt hier noch wolle, ob sie vielleicht auf dem Boden schlafen wolle. Wenn sie nicht weiche, werde er sie auf einem Sessel aus dem Schloss tragen. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Es wird eine traurige Schar gewesen sein, die nun die verwüsteten Räume verliess. Junghans jedoch hatte sich mit einem Beil in einem Winkel versteckt und wollte den Grafen erschlagen. Er schrie: «Du Bösewicht, willst mir meine liebe Mutter mit Gewalt entführen, du musst sterben!» Mit ihrem beherzten Eingreifen verhinderte Margarete von Oettingen die Bluttat im letzten Augenblick.2
Was war geschehen? Graf Hugo von Werdenberg, Herrscher über das benachbarte Sigmaringen mit seinem imposanten Schloss hoch über der Donau, hatte schon lange ein Auge auf Messkirch geworfen, das sich im Besitz der hochadeligen Freiherren von Zimmern befand. Der Urgrossvater Katharinas hatte das herrschaftliche Schloss und die dazugehörige Schlosskirche um 1400 bauen lassen. Ursprüngliche Heimat der von Zimmern war die Burg Herrenzimmern nördlich von Rottweil. Der Familie wurde nun ein Streit auf höchster politischer Ebene zum Verhängnis. Katharinas Vater, Johann Werner von Zimmern, hatte als einer der mächtigen Räte von Herzog Sigmund von Tirol eine hohe Stellung am Innsbrucker Hof inne. Dem Kreis der «bösen Räte», wie sie nach ihrem Sturz genannt wurden, warf man vor, «landesverräterische Beziehungen zu den beiden Herzögen Albrecht und Georg von Bayern» zu pflegen. Sie hätten zugegeben, dass es besser sei, sämtliche Länder Sigmunds an die Bayern zu übergeben,3 die dann für Kaiser Friedrich verloren gewesen wären. Die Räte hätten Pläne gehabt, den Kaiser zu vergiften. Welche Rolle Katharinas Vater in dem Intrigenspiel zwischen Sigmund und dem Hof Kaiser Friedrichs III. spielte, lässt sich nicht mehr bis ins Letzte ergründen. Ein Auslöser des Konflikts sei die von Herzog Sigmund vermittelte Heiratsabrede der Kaisertochter Kunigunde mit Herzog Albrecht IV. von Bayern gewesen. Friedrich III. habe dieser Heiratsabmachung zunächst zugestimmt, um sie dann aufgrund gewisser Bedenken zu widerrufen. Unterdessen habe der Bote die kaiserliche Zustimmung jedoch bereits überbracht. Der unglückliche Bote sei kein anderer gewesen als Johann Werner von Zimmern, Katharinas Vater. Er sei zum Sündenbock gemacht und wegen Majestätsbeleidigung zusammen mit einer Reihe weiterer Räte Herzog Sigmunds vom Kaiser mit der Reichsacht belegt worden.4 Die Familienchronik, die Katharinas Neffe Froben Christoph von Zimmern 1558–1566 schrieb, hat für diese Intrige den Grafen Hugo von Werdenberg verantwortlich gemacht, der nun 1487/88 in die Herrschaft Messkirch eingesetzt wurde und diese in Besitz nahm.5 Die Messkircher Untertanen mussten ihm den Huldigungseid schwören, was sie jedoch nur unter Androhung von Gewalt vollzogen.
Die Familie verlor damit auf einen Schlag alles: Güter, Herrschaft und Ehre. Der Schicksalsschlag wird bei Katharina von Zimmern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Geboren 1478, war sie als knapp 10-Jährige durchaus in der Lage, zu realisieren, welche verheerenden Auswirkungen politische Intrigen und Machtansprüche haben und dass die verleumderischen Hintergründe lange Zeit im Dunkeln bleiben können, ohne aufgeklärt zu werden. Erst 1504, acht Jahre nach dem Tod Johann Werners von Zimmern, stimmte der Nachfolger Friedrichs III., Kaiser Maximilian, der Wiedereinsetzung der Zimmern in ihre Herrschaft zu und rehabilitierte sie. «Doch der ‹Unfall› von 1487 und die Exilierung wirkte bei der Familie wie ein kollektives Trauma nach.»6
Die Mutter
Katharina von Zimmern wird in eigenen schwierigen Situationen in ihrem späteren Leben das Bild ihrer Mutter vor Augen gehabt haben, die nach der Flucht ihres Ehemanns die Geschicke der Familie allein in die Hand nehmen musste und sich dem Grafen von Werdenberg mutig widersetzte. Margarete von Oettingen war eine aussergewöhnliche Frau. Ihr Enkel Froben beschreibt sie ausführlich in seiner Chronik. 1458 geboren, wurde sie mit neun Jahren Vollwaise. Ihre acht Jahre ältere Schwester Anna, die bereits 14-jährig mit dem Truchsessen Johannes von Waldburg verheiratet worden war und ein Jahr später ihr erstes Kind gebar, und dann Jahr für Jahr ein weiteres, nahm Margarete zu sich nach Ravensburg auf die Veitsburg. Annas fünftes Kind, das sie mit 20 Jahren zur Welt brachte und das Margarete wohl mit betreute, sollte später Äbtissin zu Königsfelden und enge Vertraute von Margaretes eigener Tochter werden. Das Mädchen hiess ebenfalls Katharina. Der Truchsess von Waldburg, Landvogt in Schwaben, stand in der Gunst des Kaisers. Mit ihm in verwandtschaftliche Beziehung zu treten, konnte nur von Vorteil sein. So ist es verständlich, dass «Freiherr Werner von Zimmern, als er für seinen Sohn Johann Werner auf Brautschau ging, in Margarete eine willkommene Schwiegertochter sah. Er ging sogar auf die Heiratsbedingungen des Truchsessen und seiner Frau ein, die Hochzeit nicht in Messkirch, sondern in Ravensburg stattfinden zu lassen.»7 Margarete war bei der Heirat um 1474 etwas älter als damals ihre Schwester: Mit sechzehn Jahren galten Mädchen als heiratsfähig. Auch Margarete gebar jedes Jahr ein Kind. In den ersten elf Jahren ihrer Ehe überstand sie zehn Schwangerschaften und Geburten. Ihre ersten vier Kinder waren Mädchen, von denen die mittleren zwei das Kindesalter nicht überlebten. Anna, die Erstgeborene (1475), und Katharina (1478), das vierte Mädchen, würden unzertrennlich bleiben. Die beiden, von denen mindestens die drei Jahre ältere Anna den Tod der beiden Schwesterchen miterlebt hatte, blieben bis zum Tod Annas um 1522 zusammen. In den folgenden Jahren kamen noch vier Söhne und zwei weitere Töchter zur Welt.
Abb. 2: Messkirch heute
Margarete von Oettingen trug neben der wachsenden Kinderschar die Verantwortung für den feudalen Haushalt im Schloss Messkirch, da sich ihr Mann als Hofrat des Öftern in Innsbruck aufhielt. «Er gehörte vor seiner Ächtung zu den einflussreichsten Adligen im Umfeld des Erzherzogs.»8 Zudem unternahm er 1483 mit einer Gruppe befreundeter Adliger eine Pilgerreise nach Jerusalem und war den ganzen Sommer über abwesend. Im selben Jahr brach eine Pestepidemie aus, Margarete floh mit den Kindern, der Kleinste ein Säugling, auf die Burg Wildenstein, immerhin unterstützt von ihrem Schwiegervater. Auch diese Bedrohung und der Aufenthalt auf der imposanten Burg, die ebenfalls im Familienbesitz war, wird bei den Mädchen einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Was es für die Mutter bedeutete, kann man sich wohl kaum mehr vorstellen. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Messkirch verstarb der Schwiegervater, ihr Mann befand sich noch im Heiligen Land.
Trotzdem müssen die Jahre auf Schloss Messkirch zu Margarete von Oettingens glücklichsten gezählt haben.
Der Vater
Ihr Ehemann, Katharinas Vater, war aussergewöhnlich begabt. Der Chronist erzählt «wie Herr Johanns Wörner Freiherr von Zimbern auferzogen» wurde. Sein Vater habe allen Fleiss aufgewendet, ihm eine gute Erziehung zu geben. Er wurde auf die «hochen schuolen» Freiburg im Breisgau und Wien geschickt, darauf folgten zwei Jahre in Bologna, «daselbst er die welsch sprach zimlichen ergiffen, in astronomia, geometria und andern künsten, die man ciclicas oder mathematicas nempt, hat er fürbindig [ausgezeichnet] gestudiert», sodass ihm darin keiner seiner Standesgenossen in Deutschland gleichgekommen sei. «In beiden Rechten sei er ‹genugsam erfaren geween, die poeten und alten historien hat er gewist›, von denen er auch etliche zu seiner Kurzweil ins Deutsche übersetzt habe. Er konnte vortrefflich reden und schreiben, seine Rechtsschriften selber verfassen. Zu all dem war er ein solcher ‹Musicus›, dass er auf allen Instrumenten ausgezeichnet spielen konnte.» Er verfasste Gedichte und pflegte seinen Verwandten gereimte Briefe zu schreiben. Er sammelte Bücher und habe, da der Buchdruck noch nicht erfunden war, einen Schreiber engagiert, der ganze Bücher abschrieb. Seiner Jagdlust liess er freien Lauf. Er beschäftigte einen Falkner und baute ein «Falkengärtlin». Seine Leidenschaft für Jagd, Spiel und schöne Pferde und für ein standesgemässes höfisches Leben brachten ihn oft in finanzielle Schwierigkeiten. Seine Neigung zu magischen Praktiken lag im Trend seiner Zeit.9 Er soll bei einem Spaziergang mit seiner Gattin Schlangen beschworen haben. Diese mussten sich in einem Kreis um sie herum niederlegen und so lange verharren, wie er wollte.10 Johann Werner von Zimmern hat auch Prosa geschrieben. Eines seiner Werke, eine Versnovelle, ist in der Zimmerischen Chronik überliefert. Ihr Herzstück bildet eine aus Boccaccios Decamerone übernommene erotische Erzählung, die er in seine Zeit hinein variierte, ebenso freizügig wie die Vorlage. Christ-von Wedel schreibt: «Wie der Chronist den Vater Katharinas schildert, hat er sich durchaus um ein ordentliches Kirchenwesen in seiner Herrschaft gekümmert und ein verlottertes Dominikanerkloster zur Ordnung gerufen. Aber von vorreformatorischen Ideen […] ist nichts überliefert, dagegen, wie die Novelle zeigt, durchaus von frühhumanistischen. Dies alles dürfte Katharina als Kind mit wachen Sinnen eingesogen haben.»11 Die Lebensfreude, das offene Denken, die Bereitschaft, auf neue Ideen einzugehen, die Freude an der Musik, der ausgeprägte Gestaltungswille und nicht zuletzt die Begeisterung für das Reiten wurden ihr sozusagen in die Wiege gelegt und haben sie geprägt.
Verjagt
Mit der Vertreibung vom Schloss Messkirch 1487 aber schien alles verloren. Um keinen Volksauflauf zu provozieren, führte Graf Hugo die in Messkirch beliebte Margarete und ihre Kinder nicht durchs Haupttor aus dem Schloss, sondern durch den Schlossgarten entlang des Grabens ins Haus Gottfried von Zimmerns, des Onkels ihres Manns.12 Dieser besass neben seiner Burg Herrenzimmern und seinem Schloss in Seedorf bei Rottweil auch in Messkirch ein Haus. Hier konnte sie für kurze Zeit bleiben. Man trug ihr die Vermutung zu, Graf Hugo könnte versuchen, ihre Söhne in den geistlichen Stand zu versetzen und ihnen damit jede Möglichkeit verbauen, später ihr Gut und Erbe zurückzufordern. Dies galt vor allem den beiden älteren Buben. Durch eine geschickt eingefädelte Flucht in Frauenkleidern über die Burg Wildenstein, die noch im Besitz der von Zimmern verblieben war, liess sie die Söhne nach Heidelberg an den Hof des Pfalzgrafen und Kurfürsten Philipp bringen. Dort waren sie vor dem Zugriff des Werdenbergers sicher und erhielten eine ihrem Stand entsprechende Erziehung und Ausbildung.13 Die Flucht der beiden Knaben erzürnte den Grafen dermassen, dass er die Familie endgültig aus Messkirch verjagte. Gottfried von Zimmern nahm die völlig mittellose Frau mit ihren Kindern nun zu sich in sein Schloss nach Seedorf.
Unterdessen bemühte sich Katharinas Vater Johann Werner mit allen Mitteln an den verschiedensten Orten, über Verwandte und Freunde, mit Briefen und mit Bitten um Gespräche um seine Rehabilitierung beim Kaiser. Erfolglos. Verzweifelt erwog er, sich an den Papst in Rom zu wenden. Da rieten ihm einige Männer aus der Eidgenossenschaft, auf ihrem Boden Zuflucht zu suchen.14 Gute Freunde, darunter Georg von Werdenberg-Sargans (entfernt verwandt mit Graf Hugo), der ebenfalls zu den verbannten Räten gehört hatte, aber unterdessen rehabilitiert worden war, und Albrecht von Bonstetten, Dekan von Einsiedeln, vermittelten ihm den Kauf eines baufälligen Herrenhauses in Weesen, das er herrichten und bewohnbar machen liess. Die Zimmerische Chronik zitiert aus einem Brief Albrecht von Bonstettens, der Johann Werner «lieben Herrn Oheim» nennt.15 Weesen stand unter der Herrschaft von Schwyz und Glarus und befand sich damit ausserhalb der Reichweite des Kaisers. Ausserdem verfügte es über ein besonderes Asylrecht. Immerhin hatte der an Johann Werner von Zimmerns Schicksal mitschuldige Herzog Albrecht von Bayern ihn nun trotz der Acht an seinen Hof in München aufgenommen, was dem Geächteten ein minimales Einkommen garantierte.16
Albrecht von Bonstetten war mit Johann Werner von Zimmern verwandt und wohl aus der Studienzeit befreundet. Der damals 45-Jährige wurde von seinen Studienfreunden als geistreiche und humorvolle Persönlichkeit beschrieben. Schon früh gelang es ihm, über seine Schriften, seine Belesenheit und über sein immenses Wissen sowohl beim König von Frankreich als auch beim deutschen Kaiser bekannt zu werden. Friedrich III. ernannte ihn 1482 zum Hofpfalzgrafen und Hofkaplan.17 Auch mit Sigmund von Tirol pflegte der Dekan nach dessen Besuch in Einsiedeln einen nahen Kontakt und wurde auch von ihm mit dem Titel eines Hofkaplans bedacht.18 Katharinas Vater hatte ihm Zugang zum Hof des Herzogs vermittelt. Albrecht schenkte dem späteren Kaiser Maximilian das Schwert Karls des Kühnen, das möglicherweise sein Bruder Roll in der Schlacht bei Nancy erbeutet hatte.19 Nun aber waren ihm durch seine eigenen Interessen gegenüber allen Konfliktparteien die Hände gebunden, sich dort für Werner von Zimmern einzusetzen.
Albrecht von Bonstetten hatte sein Studium in Freiburg im Breisgau und Basel begonnen. Schon bald jedoch zog es ihn nach Italien, in «die viel gepriesene Heimat des Humanismus jenseits der Alpen»20, wo die wiedererwachte Antike an den Universitäten Raum bekam und die Gelehrten in ihren Bann zog.
Der Humanismus war eine neue, mächtige Strömung wissbegieriger, gebildeter Menschen. Sie verstanden darunter einen neuen Weg des Denkens. Der eigentliche Auslöser war die Rettung der wertvollen antiken Schriften, die 1453 nach der Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen in einer dramatischen Flucht auf 15 bis 20 christlichen Schiffen gerettet und dann in Italien übersetzt werden konnten. Christine Christ-von Wedel schreibt: «Antikebegeisterte Leser stürzten sich nicht nur vermehrt auf die klassischen Texte, sie lasen sie auch anders als mittelalterliche Gelehrte. Der Ruf ‹ad fontes›, zurück zu den Quellen, bedeutete, die alten Texte, auch die längst bekannten, auf ganz neue Art zu behandeln. Die Anhänger der ‹studia humanitatis› hatten keinerlei Berührungsängste, sich von nichtchristlichen Autoren anregen zu lassen. Sie lasen sie als authentische Texte um ihrer selbst willen, ohne sie vorschnell zu christianisieren oder als ‹heidnisch› abzulehnen. Freilich waren die meisten Humanisten überzeugt, dass antike Weisheiten und Tugenden sich mit dem Christentum verbinden liessen, ja, Anregung böten, das Christentum zu seinem wahren Wesen zurückzuführen. Beschämten die Wahrheitsliebe eines Sokrates, die Tugend eines Cato und die Lebensweisheit eines Cicero nicht die zeitgenössische Christenheit und drängten so zu Reformen? Konnte die Christenheit des ausgehenden 15. Jahrhunderts mit ihren weltabgewandten Klöstern, ihrer meist erstarrten scholastischen Theologie und ihrer oft korrupten, machtbesessenen Hierarchie nicht von der Antike eine ganz neue Lebensgestaltung lernen, weltzugewandt, heiter und kraftvoll, wie es Christus mit seiner Nächstenliebe vorgelebt hatte?»21
Die Beschäftigung mit bisher unbekannten Schriften der Philosophen veränderte das Menschen- und das Gottesbild nachhaltig. Wie ein Rausch muss sich die Wiederentdeckung der Antike ausgewirkt haben. Er hatte auch Albrecht von Bonstetten ergriffen. Ebenso wird Katharinas Vater als Humanist bezeichnet und es ist anzunehmen, dass die humanistischen Ideen mehr als alles andere auch Katharina von Zimmern geprägt haben.
Weesen (1490–1491)
Aufgenommen
Katharina, nun als Flüchtlingskind im kleinen Städtchen am Walensee zu Hause, hatte im Alter von dreizehn Jahren bereits einige schwierige Erfahrungen hinter sich. Sie wird wehmütig an die wohl glückliche Zeit im Messkirchner Schloss zurückgedacht haben, wo die grosse Familie noch vereint war, beliebt und hochgeachtet, und alles zur Verfügung hatte, was das Herz begehrte, Bücher, Musikinstrumente, Festlichkeiten und vieles mehr. Nach der Flucht des Vaters, der als Verräter gebrandmarkt und damit gezeichnet war, und der dramatischen Vertreibung aus dem Schloss, der Flucht der beiden Brüder, der materiellen Not, wird es vor allem die Verbitterung des geächteten Vaters gewesen sein, die dem Kind zu schaffen machte.
Abb. 3: Pfarrhaus (links) und Haus der Zimmern in Weesen
Das Haus in Weesen steht auf dem Bühl, nahe der Pfarrkirche, mit grossartigem Ausblick über den Walensee. Links die schroffen Felshänge, rechts die grünen Wiesen des Kerenzerbergs und dazwischen über dem See der freie Ausblick in die Ferne. Ein Ort zum Aufatmen. In Weesen, das unter der Herrschaft der Eidgenossen stand, war die Familie vor dem Zugriff des Kaisers sicher. Wahrscheinlich im Jahr 1490 oder 1491 war Margarete von Oettingen mit sechs ihrer Kinder nach verschiedenen Aufenthalten bei Verwandten in Weesen eingetroffen und wieder mit ihrem Ehemann vereint. Etwa gleichzeitig zog im Pfarrhaus, dem Nachbarhaus der Familie von Zimmern, ein 6-jähriger Bub bei seinem Onkel Bartholomäus, Pfarrer und Dekan von Weesen, ein. Er sollte von ihm erzogen und geschult werden. Es war Ulrich Zwingli, Sohn des Ammanns von Wildhaus. Ob er hin und wieder im Herrenhaus zu Gast war, mit den jüngeren Geschwistern von Katharina spielte oder gar mit ihr selber, ob er von der humanistischen Bildung der Familie etwas mitbekam und sich von der Musikalität des Freiherrn von Zimmern, der die verschiedensten Instrumente spielen konnte, beeindrucken liess, können wir nur erahnen. Auch von Zwingli wird später berichtet, er habe das Spiel auf sieben Instrumenten beherrscht, und zwar hervorragend.
Heirat oder Kloster
Nun aber galt es, in der prekären Situation an eine standesgemässe Zukunft der Zimmer’schen Kinder zu denken. Zwei Söhne waren bereits in Heidelberg versorgt. Den Kleinsten, Willhelm Werner, nahm das befreundete kinderlose Grafenpaar von Werdenberg-Sargans zu sich auf die Burg Ortenstein im Domleschg. Graf Georg war als einer der Hauptanführer der geächteten Räte ein Schicksalsgenosse Werner von Zimmerns. Er besass in unmittelbarer Nachbarschaft des Hauses der von Zimmern, südlich von Weesen, das Gut Othis (Autis) und war oft zu Gast bei der Familie. Er versprach, Wilhelm Werner später zu adoptieren und als Erben einzusetzen, was aber nach seinem Tod nicht eingelöst wurde. Der Graf hinterliess sechs aussereheliche Kinder.22 Der 4-jährige Wilhelm Werner wurde aus Vorsicht in einer Krätze versteckt, die ein Maultier nach Ortenstein zu tragen hatte. Damit er schön still und ruhig sei, gab man ihm Spielzeug – «dockenwerks» – mit in den Korb.23 Offenbar traute man Graf Hugo zu, die Zimmer’schen Kinder auch hier zu verfolgen. Bei den Treffen der Zimmerns mit Graf Georg und seiner Frau Barbara von Sonnenberg werden die Machtverhältnisse, die Interessen und Intrigen der herrschenden Familien, die Chancen auf die Rehabilitierung von Katharinas Vater durch den Kaiser und die Mitverantwortung Herzog Albrechts von allen Seiten beleuchtet und diskutiert worden sein. Die nun 12-jährige Katharina wird wohl einiges davon mitbekommen haben – eine Schule fürs Leben.
Für die beiden älteren Mädchen der Familie von Zimmern, Anna und Katharina, standen zwei Wege offen: Heirat oder Eintritt in ein Kloster. Für eine Heirat war die augenblickliche Lage nicht günstig, denn Johann Werner war nicht in der Lage, eine ausreichende Ausstattung mit Heiratsgut für zwei Töchter aufzubringen. Der Eintritt in ein Stift oder in ein Kloster verlangte zwar auch eine finanzielle Ausstattung, doch konnte man hier auf eine Stundung des Klosters hoffen. Ob Heirat oder Kloster, in beiden Fällen hatten die Töchter traditionsgemäss einen Erbverzicht zu leisten, um das Familiengut vor zu grosser Zersplitterung abzusichern.24 Anna hatte ihn bereits geleistet, Katharina hat sich nicht dazu durchgerungen. Warum sie es nicht tat, lassen sich nur Vermutungen anstellen.
Einkauf in die Abtei
Dass die Abtei Fraumünster dem hohen Adel vorbehalten war und Zürich nicht allzu weit von Weesen entfernt lag, dürfte mit ein Grund gewesen sein, dort um Aufnahme zu ersuchen. Graf Georg wird das Anliegen unterstützt haben, eine seiner Schwestern soll dort Chorfrau gewesen sein.25
Hatten die beiden Mädchen zu dem Entscheid etwas zu sagen? Gab es darüber Gespräche? Es kann gut sein, dass sie es als grosse Chance wahrnahmen. «Die Vermutung, dass Dekan Albrecht von Bonstetten dabei seinen Einfluss geltend machte, liegt auf der Hand, kann aber nicht nachgewiesen werden.»26
An Ostern 1491 traten Anna und Katharina zusammen mit ihrer Cousine Ottilie von Bitsch ins Stift Fraumünster ein – als Postulantinnen, das heisst als Anwärterinnen für eine Chorfrauenstelle. Über den Einkauf der beiden gab es Verhandlungen, die bis vor den Rat der Stadt Zürich gezogen wurden. Katharina von Zimmern wird sich dreiunddreissig Jahre später darauf berufen, dass sie auf ein Schreiben ihres Vaters hin der Obhut des Rats übergeben wurde, und ausdrücklich nicht der Obhut des Kapitels.27 Sie fühlte sich von Beginn an vor allem dem Rat gegenüber verpflichtet, der die Vogteirechte über die Abtei wahrnahm. Im Jahr 1400 hatte der römisch-deutsche König Wenzel der Faule zwei Monate vor seiner Absetzung die Vogteirechte an Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich verliehen. Diese hatten darum gebeten, da ihnen oft ein Vogt fehle. Die Reichsvogtei bringe zu wenig Zinsen und jährliche Renten ein, um einen solchen zu ernähren. Sie wollten selber einen wählen, der im Rat sitze, wenn es gelte, über schädliche Leute zu richten.28 Damit gingen «wesentliche Rechte über die Abtei an die Stadt über»29. Diese Rechte weitete der Rat im Laufe des 15. Jahrhunderts immer weiter aus.
Am 29. September 1491 trafen sich die beiden Parteien in Zürich vor Bürgermeister Konrad Schwend und den Räten: Auf der einen Seite Johann Werner von Zimmern und Frau von Tengen, Vertreterin der Ottilie von Bitsch, beide persönlich anwesend, auf der anderen die Äbtissin Elisabeth von Wyssenburg mit Chorfrauen und Chorherren. Der Rat entschied, dass die Abtei den drei Postulantinnen die ihnen zustehenden Pfründen ab vergangener Ostern auszahlen müsse, sie sich aber mit Jahrzeiten einkaufen müssten wie andere Frauen vor ihnen auch: «das von allten har ander frowen schuldig und gebunden syen gewesen die Jarzit zuo setzen und zu kouffen. Sollen die fröwli desglich ouch tuon.»30 «Die Jahrzeit (lateinisch anniversarium) geht auf die von den griechischen Kirchenvätern im 4./5. Jahrhundert entwickelte Idee des ‹Seelteils› zurück. Der Christ müsse zu seinem Seelenheil einen erheblichen Teil seines Vermögens (mind. ein Drittel) der Kirche vermachen. Die mittelalterliche Kirche empfahl, die Seele für das Jenseits mit einer mildtätigen Stiftung ‹auszurüsten›, dem sogenannten Seelgerät, das neben Beichte und letzter Ölung Voraussetzung für die Absolution auf dem Sterbebett war. Die daraus entstandenen Jahrzeit-Stiftungen verbanden das Seelgerät mit der Auflage einer jährlichen Abhaltung eines Gedächtnisgottesdiensts am Todestag für den Stifter und dessen Familie.»31 Eine «Jahrzeit» ist in der katholischen Kirche bis heute eine Stiftung, welche die Kirche verpflichtet, während der Stiftungsdauer eine oder mehrere jährliche Dankesmessen für eine verstorbene Person abzuhalten. Alle können eine Jahrzeit für sich selber stiften. Die Jahrzeit-Stiftung ist kirchenrechtlich eine Schenkung mit Auflagen. Hier war sie Voraussetzung für die Aufnahme in die Abtei und diente dazu, den Unterhalt der Stiftsdamen zu sichern.
Fraumünster Zürich (1491)
Untergebracht
Nun wurden also die beiden Mädchen der benediktinischen Abtei Fraumünster übergeben, Anna war sechzehn, Katharina dreizehn Jahre alt. Das Noviziat sollte drei Jahre dauern, dann erst würden sie eingekleidet. «Tatsächlich entsprach zur Zeit Katharinas das Leben in der Abtei Fraumünster ziemlich genau dem der Kanonissenstifte, und kaum mehr der ursprünglichen Benediktinerregel. Wie die Benediktinerinnen sangen zwar die Kanonissen die sieben Gebetszeiten und legten grossen Wert auf Abteischulen und eine gute Bildung der Stiftsdamen. Kanonissen mussten sich über genügend Lateinkenntnisse und Kompetenz im Chorgesang ausweisen, bevor sie eingekleidet wurden. Mit dem Chorgesang und dem Schulwesen aber sind die eindeutigen Gemeinsamkeiten mit der Benediktinerregel schon aufgezählt. Kanonissen lebten nicht in einer strengen Klausur, sie konnten wie die Zürcher Stiftsfrauen reisen, Verwandte besuchen und Gäste empfangen, sie verzichteten nicht auf eigenen Besitz, sie hatten ihre Pfrundeinkünfte und Leibrenten. Sie assen und schliefen nicht gemeinsam, sie lebten und kochten mit Dienstboten in ihren eigenen Wohnungen und hielten sich dabei nicht an die besonderen benediktinischen Fastenregeln. Sie legten kein Keuschheitsgelübde ab. Allein die Äbtissinnen hatten bei ihrer Einsetzung dauernde Ehelosigkeit zu geloben.»32 Kanonissen durften die Abtei wieder verlassen und heiraten. Der Reformversuch des Bischofs von Konstanz von 1470, der versucht hatte, die Abtei wieder näher an die Benediktinerregel heranzuführen, war gescheitert.
In welchen Räumen die beiden Mädchen wohnten, ist nicht bekannt. Eigene «Stuben» erhielten sie erst nach der Einkleidung. War die Übergabe durch die Eltern bereits ein grosses Fest? Allgemein üblich war eine grosse Zeremonie. Immerhin bedeutete es den definitiven Abschied von der Familie, vom gewohnten mehr oder weniger selbstbestimmten Leben. Nun waren sie eingebunden in einen streng regulierten Tagesablauf und in eine grosse, hierarchisch gegliederte Gemeinschaft mit ihren eigenen Regeln und Gewohnheiten. Die sorgfältig verfassten Rechnungsbücher der Abtei,33 die nicht ganz lückenlos erhalten sind, geben Aufschluss über die Zusammensetzung der Klostergemeinschaft. Auf der ersten Seite sind jeweils die Auszahlungen der Pfründe an die Äbtissin, an «unser frown gnad» und an die Chorfrauen aufgeführt. Im Jahr 1492 sind dies drei mit Namen: neben Frau von Bitsch die Frauen von Misox und von Helfenstein und «zwey frowen» ohne Namen und mit geringerer Pfründe.34





























