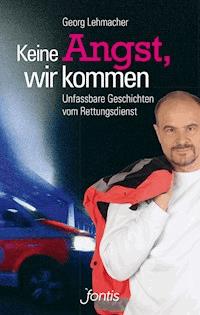
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Seit dreißig Jahren ist er ehrenamtlich im Krankentransport und Rettungsdienst des Roten Kreuzes tätig. Begonnen hatte Georg Lehmacher aber schon davor: Als Zivildienstleistender kam er 1982 auf eine kleine Rettungswache in Friedberg, wo die medizinische Versorgung und Ausstattung noch wesentlich schlechter waren als heute. Die Folge war, dass jeder einzelne Mitarbeiter bei einer wesentlich schlechteren Ausbildung viel mehr Eigenverantwortung tragen musste. In einer Zeit, in der er sich vom Glauben abgekehrt hatte, wurde Lehmacher mit extremsten Erlebnissen konfrontiert, die sein Weltbild prägten. "Ich habe Dinge erlebt, in denen es scheinbar keine Hoffnung mehr gab. Glauben Sie mir: Da habe ich das Beten wieder gelernt." Hauptberuflich arbeitet Lehmacher als Kommunikationsdesigner und ist Dozent an der Hochschule Augsburg. Er ist mit Renate verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Aus seiner Feder stammt auch das Vorgängerbuch, der Erfolgstitel "Schneller als der Tod erlaubt" (Bastei Lübbe).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Georg Lehmacher
Keine Angst, wir kommen
Unfassbare Geschichten vom Rettungsdienst
Für alle Leser, die offenen Herzens meine Erlebnisse mit mir teilen.
Für alle meine Kollegen, die mich nicht nur ertragen, sondern die mich – als Freiwilligen, der diesen Dienst nicht jeden Tag macht und aus einem anderen Umfeld immer wieder in die «Rettungsdienstwelt» eintaucht – in ihren Reihen aufnehmen, auch wenn sie mich mit meinen Ansichten und meinem Humor vielleicht manchmal als einen «bunten Vogel» empfunden haben.
Für die Kollegen, die uns im Bereich Ausbildung nicht nur fachlich, sondern auch mental für das, was uns draußen begegnet, seit vielen Jahren sehr engagiert stärken.
Für diejenigen Kollegen, die bei uns oder anderswo in diesem Beruf, in dem wir versuchen, anderen zu helfen, beleidigt oder verletzt wurden oder gar, wie es erst jüngst wieder hier im Landkreis passierte, Opfer aggressiver Übergriffe wurden.
Für meine Familie, die mich immer wieder ermunterte: für den Dienst und zum Schreiben.
Vor allem auch für die, die sich in diesen Diensten und darüber hinaus am meisten um mich bemüht haben: Hans, Thomas und Rosi.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Zum Schutz von Persönlichkeitsrechten wurden alle Namen, ferner genaue Ortsangaben und Jahreszahlen, Funkrufnamen und weitere Details, soweit notwendig, verändert.
Text nach der 2. leicht veränderten Auflage 2014
© 2014 by `fontis – Brunnen BaselUmschlag: Atelier Georg Lehmacher, Friedberg (Bayern) Fotos Umschlag: Porträt Georg Lehmacher U1: Uschi Hatzold Hintergrundbild U1: Georg Lehmacher E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-634-3
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1 Furchtbare Schmerzen
Kapitel 2 Ich denke manchmal noch an Herrn Krügler
Kapitel 3 Das Leben geht weiter
Kapitel 4 Unvorbereitet
Kapitel 5 Vatergefühle
Kapitel 6 Ein Kind mit Namen Laura
Kapitel 7 Richtig fetter Ärger
Kapitel 8 Menschen, die helfen (Oder: Wie Albträume gemacht sind)
Kapitel 9 Verwirrt verirrt
Kapitel 10 Zu spät
Kapitel 11 Allen Fehlern zum Trotz
Kapitel 12 Noch nicht im Himmel
Kapitel 13 Gutes Recht
Kapitel 14 Jacqueline und die Schulden
Kapitel 15 Depressionen
Kapitel 16 Nur das eine Leben
Kapitel 17 Alles mal wieder ziemlich verrückt
Kapitel 18 Mach's gut!
Kapitel 19 Überall genau mittendrin
Kapitel 20 Abschied
Vorwort
Manch einer der jüngeren Rettungsdienst-Kollegen wird sich an der einen oder anderen Stelle wundern. Wo ist z. B. bei einem VU, der 1983 stattfand, die Stiffneck? Ganz einfach: die gab es damals im Rettungsdienst noch gar nicht. Es hat sich unglaublich vieles entwickelt in den dreißig Jahren, in denen ich dabei sein durfte. Die Trage hieß damals noch Trage, weil man sie trug – und nicht wie heute schob.
Das Wichtigste bei der Reanimation war damals nach dem Adrenalin die Blindpufferung mit Natriumbicarbonat – die heute niemand mehr macht. Defibrillation war damals eine rein ärztliche Maßnahme. Ebenso das Legen eines venösen Zugangs. Der Rettungssanitäter hatte eine Ausbildung von weniger als 600 Stunden – aber um hinten im Patientenraum eines Rettungswagens als Verantwortlicher für den Patienten zu arbeiten, genügte es auch, Rettungsdiensthelfer zu sein – mit 320 Stunden Ausbildung.
Etwa um die Jahrtausendwende herum lernte ich noch, dass das Präoxygenieren des Patienten bei der Rea extrem wichtig sei, weil das Herz dadurch wesentlich effektiver auf die Defibrillation reagiere. Heute lernt man, dass es wichtig ist, mit der Herzdruckmassage zu beginnen, und dass man, wenn es nicht möglich ist, auf die Beatmung notfalls erst einmal verzichten soll.
Viele Änderungen, die nichts mit dem medizinisch-fachlichen Bereich zu tun haben, kamen dazu. 1982 durften Frauen bei uns nur tagsüber die Wache betreten – heute bauen wir rund um die Uhr auf ihre Mitarbeit, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten und ihre Kameradschaft.
Der Rettungsdienst muss sich heute mehr denn je mit wirtschaftlichen Fragen auseinandersetzen, und die klassischen Hilfsorganisationen haben private Mitstreiter bekommen. Gesetzliche Grundlagen haben sich verändert – und das Verständnis der Gesellschaft hat sich geändert: In den 80er-Jahren wurde man als Helfer in einer Notlage mit offenen Armen empfangen – heute muss man sich als Helfer absichern, um nicht zur Kasse gebeten zu werden, wenn einem Patienten nicht geholfen werden kann oder gesundheitliche Probleme zurückbleiben. Die Dokumentation ist zu einem eigenen Aufgabenbereich geworden. Fehler in diesem Bereich bedrohen den Helfer oft konkreter als eventuelle tatsächliche fachliche Fehler.
All diesen Änderungen im fachlichen Bereich begegnen wir nicht vor allem durch mehr Technik und Ausrüstung, sondern durch einen besseren Ausbildungsstand und ständige Weiterbildungen. Als Mitarbeiter im Rettungsdienst bin ich dafür vor allem auch denen dankbar, die hinter uns stehen. Und die das, was es an Neuerungen gibt, durchdenken und schematisieren, um es unter schwierigen Bedingungen «griffbereit» zu haben und uns stets neues Wissen zu vermitteln.
– Georg Lehmacher
1
Furchtbare Schmerzen
Mai 1983
Josef steht im Hof, als ich kurz nach 17.00 Uhr bei der Rettungswache ankomme. Er stopft in seiner Pfeife herum und versucht immer wieder, sie anzuzünden. «Du kannst schon mal den Rettungswagen durchsehen», brummt er. «Ich glaub, die linke Sauerstoffflasche muss gewechselt werden. Und nachher fahren wir dann noch tanken.»
Meine erste Nachtschicht hinten im Rettungswagen. Quasi als Verantwortlicher für den Patienten. Und doch nicht richtig. Ich bin ja nur Rettungsdiensthelfer und Josef der höher qualifizierte Rettungssanitäter. Aber ein ZDL darf bei uns nicht fahren.
«Wir hatten da ein paar, die sind hier mit den Autos so in der Gegend herumgeräubert», hatte Christian, der Wachleiter, mal bemerkt, «was die alles kaputtgefahren haben, das kann keiner bezahlen.» Also ist der Rettungsdiensthelfer und ZDL grundsätzlich immer hinten beim Patienten.
Ich bin ziemlich verschwitzt von der Fahrt an diesem heißen Tag. Mein Fahrrad binde ich an der Halterung der Regenrinne fest. Das Schutzblech ist abgegangen. Wenn ich Glück habe, sperrt mir Josef später die Werkstatt auf, und ich kann es wieder anschrauben.
«Das kannst du auch in die Halle stellen», brummt Josef und nickt in Richtung meines Fahrrads, «es ist eh genug Platz drinnen. Der 1er ist gerade in der Werkstatt.»
Der «1er» ist ein Krankentransportwagen, er hat das Kennzeichen AIC-UV 1. Ein besonderer KTW. Weil er das Vorführfahrzeug der Herstellerfirma war und einen 180-PS-Motor hat, und nicht die zu dieser Zeit üblichen 76-Diesel-PS, wird er gerne gefahren.
«Hatte der UV-1 einen Unfall?», frage ich.
«Nein», schüttelt Josef den Kopf und pafft Rauchwolken vor sich hin. Endlich ist seine Pfeife angebrannt. Ein etwas süßlicher Tabakduft.
«Die Elektrik hatte ein Problem, das Blaulicht ging immer von alleine an. Als ich mit Wolfgang letzte Woche auf der Rückfahrt von Murnau war», lacht er jetzt, «hab ich mich gewundert, dass auf einmal alle vor mir zur Seite fahren. Das war vielleicht peinlich!»
«Und was habt ihr dann gemacht?»
«Die Sicherung raus», sagt er.
«Ach, klar.» Logisch, da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
«Aber dann», grinst er, «ging auch der Funk nicht mehr.»
«Aha. Wie ging es dann weiter?», er wartet wohl darauf, dass ich ihn alles einzeln frage.
«Dann ist Wolfi hochgestiegen und hat die Blaulichter mit Dreiecktüchern und Leukosilk zugeklebt.»
«Guter Plan», bemerke ich.
«Ja», sagt er, «und als wir dann in Königsbrunn waren, haben wir tatsächlich einen Notfall bekommen und den Schalter umgelegt und zuerst vergessen, dass die Dinger zugeklebt sind. Aber wir haben es schnell gemerkt. Ist ja niemand zur Seite gefahren.»
Jetzt muss ich grinsen.
«Seid ihr dann erst wieder hochgestiegen und habt die Tücher weggemacht?»
Er schüttelt den Kopf. «Nein, es war nicht weit bis zum Einsatz. Das hätte nur noch länger gedauert. Wir haben den Warnblinker angemacht, und: das Horn ging ja. Und als wir dann am Einsatz waren, ging dafür das Horn nicht mehr aus.»
Ich kratze mich am Kopf. Solche Pannen brauche ich heute nicht. Die erste Schicht hinten im Patientenraum – das ist eh aufregend genug.
«Heute Nacht wird es sicherlich ruhig», sage ich, während ich das Fahrrad wieder losmache.
«Sicher nicht», bemerkt Josef, «der erste warme Tag. Und das noch vor dem Feiertag. Du kannst drauf warten, dass es scheppert. Wenn du ein Motorrad haben willst», scherzt er, «brauchst du dir für so einen Tag nur eine große Wiese zu kaufen.»
Das ist nicht witzig, Josef!
Ein beklommenes Gefühl breitet sich in meinem Bauch aus.
«Ich hoffe, es bleibt trotz des Vatertags morgen ruhig», bemerke ich.
«Christi Himmelfahrt!», poltert er.
«Wie?», frage ich.
«Das ist Christi Himmelfahrt! Nicht Vatertag», brummt er noch einmal. «Erstens», sagt er, «ist es nicht das gleiche! Und zweitens sind wir in Bayern.»
Ich nicke.
«Ich wette, wir haben noch vor Sonnenuntergang einen Verkehrsunfall mit einem Motorrad, Moped oder … Fahrrad», wechselt er wieder das Thema.
Weil mir das erstens nicht recht ist und ich zweitens aus Prinzip gerne widerspreche, setze ich dagegen:
«Ich wette, es wird ruhig heute Nacht und wir haben gar nichts», erkläre ich bestimmt.
Er hält mir die ausgestreckte Hand hin. «Die Wette gilt! Zwei Mark.»
Ich schlage ein.
So eine blöde Idee, gegen ihn zu wetten. Er hat viel mehr Erfahrung. Ich stelle mein Fahrrad in die Halle und schaue in meinem Geldbeutel nach. Es sind noch 1,62 DM drin. Lauter Kupfergeldstücke.
«Geht auch 1,62 DM?», frage ich ihn.
«Das Kleingeld kannst du behalten», bemerkt er.
«Dann 1,50 DM.»
*****
Fernsehen. Es gibt nur drei Programme. Die Nachrichten sind schon rum.
«Das mit den Hitlertagebüchern, die sie da angeblich jetzt gefunden haben …», fängt Josef an. «Das glaube ich nicht.»
«Die würden das nicht so groß bringen, wenn es nicht sicher wäre.»
«Ach was», winkt er ab. «Das glaubt doch keiner. Dass der Tagebücher geführt hat und keiner hat jemals etwas davon gehört.»
«Und was sonst? Meinst du, die hat jemand nachgemacht?»
«Jedenfalls glaube ich es nicht», sagt Josef noch einmal.
«Die weiße Feder» läuft. Den Film habe ich schon drei Mal gesehen, aber immer noch besser als diese Sendung mit Volksmusik, die Josef vorher unbedingt ansehen wollte.
Ich muss grinsen: Der coole Cowboy hat sich verliebt, küsst die Squaw. Während sie danach immer mit verzücktem Blick im siebten Himmel schwebt, wischt er sich mit coolem Blick den Mund ab.
Die Uhr, die über der Küchentür hängt, zeigt 20.45 Uhr. Draußen ist es noch hell, aber die Sonne ist schon hinter dem anderen Gebäudeteil verschwunden. Ich stelle mich ans Fenster: Auf der anderen Straßenseite sieht man oben auf dem Möbelhaus noch das gelbliche Streiflicht.
«Siehst du», bemerke ich, «ich hab die Wette gewonnen.»
Es ist immer noch schön ruhig. Auch am Funk, der auf der Wache leise im Hintergrund mitläuft, meldet sich nur selten jemand.
«Hm», brummt Josef.
Gerade als die Kamera im Film auf die menschlichen Gerippe im Tal des Todes schwenkt und die Reiter stehen bleiben, klingelt das Leitstellentelefon.
«Von wegen», höre ich Josef.
Aber dann lege ich zufrieden auf. «Ein eiliger Krankentransport. In Gersthofen. Ein älterer Patient mit einem schlechten AZ.» AZ bedeutet «Allgemeinzustand».
«Die Wette habe ich verloren.»
Ohne weiteren Kommentar nimmt Josef das Ledermäppchen, das auf dem Tisch liegt, schnappt sich seine Jacke und geht in den Flur. Ich laufe ihm nach. Er schaut kurz auf dem Augsburger Plan nach der Straße.
«Das ist auf der anderen Seite von Gersthofen», erklärt er, «wir fahren durch Lechhausen und dann auf die A8 und dann über die B17.»
Ich kenne mich in Gersthofen noch überhaupt nicht aus.
Wir fahren vor uns hin. Josef erzählt mir, dass er Zither spielt und wo er schon überall aufgetreten ist, dass dies aber schon lange her ist. Ich höre ihm nur halb zu. In Lechhausen kommen wir an einem Haus vorbei, in dem ich vor etwa zwei Monaten schon einmal war: Wir hatten einen Notfall, eine akute Linksherzinsuffizienz, eine Patientin, der es extrem schlecht ging. Im Treppenhaus hatte sie sich übergeben, im Rettungswagen war sie bewusstlos geworden. Eine Hausärztin war dazugekommen, die sich erst vor kurzem niedergelassen hatte und in den Jahren davor in München auf dem dortigen Notarztwagen tätig war.
«Alles halb so wild», hatte sie gesagt, die Patientin intubiert und dann den Transport begleitet.
«Du kannst dich setzen», meinte sie dann, «ich stehe lieber.»
Christian war losgefahren, Pit hatte den vorderen Sitz im Patientenraum besetzt. Ich den neben der Patientin. Die Ärztin stand mir gegenüber, hatte sich an der Haltestange festgehalten und mir dann noch einmal erklärt: «Alles nicht so schlimm, auch wenn es mal heftiger kommt», sagte sie, «entweder der Patient ist eh schon tot, dann eilt es nicht mehr so. Oder es gibt viel zu tun, dann ist man gut beschäftigt und denkt nicht viel nach.»
Ich hatte ihr zugenickt. Lieber nichts sagen, dann ist es auch nicht falsch.
«Es ist wichtig, dass du nicht weiter groß über diese ganzen Dinge nachgrübelst», hatte sie dann behauptet, «sonst drehst du irgendwann durch.»
Pit hatte ihr zugestimmt: «Am besten gehst du nach dem Dienst nach Hause und vergisst alles wieder.»
Ein paar Tage danach hatte ich den Namen der Patientin bei den Todesanzeigen in der Zeitung gefunden und das Gesicht der älteren Dame immer noch vor Augen. Und die kleine Wohnung, in der alles vollgestellt war. Das Zimmer mit den vielen Nähutensilien, in dem sie keuchend auf dem Sessel gesessen hatte.
Und jetzt, beim Vorbeifahren an ihrem Haus, erinnere ich mich wieder an diesen Einsatz und hab es immer noch nicht vergessen. Okay – vielleicht werde ich nie ein guter Sani, denke ich.
«Heee», keift Josef von der Seite, «hörst du schlecht?»
Der Funk. Die Leitstelle ruft uns wohl schon zum zweiten Mal. Ich nehme den Hörer und melde mich. «31/37 Auftragsänderung: Verkehrsunfall schwer, B300, Gallenbacher Berg», höre ich den Leitstellendisponenten.
Wir sind kurz vor Augsburg-West. Josef gibt Gas, nimmt die Ausfahrt, aber statt rechts abzubiegen, fahren wir durch das Kleeblatt des Straßenkreuzes über der A8. Mitten in der Kurve ist ein Lkw, der nicht richtig weiterkommt. Josef überholt ihn in der Auffahrtsschleife, unser Wagen schlingert, er gerät auf den unbefestigten Teil, Steine prasseln an das Blech. Er fängt den Rettungswagen wieder, dann sind wir an dem Lkw vorbei, Josef schimpft und flucht laut. Das ist die andere Seite von bayerisch, denke ich still vor mich hin.
Aber dann wird mir wieder mulmig: Die Leitstelle hat wohl alle Hände voll zu tun. Ich höre mit, dass der Aichacher Notarzt in Pöttmes belegt ist, aber der Rettungswagen aus Aichach zu dem Unfall am Gallenbacher Berg kommt.
«Ein Arzt ist ebenfalls unterwegs zu Ihnen», erklärt die Leitstelle. Dass einige andere Fahrzeuge unterwegs seien, dass sechs verletzte Personen gemeldet sind. Über Funk meldet sich auch eine Polizeistreife und erklärt, dass eine Person eingeklemmt und vermutlich bereits tot sei, fragt nach, wann der Notarzt kommt.
Der Augsburger Notarztwagen meldet sich aus Königsbrunn, er hat einen Patienten an Bord. Man beschließt, den Patienten in einen anderen Rettungswagen umzuladen. Aber dann höre ich, dass man umdisponiert hat und stattdessen der Arzt auf den 31/02 umsteigt und das EKG mitnimmt.
Als wir von der A8 auf die B300 abbiegen, bekommen wir noch mit, dass in Friedberg noch zwei Kollegen, die man zu Hause angerufen hat, einen Krankentransportwagen besetzen. Insgesamt sind erst drei Rettungswagen unterwegs. Und der Notarzt, der aber eine längere Anfahrt haben wird.
«Es ist kein Motorrad», sagt Josef, «also hast du gewonnen.»
Die Wette hatte ich vergessen. Ja, denke ich, und außerdem ist es auch lange nach Sonnenuntergang.
Die Leitstelle teilt uns mit, dass der Hubschrauber der Bundeswehr aus Landsberg trotz der bereits hereingebrochenen Nacht demnächst starten werde.
Beim Näherkommen sehe ich einen Streifenwagen mit Blaulicht und einen Rettungswagen. Die Unfallstelle ist nicht ausgeleuchtet, die wenigen Blaulichter und ein Warndreieck sind das Einzige, was den Unfallort absichert. Weiter hinten erkennt man im Scheinwerferlicht, dass Teile auf der Fahrbahn liegen und auch, dass seitlich zerstörte Fahrzeuge stehen, in alle Richtungen gedreht. Vor uns stehen einige Autos in einer Schlange, ein Autofahrer schert noch kurz vor uns aus, um zu versuchen, an den anderen vorbeizufahren. Und das offensichtlich, ohne in den Rückspiegel zu schauen. Josef muss scharf bremsen, er schimpft wieder laut vor sich hin. Dann steht uns dieses Auto auch noch im Weg rum, denn überall liegen Trümmerteile herum, und der Fahrer traut sich offenbar nicht weiter.
Ich versuche zu erkennen, wie viele Fahrzeuge am Unfall beteiligt sind: Insgesamt scheinen es drei zu sein. Neben einem der Autos, das von uns aus links steht, leuchtet ein Polizist mit einer Handlampe in den Innenraum.
Beim Aussteigen höre ich Schreie von mehreren Menschen. Vor allem eine männliche Stimme, die sehr laut ist. Ich schnappe mir den Notfallkoffer, die Tasche mit der Sauerstoffflasche und klemme mir noch eine Handlampe unter. «Da sind schon zwei Kollegen», sagt ein Polizeibeamter, «da, dahinten, Sie müssen dort schauen», er zeigt auf ein Autowrack, das im Dunkeln liegt, das man nur durch die Reflexion der Blaulichter auf den zerknitterten Blechteilen erkennen kann.
«Sind in dem Wagen dort zwei Patienten?» Josef keucht nach dem Aussteigen hektisch. Er zeigt auf den Wagen, in den der andere Beamte mit der Lampe leuchtet. Ein Feuerwehrmann versucht offenbar, durch das zerstörte Fenster hindurch eine Herzdruckmassage durchzuführen. Schon von hier aus erkennt man das Gesicht einer Frau, die voller Blut ist und die nach oben starrt.
Das Martinshorn des von gegenüber anrückenden Feuerwehrfahrzeuges übertönt die Schreie, die Scheinwerfer blenden, dann verstummt das Horn. Das Fahrzeug stellt sich leicht schräg an den Rand, einen Moment lang erkenne ich gar nichts mehr in der Dunkelheit.
«Die Frau ist wahrscheinlich tot», sagt der Polizist, er setzt hinzu: «Das hat euer Kollege gemeint. Um den Mann kümmert er sich.»
Josef und ich eilen weiter. Neben dem Autowrack liegt ein Mann, der vor Schmerzen laut schreit. Ich lege den Koffer auf den Asphalt, klappe ihn auf. Die Handlampe stelle ich neben mir ab, schalte sie auf die hellere Stufe, Josef läuft weiter.
Dass beide Oberschenkel gebrochen sind, erkennt man bereits ohne eine genauere Untersuchung. Das Gesicht des Mannes und sein Arm sind voller Blut. Ich habe nicht gelernt, einen Zugang zu legen. Ich versuche, ihm eine Sauerstoffmaske aufzusetzen, drehe die Flasche auf. Der Mann windet sich, schreit laut, schiebt die Maske zur Seite, ich schiebe sie wieder zurück vor das Gesicht.
Vier Wochen als Praktikant mitfahren, zwei auf dem Krankentransportwagen, dann sechs Wochen Zivildienstschule, davon eine Woche Staatsbürgerkunde. Ich bin völlig überfordert. Dieser Mann, der schreit, dass es nicht auszuhalten ist. In diesem Moment könnte ich auf den ganzen Staatsbürgerkunde-Unterricht pfeifen. Der Mann braucht einen Zugang und eine Infusion, etwas gegen die Schmerzen, vielleicht sollte er intubiert und beatmet werden. Ich habe mal heimlich geübt, aber nicht wirklich gelernt, einen Zugang zu legen.
Ich versuche, dem Mann in die Pupillen zu leuchten. Ich meine, dass die Pupillen beidseitig gleich reagieren. Ich lege das Blutdruckmessgerät an, die Manschette zittert in meiner Hand. Entweder der Patient ist eh schon tot, dann eilt es nicht mehr so. Oder es gibt viel zu tun, dann ist man gut beschäftigt und denkt nicht viel über alles nach. Dieser Patient ist nicht tot, aber ich bin nicht gut beschäftigt. Ich kann keinen Blutdruck messen, der Puls am Handgelenk ist so schwach, dass ich ihn nicht sicher tasten kann. Für einen Moment schaffe ich es, den Carotis-Puls am Hals zu tasten, der Puls fliegt, ist sicher über 120. Dann windet sich der schreiende Mann zur Seite, bevor ich mit dem Auszählen fertig bin.
Hinter mir läuft eine Maschine hoch, ein Diesel. Ich bekomme mit, dass andere Rettungsfahrzeuge eintreffen, die Pkws, die sich auf beiden Seiten angestaut haben, drehen alle um. Die Straße ist komplett gesperrt. Ein Lichtmast wird errichtet, er beleuchtet dieses Auto gegenüber mit der Beifahrerin, die vermutlich nicht mehr lebt. Mit schwerem Gerät beginnt man damit, das zerstörte Auto, dessen Türen sich nicht mehr öffnen lassen, auseinander zu sägen. Es riecht nach Benzin, aber hier auf dem Boden um mich herum ist nichts davon zu sehen.
Immer wieder brüllt der Mann vor mir so, dass ich kaum etwas anderes mitbekomme. Das Licht der Lampen streift auch seinen Körper, schemenhaft sehe ich das schmerzverzerrte Gesicht vor mir, erkenne Bartstoppeln und Gesichtsmuskeln, die so angespannt sind, dass sie sich durch die Haut hindurch genau abzeichnen. Dieses Schreien macht mich noch wahnsinnig. Aus der Ferne hört man das dröhnend-klappernde Geräusch eines Hubschraubers, der sich langsam nähert.
Ich lege alles bereit, was man braucht, um einen venösen Zugang zu legen. Gesehen habe ich es einige Male. Erklärt bekommen habe ich es auch. Und dann an einer Puppe geübt. Und dann in der Zivildienstschule, obwohl es der Kursleiter verboten hatte, abends im Abstellraum neben der Teeküche. Wenn nur dieses furchtbare Schreien endlich aufhören würde. Zwei Männer mit fluoreszierenden Helmen kommen in meine Richtung, aber dann sehen sie auf die Oberschenkel meines Patienten, verziehen das Gesicht und machen einen Bogen um mich.
«Ich brauche hier einen Arzt», rufe ich ihnen zu.
«Ist noch nicht hier», sagt der eine. Man sieht, dass er versucht, an dem Patienten vorbeizuschauen. «Die da drüben warten auch», ergänzt er, «die brauchen ihn auf alle Fälle zuerst.»
Wo ist überhaupt Josef?
Das Klappern der Rotorblätter wird lauter und lauter, man hat das Gefühl, der Hubschrauber müsse schon fast hinter uns sein. Ein Kollege, den ich nicht kenne, taucht aus dem Dunkel auf. «Also, was hat dein Patient hier?»
«Die Oberschenkel», ich versuche lauter zu schreien als dieser Mann, «die sind wohl gebrochen. Vielleicht auch noch das Becken. Und eine Kopfplatzwunde, vielleicht was am Arm. Die Pupillen scheinen seitengleich zu reagieren und …»
«Hast du schon einen Arzt hier gehabt?», unterbricht mich der Kollege, den ich kaum verstehen kann. Zum einen, weil es unglaublich laut ist, zum anderen wegen seines tief bayerischen Akzents.
«Nein.»
Er notiert sich etwas auf einem Zettel und ist schon wieder weg. Das klappernde Geräusch dröhnt aus der Richtung des Wagens, den die Feuerwehr gerade aufschneidet. Jetzt spüre ich richtig viel Wind, ein paar Plastikverpackungen von Infusionen oder Ähnlichem wehen an mir vorbei. Selbst in diesem Lärm ist das grauenhafte Schreien dieses Mannes noch klar zu hören. Dort bei dem Wrack, das links steht, mit den beiden eingeklemmten Personen, ist jetzt alles hell erleuchtet, kurz streift mein Blick eine Person, die mit erhobenen Händen den olivgrünen Hubschrauber mit der leuchtorangefarbenen Tür einweist. Dann wird es leiser, der Wind hört auf, die Rotorblätter werden langsamer und laufen aus.
Ich habe die Nadel in der Hand. Ich muss aufhören zu zittern. Ich konzentriere mich. Für einen Moment wird das Zittern weniger. Ganz ruhig bleiben.
Als ich ansetze, schreit der Mann besonders laut, zieht den Arm weg, ich ziehe ihn wieder zu mir her. Hör doch für einen Moment auf zu schreien, bitte!!! Jemand strahlt mit einer Lampe auf den Arm, genau erkenne ich die Venen nicht. Aber dann spüre ich einen kleinen Widerstand, habe den Eindruck, es könne passen, ziehe die Nadel zurück, um zu prüfen, ob der Zugang richtig liegt. Das hätte ich nicht dürfen. Aber was kann ich verlieren?
Eine Erinnerung ist plötzlich nah. «Das ist das Schlimmste am Sterben, die schlimmen Schmerzen, die ein Mensch hat, bevor er dann endlich tot ist. Elendig stirbt der Mensch», habe ich die Stimme meines Opas in den Ohren, der mir das einmal sagte. Jetzt geht es mir immer wieder durch den Kopf. «Dass der Mensch leiden muss, wie ein Hund …», höre ich seine Stimme in mir.
«Zuerst die Stauung aufmachen», höre ich eine Stimme hinter mir. Ich sehe an einer weißen Hose entlang nach oben. Das ist die Person, die die Lampe hält, die auf das Handgelenk des Patienten gerichtet ist. Aus der Tasche blitzen der Reflexhammer und der graue Schlauch eines Stethoskops. «Na, zuerst aufmachen», sagt die Stimme hinter mir. Die Stimme des Mannes klingt freundlich und ruhig. Bevor ich dazu komme, beugt er sich selbst vor, macht das. «Okay, die liegt», sagt er.
«Es war nur Glück», sage ich etwas leiser.
«Wie bitte …?», er versteht es nicht.
«Sie sind Arzt, ja?», rufe ich wieder etwas lauter. Er reagiert nicht, die isotonische Kochsalzlösung, die ich bereit halte, schiebt er zur Seite, stattdessen zieht er eine Haes aus meinem Koffer, hängt das System daran.
«Im Schuss reinlaufen lassen!»
Er nimmt die Blutdruckmanschette und legt sie um die Plastikflasche, pumpt auf.
«Was nur reingeht! Und danach sofort die andere», ergänzt er, «oder noch eine Haes, egal, schau, dass da anständig was reinläuft.»
«Intubation?», frage ich, «möchten Sie ihn intubieren?»
«Später vielleicht, ich habe jetzt keine Zeit.»
«Haben Sie kein Schmerzmittel für den Mann?», will ich noch wissen. Er hatte sich schon umgedreht, um weiterzugehen, dreht sich nun noch einmal zurück.
«Nichts, was wirklich bei diesen Schmerzen helfen könnte!», sagt er. «Habt ihr Opiate im Auto?»
«Nein», antworte ich, «tut mir leid. Wo soll ich es her haben, Opiate dürfen wir nicht.»
«Ich auch nicht so einfach … ich komme wieder, sobald ich mit den anderen durch bin», sagt er.
«Solange der so schreit, atmet er wenigstens», ruft er noch. Dann hält er ein paar Meter weiter bei einem anderen Patienten an. Ich erkenne Josefs Gesicht dort zwischen einigen anderen.
Ein Rettungswagen hält einige Meter weiter hinter mir. Ein Blick rundherum: Inzwischen ist alles voller Blaulichter. Rettungswagen, Polizei, Feuerwehr, ein Krankenwagen.
Das Auto, das so hell beleuchtet wird, ist fast aufgeschnitten. Der Fahrer ist offenbar bewusstlos, die Frau daneben schon im Auto mit einem weißen Tuch abgedeckt.
«Zuerst den Jungen aus dem blauen Pkw dahinten», höre ich die Stimme mit dem starken bayerischen Akzent hinter mir, «dann den hier.»
Ich höre seine Stimme lauter werden, sehe zwei hauptamtliche Kollegen von meiner Wache, die eigentlich vor uns Tagdienst hatten. Sie stellen eine Trage neben mir ab.
«Kommt er zu euch ins Auto?», frage ich.
«Nein, wir haben nur den KTW dabei.»
Ich stehe auf, gehe ein Stück zur Seite, die anderen beiden positionieren sich am Kopf und am Thorax. Rundherum die stroboskopartigen Reflexe der Blaulichter, auf der Wiese, sogar hinten auf den Bäumen, die ein Stück weiter weg sind. Wir heben den Mann, der dabei noch lauter schreit, so gut es geht auf eine Vakuum-Matratze, formen diese rundherum an, saugen ab, langsam wird die Form fest. Dann bringen wir den Mann in das Wageninnere des RTW, mit dem Josef und ich da sind. Der Arzt, der die Infusion angehängt hatte, steigt ebenfalls kurz zu. Ich bekomme mit, dass der Hubschrauber wieder anläuft und startet, am Funk höre ich die bayerische Stimme, die jetzt – so gut es geht in Hochdeutsch – mit dem Hubschrauberpiloten funkt.
«Bitte zur Klarheit, beachten Sie fei die Bäume im Westen und Überlandleitungen im Süden.»
Josef taucht in der Seitentür auf. «Alles so weit klar hier?», fragt er.
«Der Notfallkoffer steht noch draußen», entgegne ich ihm.
Kurz darauf schiebt er ihn in das Seitenfach neben der offenen Tür. Der Arzt hängt eine weitere Infusion an. «Name?», fragt er mich, während er sein Protokoll ausfüllt.
«Keine Ahnung», sage ich.
«Ich frag mal nach», meint Josef und verschwindet wieder.
«Wir können dann demnächst losfahren», sagt der Arzt und fügt hinzu: «Zentralklinikum.»
«Schockraum?», frage ich nach.
«Wir können es ja mal so anmelden», meint er, «aber wir haben insgesamt drei Patienten, die wir eigentlich für den Schockraum anmelden müssten, also müssen wir sehen, was möglich ist.»
Josef kehrt zurück. Er hat eine Jacke in der Hand und einen Geldbeutel.
«Das müsste dem Patienten gehören», erklärt er.
*****
«Die waren jetzt auch am Rotieren», meint Josef. Er zeigt mit der Hand nach hinten, in Richtung des Schockraums, aus dem wir zu unserem Fahrzeug zurückkehren.
«Hast du den Zettel mit dem Namen?»
Er greift an seine Jacke, zieht ein kleines ausgedrucktes Klebeetikett ab, das er nur leicht an den Stoff angeheftet hat, und gibt es mir. Der Name steht darauf, das Geburtsdatum und der Wohnort.
«Und die Krankenkasse?», möchte ich wissen.
«Wir hatten nur den Ausweis», erklärt er, «keine Versichertenkarte, wir müssen morgen noch mal in der Klinik anrufen. Bis dahin haben sie es sicher.»
«Hans-Peter Zäuninger, 12.4.1936», notiere ich. Der Mann ist 47, etwa so alt wie mein Vater.
«Ich hätte ihn für viel älter gehalten», sage ich, während ich schreibe.
«Wenn man krank ist, sieht man nicht jung aus», sinniert Josef.
Ein Kollege kommt vorbei, erkundigt sich nach dem Einsatz, bietet uns eine Zigarette an.
«Ich rauche nicht», sage ich.
«Und ich nur Pfeife», meint Josef, «diese Glimmstängel sind nichts, die zieht man nur gedankenlos rein, ohne sie zu genießen. Wenn ich mir schon den Teer in die Lunge sauge, möchte ich wenigstens Freude daran haben.»
«Der Patient, der mit dem Hubschrauber reinkam, hatte wohl ein Schädel-Hirn-Trauma», sagt Josef dann, «haben sie drinnen gesagt. Beide Pupillen weit und lichtstarr.»
«Beide?», fragt der Kollege, der sich nun selbst eine Zigarette anzünden will.
Josef nickt.
«Dann sieht es nicht gut aus für den», meint er. Das Feuerzeug funktioniert nicht richtig.
Josef schüttelt den Kopf.
«Nein, sieht nicht gut aus», er zieht eine Packung Streichhölzer aus der Tasche und zündet die Zigarette an. «Lass dir mal von einem Pfeifenraucher helfen», meint er süffisant.
«Wir haben nur noch eine isotonische Kochsalzlösung im Auto», erkläre ich Josef, «wir müssen bald auffüllen, vielleicht sagen wir es der Leitstelle, wenn wir uns wieder klar melden.»
Josef schüttelt den Kopf. «So melden wir uns überhaupt gar nicht klar», sagt er, «schau dich mal an.»
Ich sehe an mir runter. Die Hose, mein Hemd und auch die Jacke sind seitlich voller Blut.
«Damit kannst du höchstens Patienten erschrecken, aber rausfahren gar nicht mehr.»
Einen Tag später
Josef sitzt am Tisch in der Küche.
Ein mitgebrachtes Brot und ein Kaffee stehen vor ihm. «Dein Geld», sagt er.
Auf dem Tisch liegt etwas Kleingeld. Mir ist nicht gleich klar, was er meint.
«Die Wette», wird er jetzt deutlicher.
«Behalt das Geld», sage ich.
«Nein, wieso? Du hast gewonnen», sagt er, «ich lass mich doch nicht wegen 1,50 DM lumpen und mir nachsagen, ich habe meine Schulden an einen Zivi nicht bezahlt», erklärt er mir mit einem ernsten Gesichtsausdruck.
«Es war kein Motorrad. Und nicht vor Sonnenuntergang», meine ich, «aber du hattest irgendwie doch recht.»
«Nein: Du hast gewonnen.»
«Ich hab keine Lust mehr auf solche Wetten.»
Er zuckt mit den Schultern. «Dann tun wir es in die Kaffeekasse, basta.»
Ich setze mich hin. «Wo sind denn die von der Tagschicht?», frage ich.
«Die haben mir einen Kaffee gekocht und sind dann rausgefahren», grinst er.
Ich nicke.
«Schon in der Klinik angerufen wegen der Krankenkasse?»
«Ja, privat versichert.»
Ich gieße mir Kaffee ein. Die Milchdose ist leer.
«Im Kühlschrank ist noch welche», sagt er, «noch zwei Dosen.»
Ich bin noch müde.
«Nein, lieber schwarz.»
«Stell dir vor», sagt er, «der hatte gar kein Problem mit dem Hirn.»
«Wer?»
«Der Unfallverursacher, den sie mit dem Hubi in die Klinik gebracht haben.»
«Sondern?»
«Der war so betrunken, dass er deshalb keine Pupillenreaktion mehr hatte.»
«So … geht das überhaupt?»
Josef zuckt mit den Schultern. «Scheint wohl zu gehen.»
Ich nehme einen Schluck. Schwarz schmeckt nicht. Ich hole mir doch noch die Dosenmilch aus dem Kühlschrank.
«Dann hatte er doch ein Problem mit dem Gehirn», bemerke ich.
«Nein, mit Alkohol», widerspricht Josef.
«Ja», sage ich, «eben.»
«Ach …», er hält meine Bemerkung offenbar für unpassend und dreht die Augen nach oben.
Juli 1985
Zäuninger. Der Name ist nicht gerade häufig bei uns hier in der Gegend. Eigentlich hatte ich ihn vor diesem Unfall noch gar nie gehört. Zäuninger lese ich auf dem Namensschild des Kollegen, der an diesem Tag vor dem Eingang des Krankenhauses in Friedberg steht. Für einen Moment stutze ich, erinnere mich an diese Nacht vor fast zwei Jahren.
Ist das unser Patient von damals? Nein, sicher nicht. Der war bei dem Unfall ja schon 47 Jahre alt. Und dieser Kollege hier ist vielleicht wenige Jahre älter als ich, aber sicher keine 30 Jahre alt. Eher 25.
Ich grüße höflich. Die Kollegen sind aus Dachau. Haben eine ältere Dame hier in die Klinik gebracht. «Aus Dachau hierher?»
«Nein», schüttelt der Kollege den Kopf, «wir waren im Klinikum wieder einsatzklar, aber der Transport ging ja in unsere Richtung, da hat uns die Leitstelle den Transport hierher noch mitgegeben.»
«P. Zäuninger», lese ich nochmals auf dem aufgenähten Namensschild. Vielleicht steht das «P» für Peter. Der Patient damals hieß Hans-Peter, soweit ich mich erinnere.
Ob ich ihn einfach danach fragen kann?
Ich denke an die Schweigepflicht. Lieber lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ich schiebe unsere Trage in das Auto und verabschiede mich. Inzwischen bin ich nicht mehr Zivi. Ich fahre den KTW, mit dem wir heute unterwegs sind, und habe stattdessen selbst einen Zivi als Begleiter dabei.
Aber dann entscheide ich mich anders und steige doch noch mal aus.
«Hör mal», fange ich vorsichtig an, «bitte entschuldige, wenn ich so frage, aber … hatte bei dir in der Familie mal jemand einen Unfall?»
«Ja», sagt er, «warst du damals mit draußen?»
Ich nicke.
«Meine Eltern», sagt er. «Beide. Damals haben sie in Klingen bei Aichach gewohnt.»
Ich überlege.
«Wie war das damals?», fragt er mich.
«Na ja», ich überlege, was ich sagen darf und was nicht. «Ich fand es schlimm», winde ich mich um eine konkrete Antwort herum.
Das war vermutlich nicht das, was er hören wollte, sicher wird er noch einmal nachhaken.
«‹P›, steht für?», ich deute auf sein Namensschild.
«Peter», sagt er.
«Und … wie geht es deinen Eltern heute?», frage ich.
«Meiner Mutter gut. Sie hat ein paar Narben am linken Arm. Aber sonst nichts. Und sie hat panische Angst vor dem Autofahren, vor allem in der Nacht. Mein Vater war fast ein Dreivierteljahr in den Kliniken», erklärt er mir, «er ist früher gerne Fahrrad gefahren. War an den Wochenenden oft wandern in den Bergen. Das geht eben jetzt alles nicht mehr. Lange Zeit sah es so aus, als müsse man ihm das linke Bein ganz abnehmen. Aber er hatte Glück.»
«Das tut mir leid», sage ich.
Er schüttelt den Kopf. «Nein, mein Vater ist sehr glücklich, dass er noch lebt. Ist seit etwa einem Jahr in Pension. Er hat sich sehr verändert», erklärt er, «er ist unglaublich dankbar für jeden Tag, den er hat. Und dass auch meiner Mutter nicht mehr passiert ist. Hast du damals das Auto gesehen?», fragt er mich.
«Das Auto lag im Halbdunkel», sage ich, «ich hatte keine Zeit. Aber gut sah es nicht mehr aus. Überall lagen Trümmer herum.»
Dieses Schreien. Ich erinnere mich nur immer an dieses grauenhafte Schreien.
«Ich hab das Auto gesehen», nickt er mir zu, «ich habe es gesehen. Meine Güte!», sagt er leise.
Sein Nicken ist in ein Kopfschütteln übergegangen.
«Das ging nicht mit rechten Dingen zu. Dass die beide lebend aus dem Auto gekommen sind. Du hättest das Auto mal genau ansehen müssen. Das Lenkrad steckte im Sitz. Meinen Vater hat es während des Aufpralls irgendwie zur Seite gedreht, frag mich nicht, wie. Das war sein Glück. Ich hab mir das Auto am nächsten Tag angesehen.»
Ich hole tief Luft. Wir schweigen.
«Meine Güte», wiederholt er noch einmal, «eigentlich gibt's das gar nicht.»
Er sieht nach oben zum Himmel.
«Verstehe», sage ich.
«Der andere ist verurteilt worden. Zehn Jahre. Da war nichts mehr mit Bewährung», fährt er dann fort, «ich glaube, man hat ihm Vorsatz unterstellt. Und besondere Uneinsichtigkeit. Wie gibt's denn so was: Der hat wohl noch vor Gericht abfällig über das Mädchen geredet, das er zu Tode gefahren hat.»
«Was???», frage ich nach.
«Ja», sagt er, «die war siebzehn, er einundzwanzig und hatte seinen Führerschein davor schon abgeben müssen. Die hatten ihn schon mal betrunken erwischt.»
Oh ja: Ganz sicher hatte der ein Problem mit dem Gehirn, denke ich.
«Und … hat dein Vater mal etwas von dem Unfall selbst erzählt?», möchte ich wissen. «Ich meine, wie er alles erlebt hat?»
Dieses Schreien – es geht mir immer noch nach.
«Hm», es kommt fast lachend aus ihm heraus, «er hat gesagt, es war seltsam. Ein ganz eigenartiges Erlebnis.»
«Eigenartig?», ich stutze.
«Ja. Er hat das Gefühl gehabt, dass er sehr weit weg war. Am Ende eines langen Tunnels. Er hat von dort aus für eine kurze Zeit etwas gesehen, das er für sein Auto gehalten hat. Und jemand in Rettungsdienstklamotten. Und dann hat er eine Stimme gehört, die seine eigene war, die nicht aufgehört hat zu schreien. Aber … er sagt immer, es ging ihm da richtig gut. Schmerzen oder so – die hat er erst später in der Klinik gehabt. Er hat wohl nicht viel mitbekommen.»
«Okay …?»
Mit allem hatte ich gerechnet, nur damit nicht.
«Ich denke, wir müssen dann los», erkläre ich ihm.
«Und du? Du warst nur so dabei? Oder direkt bei meinem Vater? Wie heißt du eigentlich?»
«Georg.»
«Georg …?», es klingt fragend. Ich möchte ihm nicht meinen ganzen Namen nennen.
«Warst du damals auch schon beim Rettungsdienst?», stelle ich ihm eine Gegenfrage.
«Nein. Erst danach. Ich wollte schon immer was machen. Eigentlich mehr Erste-Hilfe-Ausbilder. Nach dieser Sache hab ich mir dann einen Ruck gegeben.»
«Hm», ich überlege. «Sag deinen Eltern einen schönen Gruß, okay? Ich freu mich, wenn es ihm wieder gut geht.»
Er nickt mir zu. «Von Georg, ja?»
«Ja», ich gehe zu meinem Wagen zurück. Der Zivi wartet schon.
Bevor ich die Tür zuschlage, halte ich noch mal einen Moment lang inne.
«Danke», rufe ich ihm noch zu, «du hast mir ziemlich geholfen.»
Er schaut mich fragend an.
Dann schaue ich nach dieser weißen Linie im Rückspiegel, an die ich mich halten muss, um rückwärts die Rampe herunterzufahren.
2
Ich denke manchmal noch an Herrn Krügler
Juni 1985
Freitagabend.
«Ich komm dich vielleicht nachher noch besuchen. Mit wem hast du Dienst?»
«Walter», sage ich knapp.
«Mhm», Renate überlegt. «Und morgen?»
Ich schaue kurz in den Dienstplan, der über meinem Schreibtisch hängt. «Morgen Nacht fahre ich mit Hardy.»
«Dann komme ich wohl eher morgen Abend mal vorbei.»
Mit Walter hat sie kein Problem, aber es geht ihr ein wenig wie mir. Sie kann auch nicht wirklich viel mit ihm anfangen. Er gehört einfach zu einer anderen Generation, hat andere Interessen, es gibt kaum Themen, man sitzt eher herum und schweigt sich ein wenig an oder tauscht Belanglosigkeiten aus. Sind Kollegen da, mit denen man auch außerhalb des Dienstes mal was unternimmt, schaut sie häufig auf der Wache vorbei, und solange wir keinen Einsatz haben, schauen wir uns einen Film an oder spielen Karten oder Mensch-Ärgere-Dich-nicht.
Trotzdem lasse ich ihr das Auto. Falls sie doch noch was unternehmen möchte oder auf die Idee kommt, vorbeizuschauen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























