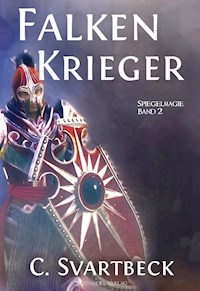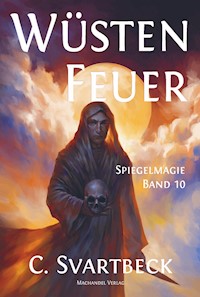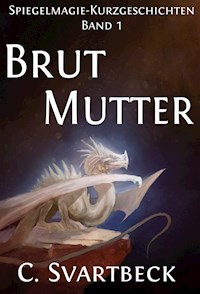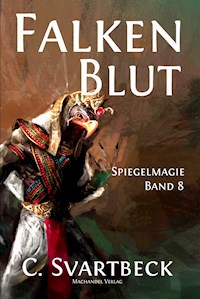Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Machandel Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Spiegelmagie
- Sprache: Deutsch
Ein Falke verbindet ihr Schicksal. Für den Zauberlehrling Jokon ist die Beherrschung des Falken die einzige Möglichkeit, den Turm der Schüler zu verlassen. Für Ioro, den ältesten Sohn des Königs von Karapak, ist der Falke der königliche Wappenvogel und die lebende Legitimation der Herrschaft seiner Familie durch die Götter. Der Falke macht sie zu Freunden. Und Freundschaft haben sie bitter nötig. Sowohl die Zauberschule als auch der karapakische Königshof sind so tödlich wie eine Schlangengrube. Sie können nur einander trauen und hoffen, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Spiegelmagie
Band 1
KÖNIGSFALKE
C. Svartbeck
Hinweis:
Am Ende des Buches finden Sie einen Anhang mit einer Landkarte sowie Erläuterungen zum Land Karapak und seinen Bewohnern.
Der Erstgeborene
Ein Sohn!
Kanata, elfter Herrscher über Karapak aus dem ruhmreichen Hause Mehme, schaute ausgesprochen zufrieden auf das kleine Geschöpf, das die Hebamme ihm mit einer tiefen Verbeugung präsentierte. Die neue Konkubine machte dem königlichen Haus Ehre. Ein Sohn als erstes Kind, und das kaum vierzehn Monde nach ihrem Einzug in den Harem. Zudem war Miomio nicht nur eine sehr schöne Frau – Kanata gestattete sich ein Lächeln, als er an vergangene Nächte dachte – die Konkubine wusste auch intelligent eine Unterhaltung zu führen, und ihre Ratschläge waren nicht schlecht. Für eine Frau war sie sogar überaus gebildet.
Kanata streckte die Hand aus, berührte vorsichtig das Neugeborene. Der erste einer hoffentlich langen Reihe von Söhnen. Der zukünftige Feldherr seines Reiches. Der Kleine sah kräftig aus. Ein dichter Schopf pechschwarzer Haare bedeckte bereits jetzt seinen Kopf, und die kleinen Händchen waren zu Fäusten geballt. Ja, das würde ein Krieger werden.
Jemand schob sich neben ihn. Kanata roch Pfirsiche. Das neuste Lieblingsparfüm seiner Ersten Gemahlin Iragana. Ihre sanfte Hand legte sich auf seinen Arm. „Ein wunderschöner Sohn, mein Gemahl“, sagte sie. „Wie werdet Ihr ihn nennen?“
„Ioro.“ Kanata musste nicht lange überlegen. „Er wird Erster Feldherr, er wird unsere Truppen zum Sieg führen, also soll er auch `der Sieger´ heißen.“
„Er sollte einen Bruder bekommen. Ein Feldherr braucht einen König, für den er kämpfen kann.“
Kanata runzelte die Stirn. Iragana war zwar seit zwei Monden Erste Gemahlin, aber es schien ihm noch etwas verfrüht, sie in sein Bett zu rufen. Schließlich war das Mädchen erst dreizehn Regenzeiten alt. Zudem – im Gegensatz zu Miomio war sie flach wie ein Brett. Nichts, woran ein Mann Gefallen finden konnte. Warum, bei allen Göttern, hatte es der Thronrat bloß so eilig gehabt, ihn zu verheiraten? Ein paar Jahre mehr, und seine Cousine hätte vielleicht ein paar Kurven gehabt, die sie attraktiver machten.
Erneut schaute er auf den Säugling. Da war der Beweis, dass er Söhne zeugen konnte. Das sollte dem Thronrat vorläufig genügen. Seine Erste Gemahlin würde wohl noch ein wenig länger warten können.
Iragana sah ihrem Gatten hinterher, der mit stolzgeschwellter Brust aus dem Raum stolzierte. Wilde Eifersucht wallte in ihr hoch. Diese nichtswürdige Konkubine durfte nicht nur das Bett ihres Gatten teilen, sie hatte auch noch einen Sohn geboren! Und sie selbst, als Erste Gemahlin, bekam ihren Gatten nur bei seltenen gemeinsamen Mahlzeiten zu sehen. Irgend etwas musste passieren. Sie musste es schaffen, dass ihr Gatte auch ihr einen Sohn zeugte. Irgendwie.
Was hatte ihre Amme ihr noch gesagt, kurz bevor sie die Brautsänfte bestieg, die sie nach Sawateenatari brachte? „Im Harem gibt es viele Geheimnisse. Wenn du mehr darüber wissen willst, frag nicht die Frauen des Königs. Frag die Dienerinnen und Diener. Frag die Eunuchen.“ Der König war im Palast aufgewachsen. Insbesondere die älteren Diener und Eunuchen kannten ihn vermutlich besser, als er sich selbst. Einer von denen wusste bestimmt, welches Mittel sie einsetzen musste, um ihren Gatten in ihr Bett zu bekommen.
Iragana zwang ein zuckersüßes Lächeln auf ihr Gesicht und trat an Miomios Lager, um der Konkubine zu ihrem Sohn zu gratulieren.
Miomio war sich nicht sicher, ob sie Grund zu Freude hatte. Sicher, König Kanata war zufrieden mit ihr. Zufrieden damit, dass sie ihm gleich als erstes Kind einen Sohn geboren hatte. Ein Sohn, den Kanata offiziell als seinen anerkannte, im Gegensatz zu den Bastarden, die er mit den Dienerinnen gezeugt hatte. Damit war ihr eigener Status ebenfalls gesichert. Die Mutter eines anerkannten Sohnes würde der Herrscher niemals verstoßen. Theoretisch war alles perfekt gelaufen.
Theoretisch.
Miomio wusste nur zu genau, welche Regung sie in dem Gesicht der ersten Gemahlin erkannt hatte. Das Mädchen war noch zu jung, um sich perfekt zu verstellen. Eifersucht und Neid. Eine gefährliche Kombination. Im Sommerharem konnten schon geringere Gründe tödlich sein.
Die Erste Gemahlin würde wohl nicht gerade mit dem Dolch auf sie losgehen. Aber es gab genügend Methoden, jemanden umzubringen, ohne sich direkt die Hände schmutzig zu machen. Der Sommerharem war berüchtigt für seine Intrigen.
Miomio beschloss, ab sofort eine Vorkosterin einzusetzen.
Der erste Sohn des Königs war ein Grund zum Feiern. Ganz Sawateenatari war auf den Beinen und jubelte.
Der erste Sohn des Königs war auch ein Grund für Fragen. Fragen, die man den Orakeln der Tempel stellte.
Die Antworten der Götter waren ... besorgniserregend. Besorgniserregend und vieldeutig. Besorgniserregend genug, dass die Priester diese Antworten an die Zauberer weiterleiteten.
Der erste Sohn des Königs war damit auch ein Grund für die Kristallkammer, einen Spiegel zu opfern.
Ro, der Großmeister der Zauberer, starrte auf Meister Li. „Das ist nicht gerade eine besonders präzise Zukunftssicht.“
Li zuckte mit den Achseln. „Die Priester sind in so etwas eigentlich besser. Die haben schließlich den direkten Draht zu den Göttern.“
„Dafür haben wir Spiegel.“
„Wenn die Götter nicht mitspielen, bleiben unsere Spiegel blind.“
„Wir können aber ein Bild erzwingen.“
Li deutete auf das zerschmolzene Glas und den verbogenen Rahmen. „Was ich ja getan habe. Ihr seht das Ergebnis. Und das Bild, das ich bekam, war keinen Deut besser als das, was aus meinem Spiegel geworden ist.“
„Auch ich sah das Bild.“ Das war Meister Ur. „Der Spiegel zeigte Unglück und Krieg.“
„Ja. Aber er zeigte auch einen karapakischen Feldherren auf dem Söller des königlichen Palastes in Tolor.“
„Pures Wunschdenken“, knurrte Ur. „Wir werden Tolor niemals erobern. Und wenn doch, dann werden wir es nicht halten können. Das hatten wir doch schon einmal.“
Li malte mit dem Zeigefinger eine verschlungene Linie in die Luft. Kurz glühte eine Feuerrune auf. „Ich habe noch eine Ebene tiefer gesehen“, sagte er nachdenklich. „Dieser Junge, Ioro, der wird seinem Namen einmal alle Ehre machen. Aber ob sein Sieg positiv oder negativ für Karapak ausfällt, das wird sehr von seiner Position abhängen. Davon, wer der nächste König wird. Ich denke, wenn es möglich wäre, dass dieser Ioro König würde, dann könnten die schlechten Zeichen, die die Orakel gesehen haben, in ihr Gegenteil verkehrt werden.“
„Unmöglich. Der Sohn einer bloßen Konkubine kann niemals König werden. So sagt es das Gesetz.“
Ro räusperte sich. Sofort sahen seine Mitstreiter ihn an. „Gesetze werden von Menschen gemacht“, sagte er. „Und Menschen können sie ändern.“
Li und Ur wechselten einen Blick. „Warum sollten sie?“, fragte Li.
Ro schaute auf den Glasklumpen. Offensichtlich war seinen beiden Kollegen entgangen, was er gesehen hatte. Dieser Ioro – seine Blutlinie war interessant. Sehr interessant. Ausreichend interessant, um dafür ein gewisses Risiko einzugehen. Außerdem wäre es für gewisse Dinge ganz brauchbar, wenn der Palast den Zauberern nicht länger hermetisch verschlossen blieb.
„Wir probieren es einfach“, sagte er. „Stellen wir einen Antrag.“
Kanata starrte aus schmalen Augen auf das Papier. Die Erbfolge ändern? Was, bei allen Winddämonen, hatten diese Zauberer da ausgeheckt? Wenn er eines sicher wusste, dann das: Die Kristallkammer tat nie etwas, ohne einen Vorteil davon zu gewinnen. Welchen Vorteil sahen die Zauberer in einem Bastardsohn als Thronfolger?
Direkten Einfluss im Palast konnten sie auch über Ioro nicht gewinnen. Niemand in der königlichen Familie hatte auch nur das kleinste bisschen Zaubererblut. Der Palast war für Magie tabu, aus gutem Grund, und alle Frauen, die dem König zugeführt wurden, waren handverlesen.
Was dann?
Aus welchem Haus stammte Miomio noch mal? Brepaka. Eine kleine, unbedeutende Baronie in den Drachenschwanzbergen, nahe der Südgrenze. Keine Provinz, aus der normalerweise königliche Konkubinen kamen. Miomio war ein Höflichkeitsgeschenk gewesen. Eigentlich hatte Kanata vorgehabt, sie direkt in den Winterharem zu schicken. Brepaka war einfach zu unbedeutend, um eine der Frauen dieses Hauses tatsächlich zur königlichen Konkubine zu ernennen.
Doch dann hatte er die Frau angeschaut. Und die Frau hatte sich bewegt. War mit einer Anmut, die ihresgleichen suchte, vor ihm auf die Knie gefallen. Er hatte nach ihrem Namen gefragt. Und als sie antwortete, war nicht nur ihre Stimme sanft und süß und vielversprechend, auch ihr Gesicht war wunderschön, wie er erkennen konnte, als sie den Kopf hob. Ein wunderschönes Gesicht, makellose Haut, und als sie aufstand und ihr Gewand sich dabei bewegte, über ihre Brust glitt, hatte er nur zu deutlich gesehen, wie wohlgeformt sie war. Ein Anblick, bei dem ihm das Blut in die Lenden schoss. Danach hatte er keinen Gedanken mehr daran verschwendet, diese spezielle Frau in den Winterharem abzuschieben.
Was konnten sich die Zauberer von Brepaka versprechen?
Nichts. Die Provinz war einfach zu unbedeutend. Nicht ein einziger Zauberer war dort stationiert.
Hm. Vielleicht war es genau das, was die Zauberer antrieb. Die letzten Jahrhunderte hatten sie ausschließlich den großen Häusern gedient. Sehr profitabel. Dennoch gab es deutlich weniger große als kleine Häuser. Vielleicht wollten die Zauberer auf diese Weise ihre Machtbasis vergrößern. Wollten sich die Unterstützung der kleinen Häuser sichern.
Das machte Sinn.
Kanata atmete durch.
Wer die Motive seines Gegners durchschaute, hatte die Oberhand, soviel hatte er gelernt. Aber egal, was für Motive die Zauberer hatten, und wie sinnvoll diese vielleicht sein mochten, er würde alles daran setzen, dass sie nicht damit durchkamen. Schon aus Prinzip. Das war er seinem Haus schuldig.
Der Palast hatte Augen und Ohren, auch im Sommerharem. Die Hofdamen konnten eine gewisse Spannung nicht verhehlen, als sie der ersten Gemahlin die Neuigkeiten erzählten.
Iragana fühlte sich elend. Die Kristallkammer hatte beantragt, die Thronfolgegesetze zu ändern? Das durfte einfach nicht sein! Ihr Sohn, und nur ihr Sohn, wenn sie denn endlich einen bekommen würde, sollte den Thron erben! Nicht der Bastard einer Konkubine, der nur das Glück gehabt hatte, dass seine Mutter ein wenig eher in das Bett des Herrschers gefunden hatte.
Was konnte sie tun?
Iraganas Augen wurden schmal. Überaus freundlich, aber sehr bestimmt, teilte sie ihren Damen mit, dass sie unpässlich sei und einige Zeit für sich alleine brauchte. Dann eilte sie in ihr Gemach, suchte Papier und Feder heraus und begann zu schreiben. Den fertigen Brief siegelte sie und übergab ihn Zoch, ihrem Lieblingseunuchen. „Sorge dafür, dass der Brief so rasch wie möglich Herzog Pritasaru zugestellt wird. Mein Onkel wartet schon zu lange auf eine Nachricht seiner Lieblingsnichte.“
Zoch verbeugte sich und eilte hinaus. Iragana sah ihm nach. Ihr Onkel würde Rat wissen. Er wusste immer Rat. Immerhin war er auch derjenige, der dafür gesorgt hatte, dass seine Nichte ihren entfernten Cousin Kanata heiratete. Völlig uneigennützig natürlich, wenn man davon absah, dass ihm mit der Geburt des Thronfolgers ein lebenslänglicher Sitz im Thronrat sicher sein würde.
Herzog Pritasaru zögerte keinen Lidschlag. Nachdem er den Brief seiner Nichte gelesen hatte, schickte er umgehend Botenvögel in alle Himmelsrichtungen. Es gab da einige Leute, die ihm einen Gefallen schuldeten.
Nur gut, dass Iragana so intelligent war und schnell gehandelt hatte. Pritasaru mochte sich nicht ausmalen, was aus seinen ehrgeizigen Plänen würde, wenn seine Nichte ihren Platz als Erste Gemahlin an diese unbedeutende Konkubine verlor. Eine Katastrophe! Und das, wo er so viele Jahre geduldig daran gearbeitet hatte, die Position seiner Familie zu verbessern.
Es gab da allerdings noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Pritasaru ging an einen Schrank und entnahm ihm aus einem gut getarnten Geheimfach ein Fläschchen. Einen Moment starrte er auf die Phiole mit der hellblauen Flüssigkeit. So unscheinbar und harmlos sie aussah, das Gift war absolut tödlich. Pritasaru schrieb seinerseits einen Brief, wickelte dann die Phiole und den Brief sorgfältig ein und übergab beides dem Eunuchen. „Meine Nichte wird sich erkenntlich zeigen, wenn du rasch zurückkehrst.“
Als Zoch eilends das Gemach verließ, umspielte die Lippen des Herzogs ein Lächeln.
Iragana las den Brief ihres Onkels. Las ihn ein zweites Mal und seufzte. Dann setzte sie ein freundliches Strahlen auf und wandte sich Zoch wieder zu. „Gut gemacht“, sagte sie.
Das Gesicht des Eunuchen verzog sich zu einem breiten Grinsen. Er liebte seine junge Herrin. Er hatte sie schon geliebt, als sie noch beide im Haus ihres Vaters gelebt hatten. Iragana hatte ausdrücklich darum gebeten, Zoch als Diener mitnehmen zu dürfen. Zoch war sich sicher, dass ihm jetzt eine glanzvolle Zukunft bevorstand. Jetzt, wo Iragana begann, ihn in ihre Pläne einzubeziehen.
Seine junge Herrin ging zu dem Tischchen, auf dem sie seit einigen Tagen stets eine Schale mit Leckereien stehen hatte. Genauer gesagt, seit der Zeit, als Zoch ihr erklärt hatte, dass Männer im Allgemeinen an Frauen gewisse Rundungen schätzten. Sie fingerte an der Schale herum, schien etwas herauszusuchen.
Dann drehte sie sich mit einem strahlenden Lächeln zu ihm um und hielt ihm eine mit kandierten Früchten gefüllte Waffel hin. Zochs Lächeln wurde noch strahlender. Seine junge Herrin erinnerte sich, was er am liebsten naschte! Vergnügt nahm er die Leckerei aus ihren Händen entgegen und schob sie sich in den Mund.
Noch während er schluckte, spürte er Feuer durch seine Speiseröhre laufen. Feuer, dass in seinem Magen zu einem tobenden Sturm wurde. Bevor er aufschreien konnte, brach er zusammen.
Iragana schaute auf den zuckenden Körper zu ihren Füßen. Es dauerte nicht lange. Onkel Pritasaru hatte recht gehabt, das Gift wirkte schnell. Sie spürte Nässe auf ihren Wangen. Mit zornigen Bewegungen wischte sie die Tränen weg. Freund oder nicht Freund, eine Königin durfte sich keine Schwächen erlauben. Mitwisser waren zu gefährlich. Onkel Pritasaru hatte recht getan, sie daran zu erinnern.
Als sie absolut sicher war, das Zoch tot war, rief sie die Diener, den Leichnam zu beseitigen. Die Männer gehorchten, ohne eine Miene zu verziehen. Das Leben eines Eunuchen im königlichen Palast wog nicht viel.
Iragana wartete, bis sie wieder alleine war. Dann ging sie zu dem kleinen Tischchen zurück. Nachdenklich hob sie die Phiole hoch. Ob der Rest da drin wohl ausreichen würde, auch eine Konkubine zu den Göttern zu befördern?
„So etwas wird sich nicht wiederholen!“ Kanata blitzte seine Gattin unter drohend zusammengezogenen Brauen wütend an. „In diesem Haus gibt es nur einen, der bestimmt, wer lebt und wer nicht. Und dieser eine bin ich!“
Iragana schwieg mit gesenktem Kopf.
„Was, bitte, hat Euch bewogen, die Dienerin einer Konkubine zu vergiften?“
Mangelnde Vorausschau. Iragana haderte mit sich selbst, dass sie nicht sorgfältiger geplant hatte. Miomio hatte wohl irgendwie Verdacht geschöpft und eine Vorkosterin bestimmt. Etwas, was Iragana zu spät herausgefunden hatte. Ihr Gatte würde vermutlich wenig Verständnis dafür haben. Iragana zog es vor, weiter zu schweigen.
„Ah, wie ich es mir dachte. Das Gift war gar nicht für die Dienerin bestimmt. Habt Ihr wirklich gedacht, ich würde nicht erkennen, was in meinem eigenen Haus geschieht?“
Hatte sie nicht. Iragana wusste so gut wie ihr Gatte, dass es außer ihr niemanden gab, der vom Tod der Konkubine profitieren würde. Andererseits – sie war die Erste Gemahlin. Sie war damit so gut wie unantastbar. Auch für ihren Gatten.
Der sie jetzt gerade sehr, sehr intensiv musterte. Iragana zuckte kaum merklich mit den Schultern. Das lose, etwas weite Gewand, das sie extra für diese Begegnung ausgesucht hatte, rutschte noch ein Stückchen weiter herab und entblößte die kleine, aber durchaus wohlgeformte Rundung ihrer Brust.
Wie von einem Magneten angezogen, wanderte der Blick ihres Gatten genau dorthin.
Dann kam er zu ihr.
Seine Hände waren grob. Seine Stimme auch. Aber er tat, was sie die ganze Zeit gewollt hatte.
Bevor er ihr Gemach wieder verließ, drehte er sich noch einmal zu ihr um. „Ich werde Miomio zu meiner Ersten Konkubine ernennen“, sagte er.
Iragana schwieg. Ihr war klar, dass Miomio als Erste Konkubine für sie leider tabu wurde. Aber ab sofort war die Konkubine nicht mehr die einzige Frau, die regelmäßig Kanatas Bett teilen durfte. Und als i-Tüpfelchen hatte eine Botschaft ihres Onkels sie heute erreicht, dass der Antrag des Kronrates auf Änderung der Thronfolge abgeschmettert worden war.
Fünf Jahre später
Jokon sah mit gerunzelter Stirn auf die Ziege. Sie fraß nichts mehr. Wahrscheinlich war ihr das Futter zu trocken. Wenn die Ziege nichts fraß, gab sie auch keine Milch, und seine Mutter brauchte die Milch. Ihre eigene war versiegt und sie hatte ein kleines Kind zu versorgen. Selbst mit seinen gerade erst sieben Jahren wusste Jokon, was das bedeutete. Wenn die Ziege keine Milch mehr gab, würde seine kleine Schwester sterben.
Aber vielleicht würden sie ohnehin alle sterben.
Zwei Regenzeiten hintereinander waren die Wolken ausgeblieben. Die Dürre hielt das Land erbarmungslos im Griff. Auf den Feldern tanzten Staubwirbel, die Bäume reckten kahle Äste in einen Himmel, der wie geschmolzenes Kupfer glühte, und im Flussbett rann kein einziger Tropfen Wasser mehr. Sein Boden war zu einer einzigen stinkenden Masse aus steinhartem, aufgesprungenem Schlamm und Tierkadavern verbacken.
Und jetzt, kurz vor der Saatzeit, war selbst die Dorfquelle versiegt. Die letzten Tage hatte sie nur noch ein müdes Rinnsal ausgeschieden. Heute Morgen war nicht einmal mehr feuchter Schlamm in der Quellmulde gewesen ...
Die Männer diskutierten die ganze Nacht über, während die Frauen versuchten, die vor Durst schreienden Kinder zu beruhigen. Sie konnten das Dorf auf keinen Fall verlassen. Die Asche ihrer Ahnen ruhte in den Lehmwänden der Häuser. Wenn sie fortgingen, würden die erbarmungslos über die Ebene fegenden Winde die Wände bald abtragen und damit die Ahnen zu heimatlosen, umher irrenden Geistern machen.
Ihnen blieb nur ein Ausweg. Die Männer wussten, was das für das Dorf bedeutete, ihre Stimmen waren bedrückt. Auch die Frauen kannten den Preis, den die Rettung des Dorfes kosten würde, und weinten ohne Tränen.
Am nächsten Morgen wurden zwei junge Männer losgeschickt, einen Zauberer zu holen.
Als sie drei Tage später zurückkehrten, waren bereits die ersten Kinder gestorben.
Der Zauberer fuhr auf einem ratternden Karren ins Dorf, der von schwarzen Ochsen gezogen wurde. Zu Jokons größtem Erstaunen war es ein junger Mann, sein kurzes Haar und sein gelockter Bart waren noch immer pechschwarz. Er trug eine einfache, braune Robe. Jokon war schwer enttäuscht. Das sollte also einer der berühmten Zauberer sein? Da sah Miron, der Dorfschmied, beeindruckender aus.
Der Zauberer war praktisch veranlagt. Er hatte seinen Karren mit zehn Fässern frischen Wassers beladen. Frauen und Männer priesen ihn gleichermaßen in aufrichtiger Dankbarkeit, während sie das Wasser in kleinen Portionen an alle verteilten. Zum ersten Mal seit Tagen verstummte das Wimmern der Kinder. Das Dorf wartete.
Der Zauberer brauchte etwas Privatsphäre, um sich vorzubereiten. Er zog sich in den kleinen Tempel der Brennenden Göttin am Ende des Dorfplatzes zurück, wo er bis zum späten Nachmittag blieb.
In der Zwischenzeit kam Jokon einfach nicht zur Ruhe. Irgendetwas nicht greifbares schien um ihn herumzuschwirren. Egal, ob er im Kreis der Gehöfte blieb, zu den vertrockneten Gärten oder gar an den Feldrand lief, das komische Schwirren verfolgte ihn. Es half auch nichts, wenn er die Finger in die Ohren steckte, er hörte es dauernd. Verärgert kletterte er schließlich auf das Strohdach seines Elternhauses und machte es sich direkt unter dem First in einer kleinen Senke gemütlich. Von hier aus hatte er einen prima Überblick über den Dorfplatz mit der Quellmulde. Was er dort sah, ließ ihn das schwirrende Etwas sofort vergessen.
Der Zauberer war wieder erschienen, in eine violette Robe mit schreiend gelben und grünen Federmustern gekleidet. Das musste wohl seine Zauberkleidung sein. Unter den einfach gekleideten, staubbedeckten Dorfbewohnern wirkte er wie ein Paradiesvogel, der sich verflogen hatte. Der Zauberer schritt geradewegs zur versiegten Quelle und befahl den Männern, ihm die große Kiste zu bringen, die auf dem Karren unter der Sitzbank stand.
Ganz unten aus der Kiste holte er vorsichtig einen rundlichen, vier Handspannen breiten Gegenstand hervor, der in ein dickes Tuch gewickelt war. Er schien irgendetwas zu murmeln, während er langsam das Tuch entfernte. Ein kollektiver Seufzer ging durch die Reihen. Dort, mitten im Dorf, lag eines der mächtigsten Zauberwerke, die Menschen erschaffen konnten: ein großer Spiegel!
Jokon fiel fast vom Dach. Sein Blick klebte förmlich an der glänzenden Scheibe, die schimmernde Reflexe von Sonnenlicht auf die schwarzen Haaren der Menschen und die roten Lehmwänden der Hütten warf. Er vergrub seine bebenden Hände im Stroh und klammerte sich krampfhaft fest.
Der Zauberer ging zu der ausgetrockneten Quelle und legte den Spiegel hinein.
Mit wohlklingender Stimme sang er einige Worte. Für Jokon klang es wie unverständliches Kauderwelsch, aber es musste wohl ein mächtiger Zauberspruch sein, denn gleich darauf begann sich die Oberfläche des Spiegels zu bewegen. Er reflektierte nicht länger den Himmel, sondern verfärbte sich zu einem sehr dunklen Blau, beinahe wie tiefes Wasser. Kaum hatte Jokon das gedacht, als auch schon die Oberfläche des Spiegels aufbrach und klares Wasser heraussprudelte. Schnell füllte es die Quellmulde und lief über. Nach einem Moment fassungslosen Staunens gerieten die Männer in hektische Bewegung. Sie fuchtelten herum, riefen durcheinander und rannten los, um Schaufeln zu holen. Im Nu hatten sie sich zu einer Gruppe organisiert und hoben eine Wasserrinne durch den trockenen Boden in Richtung der Felder aus, damit das kostbare Wasser nicht ungenutzt auf dem Dorfplatz versickerte. Die Frauen und älteren Kindern halfen mit Körben und Matten, die ausgehobene Erde wegzutragen. Der Zauberer stand mit verschränkten Armen da und sah ihnen mit einem sehr selbstzufriedenen Gesichtsausdruck zu.
Jokon kletterte vom Dach herunter und näherte sich zögernd der Quelle. Er sah vorsichtig hinein. Der Spiegel war verschwunden. An seiner Stelle gähnte ein wasserspeiendes Loch, das in die tiefsten Eingeweide der Erde zu führen schien.
Benommen trat er einen Schritt zurück und schloss die Augen. Das Plätschern der neuen Quelle klang plötzlich wie eine Drohung. Von Panik gepackt drehte er sich um und lief nach Hause. Niemand war dort, nur die blökende Ziege stand angepflockt in ihrer Ecke und schrie nach Wasser. Es gab ja wieder Wasser ... Jokon füllte den Rest aus dem Vorratskrug in die Trinkschale der Ziege. Dann setzte er sich neben sie, umarmte sie und begann, vor Furcht zu weinen.
Die dunstige Sonnenscheibe sank auf den Horizont. Der Zauberer, jetzt wieder in der braunen Reiserobe, verlangte seinen Preis. Die Dörfler gehorchten widerstrebend, versuchten, das Unvermeidliche hinauszuzögern. Aber keiner traute sich, seinen Beitrag zu unterschlagen. Alle brachten sie ihre Kinder zum Dorfplatz. Die kleineren wurden von ihren ängstlichen Müttern herbeigetragen, viele bereits eingewickelt in ihre Schlafmatten, die größeren wurden von den Vätern und älteren Geschwistern geholt.
Jokon sah auf, als sein Vater in der Hütte erschien. Seine Unterlippe zitterte, aber er gehorchte wortlos, als sein Vater ihm schroff befahl, mit zum Dorfplatz zu kommen. Der Vater schien genauso viel Angst zu haben wie er selbst. Draußen vor der Türe, noch im Sichtschutz der Hofmauern, drehte sein Vater sich um und umarmte ihn, plötzlich und heftig.
„Denk daran, Sohn, wir lieben dich, wir werden dich immer lieb haben, ganz gleich, was passiert. Sei stark. Was auch immer passiert, vergiss nie, unser Dorf wird jetzt wieder leben ...“ Er brach ab, in seinen Augen glitzerte es verdächtig.
Offenbar hatte sein Vater die gleiche dunkle Vorahnung wie er.
Beklommen folgte Jokon ihm zum Dorfplatz. Er stellte sich zu den anderen Kindern, die einen Kreis bildeten. Im Zentrum des Kreises stand der Zauberer. Um den Kreis der Kinder bildeten die Männer einen zweiten Kreis. Die Frauen standen in kleinen Grüppchen abseits. Keiner sagte ein Wort. Es war, als ob das Dorf den Atem anhielt.
Der Zauberer schritt den Innenkreis ab. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen, nickte, und zog eines der Kinder zu sich in die Mitte. Auch vor Jokon hielt er inne.
Jokon sah angestrengt auf den Boden. Zwischen seinen Schulterblättern tröpfelte Schweiß den Rücken hinab. Plötzlich fühlte er die Hand des Zauberers auf seiner Schulter. Er unterdrückte einen Schrei. Mit klopfendem Herzen sah er vorsichtig hoch. Das Gesicht des Zauberers war direkt über ihm. Die Augen glichen mattem, schwarzem Glas. Der Mund des Zauberers lächelte, aber seine Augen blieben kalt.
„Ja“, murmelte der Zauberer, „das ist gutes Material!“
Im nächsten Moment fand auch Jokon sich in der Mitte wieder.
Als die Inspektion abgeschlossen war, standen sieben Kinder im Kreis. Das heißt, sechs standen, eines lag. Der Zauberer hatte auch die erst fünf Monde alte Lira in den Kreis getragen. Liras Mutter hatte einmal kurz aufgeschrien. Sonst waren alle Dorfbewohner stumm geblieben.
„Ihr geht mit mir“, befahl der Zauberer und ging voran zu seinem Karren.
Die Dorfbewohner wichen vor ihm auseinander und bildeten eine Gasse. Jacitin, die mit ihren zwölf Regenzeiten die Älteste der Kindergruppe war, trug die kleine Lira. Zwischen den leeren Fässern bot der Karren Platz genug für sie alle. Dann schwang der Zauberer sich auf die Sitzbank und klatschte mit dem Zügel auf die Rücken der Ochsen. Mit versteinerten Mienen sahen Väter, Mütter und Geschwister zu, wie die sieben Kinder das Dorf verließen. Erst als der Wagen rumpelnd die Dorfgrenze unter dem Geisterbaum passierte, erhoben sich hinter ihnen Stimmen. Laute, klagende Stimmen, verzweifelte Rufe. Jokon brauchte einen Moment, bis er begriff, dass ihre Eltern die Totenklage angestimmt hatten. Vor Angst wie gelähmt saßen die Kinder zwischen den klappernden Wasserfässern und gaben keinen Laut von sich. Der Zauberer ließ die Peitsche auf den Rücken der schwarzen Ochsen tanzen und trällerte ein Liedchen.
Die Fahrt dauerte mehrere Stunden bis weit in die Nacht. Die Eltern hatten Jokon immer eingebläut, nach Anbruch der Dunkelheit im Haus zu bleiben. Zu groß war die Gefahr, draußen auf einen wandernden Geist zu stoßen. Dem Zauberer jedoch schien das nichts auszumachen. Er ließ mit einem Fingerschnalzen ein rundes Licht auf seiner Hand erscheinen. Auf seinen Befehl erhob sich das Licht und flog vor dem Wagen her, um den Weg zu beleuchten. Die Ochsen kannten das anscheinend, unbeirrt trotteten sie einfach weiter. Mit jeden ihrer Schritte tauchten kahle Bäume und Büsche im Lichtkegel kurz auf und verschwanden wieder wie winkende Schatten. Staub färbte die schmale Mondsichel blutrot. Ziegenmelker huschten über ihre Köpfe hinweg und stießen ihren meckernden Ruf aus. Die Geistervögel! Da konnten auch die Geister nicht weit sein! Jokon duckte sich ängstlich, seine Hand wanderte unwillkürlich zu Jacitin. Sie nahm sie und streichelte sie beruhigend.
Kurz vor dem höchsten Stand des Mondes erreichten sie das Anwesen des Zauberers. Wie ein riesiger schwarzer Hügel verdeckte es den Nachthimmel. Das Tor, das sich wie durch Geisterhand vor ihnen öffnete, war in eine wuchtige Steinmauer eingelassen. Die Ochsen steuerten geradewegs durch den Hof auf den hell erleuchteten Eingang eines großen Gebäudes zu. Staunend sah Jokon, dass sich nach rechts und links zwei endlos lange Flügel anschlossen. Am Ende des rechten Flügels thronte ein wuchtiger Turm. Er war größer als der Geisterbaum im Dorf.
Auch der Eingang des Hauses öffnete sich lautlos, aber hier waren es Menschenhände, die die Türflügel aufschoben. Der Zauberer ignorierte seine Diener, stieg wortlos vom Karren und verschwand im warmen Licht des Inneren. Die Kinder klammerten sich fest aneinander und rührten sich nicht, starr vor Angst, Müdigkeit und der Kälte der Nacht.
Einige Diener näherten sich dem Wagen. Eine energisch wirkende ältere Frau schwenkte befehlend einen langen Stock und gab ein paar knappe Kommandos. Die Diener schoben die Fässer zur Seite und brachten die Kinder durch gutes Zureden dazu, sich voneinander zu lösen. Jedes der Kinder wurde von kräftigen Armen vom Wagen gehoben und in die willkommene Wärme des Hauses getragen. Der ältere Mann, der Jokon trug, wurde von der energischen Frau Karados gerufen. Er erinnerte Jokon etwas an seinen Onkel Harg. Onkel Harg hatte auch so einen spitzen Bart und so eine Knollennase ... Der Mann trug ihn einen langen Flur entlang und schließlich in ein kleines Zimmer, wo ein gemütlich aussehendes Bett auf ihn wartete.
Aber noch gab es keine Ruhe. Der Mann lächelte schief, während er eine kleine Seitentür aufstieß und Jokon in den Nebenraum schob. Dort stand eine dampfende Badewanne, und in der Ecke befand sich ein kleiner Abort.
„Mach dich sauber von der Fahrt“, sagte der Mann nicht unfreundlich, „ich hole dir noch schnell etwas zu essen“.
Jokon erleichterte sich, dann stieg er in die Wanne, wo er, von der Wärme eingelullt, prompt nach wenigen Minuten einnickte. Sein schmaler Körper rutschte sofort tiefer in die Wanne. Mit dem nächsten Atemzug geriet Wasser in seine Nase und er schrak auf, völlig orientierungslos. Für einen Moment drehte sich sein Körper wie wild unter Wasser, während er vergeblich nach Luft suchte, dann packte eine feste Hand seinen Haarschopf und zog ihn hoch. Während er noch keuchend nach Luft japste und hustete, sagte der Mann gutmütig: „Na, Kleiner, war wohl gut, dass die Küche nicht weit ist! Du solltest noch etwas warten, bevor du übst, wie man unter Wasser atmet!“
Er half Jokon, sich abzuschrubben, verpasste ihm anschließend ein frisches Hemd und ließ ihn etwas warme Suppe essen.
Satt und völlig erschöpft ließ sich Jokon auf das breite, weiche Bett fallen und schlief auf der Stelle ein.
*
Prinz Ioro stolperte weinend zu seiner Mutter. Die Erste Konkubine kniete protokollgemäß nieder, um den kleinen Liebling seiner Majestät mit aller gebührenden Höflichkeit zu trösten.
„Mama“, schluchzte der Kleine, „Tolioro will mich nicht zu seinem Feldherren machen!“
„Weine nicht, Liebling! Feldherren dürfen nicht weinen! Tolioromehme wird dich zu seinem Feldherren machen müssen, so wie es die Tradition will. Nimm es ihm nicht übel, er ist noch zu klein, um die Tradition zu verstehen.“ Sie steckte Ioro eine kandierte Frucht in den Mund und trocknete seine Tränen mit dem gelbbestickten Seidenärmel ihres Gewandes. „Sieh nur, beim blauen Pavillon findet ein Pfauenkampf statt. Magst du einen Pfauen kommandieren?“
Schnell war die Kränkung vergessen. Der kleine Feldherr lief los, sich seinen Pfauensoldaten zu sichern. Miomio stemmte sich mit einem tiefen Atemzug am Geländer der Pergola hoch und streckte sich vorsichtig. Sie war hochschwanger und ihr schwerer Bauch machte ihr zu schaffen. Hoffentlich würde es wieder ein Sohn. Ihr königlicher Gemahl Kanata war in seinen ältesten Ioro sehr vernarrt, auch wenn der nie Thronerbe sein konnte. Tolioro dagegen ... der Erbe des Falkenthrons war schwächlich, spindeldürr und schien ein wenig dumm. Sie fächelte sich etwas Luft übers Gesicht. Dumm mochte gar nicht so schlecht sein. Dumme Könige brauchten kluge Berater. Und Feldherren.
Ein schriller Vogelschrei ertönte. Miomio blickte zum Himmel. Hoch oben über dem Palastgarten drehte ein Falke seine Kreise in der warmen Luft. Der Wappenvogel der königlichen Familie. Ein besseres Vorzeichen konnte es nicht geben. Miomio legte sich mit einem zufriedenen Lächeln wieder in die Hängematte, angelte nach einem weiteren Konfektstück und freute sich an der Pracht der Prunkreben, deren schwerer Duft von einem sanften Südwind durch den königlichen Garten getrieben wurde.
*
Jemand rannte mit klappernden Holzsandalen an der Zimmertür vorbei. Jokon schreckte hoch. Total verwirrt sah er sich im Zimmer um. Die Sonne strahlte durch ein kleines Fenster mit richtigen Glasscheiben auf das große Holzbett. Glasscheiben, was für ein Luxus! In der Ferne konnte er einen Falken sehen, der majestätisch seine Kreise zog. Sein Blick wanderte weiter. Neben dem Fenster stand ein großer schwerer Schrank, die Türen weit offen, und leer bis auf eine graue Robe. Jokon tastete über das ungewohnt weiche, dicke Deckbett über seinen Beinen. Wo war er? Was war das für ein Bett?
Dann fiel ihm alles wieder ein, der Spiegel, die Quelle, der Zauberer ... Für einen Moment krampfte sich sein Magen zusammen. Er vermisste seine Eltern. Er vermisste seine kleine Schwester Mia. Er vermisste sogar die stinkende Ziege!
Dann meldete sein Magen etwas anderes: Er vermisste Essen. Jokon stieg aus dem Bett. Die schwarzen Fußbodenfliesen fühlten sich sonnenwarm unter seinen nackten Füßen an. Da keine andere Kleidung zu sehen war, zog er die graue Robe aus dem Schrank über und öffnete dann vorsichtig die Zimmertür. Vor ihm lag ein hoher, langer Flur mit mehreren Fenstern auf der einen und ebenso vielen Türen auf der anderen Seite. Ganz hinten am rechten Ende bog der Gang nach links ab. Von dort kamen Stimmen, das Klappern von Töpfen, und nicht zuletzt der Duft von frisch gebackenem Brot. Sein Magen knurrte vernehmlich. Jokon zögerte nicht länger.
Hinter der Biegung mündete der Gang in einem großen Raum. Vorne standen mehrere Holztische mit langen Bänken, auf denen Kinder verschiedenen Alters saßen. Dahinter befand sich, nur durch einen weiten Durchgang getrennt, eine große Küche, in der mehrere Männer und Frauen geschäftig werkelten. Jokon sah, dass die Kinder und Jugendlichen an den Tischen immer in Gruppen mit gleicher Robenfarbe zusammensaßen. Gleich vorne rechts standen zwei Tische, an denen je ein gutes Dutzend Kinder mit grauen Roben saßen, dahinter zwei weitere, schwächer besetzte Tische mit grünen. Die meisten der Grüngekleideten schienen schon etwas älter zu sein. An einem der beiden Tische auf der linken Seite saßen elf Jugendliche in blauen Roben und an dem letzten Tisch drei rotgekleidete junge Erwachsene. Der älteste von ihnen, ein gut aussehender, lächelnder Mann von vielleicht zwanzig Regenzeiten, lehnte lässig mit dem Rücken an der Mauer. Die beiden weiter vorne, eine schmallippige Frau mit kalten Augen und ein deutlich jüngerer, noch bartloser Mann mit einer hellen Messernarbe auf der Wange, beugten sich interessiert über den Tisch und sahen Jokon an. Dieser letzte Tisch stand etwas von den anderen abgesondert, und die Kinder von den anderen Tischen versuchten offenbar, jeden Blickkontakt mit den drei Rotgekleideten zu vermeiden.
Ein dünner, schlaksiger Kerl mit einer Hakennase und strähnigem Haar, der nur wenig älter als er selbst sein konnte, sah vom ersten Tisch der grauen Roben hoch und winkte ihm zu. „Hallo, ein Neuer! Komm rüber zu uns!“
Jokon bewegte sich vorsichtig in Richtung auf den Tisch.
„He, ich beiß´ nicht!“ Der Junge grinste breit. „Ich bin Tevi, komme aus Kamiataneeri, und ich bin seit der letzten Regenzeit hier!“
Sein Grinsen wirkte ansteckend. Jokon lächelte zurück und stellte sich seinerseits vor. „Und ich bin Jokon, aus Maneetimai.“
Tevi klopfte einladend auf die Bank neben sich, und Jokon nahm schnell Platz. Der Tisch war reich gedeckt, frisches Brot, duftendes Öl, Scheiben von kaltem Braten und Käse. Das gab es in seinem Dorf nur zu Festzeiten. Jokon ließ sich nicht lange bitten und schaufelte das Essen nur so in sich hinein.
Noch während er aß, tauchten auch die anderen fünf Kinder aus seinem Dorf auf. Vier steuerten sofort zu Jokons Tisch. Dogon, der eine Regenzeit älter war und kräftige Muskeln hatte, schob einfach ein paar der fremden Kinder ein Stück weiter, um Platz zu schaffen. Aleti und Kabato setzten sich an Dogons linke Seite und die dreijährige Sacan kroch rechts so dicht wie möglich an ihn heran. Jacitin ging zum Nachbartisch, an dem eine ganze Seite frei war. Sie setzte sich so, dass sie größtmöglichen Abstand zu den anderen am Tisch hatte.
Jokon fiel auf, dass sie kaum etwas aß. Sie hatte verweinte Augen.
Nach dem Essen erschien die ältere Frau, die am Vorabend die anderen Diener kommandiert hatte, an ihrem Tisch und gebot Ruhe.
„Ihr seid neu“, sagte sie, „daher werde ich euch ein paar Regeln erklären. Der Zauberer, dem dieses Haus gehört, heißt Go. Ihr werdet ihn immer Meister Go nennen. In seinem Haus werdet ihr keinen Unfug machen, sondern brav lernen, jeden Tag. Ihr steht auf, sobald die Sonne in eure Zimmer scheint. Denkt daran, dass ihr euch wascht, und dass ihr immer saubere Sachen anziehen müsst. Dann kommt ihr hierher zum Frühstück. Nach dem Frühstück ist Unterricht, die Älteren werden euch zeigen, wo. Nach dem Unterricht habt ihr eine Pause, in der ihr machen könnt, was ihr wollt. Allerdings dürft ihr das Anwesen nicht verlassen. Ihr bleibt immer innerhalb der Mauern. Es gibt keinerlei Kontakte nach draußen, keine Briefe, keine Besuche. Lernt fleißig, macht kein dummes Zeug, und seid leise, damit Meister Go sich nicht gestört fühlt. Und geht auf keinen Fall auch nur in die Nähe des Turms. Nach der Krähenstunde ruft euch der Gong wieder zum Unterricht, der bis zum Sonnenuntergang dauert. Dann gibt es die große Mahlzeit, wieder hier. Und dann geht ihr schlafen.“
„Entschuldigt bitte“, quetschte Jokon zaghaft hervor, „aber was ist das für ein Unterricht?“
Sie schnob verächtlich durch die Nase. „Mal wieder Kinder vom Land!“
Noch während sie sich umdrehte, antwortete sie über die Schulter zurück: „Zauberunterricht, natürlich!“
Jokon fühlte sich wie vom Donner gerührt. Zauberunterricht? Sein Hilfe suchender Blick glitt den Tisch entlang. Seine Dorfgenossen sahen genauso verdutzt aus wie er, während die anderen Kinder breit grinsten. Tevi erbarmte sich ihrer.
„Das war Marade, die Haushälterin und Chefin der Diener. Wenn euch gutes Essen lieb ist, dann pariert ihr besser, wenn sie etwas sagt. Sie wirkt ein wenig schroff, aber sie hat ein weiches Herz. Wenn man ein bisschen jammert, kriegt man von ihr immer eine kandierte Frucht! Und das mit dem Unterricht stimmt. Was sonst sollte man im Haus eines Zauberers unterrichten, wenn nicht Zauberei!“
„Dann sollen wir Zauberer werden?“
Einen Moment glitt ein Schatten über Tevis Gesicht, dann zuckte er mit den Schultern. „Einige von uns werden sicher Zauberer. Nicht alle. Um genau zu sein, die meisten nicht. Hierher kommen alle, die Zaubertalent haben. Aber erst beim Unterricht kann man feststellen, wer von uns über genug Zauberkräfte verfügt. Und das kann dauern.“
„Können wir nach Hause zurück, wenn wir nicht zaubern lernen?“, fragte die kleine Sacan.
Tevis Blick wirkte mitleidig. „Nein, niemand kann nach Hause zurück. Wer Zaubertalent hat, und sei es auch nur ein bisschen, ist zu gefährlich für die Leute da draußen. Die keine Zauberer werden, bleiben als Diener hier. Wir werden unser Leben lang hier bleiben – hier oder im Haus eines anderen Zauberers. Manchmal tauschen sie Leute aus.“
Sacan begann zu weinen. „Ich will nicht hierbleiben, ich will nach Hause zu meiner Mama!“
Jacitin kam von dem anderen Tisch herüber und schloss die Kleine in ihre Arme. Sie wiegte sie wie ein Baby und summte dazu ein Wiegenlied. „Schon gut, kleine Schwester, schon gut. Wir sind bei dir, du bist nicht alleine, wir sind jetzt deine Familie!“
Jokon sah zu Tevi herüber. Der zuckte nur mit den Schultern. „Für eure Leute zu Hause seid ihr tot. Gewöhn´ dich lieber schnell daran. Euer Zuhause ist jetzt hier.“
Für einen Moment herrschte im ganzen Raum beklommene Stille. Dann schepperte ein Teller in der Küche, und das Stimmengewirr brandete wieder auf.
Die Schule war am anderen Ende des grauen Ganges, im Hauptflügel des Gebäudes. Zwei breite Steintreppen beherrschten das Blickfeld. Jokon bestaunte sie mit offenem Mund. Zu Hause benutzte man Leitern. Stufen hatte es nur an der Quelle gegeben, und selbst da gab es nur drei davon. Diese Stufen hier schienen unendlich in die Höhe zu wachsen. Er konnte zwei weitere Stockwerke erkennen, jedes davon mit einer breiten Tür in der Mitte zwischen den Treppen.
Tevi stupste ihn an. „Das kannst du dir heute Mittag ansehen. Jetzt ist erst mal Unterricht. Komm schon!“
Die in graue Roben gekleideten Kinder liefen zu der Tür im Erdgeschoss. Dahinter lag ein großer Saal mit hohen, lichtdurchfluteten Fenstern, durch die kein Wind kam. Beim näheren Hinsehen stellte Jokon erstaunt fest, dass auch diese Fenster mit Glas gefüllt waren. Der Zauberer musste unermesslich reich sein! Zu Hause hatte nur der kleine Tempel der Brennenden Göttin ein Glasfenster gehabt, direkt hinter der vergoldeten Sonnenscheibe, nicht größer als sechs Hände.
Der Raum war wie eine Arena geformt, mit einigen runden Sitzreihen um ein vertieft stehendes Pult in der Mitte. Einer der Grüngekleideten, ein hochgewachsener Jugendlicher mit Adlernase und langen, schlanken Fingern, war mitgekommen. Er stellte sich hinter das Pult und sah die Ränge empor. Dann winkte er den Neuen zu. „Setzt Euch nach vorne, dann könnt ihr mich besser verstehen. Und fragt, wenn ihr etwas wissen wollt. Ich bin übrigens Marte. Meine Spezialität sind Rufzauber.“
Marte demonstrierte umgehend seine Fähigkeiten. Er öffnete ein Fenster, hob einen kleinen Spiegel mit der linken Hand, ein Pfiff, und schon nach kurzer Zeit segelte eine Feldammer herein und setzte sich vertrauensvoll auf seine Schulter. Vögel fangen ohne Netz! Jokons Interesse war geweckt.
„Natürlich müsst ihr erst fleißig üben, bevor ihr mit einem Spiegel arbeiten dürft“, sagte Marte und holte etwas unter dem Pult hervor. „Ich habe hier ein paar Wasserschalen. Die benutzt ihr als Ersatz für den Spiegel. Setzt euch in Gruppen um die Schalen und versucht, den Vogel von meiner Hand zu euch zu rufen.“
„Schon wieder dasselbe!“, stöhnte Tevi genervt. „Immer diese blöden Vögel!“
Jokon sah vorsichtig zu Marte hinüber. Aber der ignorierte Tevis Meckern.
Bald saßen sie alle um die Schalen herum und konzentrierten sich.
Nichts passierte. Marte wiederholte seine Anweisungen wieder und wieder mit monotoner Stimme. Jokon konzentrierte sich, bis ihm der Schweiß auf der Stirn stand. Tevi nickte neben ihm ein. Die kleine Sacan kuschelte sich an Jacitin und verschlief ebenfalls den Unterricht. Der Vogel rührte sich nicht von Martes Hand weg.
Die nächste Stunde war auch nicht besser. Ein Mädchen in grüner Robe namens Dataree unterrichtete Bannzauber. Das schien nichts anderes zu sein als eine endlose Wiederholung völlig bedeutungsloser Wörtern. Angeblich sollte das die Rennraupen erstarren lassen, die jeder von ihnen jetzt in einem kleinen Kasten vor sich stehen hatte. Die Rennraupen zeigten sich nicht im Geringsten beeindruckt und hüpften munter weiter herum. Dataree schimpfte mit ihren Schülern, weil sie sich nicht konzentrierten und die Wörter immer wieder falsch sagten. Lediglich Aleti fand Gefallen an diesen Sprechübungen. Aber die hörte sich ohnehin gerne reden. Jokon war heilfroh, als die Grauen nach dem zweiten Unterrichtsfach in die Mittagspause entlassen wurden.
Endlich durfte er sich wieder bewegen. Was lag näher, als das Haus zu erkunden? Tevi hatte nichts dagegen, ihm ein paar Dinge zu erklären.
Vierzehn Grüne gab es, die den Grauen Unterricht gaben. Die Grünen wohnten in dem Flur über den Grauen. Sie wiederum erhielten Unterricht von den Blauen, im Unterrichtsraum im ersten Stock. Die Blauen, die wohnten unten im rechten Seitenflügel, dem, der zum Turm führte. Und ganz oben, im Stockwerk direkt unter dem Dach, bekamen die Blauen Unterricht von den Adepten. Das waren die drei Roten. Nur die Roten hatten das Privileg, im Turm von Meister Go selbst unterrichtet zu werden.
Auch die Roten wohnten im rechten Seitenflügel, im oberen Stockwerk. Jokon sah neugierig in ihren Flur. Er war lang, leer bis auf drei schmale Türen und doppelt so viele Fenster, und endete vor einer gemauerten Wand. War das alles? Jokon ging zwei Schritte in den Flur, um sich die Sache näher anzusehen. Tevi riss ihn zurück.
„Bist du bescheuert? Da kannst du nicht reingehen! Da dürfen wir nur hin, wenn wir von den Roten gerufen werden. Und glaub´ mir, das willst du ganz sicher nicht!“
„Warum nicht?“
„Sie machen komische Sachen mit uns. Zaubersachen. Es tut weh.“
Oh. Jokon zuckte zusammen. Offenbar hatten die erwachsenen Zauberer nichts Gutes mit ihren Schülern vor. Besser, man hielt sich von ihnen fern.
Fürs Erste war sein Erkundungsdrang gebremst. Den Rest der Mittagspause verbrachten sie im Hof und spielten.
So begann, was bald eintönige Routine werden sollte. Unterricht in Rufzaubern, Besprechungen, Beschwörungen, und notwendigerweise auch Lesen, Schreiben und Rechnen.
Der Glanz des Neuen verblasste schnell. Jokon hielt den meisten Unterricht für Zeitverschwendung. Trotz aller Theorie, die immer wieder erbarmungslos wiederholt wurde, lernten sie nie richtig zaubern. Keiner von ihnen schaffte mehr, als mit dem Rufzauber ein paar Mäuse ins Zimmer zu locken. Letzteres hätte er auch mit etwas Geduld und einer Portion Käse gekonnt, ganz ohne Zauber. Wozu also sollte das gut sein? Er hatte den Eindruck, dass die Grünen sich über die Grauen lustig machten und versuchten, den Unterricht absichtlich unverständlich zu halten.
Trotzdem bemühten sich alle Grauen, soviel wie möglich zu lernen. Der Unterricht war das Einzige, was die Langeweile in Schach hielt. Was hätten sie auch anderes tun sollen? Sie waren eingesperrt, obgleich die Torflügel den ganzen Tag weit offen standen und die Diener offenbar nach Belieben ein und aus gingen. Ein Zauber sperrte die Kinder ein, effektiver als jede Mauer.
Natürlich testeten sie ihre Grenzen. Auch Jokon. Er ging zuerst geradewegs auf das Tor zu. Das Tor schwirrte. Es klang wie eine Warnung. Im Torbogen hatte er das Gefühl, gegen ein großes Spinngewebe zu laufen. Mit jedem Fingerbreit, den er sich weiter nach draußen vorkämpfte, wurde der Widerstand größer. Das Schwirren in seinen Ohren steigerte sich zu einem ohrenbetäubenden Lärm. Die Luft fühlte sich wie dicker Sirup an. Er konnte kaum noch atmen. Schließlich gab er auf und wich wieder zurück. Zweimal versuchte er es noch. Aber auch beim schnellem Hinausrennen oder plötzlichem Um-die-Ecke-Biegen reagierte der Schutzzauber des Tors zuverlässig. Es gab kein Hinaus. Nicht aus dem Tor, nicht aus den Fenstern, nicht einmal von der Mauer. Überall umgab der unsichtbare Schild lückenlos den Besitz des Zauberers und schloss die Kinder sicher ein.
Neidisch sah Jokon den Dienern zu, wie sie zum Heumachen auszogen, Marades kleinen Kräuter- und Gemüsegarten draußen vor der Mauer versorgten oder mit geheimnisvollen Besorgungen die Ochsenkarren zum großen Tor heraus- und hereinfuhren.
„Quatsch, von wegen geheimnisvoll!“, meinte Tevi wegwerfend. „Die fahren nur zum nächsten Dorf, um Waren zu besorgen. Das ist ganz in der Nähe, du kannst den Ort oben von der Mauer sogar sehen!“
Er zeigte Jokon eine Stelle hinter der Küche, wo eine große Treppe zur Mauer hinaufführte. Die Mauerkrone war breit genug, dass sie darauf nebeneinander zum Tor laufen konnten. Von hier aus war das Ziel der Ochsenkarren gut zu erkennen: eine Ansammlung geduckter Hütten, deren Strohdächer kaum von den umgebenden trockenen Grashügeln zu unterscheiden waren. Nur der Rauch der Kochfeuer verriet die menschlichen Behausungen. Der Anblick erinnerte Jokon sofort an Zuhause. Er kämpfte mit den Tränen. Nein, er wollte seinem Vater keine Schande machen. Er würde nicht weinen.
Von da an mied Jokon das Tor. Lieber saß er im Schatten des Turmes auf der Nordmauer. Dort fiel das Gelände hinter dem Anwesen steil zu einer sanddurchsetzten, steinigen Ebene ab. Ein Paradies für Falken, die in der Thermik der Trockenfelder segelten. Jokon konnte sich an ihnen nicht satt sehen. Die Falken waren frei. In seinen Träumen segelte er mit ihnen davon.
*
Ioro sah sehnsüchtig aus dem Fenster. Ganz weit hinten über den Dächern des Sommerharems konnte er einen Vogel kreisen sehen. Wahrscheinlich war es nur wieder eine Krähe. Aber vielleicht war es auch ein Falke. Ja, ganz bestimmt, es musste ein Falke sein! Schließlich war der Falke sein Wappenvogel. Er würde unter dem Falkenbanner kämpfen, und er würde der größte Feldherr aller Zeiten werden! Wenn er doch bloß endlich aus dem Palast herausdürfte ...
Eine kräftige Hand legte sich auf seine Schulter. „Na, mein Sohn, was gibt es da Interessantes zu sehen?“
Ioro sah hoch. Sein Vater stand hinter ihm, groß und kräftig, auf seiner Brust das Falkenwappen des Hauses Mehme, den Kronreif in der dichten, schwarzen Mähne. Ioro zersprang fast vor Stolz. Sein Vater musste der schönste und beste König sein, den Karapak je gesehen hatte. So wie sein Vater wollte er auch einmal werden. Und sein Vater hatte alle seine Kriege gewonnen. Immer. Spontan platzte er heraus: „Kann ich nicht endlich anfangen, ein Feldherr zu sein? Ich möchte für dich in den Krieg ziehen!“
Kanata lachte und wuschelte ihm das Haar. „Kleiner Falke, noch nicht flügge, und schon so kriegerisch! Du wirst wohl noch etwas warten müssen.“
„Wie lange?“, verlangte Ioro zu wissen.
„Nun, lass´mich mal überlegen – ein paar Jahre Schule ... ein paar Jahre Waffen-Unterricht ...ein paar Jahre Politik ... ein paar Jahre in der Armee ... Ich denke, so in zwanzig bis dreißig Jahren bist du soweit!“
Ioro war entsetzt. „Dann bin ich alt, bevor ich kämpfen darf!“
Kanata warf den Kopf zurück und röhrte vor Lachen. „Bin ich alt?“, wollte er wissen. „Ich bin schließlich dreißig Jahre älter als du!“
„Oh nein!“, rief Ioro entsetzt, “Du bist nicht alt! So habe ich das nicht gemeint, ich ... Ich meine nur ... Dreißig Jahre, das ist so schrecklich lange ...“ Unsicher verstummte er und sah betreten zu Boden.
Kanatas griff mit der Hand unter sein Kinn und hob seinen Kopf behutsam. „Vielleicht ist es ja nicht ganz so lange“, schlug er mit einem gutmütigen Grinsen vor. „Du könntest ja einige Fächer gleichzeitig lernen.“
Ioro ruckte vor. „Ja? Das geht?“
„Wir werden deiner Mutter sagen, dass du ab morgen regelmäßig die Schule besuchst. Die Kadetten der Offiziersgarde werden sich freuen, ein neues Maskottchen zu haben.“
Ioro war sich nicht sicher, was sein Vater damit meinte, aber es konnte natürlich nur etwas Gutes sein. Deshalb strahlte er ihn glücklich an.
Miomio war weniger glücklich. Von jetzt an würde ihr Sohn ihr nicht mehr alleine gehören. Sie musste ihn nun mit dem Rest der Welt teilen. Aber sie hatte gewusst, dass dieser Tag kommen würde. Miomio verdrängte ihre Trauer und umarmte ihren Liebling. „Ioro, mein Schatz, ich freue mich so für dich!“ Dann verneigte sie sich vor Kanata. „Königlicher Gemahl, es freut mich sehr, dass Ihr unseren Sohn mit Eurer Gunst auszeichnet!“
Kanata winkte ab. Er nahm Ioros Hand. „Lass uns gleich mal einen Blick in die Schule werfen, Ich werde dich persönlich deinen Lehrern vorstellen.“
Ioro trottete glücklich mit ihm davon.
Miomio hob ihren Fächer. Niemand brauchte zu sehen, dass eine kleine Träne über ihre Wange rann. Ioros unbekümmerte Kindheit war zu Ende. Wie sie diese Tage vermissen würde!
*
Sacan vermisste ihre Mutter. Sie weinte vor Heimweh. Nicht draußen auf der Mauer, sondern abends, in ihrem Zimmer. Aleti und Jacitin setzten sich jede Nacht zu ihr und versuchten, sie zu trösten. Es dauerte volle zwei Monde, bevor Sacan aufhörte zu weinen.
Während des Unterrichts hockte sie neben Jacitin oder drückte sich wie ein verschüchtertes kleines Vögelchen in eine Ecke.
Marade steckte ihr beim Essen einmal eine extra Leckerei zu.
Der rotgekleideten Frau schien das nicht zu gefallen. Sie schimpfte mit Marade. „Du hast Besseres zu tun, als diese unnützen kleinen Dorfbälger zu verwöhnen!“
Marade hielt den Kopf gesenkt und sagte nichts. Die Rote umrundete langsam den Tisch der Grauen. Die Kinder versuchten, mucksmäuschenstill zu sein und sich nicht zu rühren. Dann kehrte die Rote an ihren Tisch zurück und unterhielt sich weiter mit den anderen beiden Adepten.
Sobald sie mittags im Hof waren, fragte Jokon Tevi über die Roten aus.
„Der gutaussehende Rote ist Nao“, erklärte Tevi. „Er ist der älteste der Adepten. Marade hat mal gesagt, der wäre einer der Besten, die Meister Go je ausgebildet hat. Der mit der Narbe ist Tur. Mach am besten einen großen Bogen um den! Er soll jemanden umgebracht haben, bevor er hierherkam. Die Stalldiener haben mir erzählt, dass Meister Go ihn vom Galgen freigekauft hat. Keine Ahnung, ob das wahr ist, aber zutrauen würde ich es ihm. Und stell dir vor, der hat noch nie einen längeren Namen gehabt!“
Jokon schauderte. Es gab in Karapak nur drei Sorten Menschen, die einen einsilbigen Namen bekamen: Zauberer, Sklaven und die Kinder von Prostituierten. Erstere wurden gefürchtet, letztere verachtet. Kein Wunder, dass niemand Tur mochte. „Und die Frau?“, fragte er.
„Das ist Kai, eine Schneidertochter aus Toolinemeeka, einem kleinen Ort nicht weit von hier. Sie soll früher ganz nett gewesen sein. Aber dann hat sie sich wohl in Nao verliebt, und der wollte nichts von ihr wissen. Danach hat sie sich mit Tur zusammengetan.“
„Du meinst, sie sind ein Liebespaar?“
„Nein, bestimmt nicht. Wer liebt schon so jemand wie Tur? Aber er hat ihr ein paar Sachen gezeigt, und sie hat entdeckt, dass sie einige Vorlieben teilen. Beiden macht es Spaß, anderen weh zu tun. Halt´ dich fern von ihnen und versuch, nicht aufzufallen. Graue, die den Roten auffallen, werden meist gleich zu ihnen gerufen. Es sind schon welche nie zurückgekommen.“
Das war das einzige Gespräch, dass Tevi über die Roten mit ihm führen wollte. Danach stellte er sich taub, wenn Jokon fragte. Niemand sprach über die Roten. Alle, die schon länger hier waren, schienen sie zu fürchten. Selbst die Diener versuchten, den Roten so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. Und auch sie waren nicht bereit, über die Roten zu reden.
Wenn irgend möglich redeten sie über den Meister noch weniger. Meister Go schien im Turm zu wohnen. Allerdings bekam man ihn kaum zu Gesicht, wenn er nicht gerade mal wieder von irgendeinem eiligen Boten fortgerufen wurde und den Hof mit seinem Ochsenkarren überquerte. Zu Hause trug Meister Go eine sonnengelbe Robe, aber wenn er fort fuhr, warf er immer die unscheinbare braune Reiserobe über.
Marade war die einzige unter den Dienern, die den Turm betrat und Meister Go mit Essen und anderen Dingen versorgte. Die anderen Diener versuchten die meiste Zeit, möglichst nicht einmal in die Nähe des Turmes zu kommen. Jeder schien den Meister zu fürchten. Selbst die Roten wurden in seiner Gegenwart ganz klein und zahm. Das schwirrende Geräusch umgab Meister Go wie eine schwingende Kugel und Jokon dröhnte der Schädel, wenn der Meister nahe an ihm vorbeikam. Auch die Adepten schienen von dem Schwirren eingehüllt zu sein, wenn auch weniger stark. Es musste wohl ein Anzeichen für starke Zauberkräfte sein.
Kurz bevor die nächste Regenzeit kam, wurde Jacitin krank. Sie hatte die meiste Zeit nur halbherzig am Unterricht teilgenommen. Dann hatte Meister Go sie einmal in den Turm gerufen. Meister Go rief die Kinder scheinbar willkürlich zu sich. Keiner wusste, nach welchen Kriterien er sie aussuchte. Aber jeder wurde irgendwann einmal zu ihm bestellt. Nach ihrem Turmbesuch hatte Jacitin überhaupt nicht mehr gelernt. Sie hatte nur noch am Fenster gesessen und in die Landschaft hinausgestarrt. Jacitin verfiel, Tag um Tag, sie wurde immer schmaler und schwächer.
Auch Dogon wurde krank, nachdem er im Turm gewesen war. Sein Körper gesundete schnell, aber sein Gedächtnis funktionierte danach nicht mehr so gut. Er hatte deutliche Schwierigkeiten, etwas Neues zu behalten. Jokon beobachtete das Geschehen argwöhnisch. Zwei weitere Graue gingen in den Turm und kamen krank zurück. Eines der Mädchen lag fünf Tage im Fieber und überlebte nur knapp. Aber nicht nur Graue, auch einer der Grünen erkrankte. Andere Kinder dagegen blieben nach ihrem Turmbesuch völlig gesund. Jokon fragte Tevi.
„In der letzten Regenzeit war das genauso. Da sind auch einige krank gewesen. Drei sind sogar gestorben. Und Zaraca war nach seiner Krankheit verrückt wie ein Tollbär. Sie mussten ihn nach Sawateenatari bringen, in das Asyl.“
„Ich kenne diese Art Krankheit nicht. So etwas hatten wir nicht in Maneetimai“, sagte Jokon traurig.
Die Diener schienen genauso zu fühlen wie er. Sie umsorgen und verwöhnten die kranken Kinder und bemühten sich, sie wieder aufzupäppeln.
Jacitin ging es immer schlechter. Schließlich lag sie nur noch in ihrem Bett. Jokon besuchte sie jeden Tag und erzählte von zu Hause, um sie etwas aufzuheitern. Erschrocken stellte er fest, dass ihm bereits viele Details entglitten waren. So viele Namen und Gesichter, an die er sich nur noch verschwommen erinnerte. Er versuchte angestrengt, das Puzzle seiner Vergangenheit wieder zusammenzusetzen. Dabei fiel ihm etwas ein, was er komplett vergessen hatte. „Jacitin, wo ist Lira geblieben?“, fragte er. Jacitin sah mit fiebrig glänzenden Augen auf. Ihre dünne, knochige Hand drückte sein Handgelenk schmerzhaft, während ihre rissigen Lippen versuchten, Worte zu formen. „Lira ist tot“, presste sie mit pfeifendem Atem heraus. „Sie war zu klein. Sie haben sie gleich verbraucht!“
„Verbraucht? Was meinst du damit?“
Jacitin waren die Augen zugefallen. Jokon schüttelte sie voller Panik. „Jacitin? Jacitin? Bitte, du musst mir sagen, was mit Lira passiert ist!“
Aber Jacitin hielt die Augen geschlossen und rührte sich nicht. Jokon wartete lange, ohne dass sie sich wieder regte. Dann schlich er auf Zehenspitzen zur Tür.