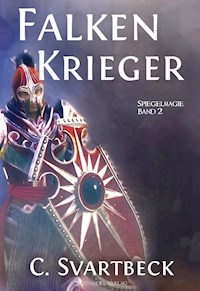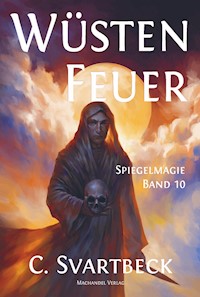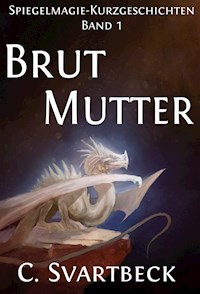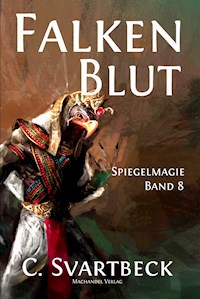Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Machandel Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Spiegelmagie
- Sprache: Deutsch
Nirgendwo sonst hätte ein Waisenknabe in der Armee Karriere machen können. In Karapak nicht, denn dort kommandiert nur der Adel. In den Grauen Schluchten nicht, denn die sind noch hochnäsiger. In Kirsitan nicht, denn da regieren die Frauen. In den Nordlanden nicht, denn die haben überhaupt keine Armee, da ist jedermann ein Krieger. Und in seiner alten Heimat Meelas nicht, denn … die gibt es nicht mehr. Steinfaust weiß, worauf er sich eingelassen hat. Wer in Narkassias Armee an die Spitze kommen will, muss mit allem kämpfen: Worte, Waffen und Verrat. Nur mit einem hat er nicht gerechnet: Dass ihm auch Magie in die Quere kommen könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Steinfaust
Die Welt des Königreichs Karapak
Sie können das Buch direkt zu lesen beginnen, ohne dass Sie deswegen die ganze Vorgeschichte kennen müssen. Falls es Sie aber doch interessiert: Zu dieser Welt gibt es bereits acht Bücher plus eine Kurzgeschichtensammlung. Näheres finden Sie im Anhang.
Soweit Sie zu bestimmten Dingen wie der Magie, Geschichte oder Völker dieser Welt nähere Informationen benötigen, finden Sie diese ebenfalls im Anhang des Buches.
Und da in diesem Buch von mehreren Staatsgebilden die Rede ist, dürfte Sie auch die Landkarte im Anhang interessieren.
Steinkind
1083 - Narkassia, beginnender Winter
Es gab eine Zeit vor den Steinen.
Eine Zeit, in der er eine Familie gehabt hatte, eine Heimat, ein Zuhause.
Eine Zeit vor den weißgesichtigen Ungeheuern.
Freundlich waren sie gewesen, oh ja. Hatten sich zu den Ältesten gesetzt, Brot und Wasser mit ihnen geteilt und dann über die Frostgeister geredet. Darüber, dass Meelas Schutz brauchte, mehr Schutz, als Mauern und Feuer und Schwert ihnen bieten konnten. Die Ältesten hatten zugestimmt.
Wie konnte jemand ehrlich sein und gleichzeitig lügen? Damals hatte er es nicht begriffen, heute schon. Heute beherrschte er selbst diese Kunst.
Helfen wollten sie Meelas, hatten die Weißgesichtigen gesagt. Schutz vor den Frostgeistern sollte das Land finden. Natürlich, dieser Schutz würde Opfer fordern, am meisten von denen, die weit außen, am Rand des Landes, ihre Dörfer hatten, aber die waren es ja auch, die ohnehin schon die Hauptlast der Abwehr gegen die Frostgeister trugen.
Die Ältesten hatten genickt. Und die Laren hatten gelächelt.
Noch heute packte ihn Schrecken, wenn er an dieses Lächeln dachte. Noch heute sah er es in seinen Alpträumen. Nicht mehr so häufig wie früher, aber häufig genug.
Damals … damals war er geflohen. Dieses Lächeln war ihm zu unheimlich gewesen. Seine Mutter hatte noch hinter ihm hergerufen. „Bleib, du dummer Junge!“, hatte sie ihn gescholten, aber sie war ihm nicht nachgekommen, und auch kein anderer, denn es war Sommer, die Frostgeister waren weit fort in den Eisbergen, die Hornziegen sorgten dafür, dass die Raubtiere dem Dorf fernblieben und so wusste sie, dass für ihn keine Gefahr bestand.
Genau zu diesen Ziegen war er gelaufen, hatte sich in der Herde versteckt, war mit ihnen am Abend zum Grat aufgestiegen, weit hinauf, wie die Hornziegen es liebten.
Die Hirten hatten den umgekehrten Weg gewählt, waren hinab ins Dorf gegangen, die unerwarteten Gäste zu feiern.
Sie waren in den Tod gegangen.
Nein, in etwas, das schlimmer war als der Tod. Er erinnerte sich. Gelächter war dort unten im Tal zu hören gewesen, er hatte die Menschen, klein wie Spielzeug in der Entfernung, zwischen den Hütten gehen sehen, einige der jungen Männer und Frauen hatten sich zum Tanz um das Festfeuer eingefunden. Lieder hatte er gehört und er war kurz davor gewesen, seinem knurrenden Magen mehr Glauben zu schenken als seinem Instinkt.
Und dann waren die Lieder verstummt.
Er hatte niemanden mehr gesehen.
Das Feuer war langsam heruntergebrannt, ohne dass jemand kam, Holz nachzulegen.
Sein Herz hatte sich angefühlt wie ein Klumpen Eis, als nach und nach auch die Rauchfahnen aus den Schornsteinen der Häuser vor dem sternhellen Nachthimmel erloschen. Die Kochfeuer gingen niemals aus. Nie!
Dann ging die Sonne auf. Die zwei Weißgesichtigen kamen aus dem Haus des Dorfvorstehers und gingen bedächtig auf ihren kurzen, dicken Beinen Richtung Hochtal, Richtung Hauptstadt.
Es gab noch anderes Leben im Dorf. Er konnte das gefleckte Fell von dem großen Hütehund des Dorfvorstehers ausmachen. Der Hund umkreiste das Haus, wagte sich aber nicht hinein.
Er war hinuntergeklettert, langsam, um seiner Welt Zeit zu geben, wieder normal zu werden.
Aber das wurde sie nicht.
Da war niemand in dem Dorf. Stattdessen … Steine. Vierkantige, graue Steine, halb so groß wie er selbst. Um die kalte Feuerstelle, in den Häusern.
Er war zurückgewichen, langsam erst, dann fast rennend. Der gefleckte Hund war ihm gefolgt.
Auf halbem Weg zwischen den Ziegen und dem Dorf hatte er den Rest des Tages gewartet. Mit knurrendem Magen und brennendem Durst und soviel Angst, dass er den Hund krampfhaft festhielt und nicht von seiner Seite ließ.
Dann war die Sonne untergegangen. Etwas hatte sich bewegt im Dorf. Einen Moment hatte er gedacht, sie sind zurück, alles ist wieder gut. Dann sah er, dass es nur die Steine waren. Sie glitten durch Geröll und Gras wie Schnecken über Gemüseblätter. Der erste kam unweit von ihm zum Stehen. Die anderen verteilten sich nach links und rechts, in ungefähr gleichen Abständen.
Da war es ihm eingefallen. Die Weißgesichtigen hatten davon gesprochen, eine Art Schutzzaun gegen die Frostgeister zu errichten. Und davon, dass das Dorf einen Preis zahlen würde. Zum Wohl des ganzen Landes.
Steine. Sie waren alle zu Steinen geworden. Seine Eltern. Seine Geschwister. Seine Nachbarn. Deren Kinder. Die Ältesten. Alle.
Er hatte sich übergeben. Es war nichts in seinem Magen gewesen, aber er hatte gewürgt, bis die bittere Galle herauskam.
Dann war er davongestolpert. In der Nacht, nur mit dem Hund an seiner Seite. Fort, weg von dem Dorf, weg von dem Hochtal, aus dem die Teiggesichter gekommen waren.
Der alte Mann starrte blicklos in die Nacht.
Die Schneeflocken tanzten um ihn herum. Er rührte sich nicht. Hier in Narkassia war der Schnee harmlos. Hier gab es keine Frostgeister.
Im Nordland
Sechzig Jahre früher (Sommer 1023)
Hätten ihn nicht zu Anfang noch einige der Ziegen begleitet, er wäre verhungert. So hatte er Milch, und er gab auch dem Hund davon ab.
Aber vor fünf Tagen waren die Ziegen verschwunden. Wahrscheinlich wollten sie zurück zu ihrer Herde. Und der Hund lag jetzt tot zu seinen Füßen, einen Pfeil zwischen den knochigen Rippen in seinem abgemagerten Leib.
Einen Pfeil wie der, den der fremde Krieger gerade auf seinen Bogen gelegt hatte.
Er rührte sich nicht. Mochte der Fremde ihn töten. Das war ihm auch schon egal.
Wenigstens würde ihn hier niemand zu Stein verwandeln.
„Was willst du hier? Wo sind deine Leute?“
Die Frage des fremden Kriegers klang holprig, als wäre ihm die Sprache von Meelas nicht vertraut.
„Meine Leute sind tot.“
„Warum bist du dann in unsere Richtung geflohen und nicht dorthin, wo mehr von euch leben?“
„Da ist es nicht sicher.“
„Nicht sicher?“ Der Krieger ließ verblüfft den Bogen sinken. „Mitten zwischen denen von deinem Volk?“
„Es sind Fremde gekommen.“ Der Junge konnte nicht verhindern, dass Bitterkeit in seine Stimme kroch. „Fremde, die uns Schutz versprachen. Aber dieser Schutz vernichtet uns. Mein Dorf … meine Eltern … Es hat nur eine einzige Nacht gedauert.“
Der Krieger steckte den Pfeil wieder in den Köcher. Der Junge musterte ihn misstrauisch. „Willst du mich nicht töten?“
„Wozu? Ein Junge alleine ist keine Gefahr.“
„Aber … du hast doch auch meinen Hund getötet!“
„Dein Hund wollte mein Fleisch rauben.“
„Er hatte nur Hunger.“
„Er hat mich angegriffen, als ich ihn davon abhalten wollte. Jeder, der mich angreift, stirbt. Interessiert mich nicht, warum.“
Einen Moment spielte der Junge mit dem Gedanken, es seinem Hund gleichzutun. Ein Pfeil, ein kurzer Schmerz, und alles wäre vorüber. Aber wenn der Krieger seinen Körper dann hier einfach liegen ließ, dann musste sein Geist für alle Zeiten im Wind umherirren. Und der Wind … der Wind würde ihn vielleicht zurückwehen nach Meelas. Dorthin, wo die Steine warteten.
Nein.
Das auf keinen Fall.
„Und jetzt?“, fragte er zögernd.
„Du kannst mit mir kommen. Für kurze Zeit. Mein Winterhaus ist voll genug, ich brauche keine fremden Jungen an meinem Winterfeuer, aber noch ist Sommer, da kannst du mein Gast sein, vorerst. Wenn die Händler kommen, wirst du mit ihnen weiterziehen.“
Der Junge überlegte erneut. Aber er wusste, er hatte keine andere Option. Entweder das oder der Tod. Durch den Pfeil oder durch Verhungern. In mehreren Tagesmärschen Umkreis gab es keine Siedlung. Niemand siedelte freiwillig in den Grenzbergen.
„Ich komme mit dir.“
Der Krieger nickte. Er griff nach dem Beutel, der neben ihm am Boden lag, den, auf den der Hund zugestürzt war, als er den Geruch in die Nase kriegte, öffnete ihn, holte einen verdrehten, dunkelbraunen, zwei Hände langen Streifen heraus und warf ihn dem Jungen zu. „Ich nehme nicht an, dass du deinen eigenen Hund essen willst.“
Der Junge antwortete nicht. Es war ja nicht sein Hund.
Er kaute das zähe Fleisch, langsam und systematisch, während er zusah, wie der Krieger dem Hund das Fell abzog, ihn ausweidete und dann die brauchbaren Fleischteile aus dem Kadaver löste und in das Fell einschlug.
„Das räuchern wir heute Abend über dem Feuer.“ Der Krieger streifte seine Hände am Gras ab und erhob sich. „Komm, Junge.“
Der Junge trottete hinter dem Mann her.
Der Mann sah kurz zurück. „Du wirst unsere Sprache lernen müssen. Unter den Sippen, die weiter weg leben, kennt kaum einer die Sprache von Meelas. Wie heißt du überhaupt?“
Der Junge dachte an seine Eltern, die zu Stein geworden waren.
„Steinkind.“
„Dreckiger kleiner Zwerg!“
Wokas Sohn Kara trat nach Steinkind. Der krabbelte hastig außer Reichweite und richtete sich wieder auf, die Fäuste geballt. Feindselig funkelte er Kara an.
Der Nordländer hatte die Hand auf dem Dolchgriff. „Dich konnte man echt besser ertragen, als du unsere Sprache noch nicht kanntest. Wärst du nicht Gast im Hause meines Vaters, würde ich dich jetzt in Stücke schneiden, du Stück Bergmist!“
Steinkind hob die Faust. „Vielleicht versuchst du es lieber noch einmal mit einem ehrlichen Wettstreit?“
„Mit dir? Was ist ehrlich daran, sich mit einer Laus zu messen? Ich verpasse dir lieber eine zweite Tracht Prügel.“
So eine wie die, der Steinkind gerade seine gebrochene, blutende Nase zu verdanken hatte. Er zog den Kopf zwischen die Schultern, blieb aber trotzig stehen. „Versuchs doch!“
Kara wollte gerade wieder auf ihn losgehen, als seine Mutter ihn am Arm packte.
„Hör auf damit, du Dummkopf. In diesem Kampf liegt keine Ehre!“
„Aber er hat mich beleidigt!“
„Na und? Er ist ein Kind, kaum halb so alt und halb so groß wie du. Du dagegen wirst im nächsten Sommer bereits ein Mann sein. Was kümmern dich die Worte eines Kindes?“
„Ein Kind?“ Kara sah erst verblüfft, dann betroffen von seiner Mutter zu Steinkind. „Er benimmt sich nicht wie eines. Er redet nicht wie eines. Ich hielt ihn für viel älter. Nur eben … klein.“
„Kinder, die ihre Eltern verlieren, müssen schnell erwachsen sein.“ Karas Mutter klang, als ob sie aus Erfahrung sprach. Brüsk drehte sie sich um und ging wieder zu ihrem Webstuhl.
Kara musterte den ungebetenen Gast am Feuer seines Vaters. „Bist du wirklich … Ich meine, wie alt bist du?“
Steinkind sah keinen Grund, Tatsachen zu verschweigen. „Sieben Winter.“
„Sieben!“ Einen Moment schien Kara mit sich selbst zu ringen. Dann trat ein breites Grinsen auf seine Züge. „Für jemand, der erst sieben ist, hast du schon einen verdammt guten Schlag am Leib.“ Er streckte seine Hand aus. „Frieden?“
Steinkind dachte daran, dass er noch einen ganzen Herbst hier verbringen würde. „Frieden.“ Er schlug in Karas Hand ein.
Danach war es tatsächlich um vieles leichter. Natürlich blieb ihm immer bewusst, dass es nur ein Heim auf Zeit war, dass Wokas Volk nie sein Volk werden konnte. Aber jetzt hatte er jemanden an seiner Seite, der ihn vielleicht nicht sonderlich mochte, ihn aber dennoch wie ein älterer Bruder unter seine Fittiche nahm, beschützte und ihn Dinge lehrte.
Wie das Bogenschießen. Und was ein Krieger sonst brauchen mochte. Steinkind lernte, so schnell er konnte. Wahrscheinlich würde er dieses Wissen brauchen. Und er war sich keineswegs sicher, ob er bei den Händlern Ähnliches lernen würde.
„Morgen ziehen wir ins Winterlager.“
Steinkind sah verwundert, wie fröhlich die Sippe Wokas Ankündigung aufnahm. „Was ist so besonders an dem Winterlager?“, fragte er vorsichtig.
Kara grinste und wuschelte ihm in einem Anflug von Gutmütigkeit die Haare. „Da kommen die Händler. Sie sind lustig. Der große Hagere, der sie anführt, kann gut erzählen und weiß immer eine Menge Neuigkeiten. Und außerdem, sie haben schöne Sachen.“ Ein verträumter Ausdruck trat in seine Augen. „Vielleicht hat er ja dieses Mal wieder Flöten dabei. Seine klingen immer besonders weich.“
Steinkind starrte Kara verdutzt an. Flöten? Kara, der größte Raufbold der ganzen Sippe, wollte eine Flöte?
„Was … machst du mit einer Flöte?“
„Na was schon! Lieder flöten, natürlich. Im Winterlager sind noch andere Sippen. Enko lagert mit uns, und Enko hat eine wunderschöne Tochter. Birga heißt sie. Sie ist schlank und geschmeidig wie eine Weide und ihre Zöpfe schimmern wie Rabenfedern. Du müsstest sie sehen, wenn sie tanzt! Dieses Jahr bin ich alt genug, dass ich um sie werben darf. Wenn ihr mein Lied gefällt, wird sie es singen, dann weiß ich, dass sie zusagt.“
Kara ging also auf Freiersfüßen! Das erklärte einiges. Wenn auch nicht alles. „Du bist doch erst dreizehn Winter alt. Darfst du trotzdem schon heiraten?“
„Ja. Beinahe.“ Karas Enthusiasmus verflog so schnell, wie er gekommen war. Jetzt sah er sehr ernst aus. „Zuerst muss ich mich als Mann beweisen.“
„Womit?“
„Entweder ich erlege einen Bären oder einen Vielfraß.“
„Das muss jeder von euch tun, bevor er ein Mann ist?“
„Entweder das, oder man muss im Kampf große Tapferkeit gezeigt oder einen Gegner getötet haben. Aber zur Zeit ist keine Blutfehde und der Ard hat verboten, dass wir Raubzüge nach Narkassia oder Karapak machen. Hat etwas mit seinem Schamanen zu tun, glaube ich. Der soll gesagt haben, der Ard würde noch froh sein um jeden überlebenden Krieger, den er hat, und das in nicht allzu ferner Zeit.“
Das klang übel. Steinkind dachte an die Berge. An die Steine. In diesem Moment wusste er, dass auf keinen Fall bei Wokas Volk bleiben wollte.
Das Winterlager war laut und eng. Statt der bunten Zelte wohnten Wokas Leute nun in festen, langen Steinhäusern, die halb in der Erde vergraben schienen und auf deren mit Erdsoden gedeckten Dächern Gras wuchs. Alle Familien einer Sippe drängten sich im gleichen Haus zusammen, und mit ihnen die Hunde und die Ponys. Dazu kam die ständig verräucherte Luft, denn diese Häuser hatten keinen Kamin. Steinkind war froh, dass es noch warm genug war, um draußen zu schlafen.
Und er war noch froher, als die Händler noch vor dem ersten Frost eintrafen.
Die Händler sahen merkwürdig aus. Das lag nicht nur an ihren kurzgeschnittenen Haaren oder den zu zwei Zöpfen geflochtenen Bärten, deren Länge und Verzierungen anscheinend mit ihrem Rang zu tun hatte. Steinkind brauchte eine Weile, bis er kapierte, was ihn störte. Es waren die Farben. Alles, was die Händler trugen, war entweder orange oder braun gemischt mit orange. Und diejenigen in ihrer Gruppe, die von sich behauptete, keine Händler zu sein, trugen nur braun.
Kara bekam seine Flöte. Sie war aus einem merkwürdigen, fast roten Holz geschnitzt, das irgendwie aromatisch roch. Kara bezahlte mit drei Fuchsfellen dafür. Sowohl der Händler als auch Kara wirkten mit dem Geschäft ausgesprochen zufrieden. Steinkind war neugierig, wie die Flöte klingen würde.
„Hey, Junge, komm her!“ Wokas winkte ungeduldig. „Nun mach schon!“
Steinkind ging verwundert zu ihm. Der große Nordmann packte ihn an den Schultern, drehte ihn mit dem Gesicht zu dem Anführer der Händler, dessen zwei Bartzöpfe steif abstanden vor lauter eingeflochtenen Bändern und Holzperlen, und schob ihn einen Schritt nach vorne. „Das ist er. Klein, nicht besonders stark, aber er kann gut mit Ponys und Hunden umgehen und er lernt schnell eine neue Sprache.“
Der Händler starrte auf Steinkind herab und runzelte die Stirn. „Der ist wirklich noch sehr klein.“
„Aber zäh. Immerhin ist er alleine von Meelas über die Berge zu uns gekommen.“
„Hm.“ Der Händler hockte sich hin. Jetzt war sein Gesicht auf Augenhöhe. „Mach mal den Mund auf, Junge.“
Steinkind gehorchte verdutzt.
„Scheint gesund zu sein“, murmelte der Händler. „Heile Zähne, kein unschöner Atem.“ Er erhob sich wieder. „Was hat dein Vater gearbeitet, Junge?“
Steinkind dachte zurück an … nein, lieber nicht. „Wir hatten Ziegen“, gab er kurz angebunden zurück.
„Also ein Hirte.“
Sein Vater war ein Bauer gewesen, der nebenbei auch einige Ziegen gehalten hatte. Aber Steinkind schwieg. Diesen merkwürdigen Mann würde er ganz bestimmt nichts über seine Familie erzählen.
„Viel wert ist er nicht. Einen Beutel blaues Farbpulver.“
„Zwei Beutel!“
„Viel zu viel. Bis der richtig arbeiten kann, muss ich ihn noch mindestens drei Winter durchfüttern.“
„Dann einen Beutel blaues und ein Beutel rotes Pulver.“
„Ein Beutel blaues und ein kleiner Beutel rotes.“
„Einverstanden.“
Die Männer schüttelten sich über Steinkinds Kopf die Hände. Dann packte der braun gekleidete Gehilfe des Händlers ihn am Kragen und zog ihn weg, fort zum Lagerplatz der Händler. Steinkind begriff, dass er soeben verkauft worden war.
Der Gehilfe des Händlers kannte nur wenige Worte der Nordmannsprache. Es brauchte ein wenig Zeit, bis Steinkind begriff, dass er seine Tunika ausziehen sollte. Der Mann zog sein Messer und machte sich umgehen daran, alle bunten Bänder und Verzierungen abzutrennen. Die Tunika war ein abgelegtes Teil von Karas jüngstem Bruder gewesen. Sie mochte ja nicht besonders schön gewesen sein, aber ohne diese Verzierungen wirkte sie jetzt geradezu ärmlich. Die Prozedur dauerte, denn der Mann arbeitete gewissenhaft, ließ kein bisschen Farbe zurück. Steinkinds Zähne klapperten vor Kälte, als er sie endlich wieder anziehen konnte. „Warum?“, brachte er schließlich hervor.
„Du … wie ich“, erklärte der Mann, nahm dann die Hände zur Hilfe und deutete auf die Ponys. „Diese … du hilfst. Wie ich. Wir … nur dieses.“ Er deutete auf seine eigene Kleidung, die ziemlich nichtssagende graubraune Töne zeigte.
Steinkind begriff, dass er, ebenso wie dieser Mann, für die Ponys sorgen sollte und ganz offensichtlich keine bunten Farben dabei tragen durfte. Warum auch immer.
Es gab keinen Abschied von Wokas oder seiner Sippe. Die Händler brachen am nächsten Morgen in Richtung Westen auf, und Steinkind ging mit ihnen.
Narkassia
Winter 1023
Fünf weitere Winterlager besuchten sie. Als der erste Schnee fiel, wandten sich die Händler nach Südwesten, die Ponys schwer bepackt mit Fellen.
Zwei Doppelhände an Tagen später erspähte Steinkind über den Baumwipfeln eines fernen Hügels ein kastenförmiges Gebilde. Das Gebilde entpuppte sich beim Näherkommen als kleines, von doppelt mannhohen Palisaden umgebenes Fort mit Aussichtsturm. Die Händler ritten ganz selbstverständlich auf dieses Fort zu.
„Die Grenze“, erklärte einer der Diener, der seinen fragenden Blick bemerkte. „Hier müssen wir dem Shorok unseren Zoll zahlen.“
Shorok, das bedeutete hoher Berg. Steinkind war perplex. „Wir müssen einem Berg etwas bezahlen?“
Der Mann schüttelte ungehalten den Kopf. „Der Hohe Berg ist ein Titel. So nennt man den Herrscher über ganz Narkassia.“
Ein Mann beherrschte also dieses Land. Steinkind wusste, was seine Mutter dazu gesagt hätte. „Die anderen Völker sind verrückt. Legen ihre Geschicke in die Hände der Männer. Da kann ja nichts Gutes bei herauskommen.“
Seine Mutter … Die Herrschaft der Frauen hatte Meelas nicht vor den Weißgesichtigen schützen können. Steinkind schluckte den Kloß herunter, der seinen Hals zu blockieren drohte, und kämpfte die Erinnerung an zu Hause nieder.
Die in dem Fort waren ausschließlich Männer. Soldaten, wie man ihm sagte. Männer, die sich durch zwei Dinge auszeichneten: Sie sahen alle gleich aus in ihrer schwarzen Kleidung und den kurz gestutzten Haaren und Bärten, und sie waren überaus gründlich und effizient. Jedes einzelne erhandelte Fell trugen sie in Listen ein, und auch Steinkind kam in diese Listen. Dann mussten die Händler bezahlen, mit kleinen ovalen Metallscheiben, die sie als Silberlinge bezeichneten.
Und keine zwei Kerzen später waren sie schon wieder unterwegs.
Narkassia war deutlich dichter besiedelt als das Land der Nordmänner. Und die Leute hier lebten in festen Häusern aus Holz und Stein, wie in Meelas. Die Häuser allerdings sahen anders aus. Dächer, die bereits in Schulterhöhe begannen und steil nach oben ragten, Balken, auf die merkwürdige Zeichen gepinselt worden waren. Sprüche, Gebete, wie man ihm erklärte. Aber kein einziges Haus war bunt bemalt oder hatte geschnitzte Verzierungen. Und die vorherrschende Kleidung war braun oder grün. In allen Schattierungen, aber eben nur das. Ganz selten, dass ein Mann oder eine Frau ein paar Farbtupfer in dunkelrot zeigte, noch seltener, dass es ein richtig kräftiges Rot war.
Erst in einer kleinen Stadt sah Steinkind andere Farben. Männer, die wie der Händler, der ihn gekauft hatte, orange Verzierungen auf ihrer braunen Kleidung trugen und offenbar ebenfalls Händler waren, einen rot gekleideten Schmied und einen Mann, der seinen Werkzeugen nach ein Zimmermann war, und dessen Kleidung intensiv rot und grün leuchtete.
Warg, der älteste der Sklavendiener, der ihn unterwegs in der Sprache Narkassias unterrichtet hatte, erklärte es ihm, als er ihm neue, dunkelgraue narkassianische Kleidung gab. Die Kleidung zeigte die Kaste. Jedermann wurde in eine Kaste hineingeboren und durfte sein Leben lang nur die Farben tragen, die seine Kaste ihm erlaubte. Dunkelgrau war die Farbe der niedrigsten Kaste, der Sklaven und der Strafgefangenen.
Steinkind spürte Wut in sich aufsteigen. „Heißt das, ich werde für immer ein Sklave sein und nichts als dieses trübe Grau tragen dürfen?“
„Unser Herr könnte dich freilassen. Oder du könntest dich freikaufen, wenn du genügend Silberlinge zusammenkriegst.“
„Du hast das nicht getan.“
Warg zuckte mit den Achseln. „Unser Herr hat noch nie jemanden freigelassen. Und für einen Freikauf braucht man zwölf Silberlinge. Ich habe erst acht. Sklaven werden selten für ihre Arbeit belohnt.“
Steinkind biss sich auf die Lippen. Verfluchte Götter! Hatten sie ihn nur vor den Weißgesichtigen gerettet, um ihn hier als Sklaven enden zu lassen? Einen Moment tat es ihm richtiggehend leid, dass Wokas damals nur den Hund erschossen hatte.
Sklaven hatten wenig Rechte, dafür aber umso mehr Pflichten.
Zu Hause, und später bei den Nordmännern ebenfalls, hatte es Spaß gemacht, die Herden zu hüten, die kleinen Kräutergärten zu jäten oder Wildfrüchte zu sammeln. Da hatten sich alle an der Arbeit beteiligt und dabei gelacht und gescherzt. In Narkassia schien es verpönt, zu lachen. Kinder taten es. Erwachsene nicht, und Sklaven erst recht nicht. Und Steinkind merkte sehr schnell, warum. Das erste Mal, als er seine zugewiesene Arbeit am Abend nicht geschafft hatte, bekam er einen scharfen Tadel zu hören und kein Essen. Beim zweiten Mal packte ihn der mürrische Kerl, der die Arbeiten für die Sklaven einteilte, band seine Hände mit einem langen Strick zusammen und schleppte ihn ganz hinten in den Hof zu einem großen, hohen, säulenartigen Stein mit einem Loch an der Spitze. Steinkind sah den Stein und erstarrte vor Angst. Der Mann zog den Strick durch das Loch, bis Steinkind fast daran hing, und band ihn irgendwo dahinter fest. Dann nahm er eine Peitsche und schlug zu.
„Du darfst nicht so laut schreien.“ Warg tupfte sanft mit dem nassen Tuch über Steinkinds Schultern. Der Junge spürte, wie ein Splitter der Holzbank sich schmerzlich in seinen Oberschenkel presste, aber er traute sich nicht, sich zu rühren. Jede Bewegung schmerzte höllisch. „Unser Herr mag kein lautes Gebrüll. Meist gibt er Befehl, denjenigen, die laut brüllen, ein paar extra Hiebe zu verpassen.“
„Aber…“ Steinkind konnte die Worte kaum aus seiner wunden Kehle pressen. „Warum? Was habe ich Verbotenes gemacht?“
„Nichts Verbotenes. Nur zu wenig. Du hattest den Auftrag, die Stallboxen auszumisten. Aber es waren immer noch vier dreckige Boxen da am Abend.“
„Ich konnte es aber doch nicht schneller! Die Boxen sind tief und der Mist ganz unten war so hart …“
„Kleiner Dummkopf!“ Wargs Stimme hörte sich halb mitleidig, halb belustigt an. „Was glaubst du denn, weshalb der Mist ganz unten so hart ist? Weil ihn nie jemand herausholt! Niemand schafft das, wenn er alle Boxen bis zum Abend fertig haben will. Mach oben sauber und streu frisches Stroh drüber. Dann sieht die Box ordentlich und frisch aus, das reicht.“
„Aber …“ Steinkind verstand nicht. „Wenn der Dreck nicht ganz rauskommt, dann fault das Stroh, und die Ponys kriegen wunde Hufe.“
„Was ist dir lieber – dass die Ponys wunde Hufe kriegen oder dass du einen wunden Rücken hast?“
Steinkind schloss die Augen. Sein Rücken schmerzte, sein Puls klopfte hart in seinen Ohren, seine Handgelenke waren wund, sein Magen leer. Und dann war da immer noch der Stein.
„Dachte ich mir“, brummte Warg und erhob sich.
Beim nächsten Mal waren alle Boxen rechtzeitig fertig.
Steinkind lernte schnell. Nach kaum einem Jahr sprach er wie ein Einheimischer. Die Ponys mochten ihn und er sie. Sie waren pflegeleichter als Hornziegen. Allerdings auch dummer. Aber das war nur gut, denn so rissen sie nicht aus, und er musste sie nicht suchen gehen.
Sein Herr war in diesem Jahr nicht zu den Nordmännern gegangen, sondern hatte eine Handelsfahrt nach Süden gemacht, zum Meer. Steinkind konnte sich nichts darunter vorstellen. Ein See, der so groß war, dass man die gegenüberliegenden Ufer nicht mehr sehen konnte? Unmöglich. Und noch dazu sollte das Wasser salzig sein und ungenießbar. Aber die älteren Sklaven beharrten darauf. „Warte, bis du groß genug bist, um auf einer der großen Fahrten nützlich zu sein. Dann wirst du auch das Meer sehen.“
Wozu? Welchen Vorteil brachte es, einen Haufen Wasser zu sehen?
„Es gibt Piraten dort. Räuber, die in Booten über das Wasser kommen. Sie überfallen besonders gerne Händler, weil sie da viel Beute finden.“
Und das sollte gut sein?
„Es heißt, sie nehmen jeden Sklaven, der sich ihnen anschließen will, als freien Mann in ihre Reihen auf.“
„Ja, wenn sie ihn nicht gleich umbringen. Wenn ihnen deine Nasenspitze nicht gefällt, war’s das.“
„Aber wenn … dann bist du frei!“
„Und wenn du dann je wieder narkassianischen Boden betrittst, bist du so gut wie tot“, knurrte Warg. „Was soll der Unfug? Frei sein wird überbewertet. Hier haben wir immerhin ein Dach über dem Kopf, ein warmes Feuer im Winter und genug zu essen.“
Als er den Stall verließ, knallte er die Tür hinter sich zu.
Einer der anderen Männer, Savet, warf Steinkind einen Blick zu. „Nimm das nicht so ernst. Der ist manchmal einfach so. Er ist ein Sklave geworden, nachdem seine halbe Familie in einem besonders harten Winter verhungert ist. Hat sich selbst, seine Frau und den verbliebenen Sohn verkauft für je einen Silberling.“
„Aber Warg lebt doch alleine?“
„Der Herr hat seine Frau in sein Bett gerufen. Sie ist von ihm geschwängert worden. Bei der Geburt des Kindes starb sie. Warg hat geweint, sein Sohn hat geweint. Der Herr, der ihr Geweine nicht hören mochte, ließ sie auspeitschen. Der Junge hat das nicht überlebt.“
Steinkind fühlte einen Felsblock auf seinem Herzen. „Und dann will Warg nicht weg?“
Savet zuckte mit den Achseln. „Er ist gebrochen. Selbst wenn er sich mal freikaufen sollte, der wird nie wieder etwas anderes sein als ein Sklave.“
„Und du?“
Savet gab keine Antwort. Aber Steinkind sah, wie sich seine Fäuste kurz ballten.
Das war der Tag, an dem Steinkind den Entschluss fasste, irgendwann ein freier Mann zu werden. Der Tag, an dem er begann, sich nach Geld umzusehen. Nicht, dass ein Sklave viele Möglichkeiten hatte an Münzen zu kommen, und wenn doch, dann waren es meist nur die kleinsten der Kupferlinge. Aber sechzig Kupferlinge konnten gegen einen Silberling eingetauscht werden. Mit genügend Fleiß und Geduld … Steinkind lernte, welche Arbeiten ihm tatsächlich Münzen einbringen konnten. Von seinem Herrn bekam er nichts. Aber wenn er seine Arbeit getan hatte und danach noch woanders helfen konnte, in anderen Haushalten, bei anderen Händlern, dann gab es hin und wieder für ihn einen Kupferling. Wenn nicht, bekam er zumindest einen guten Happen zu essen und manchmal ein Bier.
Es lohnte sich auch, für die Herrin zum Markt zu gehen. Sie gab das Geld immer sorgfältig abgezählt mit. Aber manchmal, wenn man geschickt handelte und den ganzen Markt nach einem passenden Händler absuchte, konnte man die Ware etwas günstiger kriegen und von dem Wechselgeld ein wenig abzweigen. Savet hatte ihm diesen Trick gezeigt. Die Herrin fragte nicht, solange das, was Steinkind nach Hause brachte, mit ihren Berechnungen übereinstimmte. Manchmal lächelte sie ihn sogar an.
Einmal allerdings war sie sehr zornig. Ihre Auftragsliste war sehr lang geworden. Steinkind hatte sich ein Stück Holzkohle und ein flaches Scheit geschnappt und sich ein paar Notizen darauf gemacht. Die Herrin hatte ihm das Scheit aus der Hand gerissen und es ins Feuer geschleudert. Aus der Schimpftirade, die sich anschließend über ihn ergoss, lernte Steinkind zweierlei: Sklaven war es nicht gestattet, lesen und schreiben zu können. Und solche, die es dennoch lernten, landeten bei nächster Gelegenheit als Opfer im Götterfeuer. Oder sie wurden den Meerhexen verkauft.
Meerhexen! Es gab also auch hier Wesen, die Magie ausübten, und man fürchtete sie. Gewiss nicht ohne guten Grund. Steinkind zitterte sich an diesem Abend in den Schlaf. Er träumte von Steinen.
Der Hund
Sommer 1025
„Ich wette, es sind zwei!“
Die Stallsklaven drängten sich um den Hundezwinger. Die graugefleckte Hündin fletschte die Zähne und rutschte ein Stück zurück. Weit kam sie nicht, der Zwinger war klein und eng. Sie trat auf der Stelle, legte sich dann schützend vor eine mit Stroh aufgeschüttete Ecke.
„Höchstens eines! Letztes Mal war überhaupt keines dabei! Und ich wette sogar, das ist auch dieses Mal wieder so. Keines, ganz bestimmt!“
„Aber davor war es der halbe Wurf. Wenn sie jetzt wieder eines dabei hat, war’s das. Dann ist sie raus aus der Zucht.“
„Ja, und wir kriegen sie dann irgendwann als Festbraten, wenn sie nicht vorher bei der Bärenhatz draufgeht.“
„Und, hältst du die Wette? Schwarz gegen blau?“
„Um welchen Einsatz?“
„Ich setze zwei Kupfer.“
„Halte dagegen!“
Die Hündin winselte. In dem Stroh hinter ihr bewegte sich etwas. Dann schob sich der Welpe hervor, kletterte ungeschickt über ihren Leib und begann nach der Zitze zu suchen. Ein zweiter, folgte, ein dritter, ein vierter. Nach einigen Rangeleien fanden auch Nummer fünf, sechs und sieben ihren Platz.
„Und? Haben sie die Augen schon auf?“
Der Hundeführer kletterte in den Zwinger und griff nach einem der Welpen. Die Hündin knurrte, rührte sich aber nicht.
„Schwarz.“
Er hob den nächsten Welpen hoch. „Schwarz.“
Steinkind war irritiert. Die Welpen waren doch gescheckt, wie ihre Mutter!
„Schwarz!“
„Schwarz!“
„Verdammt“, murmelte der Initiator der Wette.
„Schwarz!“
Der Hundeführer zögerte. „Blau.“ Seine Stimme war leise geworden. Er griff nach dem letzten der Welpen und schob noch ein „Schwarz“ hinterher, aber es klang nicht mehr so forsch wie am Anfang.
„Ha, ich hab’s gewusst!“ Der Gewinner machte einen Freudensprung und hielt dann sofort die Hand auf. „Deine Kupfer!“ Sein Wettgegner zahlte mit verdrossener Miene.
Im Zwinger jaulte die Hündin auf. Steinkind sah, wie der Hundeführer ihr die beiden letzten Welpen zurücklegte. Aber nur einer bewegte sich sofort wieder in Richtung der mütterlichen Zitzen. Der andere regte sich nicht, auch nicht, als seine Mutter ihn intensiv zu lecken begann. „Was ist mit dem Kleinen?“, fragte Steinkind.
„Tot“, gab der Hundeführer mürrisch zurück.
„Aber … warum?“
„Falsche Farbe.“
Steinkind war kein bisschen schlauer. „Wieso falsch? Die sehen doch alle gleich aus.“
„In welcher Höhle bist du denn groß geworden? Haben dir deine Eltern überhaupt nichts beigebracht? Ich meine natürlich die Augen!“
„Du meinst, du hast den kleinen Hund getötet, weil er die falsche Augenfarbe hatte? Darum ging das die ganze Zeit? Weil die Welpen heute das erste Mal ihre Augen offen hatten?“
„Ja. Und jetzt halt endlich den Schnabel, Junge. Ich will nicht weiter darüber reden. Schlimm genug, dass ich eine zuverlässige, gute Jagdhündin deswegen verlieren werde. Nach diesem Wurf wird unser Herr sie nicht noch einen Winter durchfüttern.“
Steinkind schwieg wie befohlen. Aber ihm war absolut nicht klar, weshalb blaue Augen bei einem Welpen so schlimm sein sollten, dass man nicht nur den Welpen, sondern auch seine Mutter deswegen tötete.
Bei den Ponys gab es keine blauen Augen. Steinkind war den Göttern dankbar dafür. Er sparte seine Kupferlinge, versorgte die Tiere und versuchte, möglichst niemandem aufzufallen.
Drei Winter zogen ins Land. Und als zu Beginn des Frühlings Steinkind seine Münzen zählte, stellte er erfreut fest, dass er bereits genügend Kupferlinge für einen ersten Silberling zusammenbekommen hatte.
Am nächsten Abend war der Beutel fort.
Steinkind ging zu Warg.
„Du hast einen Silberling einfach unter deinem Lager liegen lassen?“
„Keinen Silberling. Einen Beutel Kupferlinge. Vier Doppelhände große Kupferlinge, der Rest kleine Kupferlinge“, erklärte Steinkind.
„Und ich hab’ mich schon gewundert, woher Kromur so schnell neues Wettgeld bekommen hat.“
Steinkind war entsetzt. „Du meinst, er hat mein Geld einfach genommen?“
„Genommen und verwettet.“
„Aber … das kann er doch nicht einfach tun!“
„Offensichtlich doch.“
„Er muss bestraft werden!“
Warg seufzte. „Dir spuken immer noch die Gebräuche deiner Heimat im Kopf herum. Niemand wird Kromur bestrafen. Hätte er unseren Herren oder einen anderen freien Mann bestohlen, dann ja. Aber er hat nur einen Sklaven bestohlen, noch dazu einen aus seinem eigenen Haus. Was Sklaven untereinander treiben, ist den Herrn egal.“
„Aber … so kriege ich nie genügend Silberlinge für meinen Freikauf zusammen. Kromur … oder irgendein anderer … er könnte jederzeit dasselbe machen.“
Warg zuckte mit den Achseln. „Wenn du dein Geld behalten willst, musst du dich selbst darum kümmern. Such dir ein besseres Versteck.“
Das würde er tun. Aber vorher hatte Steinkind noch ein gewaltiges Hühnchen mit jemandem zu rupfen.
Da lief er, der Dieb. Ein gestandener Mann von zwanzig Wintern, langbeinig, breitschultrig, einen Kopf größer als Steinkind und zurzeit sehr gut gelaunt. Das würde ihm vergehen, dem elenden Dieb. Sein Ziel war ganz offensichtlich der Küchenhof, er war also nicht im Auftrag des Herrn unterwegs. Gut so. Steinkind beeilte sich, auf der anderen Seite der Scheune ebenfalls zum Küchenhof zu gelangen. Er pflanzte sich im Tor auf und wartete.
Kromur tauchte auf, wollte an ihm vorbei, und bekam prompt eine Faust zwischen die Rippen. Er taumelte einen Schritt zurück, blieb verdutzt stehen. „He, Junge, was soll das?“
„Du hast mein Geld gestohlen!“
„Deine paar Kupfer? Warum sollte ich die stehlen wollen?“
Steinkind spürte, wie ihm das Blut in die Wangen stieg. „Du hast es gerade zugegeben, woher könntest du sonst wissen, dass es lauter Kupferlinge waren?“
„Und wenn. Was kann ich dafür, dass du deinen Geldbeutel einfach so liegen lässt. Das ist doch die reinste Aufforderung, ihn zu nehmen!“
„Ich will es zurück!“
Kromurs Gesicht verzog sich zu einem bösen Grinsen. „Ist aber nichts mehr da!“
Steinkind hechtete vor und rammte mit seinem Kopf Kromurs Bauch. Drei Jahre Ställe ausmisten verschaffte einem ordentlich Muskeln. Der Mann ging zu Boden. Noch bevor er reagieren konnte, schlug Steinkind mit der linken Hand zu. Mit dem Stein, einem glatten, runden, gut hühnereigroßen Stein, den er die ganze Zeit darin festgehalten hatte. Der Stein traf Kromurs Schläfe. Der Mann erschlaffte. Steinkind schlug noch einmal zu, dieses Mal in Kromurs Gesicht. Die Nase brach mit einem hässlichen Knacken. Noch ein Schlag. Zähne splitterten. Dann packten ihn harte Fäuste und rissen ihn von seinem Opfer weg.
Sie warfen ihn in einen Verschlag ohne Fenster. Ein wenig faulendes Stroh lag auf dem Boden, sonst nichts. Seine Notdurft musste er in einer Ecke verrichten, unter den interessierten Augen quiekender Ratten. Es gab nichts zu essen, nichts zu trinken, und sobald er nachts einschlief, kamen die Ratten und versuchten an ihm zu knabbern. Nur das wenige Licht, das durch einige Ritzen zwischen den unteren Brettern hereindrang, verriet ihm, dass er bereits zwei Tage in diesem Loch saß. Am Abend des zweiten Tage hörte er ein Flüstern hinter der Wand. „Steinkind?“
„Warg!“ Steinkind hätte weinen können vor Erleichterung, dass ihn nicht alle vergessen hatten.
Es kratzte in der Wand. Dann schob sich ein Strohhalm in Kniehöhe hindurch, und aus dem Strohhalm begann Wasser zu tropfen. „Trink, Junge!“
Steinkind legte sich unter den Strohhalm, öffnete den Mund und trank jeden einzelnen Tropfen, bis nichts mehr kam. Der Strohhalm verschwand wieder.
„Du hast Glück, Junge. Kromur lebt noch und die Heiler sagen, er wird wieder.“
„Hat er nicht verdient“, knurrte Steinkind düster. „Und überhaupt, wen interessiert das?“
„Dummkopf! Dich! Hast du die geringste Ahnung, was dir sonst geblüht hätte? Vermutlich nicht, sonst hättest du dich nicht so dämlich verhalten. Es mag dem Herrn egal sein, ob wir einander bestehlen. Es ist ihm aber ganz sicher nicht egal, wenn einer von uns einen anderen verletzt oder sogar tötet. Das ist Beschädigung seines Eigentums, da wird der Herr sehr ungemütlich. Für das, was du getan hast, wird er dich auspeitschen lassen.“
Steinkind schwieg eine Weile. Dann fragte er zögernd: „Und wenn Kromur gestorben wäre?“
„Dann hätte der Herr dich totpeitschen lassen. Als Warnung. Aufsässige Sklaven kann er nicht gebrauchen.“
Steinkind hörte, wie Warg sich hinter der Bretterwand erhob und fortging. Er hatte eine Menge, worüber er nachdenken konnte. Die Peitsche also.
Noch nie war ihm eine Nacht so lang vorgekommen.
Es war Mittag, als der Herr ihn endlich holen ließ. Halb geblendet durch das plötzliche Licht stolperte Steinkind mit gefesselten Händen hinter dem Aufseher her, der ihn direkt zur Strafsäule brachte und festband. Der Herr hatte es sich nicht nehmen lassen, persönlich der Bestrafung beizuwohnen, und alle Sklaven standen im Hof der Schreie und mussten zusehen. Sie vermieden es, Steinkinds Blick zu begegnen.
„Ich dulde keine Aufsässigkeit. Ich dulde es nicht, dass einer von euch, egal aus welchem Grund, mein Eigentum beschädigt“, hörte er den Herrn in seinem Rücken laut sagen. „Normalerweise würde ich für eine Rauferei zwanzig Peitschenhiebe verhängen. Aber diese kleine Missgeburt aus den Bergen hat einen guten Arbeiter so sehr verletzt, dass ich teure Heiler bezahlen musste und trotzdem noch dreißig Tage auf seine Dienste verzichten muss. Für jeden dieser Tage verhänge ich einen zusätzlichen Peitschenhieb, und für jedes einzelne der dreiundzwanzig Kupferlinge, die ich den Heilern zahlen musste, ebenfalls.“
Steinkind sackte an der Strafsäule zusammen. Dreiundsiebzig Peitschenhiebe. Er konnte froh sein, wenn er danach überhaupt noch Haut auf seinem Rücken hatte. Dann klatschte auch bereits die Peitsche herab. Nach dem vierten Schlag schrie er. Nach dem achtunddreißigsten hörte er auf zu zählen. Kurz danach verlor er jedes Zeitgefühl. Die Welt versank in Schmerz.
Warg pflegte ihn gesund. Mit kühlenden Salben und einem Tee, der scheußlich schmeckte, aber das Wundfieber zurückdrängte. Es dauerte trotzdem fast einen Mond, bis Steinkind wieder arbeiten konnte. Er tat es mit zusammengebissenen Zähnen. Das frisch vernarbte Gewebe auf seinem Rücken spannte und schmerzte.
Drei Tage später passte er Kromur in der Küche ab, als der gerade seine Mahlzeit abholen wollte. Der Mann erstarrte, als er ihn sah. Seine Nase hatte eine hässliche Delle, und als er jetzt den Mund zu einem schiefen Grinsen öffnete, sah Steinkind, dass drei Zähne fehlten. Und über seinem Grinsen zuckten seine Augen nervös.
„Eines solltest du wissen“, sagte Steinkind. „Ich bereue nichts. Und ich würde es wieder tun, wenn nötig. Selbst, wenn es mich das Leben kostet. Also überlege dir, ob du noch einmal etwas von mir stiehlst.“
Zufrieden wandte er sich ab. Kromurs Grinsen klebte zwar immer noch in dessen Gesicht, aber er war aschfahl geworden. Dieser Mann würde ihn nie wieder bestehlen. Und vermutlich auch kein anderer.
Ein Kind mit blauen Augen
Sommer 1029
Steinkind hätte sich die Mühe sparen können. In den nächsten Monden sah er nicht eine einzige noch so kleine Münze. Nach dem Vorfall mit Kromur degradierte ihn sein Herr zu den untersten Rängen. Es gab keine Einkäufe mehr für ihn, keine Gelegenheit, Gästen zu Diensten zu sein und so vielleicht einen kleinen Kupferling als Trinkgeld zu bekommen. Nur noch Putzen. Den Pferdestall ausmisten, die Hundezwinger säubern, und wenn dann noch Zeit übrig war, im Haus die Fußböden schrubben.
Heraus kam er nur noch selten.
Allerdings hatte diese Situation dennoch einen unerwarteten Vorteil. Beim Fußbodenputzen bekam er hautnah mit, was sich im Haus tat. Unter anderem war das der Unterricht des bislang einzigen Sohnes seines Herrn. Wenn er leise und langsam genug putzte, gelang es ihm sogar, die eine oder andere Stunde mitzuhören. Steinkind ließ sich nichts anmerken. Der Zorn seiner Herrin, als sie damals entdeckt hatte, dass er schreiben konnte, war ihm noch zu gut in Erinnerung. Aber selbst mit dem wenigen, was er bruchstückhaft mitbekam, gelang es ihm, mehr von dem zu lernen, was in Narkassia wichtig war: Politik, Grenzkunde, Gesellschaft und Geschichte. Mathematik und Buchführung natürlich auch, denn das waren Dinge, die ein zukünftiger Händler wissen musste. Der Sohn seines Herrn war noch jung, hatte wenig Lust zu lernen und musste den Lehrstoff des Öfteren wiederholen. Steinkind bekam alle Wissensgrundlagen, die der Hauslehrer zu bieten hatte.
Vermutlich würde er den ganzen Stoff sogar wiederholen können, denn die Herrin war erneut schwanger. Nach zwei Töchtern und einer Fehlgeburt hatten die Tempelältesten ihr für dieses Mal erneut einen Sohn prophezeit. Seitdem ging sie mit stolz durchgedrücktem Rücken und vorgestrecktem Bauch durch das Haus, und der Herr ließ ihr alle Launen durchgehen und lächelte sie wohlwollend an, bevor er zu seinen Bettsklavinnen ging.
Steinkind träumte vom Lernen. Einen einzigen Wermutstropfen hatte die Sache allerdings: Er wusste nicht, ob er dieses Wissen jemals würde anwenden können. Um Ställe auszumisten, musste man keine Landesgrenzen kennen, und Fußböden zu wischen erforderte keine mathematischen Kenntnisse.
Das Kind wurde vier Tage nach dem ersten Sommermond geboren.
Der Herr war nicht im Haus, als die Hebamme kam. Eine wichtige Sitzung der Handelsgilde. Zusammen mit den anderen Haussklaven saß Steinkind in der Küche und horchte auf die Schreie der Kreißenden, unterlegt von dem beruhigenden Zuspruch der Hebamme.
Dann schrie ein Kind, ein zunächst schwaches, dann aber schnell fordernder werdendes Greinen. Die Zofe der Herrin steckte kurz den Kopf durch die Küchentür. „Ein Sohn!“ Steinkind öffnete den Mund, wollte eine frohe Bemerkung machen – und schloss ihn wieder, als ihm auffiel, dass alle um ihn herum nach wie vor mit fast ängstlichem Blick warteten. Kurz darauf erschien der Kopf der Zofe wieder. „Er ist ansehnlich und gesund. Nur …“ Ihre Stimme brach, sie zog ihren Kopf rasch wieder zurück. Hatte die Frau geweint? Aber warum? Dieses Kind entsprach doch genau den Wünschen seines Herrn! Und warum reagierten die anderen Sklaven so merkwürdig? Steinkind wusste nicht, was er erwartet hatte. Auf jeden Fall nicht das. Diese lähmende Reglosigkeit, diese bedrückten Blicke und gesenkten Köpfe. Freute sich denn keiner hier, dass die Herrin einen gesunden Sohn geboren hatte?
Die Hebamme erschien, das Kind in ein Tuch gewickelt, und ging langsam und mit gesenktem Kopf zum Eingang. Steinkind sah ihr ratlos hinterher. Sollte das Kind nicht bei seiner Mutter bleiben? Als seine kleine Schwester geboren wurde, hatte seine Mutter darauf bestanden, den Säugling in ihrem Arm zu halten, direkt über ihrem Herzen, damit der gewohnte Rhythmus ihres Pulsschlags das Kind in dieser irritierend neuen Welt beruhigte. Wusste man das in Narkassia nicht?
Am Tor wurden Stimmen laut. Der Herr war zurück. Er klang verärgert. Harte, schnelle Schritte in der Eingangshalle. Dann Stille. Totale Stille.
Auf Zehenspitzen schlich sich Steinkind zur Küchentür, huschte den Flur entlang, bis er in die Eingangshalle sehen konnte. Da stand der Herr, reglos, mit zusammengepressten Lippen, und starrte herab auf das Kind, das die Hebamme ihm mit zitternden Armen präsentierte. Nach einer gefühlten Ewigkeit öffnete er endlich den Mund. „Schaff mir das Balg aus den Augen! Ich werde nachher entscheiden, was ich damit mache. Wo ist meine Frau?“
„In ihrer Stube, Herr. Sie war zu geschwächt von dem Blutverlust, um Euch zu empfangen.“
Der Herr stolzierte mit harten, knallenden Schritten zur Wohnstube. Die Hebamme musste hastig zur Seite treten, sonst hätte er sie umgestoßen.
Steinkind ächzte vor Erstaunen.
Die Hebamme sah sich um, entdeckte ihn, und kam rasch, aber leise zu ihm. „Weißt du, wo die Hexen leben?“
Steinkind senkte bestätigend die Hand. „In den blau bemalten Häusern in der Flussstraße.“
Sie drückte ihm das Kind in den Arm. „Rasch, bring ihn fort. Gib ihn den Hexen. Wenn er hier bleibt, wird er sterben.“
„Aber … warum?“
„Sieh ihn dir doch an!“
Steinkind sah auf das Baby in seinen Armen. Ein ganz normaler kleiner Junge, rosige Haut, Händchen und Füßchen, an denen alles dran war, eine winzige Stupsnase, wasserblaue Augen und ein winziger Schopf schwarzer Haare mit einer einzelnen Locke.
„Seine Augen, Dummkopf! Er hat blaue Augen!“
Steinkind zögerte. Was war schlecht an blauen Augen? Über die Hälfte der Leute in seinem Dorf hatte blaue Augen gehabt. Seine Mutter auch.