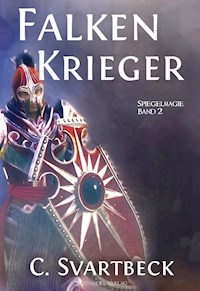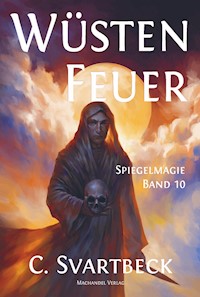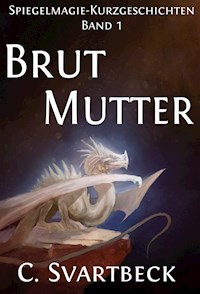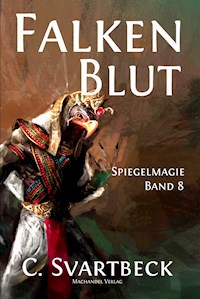Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Machandel Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Spiegelmagie
- Sprache: Deutsch
Viele Jahre kämpfen die Menschen in den Drachenbergen jetzt bereits gegen die Frostgeister – die größte Katastrophe ihres Lebens. Denken sie. Aber die Frostgeister sind nur die Vorboten. Hoch im Norden machen sich die Laren bereit, für jahrhundertelanges Leiden Rache zu nehmen. Eine Rache, die ganz Karapak und die Länder der Drachenberge zerstören kann. Nur drei vermögen diesem Schicksal Einhalt zu gebieten: Eine Frau aus den Drachenbergen mit Seherblut. Ein Mann aus der Ebene, der dieses Blut mit dem Zauberer-Erbe der Drachenberge verbindet. Ein Kind, das als drittes Element den Meereszauber in sich trägt. Aber um Karapak zu retten, müssen sie erst einmal selbst überleben. Und es gibt mehr als genug Parteien, denen genau daran nichts gelegen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Spiegelmagie
Band 6
Windschwingen
C. Svartbeck
Hinweis:
Am Ende des Buches finden Sie einen Anhang mit einer Landkarte sowie Erläuterungen zum Land Karapak und seinen Bewohnern.
C. Svartbeck 2018
Bildquelle cover: Vuk Kostic / www.shutterstock. com
Vignette: Fernando Cortez /shutterstock.comp
2019
Was bisher geschah
Band 1-3
Anmerkung: Sie können das Buch direkt zu lesen beginnen, ohne dass Sie deswegen die ganze Vorgeschichte kennen müssen. Falls es Sie aber doch interessiert oder Sie die ersten Bände nicht mehr so ganz im Gedächtnis haben: Die Grundlagen-Fakten sind in diesem Kurz-Kapitel aufgeführt.
Was gibt es in den ersten drei Bänden zu lesen?
Band 1 - Königsfalke
Ioro, ältester Sohn einer Konkubine König Kanatas (und daher nicht Erbe), ist zum obersten Feldherren bestimmt, sein jüngerer Bruder Tolioro als Sohn der Ersten Gemahlin ist Thronerbe.
Wie das Schicksal so spielt, scheint Ioro mehr Intelligenz und Ehre zu besitzen als Tolioro, was Vater Kanata wohlwollend vermerkt. Ebenso wohlwollend (da er es in seiner Jugend ebenso gehandhabt hat) sieht er allerdings zu, wie Söhnchen Tolioro einen potenziellen Konkurrenten nach dem nächsten aus dem Weg räumt. Und Mutter Iragana beseitigt unauffällig einige Leichen, die Tolioro bei seinen sexuellen Eskapaden produziert.
Da Tolioro auf Ioro eifersüchtig ist, wäre Ioro dem Weg aller Königssöhne in ein frühes Grab gefolgt sein, hätte er nicht in dem angehenden Zauberer Jokon einen tatkräftigen Freund gefunden. Dumm ist halt nur, dass auch Jokon sozusagen auf Messers Schneide lebt.
Band 2 - Falkenkrieger
Sowohl König Kanatas Ehe als auch die seines Sohnes Tolioro, aus Gründen der Staatsraison mit Sirit, der Tochter eines Nachbarkönigs geschlossen, sind unglücklich. Zudem versucht sich die halbe Familie und Schwiegerfamilie gegenseitig zu meucheln.
Am Ende stirbt der König von der Hand seines Sohnes, und Ioro, der jetzt keine Zukunft mehr für sich sieht im Reich, flieht zu den Wüstenkriegern, gegen die das Reich gerade Krieg führt.
Zauberer Jokon, der sich jetzt Jo nennt, hat derweilen einen kapitalen Fehler begangen, ist einer fremden, feindlichen Zauberer-Fraktion auf den Leim gegangen und sitzt im Körper eines Falken fest.
Band 3 - Wüstenkrieger
Ioro kämpft unter seinem neuen Namen Nior mit den Wüstenkriegern gegen seine alte Heimat Karapak. Hauptziel: Vernichtung seines Bruders Tolioro.
Bei diesem speziellen Ziel unterstützt ihn Tolioros Gattin Sirit aus ganzem Herzen.
Und Jo, der ihn im Körper eines Falken begleitet, bekommt dabei kaum mit, dass auch Karapaks Zauberer um ihr Überleben kämpfen, gegen einen Feind, den sie seit 500 Jahren vernichtet wähnten.
Am Ende verbleiben nur 3 der bekannten Akteure auf dem Schachbrett:
Sirit, jetzt Witwe Tolioros und Regentin Karapaks. Ihr Gatte hatte sie geblendet. Da sie einer Zauberin half, hat diese ihr Ersatz-Augen aus Spiegelscherben geschenkt, mit denen Sirit jetzt mehr sehen kann als vorher mit ihren natürlichen Augen. Zum Beispiel Geheimgänge in Mauern.
Weiter verbleiben noch:
Inagoro, ihr minderjähriger Sohn
Jo, der seinen Falkenkörper verloren hat und jetzt in einem Spiegel gefangen ist.
Und es beginnt eine neue Geschichte. Sozusagen „The next Generation“, die
Trilogie Blut der Drachenberge
1. Band: Hornstachler
Die großen Umwälzungen in Karapak haben nur drei Mitglieder der königlichen Familie überlebt: Sirit, ihr Sohn Inagoro, inzwischen König, und ihre Adoptivtochter Taephe. Die allerdings hat der Kronrat eiligst verheiratet mit Shioge, dem Herrn einer entlegenen Grenzburg im Norden.
Und genau dort, im Norden, im benachbarten Kirsitan, taucht eine uralte Bedrohung wieder auf, die Frostgeister. Horden vermehrungsfreudiger, fleischfressender kleiner Ungeheuer, denen zu allem Überfluss noch etwas Magie innewohnt. Sie fressen sich quer durch Kirsitan, entvölkern Meelas und bedrohen inzwischen auch Tolor massiv.
Wären nicht inzwischen die Drachenherrn und ihre ziemlich unheimlichen Nachkommen wieder aufgetaucht, hätten die Menschen überhaupt keine Chance.
Auch so ist sie gering genug. Shioge stirbt durch die Frostgeister. Taephe flieht mit ihren kleinen Söhnen vor dem Zugriff habgieriger Verwandter nach Kirsitan, das wiederum wegen der Frostgeister weitgehend nach Nord-Tolor evakuiert wird.
Inagoro, Karapaks junger König, befürchtet das Schlimmste für seine Schwester, kann aber den Thronrat nicht dazu bewegen, dem Norden zu Hilfe zu kommen.
Und Sirit macht sich Sorgen, ob der neue tolorische König Patta dieser Ausnahmesituation in seinem Land, ihrer alten Heimat, gewachsen ist.
Zauberer Jo, inzwischen wieder frei, hat dagegen ganz andere Sorgen. Die Kristallkammer ist sauer, dass er zusammen mit seiner Schülerin Fü Tolor ohne Bezahlung hilft. Soweit Jo weiß, kennt Großmeister für unbotmäßige Zauberer nur eine Strafe: Er verwandelt sie in Spiegel. Und genau davon hat Jo die Nase gestrichen voll.
2. Band: Feuerwind
Die Frostgeister nehmen derart überhand, dass Kirsitan komplett evakuiert werden muss. Kein Mensch weiß, ob es Meelas ähnlich geht. Jo macht sich auf, die Lage in dem Bergreich zu erkunden. Eine Aktion, die ihn fast das Leben kostet, denn dort haben sich die Laren verschanzt, alte Feinde der Drachenherren. Ganz offensichtlich sind diese auf Rache aus – und nicht ganz so offensichtlich haben sie irgendetwas mit den Frostgeistern zu tun. Was auch immer, Jo ist heilfroh, dass er am Ende wieder lebendig in Tolor landet.
Angenehm wird es allerdings auch da nicht. Jo muss schnell feststellen, dass die Erziehung von Zaubererkindern für Fü und ihn ein Knochenjob ist.
Um Nachwuchs geht es auch in Karapak. Königlichen Nachwuchs, denn Inagoro braucht Thronerben. Allerdings nicht unbedingt die zugehörige Mutter. So ist er auch nicht traurig, als Gattin Kaleka von der Bildfläche verschwindet.
Als gelernte Schattengeherin (Assassine) ist sie allerdings alles andere als tot. Tot sind dafür ziemlich bald andere, nämlich diejenigen, die ihrem Sohn, dem Thronprinzen, gefährlich werden können.
1026
Sommertochter
Zwei Jahre war es jetzt her, dass Taephes dritter Sohn im Feuerwind umgekommen war. Lange genug, dass die Welt wieder halbwegs normal aussah. Den Schatten, der immer noch auf ihr lag, schien außer Taephe niemand zu sehen. Ihre Mit-Gattinnen lachten, scherzten, arbeiteten und erzählten, und die beiden jüngeren bekamen weitere Kinder. Ortege und Okano wuchsen zu Kriegern heran, ihnen tat es gut, dass sie nicht mehr in den friedlichen Bergen Ganens lebten. Wenn Taephe sah, wie Ortege die Axt schwang, wusste sie, dass er einen Kampf um sein Erbe nicht zu scheuen brauchte. Oke behandelte die beiden nicht anders als seine leiblichen Söhne. Und wenn schon für nichts sonst, dafür liebte Taephe ihn.
Im Vorjahr waren die Herden fruchtbar gewesen. Im Winter hatte Okes Sippe reichlich zu essen gehabt und die Erdhäuser kaum verlassen müssen. Lange Tage und Nächte am Feuer, Honigwein, Lieder, Erzählungen. Und Nächte, in denen Oke nach anderem der Sinn stand als nach Schlaf.
Taephe wurde erneut schwanger.
Die Karapakierin gab eine bessere Gattin ab, als Oke befürchtet oder erhofft hatte. Nur ihr Aussehen und ihr Akzent verrieten noch, dass sie nicht im Norden geboren worden war. Sie nahm die Fische, die Oke gerade erst gebracht hatte, aus, als habe sie niemals in ihrem Leben etwas anderes getan. Ihre Haut war gebräunt von der Sommersonne, und ihre Wangen leicht gerötet, während sie lebhaft mit Ala diskutierte und dann über etwas lachte, das die ältere Frau gerade gesagt hatte. Oke trat hinter sie, zog sie an seine Brust. Ihr Körper war warm und weich. Seine Hand glitt von ihrer Brust nach unten. In dem Maße, in dem der Sommer voranschritt, hatte sich auch Taephes Bauch gerundet. Oke streichelte über die Wölbung. Das Kind trat kräftig. Ob es wieder ein Sohn werden würde? Taephe war fruchtbar. Oke freute sich schon auf eine ganze Horde schwarzhaariger Kinder.
Zuvor allerdings würde es zum Mittsommerfest eine ganz besondere Zeremonie geben.
Hier oben im Norden ging die Sonne in der Mitte des Jahres überhaupt nicht mehr unter. Ein Schauspiel, an dem Taephe sich nicht sattsehen konnte, auch wenn es ihr immer ein bisschen unheimlich blieb, genauso wie jene Tage im Winter, wenn die Sonne ganz fort blieb und bunte Feuer über den Himmel flackerten.
Im Winter kamen die Frostgeister. Im Winter war ihr dritter Sohn gestorben. Taephe war sehr froh, dass dieses Kind im Sommer zur Welt kommen würde. Okes Hand war hart und schwielig, aber warm, und sie bewegte sich behutsam über ihren Bauch. Oke war ganz anders als Shioge. Taephe war sich immer noch nicht sicher, warum Oke sie hatte heiraten wollen, aber er war freundlich zu ihren Söhnen, unterrichtete sie wie seine eigenen Kinder, gab seinen Frauen, was immer sie brauchten, und sorgte dafür, dass auch ihre Lust Erfüllung fand.
Ihre Söhne liebten Oke. Vermutlich betrachteten sie eher ihn als Shioge als ihren Vater. Shioge hatten sie ja kaum gekannt. Und jetzt wollte Oke ihren jüngeren Sohn Okano adoptieren. Eigentlich hatte er beide Jungen adoptieren wollen, aber Taephe hatte sich gesträubt. Sie war Shioge einen Erben schuldig. Wenigstens einer der Jungen sollte ein Karapakier bleiben.
Jedenfalls, es würde ein Fest geben. Ein großes Fest, und wenn sie die Nordleute richtig beurteilte, ein Fest, dass wie alle anderen auch in viel Met, lauten Liedern und ungehemmter Lust enden würde. Es sollte ihr recht sein. Oke war vorsichtig genug, wenn er sie in sein Bett rief. Und Taephe wusste aus Erfahrung, dass ein dicker Kinderbauch kein Grund war, keinen Spaß im Bett zu haben.
Okes Hand rutschte etwas tiefer auf ihrem Bauch. Unwillkürlich presste Taephe sich dagegen. Ja, es würde ihr sehr recht sein.
Der Schamane war extra gekommen. Auf einem der nahen Hügel wartete er neben einem großen Holzstoß. Festlich gekleidet und in bester Laune strebten alle Dorfbewohner dorthin, begleitet von tollenden Kindern und kläffenden Hunden. Ortege sah finster, wie sein kleiner Bruder, mit nichts angetan außer einem grob zusammengenähten Gewand aus Birkenrinde, von Okes älteren Söhnen vor den Schamanen geführt wurde. Dann war auch Oke da. Die Menschen rundum wurden still. Der Schamane hob die Hände gen Himmel und flehte um den Segen der Götter, bevor er mit der Zeremonie begann.
„Ein Fremder steht vor mir“, begann er mit weittragender Stimme. „Ein Fremder, der ein Freund geworden ist. Ein Fremder, der mit uns Feuer, Wasser und Fleisch geteilt hat, dessen Mutter zur Gattin Okes, unseres Torks, wurde. Sage mir, Oke aus dem Clan der Steinschleuderer, ist es dein erklärter Wille, diesen Fremden in deine Familie und deinen Clan aufzunehmen, ihn zu deinen Söhnen zu zählen und zu deinen Erben?“
„Das will ich!“, tönte Okes tiefe Stimme über den Hügel. „Dieser Fremde ist kein Fremder mehr. Ich habe für ihn gejagt, und er hat für mich gejagt. Ich habe ihm Geschichten am Winterfeuer erzählt, und er hat mir seine Träume erzählt. Ich habe ihn gelehrt, wie er zu kämpfen hat, und er hat mir versprochen, dass er für mich kämpfen wird. Er ist kein Sohn von meinem Blut, aber ich will ihn zu einem Sohn meines Herzens machen.“
„So sei es.“ Der Schamane trat zu dem Holzstapel und verstreute etwas darauf. Dann ging er zu Okano.
„Fremder, der du ein Freund geworden bist am Herdfeuer Okes aus dem Clan der Steinschleuderer, der du für ihn gejagt und mit ihm Wasser, Feuer und Fleisch geteilt hast, bist du gewillt, auch für ihn zu kämpfen und gegebenenfalls für ihn zu sterben, wenn es der Wille der Götter ist? Wirst du, wenn er dich als seinen Herzsohn annimmt, ihn als deinen Herzvater annehmen?“
„Das will ich!“ Okanos Stimme war hell, jungenhaft, aber fest und bestimmt und über den ganzen Hügel zu vernehmen.
Der Schamane nahm ihm das Gewand aus Birkenrinde ab und legte es auf den Holzstapel. Dann entzündete er das Holz. „Der, der ein Fremder war, ist nicht mehr“, verkündete er. „Okes Sippe hat ab heute einen neuen Sohn!“
Unter dem Jubel aller brachten Okes älteste Frauen ein neues Gewand aus frischem, hellem, bunt bemaltem und reich besticktem Leder herbei und zogen es Okano an. Dann gab Oke ihm Dolch und Bogen, während die Trommeln begannen und die Methörner gefüllt wurden. Und vor dem prasselnden Feuer standen Oke und sein neuer jüngster Sohn, stolz und aufrecht, in der Gunst der Götter.
Ortege wandte sich ab und entfernte sich verstohlen. In seinem Herzen glühte die Eifersucht. Warum durfte Okano Okes Sohn werden, warum nicht er? Lebte er nicht schon länger an Okes Herdfeuer? Hatte Okes ihm nicht schon viel früher einen Bogen gegeben? Er ging schneller und schneller. Am Ende lief er. Lief, bis er nicht mehr konnte, und irgendwo im hohen Gras erschöpft zu Boden fiel.
Wenigstens war hier nichts mehr von dem Fest zu hören.
Die Sonne berührte fast den Horizont. Dann kletterte sie wieder in den Himmel. Sie stand hoch oben, als Ortege eine Berührung an seiner Schulter spürte. Er öffnete die Augen. Oke stand über ihm.
„Du bist nicht bei dem Fest.“
„Es ist nicht mein Fest.“
„Es ist das Fest deines Bruders.“
„Ist er noch mein Bruder?“ Ortege konnte nicht verhindern, dass Bitterkeit durch seine Stimme klang.
Oke setzte sich zu ihm „Er ist dein Bruder durch euer gemeinsames Blut. Und das ist etwas, was sich niemals ändern wird.“
„Aber er ist jetzt einer von euch. Und ich nicht.“
„Denkst du, dass ich dich nicht liebhabe?“
„Du hättest auch mich zu deinem Herzsohn machen können.“
„Deine Mutter wollte es nicht. Und ich achte deine Mutter zu sehr, um ihre Wünsche zu missachten.“
„Wegen dieser blöden Burg irgendwo in Karapak. Einer Burg, an die ich mich kaum erinnern kann, die mir nichts bedeutet.“
„Sie gab ihrem ersten Gatten ihr Ehrenwort, dass sie dafür sorgen würde, dass einer seiner Söhne sein Erbe antreten würde. Willst du, dass deine Mutter wortbrüchig wird, dass sie ihre Ehre verliert?“
„N–nein. Aber … hätte es nicht eine andere Möglichkeit gegeben? Warum muss ich es sein?“
„Du bist der Älteste. Die Verantwortung lastet auf dir. So ist das nun mal.“
Beide schwiegen jetzt.
Schließlich seufzte Oke. „Vielleicht sollte ich dir etwas sagen. Etwas, was du wohl noch nicht begriffen hast. Du magst nicht mein Blutsohn sein und auch nicht mein Herzsohn, aber du bist mein Herdfeuersohn, und du sollst wissen, dass du auch ohne Eid immer meinem Herzen nahestehen wirst. Ich habe keine Verpflichtungen aus Blut und Familie dir gegenüber, aber ich verspreche dir, dass ich dir genauso in Worten und mit Waffen zur Seite stehen und dich unterstützen werde, als seist du mein Blutsohn. Bedingungslos. Und koste es mein Leben.“
Ortege sah Okes Augen. Sie sprachen von Wahrheit und Liebe. Er rückte näher an den Tork heran, umarmte ihn und flüsterte: „Ich werde es nie vergessen. Und wenn ich dich auch nie so nennen darf, Oke, in meinem Herzen wirst du für mich immer ein Vater sein.“
Oke drückte ihn kurz. Dann stand er auf. „Komm, Ortege. Das Fest ist noch lange nicht zu Ende. Ich erwarte, dass du genau das tust, was auch meine älteren Söhne getan haben. Du wirst dich für deinen Bruder und mit uns freuen und mit uns feiern und singen. Und du wirst ihm zeigen, dass er zwar Brüder gewonnen, aber keinen Bruder darüber verloren hat.“
Taephe erfuhr nie, was Oke mit Ortege besprochen hatte. Aber sie sah, dass ihr ältester Sohn seinen Bruder umarmte, ihm gratulierte, und sie sah, dass sein Lächeln echt war.
Einen Mond später gebar sie Oke eine Tochter. Sie fürchtete Enttäuschung, aber ihr Mann lachte nur. „Es können ja nicht immer nur Söhne sein. Ein kräftiges kleines Mädchen. Ich hoffe, sie wird wie ihre Mutter.“
Taephe nannte die Kleine Nitiri, nach den winzigen gelben kirsitanischen Bergblumen, die Wind und Eis und sengender Sonne trotzten und jeden Sommer an den steilsten Hängen der Drachenberge blühten.
*
Weit weg in den Bergen Kirsitans dachte in jenem Moment eine Frau an Taephe. Inana hatte seit Taephes Abreise nichts mehr von ihrer Freundin gehört. Die Händler waren ausgeblieben, die Nordleute hatten sich anderen Zielen zugewandt. Kein Wunder, in Kirsitan gab es nichts mehr zu handeln, und von Meelas hörte man erst recht nichts. Inana seufzte und sah zu ihrem Sohn. Zwei Monde nach Taephes Abreise war er zur Welt gekommen. Der Kleine hätte Taephe vermutlich gefallen.
Und Inana hätte eine Schwester an ihrer Seite gebrauchen können. Nicht einmal ihr Hornstachlerkind vorher hatte sie dermaßen erschöpft wie dieser Junge. Mako mochte erst zwei sein, aber er war groß und stark für sein Alter und kaum zu zähmen. Inana hatte manchmal den Eindruck, dass der Junge ihre Erziehungsversuche einfach auslachte.
Sie erhob sich, strauchelte und musste sich am nächsten Stützpfeiler des Hauses festhalten. Schwarze Wolken schienen vor ihren Augen zu tanzen. Irgendetwas stimmte da ganz gewaltig nicht. Sie war nicht krank, sie hatte weder Schmerzen noch Fieber. Und trotzdem war sie seit einiger Zeit praktisch ständig erschöpft und kaum noch fähig, ihre ganz normalen Arbeiten zu verrichten.
Es gab nur eine Stelle, die ihr Rat geben konnte. Inana suchte die Duka auf.
Kira saß schwatzend am Feuer ihres Sippenhauses und verlas zusammen mit drei älteren Frauen die Bohnen. Einwandfreie wanderten in die Vorratsgefäße, beschädigte kamen gleich in den Eintopf, der auf dem kleinen Feuer vor ihnen leise simmerte.
Inana setzte sich schweigend zu ihnen und wartete.
Zwei Handvoll Bohnen später wandte Kira sich an sie. „Ich habe dich während der letzten Monde selten gesehen. Du kommst kaum noch aus dem Haus. Und du bist dünner geworden und kraftlos. Was ist mit dir, Schwester?“
Inana öffnete ihre Hände dem Schein der Flammen. „Ich dachte, das könntest du mir sagen.“
Kira sah sie an, dann ihre Hände, dann die Flammen. „Du bist nicht die Einzige“, sagte sie schließlich leise. „Da sind andere, deren Leben genauso schwindet. Und ihr alle habt eines gemeinsam. Ihr habt zuvor Drachenbrut ausgetragen, und danach habe ihr ein menschliches Kind geboren.“
Inana wollte die Antwort, auch wenn sie sich davor fürchtete. „Was bedeutet das?“
„Das bedeutet, dass ihr sterben werdet, wenn eure Kinder bei euch bleiben. Das bedeutet, dass dein eigenes Kind dir das Leben stehlen wird. Die Flammen haben mich gewarnt. Das Drachenblut ist zu stark in euren Kindern. Ich habe versucht, so lange wie möglich zu warten. Es ist nicht unsere Art, Mütter von ihren Kindern zu trennen. Aber ich fürchte, uns wird keine andere Wahl bleiben.“
„Heißt das, ich muss meinen Sohn einer anderen Sippe geben?“ Das hieße, sie würde ihn nicht mehr jeden Tag sehen können. Würde sich nicht erfreuen können an jedem kleinen Fortschreiten seiner Entwicklung. Es würde schwer sein für sie.
„Das heißt, dein Sohn und alle anderen Kinder, die wie er sind, müssen Kirsitan verlassen.“
Inana sog erschrocken die Luft ein.
„Grau hat so etwas bereits angedeutet bei seinem letzten Besuch. Er sagte, die Drachenblütigen sind Zauberer und müssen als solche aufgezogen werden.“
„Aber … können wir das nicht hier machen? Notfalls in einem anderen Dorf?“
„In welchem denn? Über den Winter ist doch nur Ganen selbst bewohnt. Außerdem brauchen sie Erzieher, Lehrer, Vorbilder. Kirsitan hat keinen einzigen Zauberer. Wir können das einfach nicht.“
Inanas Herz schien zu stolpern. Mit gepresster Stimme fragte sie: „Wohin müssen unsere Kinder dann gehen?“
„Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Karapak oder Tolor. Nur in diesen beiden Ländern gibt es Zauberer. Und Karapak … Wir wissen, wie sehr die Karapakier uns mögen. Das Land kommt also nicht infrage. Es bleibt nur Tolor. Die beiden Zauberer dort würden unsere Kinder bei sich aufnehmen.“
„Wie lange?“ Inana konnte hören, wie dünn und verloren ihre Stimme klang.
„Für immer. Sie kehren niemals zurück.“
Jetzt flossen die Tränen.
Inana spürte, wie zwei der älteren Frauen an sie heranrückten und sie in die Arme nahmen.
Hätte sie aufgesehen, hätte sie den fast verzweifelten Blick ihrer Duka bemerkt.
Kira haderte mit den Flammen. Mussten sie ihr das sagen? Hätte es nicht schon gereicht, zu wissen, dass sie Kinder ihres eigenen Volkes wegschicken musste? Sie dankte den Göttern, dass Inana in diesem Moment nicht fähig war, weiter zu fragen. Wie hätte sie ihr erklären sollen, dass sie diese Kinder wissentlich in den Tod schickte?
Denn das hatten ihr die Flammengeister gesagt. Keines der Kinder würde Tolor überleben. Und trotzdem war es nötig, sie dorthin zu schicken. Das Überleben ihres ganzen Volkes hing davon ab. Die Zauberer im Süden waren das Zünglein an der Waage des Schicksals.
*
Als der Drachenherr nach seinem nächsten Besuch wieder fortflog, trug er fünf kleine Kinder in einem Korb mit sich.
So, wie in den nächsten Jahren auch, nur dass es immer weniger Kinder wurden, denn auch die Zahl der Frauen, die zuvor Drachenbrut austrug und danach noch ein menschliches Kind wagte, sank. Es tat zu weh, seine Kinder so rasch wieder zu verlieren.
Aber die Frauen fanden zu ihrer alten Kraft zurück, sobald die Kinder fortgeschafft waren.
1027
Nachwuchssorgen
Vio, seines Zeichens oberster Meister der Töpfe und Pfannen im Sommerharem, sortierte geistesabwesend seine Gewürze. Es waren mehr geworden als früher, die neue Erste Gemahlin des Königs hatte einige Kräuter aus ihrer Heimat mitgebracht, die sie in ihren Speisen wünschte. Bei einem der neuen Kräuterbüschel zögerte er kurz. War diese Pflanze nun als Zutat zu Fleisch oder zu Gemüse gedacht? Aber nein, jetzt fiel es ihm wieder ein. Dieses würzige, harte Blatt gehörte zu Fisch. Meeresfisch, wie die Erste Gemahlin betont hatte. Nun, dann konnte er das Kraut gleich ganz hinten in den Schrank hängen. Wenn man nicht gerade die Dienste eines Zauberers in Anspruch nahm, war es so gut wie unmöglich, Meeresfische in die Hauptstadt zu bekommen, die noch frisch genug waren, um sie zu essen.
Jetzt nur noch rasch die Töpfchen mit den Würzsamen überprüfen. Der Fenchel roch muffig. Vio warf ihn ins Herdfeuer und beauftragte einen Küchenjungen, unverzüglich zum Markt zu laufen und frischen zu holen. Beim achtzehnten Töpfchen hielt Vio erneut inne. Zirmetsamen. Noch so ein Fischgewürz. Allerdings rochen diese Zirmetsamen merkwürdig schwach. Er streute ein paar auf die weißgescheuerte Tischplatte. Seine Augen verengten sich. Das war kein Zirmet. Genauer gesagt, das war Zirmet, der mit einer ordentlichen Portion Möhrensamen gestreckt war. Vio war absolut sicher, dass die Königinmutter das interessant finden würde.
„Wer weiß alles, welche Gewürze die Erste Gemahlin meines Sohnes gerne und in größeren Mengen isst?“ Sirit besah die so unscheinbar und harmlos auf ihrer Hand liegenden Körner.
Vio zog den Kopf ein. „Praktisch jeder hier in der Küche. Und ihre Hofdamen. Und natürlich so gut wie alle Diener im Sommerharem.“
„Und du bist sicher, was die Wirkung betrifft!“
„Absolut.“ Vio zögerte kurz, bevor er hinzusetzte: „Meine Schwester hat die gegessen, als sie bereits fünf Kinder hatte und keine mehr wollte.“
„Das ist Sabotage. Schlimmer, Hochverrat. Ein Angriff auf das Haus Mehme. Der König muss davon erfahren.“
Vio wünschte sich ein Mauseloch, in dem er unverzüglich verschwinden konnte. Der König … Es waren schon Leute aus weniger guten Gründen hingerichtet worden.
Inagoro hörte mit versteinertem Gesicht, was seine Mutter ihm berichtete. „Ein Kraut, das unfruchtbar macht“, sagte er dann. „Für immer? Oder ist der Effekt vorübergehend?“
„Vorübergehend“, versicherte Sirit ihm.
„Wissen wir, wer es war?“
Sirit lächelte dünn. „Noch nicht. Aber vermutlich bald. Nur fürchte ich, dass der Anstifter zu dieser Tat von außen kommt. Wir beide wissen sehr genau, wer Interesse daran hat, dass du keine weiteren Söhne bekommst.“
Inagoros Wangenmuskeln spannten sich. Instinktiv wich Sirit einen Schritt zurück. So hatte Tolioro ausgesehen, bevor er zuschlug.
Die Lieferung war aus dem Süden gekommen. Wie die Erste Gemahlin. Niemand hatte Verdacht geschöpft. Die Gattin des Königs ließ viele Gewürze aus ihrer alten Heimat kommen und pflegte Unmengen davon über ihr Essen zu geben.
Der königliche Geheimdienst grub allerdings ein interessantes Detail aus. Der Händler, der normalerweise direkt vom Grünwassersee aus seine Waren anlieferte, hatte bei seiner letzten Fuhre massiv Schwierigkeiten gehabt. Ein verendeter Ochse, zwei gebrochene Wagenräder, eine merkwürdige Häufung von Durchfallerkrankungen unter seinen Angestellten. Auf halbem Wege hatte er sich einen Lohnunternehmer anheuern müssen, um seine Waren noch pünktlich zum Palast zu schaffen. Und dieser Lohnunternehmer stammte den Papieren nach rein zufällig aus einer Stadt im äußersten Norden des Lehens von Herzog Komato.
Noch viel zufälliger hatte dieser Lohnunternehmer auf seinem Heimweg einen äußerst tragischen Unfall gehabt und sich den Hals gebrochen, als seine Ochsen aus unerfindlichen Gründen plötzlich durchgingen.
Es gab also keine Beweise.
Inagoro wusste dennoch, woran er war. Die Wachen vor dem Sommerharem wurden verdoppelt, alle eingehenden Lieferungen mehrfach überprüft, eine zusätzliche Vorkosterin für die erste Gemahlin bestimmt.
Trotzdem dachten alle zuerst an einen Giftanschlag, als die erste Gemahlin am dritten Morgen der Regenzeit über massive Übelkeit klagte. Bis zum Nachmittag ging es ihr allerdings schon wieder besser.
Und am nächsten Morgen war ihr wieder übel.
Fabriele war schwanger.
Endlich. Es hatte schon ungutes Geflüster gegeben in Palast und im Thronrat, Erinnerungen an Inagoros Vater, der es nicht geschafft hatte, mehr als einen einzigen Sohn zu zeugen. Ein Königshaus ohne Söhne war ein Haus, das nicht mehr lange Bestand haben konnte.
Ein Königshaus mit vielen Söhnen hatte andere Probleme. Inagoro dachte daran, was er über seinen Vater und dessen Brüder erfahren hatte. Die meisten davon waren nicht einmal alt genug geworden, um Laufen zu lernen. War sein ältester Sohn in Gefahr?
Aber da war immer noch Sirit. Inagoro war sich sicher, dass seine Mutter über ihren ersten Enkelsohn wachen würde wie eine Löwin.
Das Problem war nur, mit der Geburt eines Sohnes würde Fabriele Sirit von ihrer Position als Erste Frau im Sommerharem verdrängen. Wenn Fabriele es so wollte, würde Sirit in den Winterharem ziehen müssen.
Und von da aus konnte sie nicht mehr über ihren Enkel wachen.
Inagoro ballte die Fäuste. Soviel unnützer Ballast an Sorgen alleine in seiner Familie! Bei allen Winddämonen, er war der König, er sollte Besseres zu tun haben. Beispielsweise einen kleinen Eroberungsfeldzug. Aber wo? Im Norden gab es nichts zu erobern. Bis tief hinein nach Kirsitan waren die Berge inzwischen fast menschenleer. Mit Tolor hatte Karapak einen Friedensvertrag. Mit den Wüstenstämmen auch. Inagoro starrte finster ins Nichts. Es gab nur noch eine einzige Stelle, an der Karapak tatsächlich kämpfen konnte. Das Delta. Jene Sumpfinseln, auf denen sich die Piraten verschanzt hatten.
So ziemlich die schlechteste Stelle für einen Krieg, wenn man normalerweise mit Fußsoldaten und Kavallerie kämpfte.
1028
Ein kleiner Feldzug
Am Ende waren es die Gilden, die den letzten Anstoß gaben.
Berichte über Piraterie waren ohnehin in den letzten Jahren an der Tagesordnung gewesen. Mit einer Regentin, auf die niemand so recht hören mochte, einem jungen handlungsunfähigen König und einen alten, handlungsunwilligen Thronrat, hatten die Piraten sich fast unbehelligt wieder ausgebreitet und große Teile des Landes erneut besetzt, dort, wo das Delta an das Meer grenzte. Schiffe wie Dörfer mussten Schutzgeld zahlen, um überhaupt einigermaßen unbehelligt zu bleiben, und selbst das nützte nicht immer. Die Piraten holten sich Lebensmittel und Frauen aus den Dörfern und Geld und Gut von den Kaufleuten. Wer sich wehrte, starb.
Die Seidengilde wurde vorstellig. Der Thronrat schmetterte ihr Hilfeersuchen ab, unter Hinweis darauf, dass die Seidengilde genug verdiente, um selbst mehr Wachen zu bezahlen. Den Gewürzhändlern ging es nicht besser.
Dann sprach jemand vor, mit dem überhaupt kein Mitglied des Thronrates gerechnet hatte.
Ein vierschrötiger, stiernackiger Mann, der so überhaupt nicht zu den ziselierten Alabastersäulen und den goldgeschmückten Kerzenständern passen wollte, zwischen denen er einherging.
„Prakat von der Steinmetzgilde!” Die Stimme des Herolds dröhnte durch den Audienzsaal.
Der Mann baute sich vor Inagoro auf, zwar mit einer angemessen demütigen Verneigung, aber seine Gestalt war keine, die höfische Formen verinnerlicht hatte. Er strahlte Kraft aus und tatkräftige Energie.
„Ihr müsst etwas gegen die Piraten unternehmen, Majestät!”, dröhnte sein tiefer Bass durch den Raum.
„Ich muss?”, fragte Inagoro betont sanft.
Prakat zuckte zusammen, verneigte sich hastig noch einmal. „Meine Worte waren schlecht gewählt, Majestät. Ich meinte damit, es ist in Eurem ureigensten Interesse, dass den Piraten das Handwerk gelegt wird.”
„Erläutere mir das.”
Prakat räusperte sich, fuhr sich mit der Hand über den Bart und begann dann zu reden, langsam zuerst. Aber mit jedem Wort wurde er sicher, schneller – und lauter. „Ich vertrete die Steinmetzgilde. Wir sind diejenigen, die Häuser, Tempel und Paläste in Sawateenatari bauen. Wie Ihr wissen dürftet, Majestät, wird in dieser Stadt – und auch an Eurem Palast – unentwegt gebaut. Die Steinbrüche aber, aus denen unser Material stammt, sind sehr weit weg.
Steine aus den Drachenbergen können wir natürlich den Tsaomoogra herabschiffen. Bei den begehrten weißen und roten Steinen aus den Drachenschwanzbergen oder gar dem schwarzen Basalt aus den grauen Schluchten aber geht das nicht. Da sind wir auf den Land- oder Seeweg angewiesen. Und während der Regenzeit, so wie jetzt, können wir nur den Seeweg nutzen. Trotz des großartigen Straßenbauprogramms Eures verehrten Großvaters Kanatamehme sind immer noch weite Teile unseres Straßennetzes unbefestigt. Die Wagen mit den Steinladungen sind einfach zu schwer, sie bleiben in dem Morast stecken. Wir müssen also den Seeweg nutzen – oder wir müssen aufhören zu bauen.
Damit aber wären weder Ihr noch unsere sonstigen Kunden einverstanden.
Auf dem Seeweg allerdings fangen uns seit einigen Jahren regelmäßig die Piraten ab und verlangen Schutzzoll. Unsere Schiffe sind durch die Steine so sehr beladen, dass sie nur schwerfällig manövrieren und die Piraten mit ihnen leichtes Spiel haben. Anfangs waren die Schutzzölle moderat, aber in diesem Jahr sind sie derart hoch geworden, dass sie unseren ganzen Gewinn auffressen. Eine Gilde ohne Gewinn kann nicht existieren. Und, wie ich vorsichtig anmerken möchte, Majestät, eine Gilde ohne Gewinn kann auch keine Steuern zahlen.”
Das war endlich ein Argument, das der Thronrat verstand. Bauwerke, die nicht ausgeführt werden konnte, Steuereinnahmen, die der Staatskasse fehlten. Der versammelte Thronrat empfahl dem König einstimmig, den Piraten den Krieg zu erklären.
*
Niemand, der seine Sinne beisammen hatte, führte während der Regenzeit Krieg in den Sümpfen. Inagoro wartete, bis die Regenzeit vorbei war und der Wasserstand des Tsaomoogra sich normalisierte.
Dann zog er seine Truppen zusammen.
Er deklarierte seinen Feldzug allerdings nicht als Krieg. Natürlich nicht. Alleine das Wort Krieg reichte schon, um die halbe Bevölkerung in Panik zu versetzen. Außerdem hätte er dann die Kaufleute und Händler empfindlich in Unruhe versetzt.
Nein, Inagoro deklarierte seinen Feldzug als Strafexpedition.
*
Piraten waren eine Sache. Mücken eine ganz andere. Falls Inagoro bislang gedacht hatte, dass Sawateenatari während der Regenzeit ein Mückenparadies war, wurde er jetzt eines Besseren belehrt. Das wahre Mückenparadies lag hier im Delta. Gegen die blutrünstigen kleinen Stechsauger waren selbst die Krokodile nicht mehr als eine unangenehme Randerscheinung. Fluchend schlug er wieder zu. Die Mücke war tot. Sein Arm juckte trotzdem. Wie machten die Einheimischen das nur, inmitten dieser Mückenschwärme so stoisch ruhig zu bleiben?
Einer dieser Einheimischen stand gerade vor ihm und behauptete dreist, dass es hier keine Piraten gäbe. Weit und breit nicht, im ganzen Delta nicht, und hier schon gar nicht.
„Ach ja?“ Inagoros Augenbrauen schossen in die Höhe. „Nun, dann bist du nutzlos für mich. Werft ihn den Krokodilen vor.“
Die Wachen ergriffen den Mann und zogen ihn fort.
„Halt, wartet, nicht! Mir fällt gerade doch noch einer ein!“
Inagoro gab den Wachen ein Handzeichen, den Mann wieder zurückzubringen. Sie schleiften ihn nicht gerade besonders sanft über die Schiffsplanken und warfen ihn vor Inagoro auf den Boden.
„Sieh an“, bemerkte er trocken. „Dein Gedächtnis ist offenbar doch noch nicht völlig zu Sumpfbrei geworden. Dann erzähl mir mal, was dir doch noch eingefallen ist.“
Der Mann presste seine Stirn auf dem Boden. „Majestät, verzeiht, bitte, mein Fehler, ich habe nicht nachgedacht. Da ist tatsächlich jemand, den ihr als Piraten bezeichnen könnte. Zumindest habe ich gehört, er hätte vor zwei Monden mit vorgehaltenen Waffen von den Schiffen der Gewürzgilde eine gute Summe Geld erpresst.“
„Würde mich auch ausgesprochen wundern, wenn es eine andere Bezeichnung als ‚Pirat’ für so jemanden gäbe.“
Der Mann murmelte etwas Unverständliches.
„Wie bitte?“
Er bekam keine Antwort. Inagoro winkte dem Zuchtmeister. Der Mann trat vor, holte aus. Der Peitschenhieb hinterließ auf dem Rücken des Knienden einen blutigen Streifen.
„Also, was hast du gesagt?“
Der Mann aus dem Delta hob den Kopf von den Planken und blickte trotzig hoch. „Steuereintreiber, habe ich gesagt.“
Einen Moment schien jeder auf dem Schiff den Atem anzuhalten. Dann lachte Inagoro los. Nach kurzem Zögern fielen die Soldaten verhalten mit ein.
„Steh auf“, bedeutete er dem Mann. „Wie heißt du?“
„Enki.“
„Enki, es gibt nicht viele Bürger Karapaks, die es wagen würden, so mit ihrem König zu reden. Ich honoriere deinen Mut und lasse dich leben. Du wirst, solange ich hier im Delta bin, als mein direkter Berater fungieren.“ Er trat an den Mann heran, fasste unter sein Kinn und zog ihn hoch, so dass sie sich Auge in Auge gegenüberstanden. „Allerdings solltest du dir einer nicht ganz unerheblichen Kleinigkeit bewusst sein, Enki. Wenn du mich je wieder belügst, bist du Krokodilfutter. Unwiderruflich.“
Enki belog ihn kein zweites Mal. Inagoro war sich jedoch sicher, dass der Sumpfbewohner ihm die eine oder andere Wahrheit schlichtweg verschwieg. Er wusste nur nicht, wollte Enki die Piraten schützen, oder tat er es aus Prinzip, weil die Bewohner des Deltas den karapakischen Eroberern auch nach zwei Generationen noch immer nicht trauten?
Enki führte ihn tatsächlich zu einem Piratennest.
„Leer. Ausgeflogen.“ Der Hauptmann starrte nicht weniger düster als Inagoro auf den leeren Platz zwischen den Hütten. Mit der Stiefelspitze schob er die Asche der Feuerstelle auseinander. Darunter glomm es noch schwach. „Sie sind gewarnt worden.“ Er sah zu Enki herüber.
„Unmöglich. Der Mann stand die ganze Zeit praktisch neben mir.“ Inagoro sah zu seinen Schiffen herüber. Die breiten, hohen Rümpfe leuchteten ochsenblutrot über das grüngelbe Schilf. Die Fahne hing schlaf am Mast, hier im Delta regte sich kein Lüftchen. „Sie brauchten wohl auch keine Warnung außer der, die wir ihnen selbst gegeben haben. Wie hoch ist das Schilf? Kaum mehr als zwei Köpfe über Mannshöhe. Unsere Schiffe liegen zweieinhalb Mannslängen über der Wasserlinie. Gut für Transporte, aber miserabel, wenn man in so flachem Gelände ungesehen irgendwohin kommen möchte. Wir brauchen andere Schiffe.“
Der Hauptmann runzelte die Stirn. „Schiffe zu bauen braucht Zeit.“
„Habe ich gesagt, dass ich sie bauen will? Hier im Sumpf hat so gut wie jeder ein Schiff. Wir werden die, die wir brauchen beschlagnahmen. Du wirst dafür sorgen. Wenn wir das nächste Mal losfahren, wird uns niemand vorzeitig sehen können.“
Die Sumpfleute waren nicht gerade begeistert, als die königliche Marine ihnen die besten Schiffe konfiszierte. Aber angesichts einer Tausendschaft schwer bewaffneter Soldaten beschränkten sich ihre Proteste auf leises Murren und ein paar geschüttelte Fäuste. Der Hauptmann beschlagnahmte auch gleich noch die notwendigen Arbeitskräfte, da seine Soldaten, wie er ganz richtig annahm, absolut keine Ahnung hatten, wie die flachen, schmalen Sumpfboote zu handhaben waren.
Den Soldaten war es nicht ganz geheuer, dass sie jetzt auf Augenhöhe mit den Krokodilen verkehrten. Aber was konnten sie schon tun, außer dem guten Beispiel ihres Anführers und Königs zu folgen?
Enki wusste, wohin die Piraten ausgewichen waren. In das große Schilfmeer an der rechten Uferseite flussabwärts. Eine eintönige Fläche, bewachsen mit hohem Schilfgras, die von keinem Baum und keiner Anhöhe unterbrochen wurde und sich bis zum Salzwasser erstreckte. Die Hütten der Dörfer darin waren mit Schilf gebaut und gedeckt und von ihrer Umgebung kaum zu unterscheiden. Die Dörfer waren so klein, dass die Soldaten auf den Booten übernachten mussten, und lebten ganz offensichtlich nur von Fisch, Krokodilfleisch und gerösteten Schilfwurzeln. Jedenfalls war es das, was man Inagoro und seinen Soldaten zu Essen vorsetzte.
Der Tsaomoogra floss so langsam, dass er fast stand, und das wenige Land, das aus seinen trübbraunen Fluten auftauchte, bestand aus stinkendem Schlick. Inagoro verlor fast die Geduld. Dank der zahllosen, ausgiebigen Mäander des Flusslaufes, waren sie am nächsten Abend kaum näher an der Mündung als am Tag zuvor, trotz eines ganzen Tages angestrengten Ruderns. Aber als er in dem dritten Dorf abends erwähnte, dass es vielleicht schneller sei, einfach eine Schneise durch das Schilf zu schlagen und zu Fuß zu gehen, sahen ihn Enki und die Dorfältesten an, als sei ihm ein zweiter Kopf gewachsen.
„Wenn Ihr unbedingt sterben wollt …“
„Wieso?“
„Im Schilf leben die schwarzen Büffel. Die greifen alles an, was sich in Ihrer Nähe bewegt.“
„Ich habe schon mehr als einen Büffel gejagt“, knurrte Inagoro.
„Und es sind Schlangen darin. Jede Menge. Jede einzelne von ihnen tödlich giftig. Nur Selbstmörder gehen durch das Schilf.“
Der Dorfälteste hatte plötzlich ein Messer in der Hand. Noch bevor auch nur einer von Inagoros Begleitern reagieren konnte, flog das Messer durch die Luft. Mit einem satten „Tokk“ landete es in einem der Stützbalken hinter ihm.
Inagoro hob die Hand. Der Soldat, der schon mit seinem Schwert ausholte, erstarrte, ließ dann das Schwert sinken. Der Älteste lächelte dünn, erhob sich und ging sein Messer holen. Er hielt es Inagoro unter die Nase. Etwas Grünes war daran aufgespießt, das mit acht dünnen Beinen zappelte.
„Und die sind dort auch. Hier im Dorf halten wir sie kurz. Aber im Schilf werdet ihr sie auf jedem zweiten Blatt finden. Ihr Biss ist nicht tödlich. Aber er schmerzt höllisch. Ich garantiere Euch, ein Soldat, der von einer Sumpfspinne gebissen wird, kämpft mindestens drei Tage nicht mehr.“
„Eure Argumente sind stichhaltig“, gab Inagoro zu. „Dann bleibt wirklich nur der Flusslauf.“
Besagten Flusslauf hätten sie am vierten Tag wohl ohne Enki nicht einmal gefunden. Der Tsaomoogra schien sich in tausend Arme zu verästeln. Die meisten von ihnen endeten als Sackgassen. „Das reinste Labyrinth. Wie finden die Handelsschiffe hier durch?“
Enki zuckte mit den Schultern. „Genauso wie Ihr, mein König. Sie brauchen einen Lotsen, der hier aus der Gegend stammt.“
Inagoro erschlug eine weitere Mücke. „Wie weit ist es noch?“
„Wir müssten den Schlupfwinkel der Piraten morgen erreichen.“
Dann war dieses elende Dorf vor ihnen die letzte Station. Den Göttern sei Dank. Inagoro war es gründlich leid, in stinkenden Schilfhütten zu schlafen.
Immerhin waren die Leute gastfreundlich. Sie versorgten ihren Herrn und König sogar mit einer jungen Frau, die sein Lager teilte und deren Gegenwart wundersamerweise die Mücken fernzuhalten schien. Sie lachte, als er sie darauf ansprach. „Das ist das Kaui-Öl. Jeder hier benutzt es.“
Inagoro hatte den Ältesten gesagt, dass er am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang los wollte. Die Piraten sollten gründlich überrascht werden. Die Dorfleute hatten sich nicht dazu geäußert, aber als Inagoro mit dem ersten grauen Streifen am Horizont aufstand, war das Frühstück für ihn und seine Soldaten bereits bereitet. Er aß schnell und mechanisch und war auf seinem Boot, sobald es hell genug war, die Umgebung einigermaßen zu erkennen.
„Herr, wartet!“ Das war die junge Frau, die ihn in der Nacht verwöhnt hatte. „Ihr habt doch darüber geklagt, dass die Mücken Euch förmlich auffressen. Wollt ihr nicht etwas von dem Kaui-Öl mitnehmen?“
Selbstredend wollte Inagoro. Er hieß die Ruderer zu warten. Die junge Frau eilte zur Hütte zurück und verschwand darin.
Der Himmel wurde heller. Der Horizont wies jetzt bereits einen rosa Streifen auf. Inagoro war drauf und dran, auch ohne das Öl aufzubrechen.
Dann kam sie wieder aus der Hütte, einen schweren Krug auf ihrer Hüfte. Sie balancierte ihn vorsichtig zu seinem Boot. „Ich habe mir gedacht, dass Ihr mehr davon brauchen könnt. Nicht nur für Euch, meine ich.“
Sieh an, die Kleine dachte mit! Inagoro lächelte, bedankte sich, ließ den Krug sorgfältig zwischen den Sitzbänken verstauen und gab endlich den Befehl zum Aufbruch.
Die Piraten waren ausgeflogen. Vermutlich unmittelbar vor ihrer Ankunft, denn die Kochfeuer brannten noch, die Töpfe hingen noch darüber. Sie mussten gewarnt worden sein. Und da dieses Mal ihre Schiffe sie nicht verraten haben konnten, gab es nur eine Möglichkeit.
„Die Dorfleute!“ Inagoro musterte den Krug mit dem Kaui-Öl mit finsterem Blick. „Sie haben mich reingelegt. Haben mich damit lange genug aufgehalten, dass eines ihrer eigenen Boote vor mir losfahren und die Piraten warnen konnte.“
Er ließ alles im Dorf der Piraten zerstören.
Auf dem Rückweg machten sie in dem gleichen Dorf wie am Abend zuvor wieder Halt. Die Dorfbewohner waren genauso spurlos verschwunden wie die Piraten. Inagoro ließ auch dieses Dorf zerstören.
Zweimal der gleiche Reinfall. Mit einem Gegner, den man nicht zu packen kriegte, war kein Staat zu machen. Inagoro verdoppelte seine Patrouillen. Irgendwie musste er doch die Piraten finden können!
Die Piraten fanden ihn. Genauer gesagt, seine Männer.
Als das erste Boot nicht zurückkam, dachte er sich nichts dabei. Ein Unglücksfall. Vielleicht hatten sie einen treibenden Baum gerammt. Oder sich mit einem besonders großen Krokodil angelegt.
Dann fehlten zwei Boote.
Inagoro ließ die Boote nur noch im Verbund ausfahren. Mindestens vier Boote zusammen.
Von den sechzehn Booten, die er dieses Mal losgeschickt hatte, kam ein einziges zurück, nur noch mit der Hälfte der Männer besetzt. Der Dienstälteste von ihnen, ein graubärtiger Soldat, erstattete Bericht.
„Wir sind vorschriftsmäßig gefahren, immer zwei Boote nebeneinander, keine fünf Bootslängen auseinander, alle vier. Und dann kamen sie plötzlich angeschossen, aus diesen schmalen Krokodilslöchern im Schilf, wo keines unserer Boote durchpasst. Schmale, leichte, hochbordige Plankenschiffe, nichts so Schwerfälliges wie diese Sumpf-Flachboote, mit denen wir unterwegs sind. Sie sind zwischen uns durchgeschossen wie Rennpferde zwischen Ochsen. Die Hälfte unserer Männer war bereits tot, bevor wir überhaupt nach den Waffen greifen konnten. Den Hauptmann haben sie zuerst erledigt. Danach wusste keiner von uns so recht, was wir machen sollten, und wir sind einfach zurückgerudert. Die haben uns die ganze Zeit umrundet. Das vordere linke Boot ist überhaupt nicht mehr weggekommen, da waren gleich drei von den Piratenbooten. Unsere Männer waren tot, bevor wir außer Sicht waren. Wir anderen drei sind kaum vorwärtsgekommen. Schließlich haben die ganz hinten angehalten und sich den Piraten zum Kampf gestellt, damit wir anderen wegkamen. Ich konnte noch sehen, wie das Boot geentert wurde. Und dann haben sie uns mit Pfeilen beschossen, und an den Pfeilen waren so kleine Behälter, und als die aufgeschlagen sind, sind die kaputtgegangen, und da waren diese kleinen Mistspinnen drin. Sie haben viele von uns gebissen, manche mehrfach. Die, die es am schlimmsten erwischt hatte, konnten sich vor Schmerzen nicht mehr rühren. Wir haben alle, die sich noch bewegen konnten, auf ein Boot gepackt und sind so schnell es ging weggerudert. Ich habe gesehen, wie die, die auf dem anderen Boot zurückblieben, von den Piraten ins Wasser geworfen wurden. Sie haben noch gelebt, als sie reingeworfen wurden.“
Und im Wasser hatten die Krokodile gewartet.
So ging es nicht weiter. Er brauchte endlich einen Erfolg. Nicht nur seine Soldaten wurden langsam mürbe. Er musste etwas ganz anderes versuchen.
Inagoros Finger trommelten auf den schmalen Tisch. Da war doch diese ganz spezielle Taktik gewesen, mit der seinerzeit der berühmte Feldherr Kaguiki die Nomadenstämme erfolgreich aus der Grasebene vertrieben hatte. Wenn er die ein bisschen abwandelte … So sehr unterschied sich der Schilfsumpf nicht von dem endlosen Grasmeer, das der Süden Karapaks damals noch gewesen war.
Er musste den richtigen Wind abwarten.
Es war ein zermürbendes Warten. Der Wind blies überhaupt nicht, oder aus der falschen Richtung. Nicht mehr lange, und die Regenzeit begann. Dann konnte er nur noch seinen Plan vergessen und sich zurückziehen. Inagoro wurde nervös und reizbar, die Männer gingen ihm aus dem Weg.
Dann kam der Morgen mit dem richtigen Wind. Befehle liefen von Boot zu Boot. Kleine Fässer wurden verteilt. Die rekrutierten einheimischen Ruderer schauten verblüfft auf die vielen Pfeile, die zusätzlich an Bord gebracht wurden. Die Boote fuhren los, ein jedes zu einem anderen Seitenkanal auf der windabwärts gelegenen Seite des Hauptarmes. Dort wurden zur Mittagszeit die Fässer geöffnet.
Als die einheimischen Ruderer sahen, was die Fässer enthielten, wurden sie unruhig, konnten nur mit Waffendrohungen niedergehalten werden. Auf einigen Booten kam es zum offenen Aufstand. Das waren diejenigen, deren Heimatdörfer auf der windabwärts gelegenen Seite lagen. Diese spontanen Aufstände wurden blutig beendet. Dann wickelten die Soldaten die pechgetränkten Lappen um die Pfeile, entzündeten sie und schossen die Flammen in den Schilfwald.
Wenig später stand das ganze Schilf auf dieser Seite des Tsaomoogra lichterloh in Flammen. Schwarzer Rauch ballte sich darüber, zog mit dem Wind und den Flammen in Richtung Meer. Enki stand an der Bordwand, beobachtete mit geballten Fäusten und zusammengepressten Lippen das Schauspiel und sagte keinen Ton.
Inagoro wartete.
Das Feuer erlosch spät in der Nacht, als es keine Nahrung mehr fand.
Am nächsten Morgen kamen Boote aus dem verbrannten Delta. Männer, Frauen und Kinder waren darauf, auch einige Hunde und Hühner. Sie sahen nicht auf, als sie an den karapakischen Booten vorbeiruderten.
Aber Enkis Fäuste lockerten sich.
Inagoro trat zu ihm. „Deine Leute?“
„Sieht so aus, als ob sie es überlebt haben.“
Enki klang nicht sonderlich glücklich darüber. „Willst du zu ihnen?“
„Wozu? Sie würden mich bestenfalls erschlagen.“
„Hast du gesehen, ob alle aus deiner Sippe dabei waren?“
Enki sah ihn ziemlich merkwürdig an. „Nein. Ein paar der Männer fehlten.“
Das konnte nur eines bedeuten. Sie waren zu den Piraten gegangen.
Die Sumpfleute kannten das Schilf, wussten wie schnell es sich in der Trockenzeit durch ein unachtsames Feuer oder ein Gewitter entzünden konnte. Es hatte nur wenige Opfer unter ihnen gegeben, ganz so, wie Inagoro es kalkuliert hatte. Schließlich wollte er seine Untertanen nicht umbringen, ihnen nur eine Lehre erteilen. Es sah nur nicht so aus, als ob sie das verstanden hatten. Etliche der Ruderer desertierten. Vermutlich würde er sie bei den Piraten wiederfinden.
Als ihm der nächste Deserteur gemeldet wurde, ließ er die ganze Rudermannschaft hinrichten. Danach war Ruhe. Aber es war eine ungemütliche Ruhe.
Gerade war Inagoro soweit, dass er auch die andere Hälfte des Schilfsumpfes niederbrennen wollte, da kamen endlich Unterhändler mit der grünen Fahne. Etliche der Dorfältesten aus dem Delta, und zwei, drei Gestalten, die ihm unbekannt waren, die, ihrer strohähnlichen Haarfarbe nach, wohl mischblütig waren. Vermutlich Abgesandte der Piraten. Sie stellten sich nicht vor, sie redeten auch nicht, beobachteten nur, und Inagoro hütete sich, sie anzusprechen. Er tat so, als gäbe es diese Männer überhaupt nicht.
Die Dorfältesten führten die Verhandlungen. Sie versicherten ihm, dass die Piraten sich zurückgezogen hatten. Die beiden Hauptarme des Tsaomoogra-Deltas waren wieder frei, hier würden die Handelsschiffe nichts zu befürchten haben. Bei den Seitenarmen mochte das anders aussehen, aber dort würden doch wohl ohnehin keine Handelsschiffe fahren. Die Flussarme dort waren viel zu eng, verwinkelt, der reinste Irrgarten, in dem außer ein paar Verrückten und den Krokodilen niemand freiwillig hineinschwamm. Und eine weitere Strafexpedition dort hinein sei unnötig, viel zu aufwändig für das Wenige, was man damit erreichen könne.
Inagoro verstand die unterschwellige Drohung. Mit steinernem Gesicht hörte er die Gesandten zu Ende an, hieß sie dann, in zwei Tagen zurückzukommen, wenn er sich entschieden habe.
Zwei Tage, in denen er auf Krokodiljagd ging.
Danach teilte er den Dorfältesten mit, dass er die Strafexpedition als erfolgreich betrachtete und sie jetzt beenden würde, da er keine Lust habe, noch länger in diesem mückenverseuchten Sumpf zu bleiben. Zuhause warteten wichtigere Dinge auf ihn.
Enki fuhr mit nach Sawateenatari. Er hatte nicht im Sumpf bleiben wollen, sich stattdessen freiwillig zur Armee des Königs gemeldet.
Auf der Fahrt den Fluss hinauf trommelten die Siegestrommeln der roten Schiffe. Die Handelswege waren wieder frei. Niemand erwähnte, dass dieser ganze Feldzug keinen einzigen Piraten eliminiert hatte.
*
Sirit hörte, dass ihr Sohn aus dem Delta zurück war, und ging, ihn zu begrüßen.