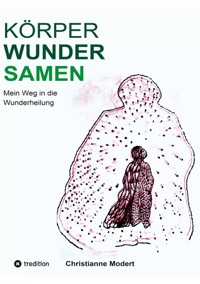
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ich beschreibe meinen Weg aus einer langen, schweren und seltenen Krankheit zurück in das Leben. Ich war überzeugt, dass die schweren Symptome meines Körpers eine Botschaft meines Innersten enthielten. Ich könnte gesund werden, wenn ich sie entschlüsseln und ihre Bedeutung anerkennen würde. So geschah es schlussendlich auch. Kraftlosigkeit, Ohnmacht und Schmerzen forderten mich bis an die Grenze zum Tod heraus. Hingabe und Einverständnis mit dieser Situation liessen aber auch innere Bilder und Erkenntnisse in meinem Bewusstsein auftauchen. Sie waren mir Kompass oder Anker und markierten Stationen auf dem Weg meiner Seele zurück in ihren Körper. Mit meinem Erlebnisbericht möchte ich Menschen in schwierigen Situationen Mut machen, den eigenen Weg im Ein-Klang zu wagen, hinein ins Leben und das Lebendige.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
„Wenn die Seele etwas erfahren möchte, dann wirft sie ein Bild der Erfahrung vor sich nach außen und tritt in ihr eigenes Bild ein.“
Meister Eckhart
„Ich suche nicht, ich finde. Suchen ist das Ausgehen von alten Beständen und ein Finden- Wollen von bereits Bekanntem. Finden ist das völlig Neue. Alle Wege sind offen, und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, die im Ungeborgenen sich geborgen wissen, in der Führerlosigkeit geführt werden, die sich vom Ziel ziehen lassen, und nicht das Ziel selbst bestimmen.“
Pablo Picasso
Christianne Modert
KÖRPERWUNDERSAMEN
MEIN WEG IN DIE WUNDERHEILUNG
© 2023 Christianne Modert
Umschlag, Illustration: Christianne ModertLayout: Jérôme Boor
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN Paperback
978-3-347-95770-1
ISBN Hardcover
978-3-347-95771-8
ISBN e-Book
978-3-347-95772-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich.
Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
VORWORT
ÜBERBLICK
Teil 1: PLÖTZLICH KONNTE ICH KAUM MEHR GEHEN
Teil 2: TRAUER, ENTWICKLUNG UND VERANTWORTUNG
Teil 3: MULTIPLES SCHLURFEN IN DER ERSTEN KRANKHEITSEPISODE
Teil 4: DIE KRANKHEIT FLETSCHT MICH WIEDER AN
Teil 5: PRÄGENDE KINDERZEIT
Teil 6: ZEITNAHE DOKUMENTATION DES ZWEITEN KRANKHEITSJAHRES
Teil 7: PUZZLETEILE DES BEWUSSTSEINSFELDES
Teil 8: BILDER AUS DEM ZWISCHENRAUM
NACHGETRAGENES: GEBORGENHEIT
KörperWunderSamen
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
VORWORT
NACHGETRAGENES: GEBORGENHEIT
KörperWunderSamen
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
VORWORT
Aus nacheinander auftauchenden Gründen entstand dieses Buch. Der erste war, dass meine besondere Krankheit mir nicht nur meine Kräfte, sondern auch mein Zeitgefühl raubte. Sie konnte sehr stark schwanken, so dass ich nicht mitkam und nicht einordnen konnte, was wie warum wann geschah. Deshalb schrieb ich täglich mein Befinden und Erleben auf, um die Dinge zeitlich auf die Reihe zu bringen. Zudem hatte ich die Hoffnung, durch eine genaue und objektive Dokumentation ein Ursache-Wirkungs-Prinzip ausfindig zu machen, von dem aus die Fehlermeldungen meines Körpers zu beheben wären.
Als ich im zweiten Jahr des großen Krankheitsgeschehens mit dem Schreiben begann, wusste ich noch nicht, dass ich meinen Heilungsweg dokumentieren würde. Als ich später erkannte, dass eine Gesundungsgeschichte ohne die dazu gehörende Krankengeschichte unverständlich bleibt, habe ich diese davorgesetzt. Ursachenforschung betrieb ich vom Erwachsenenleben in die Kindheit hinein und noch weiter zurück. So ist der eigentliche Ausgangspunkt in die Mitte der Erzählung gerückt. Anfangs dachte ich, solange zu schreiben, bis ich zwei Monate lang symptomfrei wäre. Aber meine Gesundung ging über die Wiederaneignung körperlicher Kraft und normaler Gehbewegungen hinaus. Sie bescherte mir ein neues, klareres Welt- und Menschenbild. Es kostete mich Mühe, zuzugeben, dass das menschliche Vermögen alles, was ich bisher gedacht und gefühlt hatte, weit übersteigt und Vorstellungen über eine innige und schöpferische Allverbundenheit mehr als nur Ideen im Kopf sind. Obschon es eigentlich einfach ist, war es schwierig, und es dauerte lange, bis ich verstehen und annehmen konnte, dass meine spirituellen Erfahrungen positive Auswirkungen auf meinen Körper haben. Dazu musste ich die neuen Einsichten körperlich, psychisch und mental verarbeiten und sie zu einem neuen roten Faden verzwirnen.
Für meine Gesundung ging ich im Grunde genommen meinen Weg in die Krankheit in entgegengesetzter Richtung noch einmal. Schwierige und entscheidende Stationen konnte ich mir erneut und wie von der anderen Seite her distanziert ansehen. Einfach war es nicht, aber es wurde mir immer selbstverständlicher. Die frühere Notwendigkeit, konsequent und zuverlässig auf schwierige Situationen zu reagieren, hatte sich als scheinbar notwendiges, festes Muster in mir festgekrallt. Diesem ordnete sich meine eigene freie Persönlichkeit unter, und das ließ meinen Körper erstarren. Im Außen präsentierten sich immer wieder Situationen, in denen ich mich behaupten musste. Es schien fast so, als wäre das Angehen der ständigen Prüfungen mein Lebenssinn. Erst in der letzten langen Krankheitsepisode wurden mir dieses Glaubensmuster und die Tragweite seines Teufelskreises bewusst. Auch weil meine Kraft am Ende war, konnte ich das Kämpfen, d. h. den Wunsch, meine Probleme zu bezwingen, aufgeben. Als ich mir dies endlich gönnte, und es mir egal war, ob ich sterben würde, konnten die alten Fesseln sich nach und nach lösen. Die Verstrickungen verstandesmäßig einzuordnen und gefühlsmäßig zu durchleben, hatte nicht gereicht. Es schien, dass die Saat dieser Bemühungen nun in meinen Körper einregnete, dort, in meinem Bewusstsein, wie ein Same in der Erde keimte und sich in Richtung Heilung entfaltete. So selbstverständlich und so mühsam, wie ein Pflanzenkorn sich beim Keimen der Sonne zuwendet.
Was mir in Krankheit und Gesundung widerfuhr, scheint unglaublich. Dennoch ist mein Schreiben ein Bemühen um die authentische Erzählung dessen, was ich erlebte. Aufgrund meiner sowohl rational-objektiven als auch innerlich-subjektiven Betrachtungsweise tauchte aus den Tiefen des Unbewussten ein lebendiges Menschen- und Weltbild auf, das mir Spiritualität jenseits der Religionen und Heilung jenseits der Medizin bescherte. Es gelang mir, die Spaltung von Körper und Psyche zu überwinden, die psychosomatischen Anteile zu verbinden und dadurch zu einer geistigen Ebene vorzudringen, die alle Bereiche meiner Persönlichkeit durchdringt und nährt. Voraussetzung war, meinen Durchsetzungswillen aufzugeben und meine Ohnmacht und Kraftlosigkeit anzunehmen. Die Krankheit war mir eine strenge Lehrmeisterin. Ich verschloss mich nicht vor ihr und lief ihr nicht davon. So lernte ich, den Weg zu mir selbst zu gehen, über anerzogene und angelernte Vorstellungen und Verhaltensweisen hinaus. In diesem inneren Prozess stellte ich mich meinen Wunden und Enttäuschungen. Anstatt sie als schmerzhaft von mir zu weisen, konnte ich sie mit Wohlwollen als mir zugehörig annehmen. Dadurch gelang es, mir meines eigenen Wertes bewusst zu werden und mir das Recht auf mein Leben zuzugestehen. Als wäre die Rückkehr zu mir selbst gleichzeitig eine Rückkehr zum Urquell, durfte ich erleben, wie die Lebenskraft wieder in meinen Körper floss und mich gesunden ließ.
Eine Wunderheilung ist eine Heilung, die medizinisch nicht erklärt werden kann. Für die Schulmedizin waren meine bizarren Symptome Zeichen einer psychosomatischen und multiformen Krankheit, für die es in ihrem wissenschaftlich-materialistischen Weltbild keine Lösung gibt. Mein Gesundungsweg, auf dem ich immer fest an die „Weisheit des Körpers“ glaubte, führte mich zu spirituellen Dimensionen, aus denen mir Verständnis für die Zusammenhänge und Lebenskraft zufloss. Die Normalmedizin nennt dies Spontan- oder Wunderheilung.
Als ich wieder gesund war, entdeckte ich Literatur über die moderne Neurobiologie. Es faszinierte und erschütterte mich zugleich, meine Krankengeschichte als neurobiologisch logischen Ablauf zu verstehen, der unter anderen Umständen auch einen anderen Verlauf hätte nehmen können. Es war faszinierend zu wissen, dass weder Gehirn noch Gene feststehende Größen sind, sondern dass sie sich in Reaktion und Zusammenspiel mit der inneren und äußeren Umwelt stetig verändern.
Ihr Ziel ist die Sicherung des Überlebens. In diesem Sinne ist die Dissoziation als psychischer und neurobiologischer Schutzmechanismus zu verstehen, der dann zum Tragen kommt, wenn jemand keine Hoffnung mehr auf das Entkommen aus einer nicht mehr aushaltbaren Situation sieht. Dass mein Krankheitsweg so nachvollziehbar wurde, empfand ich als Erleichterung. Ebenso ging es mir mit der Aussage, dass das Bewusstsein nicht an den Körper gebunden ist, sondern auch außerhalb von diesem existiert. Alles ist mit allem vernetzt, im Gesunden wie im Kranken, von den Zellen bis zum Organismus, vom persönlichen bis zum gesellschaftlichen Körper, von der Gesellschaft bis zur Natur. Diese Allverbundenheit, das dauernde Bezug-Nehmen macht die schöpferische Kraft aus, aus der heraus sich Leben und Gesundheit entwickelt. Zu erleben, dass ich als Teil dieses Lebendigen wirklich die Macht habe, auf dieses Einfluss zu nehmen, erschütterte mich, denn dies bedeutet, selbst zum Teil ein göttliches, lebensschaffendes Wesen zu sein. Ich bin überzeugt, dass diese geistige Dimension zur biologischen Ausstattung des Menschen gehört. Damit hat er die Verantwortung, mit sich und seinen Mitmenschen wohlwollend umzugehen. Dass diese Einsichten nicht in meinem Verstand reiften, sondern sich in meinem Körper regten, um von dort aus durchlebt und verstanden zu werden, hat mich entgegen aller Wahrscheinlichkeit wieder gesunden lassen. Es ist schön zu wissen, dass es viele Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, und dass manche sich auf wundersame Weise tatsächlich in unserem Leben ereignen …
Durch das Fertigstellen des Buches habe ich das Gefühl, die Schmerzen meiner „alten Geschichte“ hinter mir gelassen zu haben. Den Erklärungsdruck wie eine Haut abzustreifen, gibt mir neue Freiheit und Leichtigkeit, mein Leben in spannende Bereiche hinein zu öffnen. Das Hauptmotiv aber, diese Arbeit fertigzustellen, ist die Hoffnung, dass meine Erfahrungen anderen Mut machen, sich selbst zu vertrauen – und es zu wagen, sich den eigenen Weg zuzutrauen. Auch möchte ich die Menschen, die mir selbst Wegbegleiter waren, ehren und ihnen danken. Alle, die einverstanden waren, mit vollem Namen genannt zu werden, sind mit ihren Therapieansätzen im Internet auffindbar.
Das Buch ist in acht Teile (und einen zusätzlichen) gegliedert. Die fetten Zwischen-Überschriften und Datenangaben sollen inhaltliche und zeitliche Orientierung geben.
ÜBERBLICK
Ich wurde als erstes von vier Kindern geboren. Mein Vater war Busfahrer, meine Mutter Grundschullehrerin. Sie war oft und viel krank, was dazu führte, dass ich mir schon recht früh Gedanken über Leben und Tod machte. Obschon die Religion mich stark anzog, hielt sie meiner kindlichen Prüfung nicht stand und bescherte mir sehr viel Kopfzerbrechen. Ebenso prägend, aber aufbauender war für mich der „Bau“, bei dem mein Vater mit einer Gruppe von Freunden unser neues Haus entstehen ließ. Auch hier gab ich mir Mühe zu verstehen, wie so ein riesiges Unternehmen überhaupt möglich ist, und ich lernte sehr viel über planendes und analoges Denken und konsequenten Einsatz für Familie und Zukunft.
Meine Kindheit war ernst, und meine Jugend auch. Nach dem Abitur studierte ich Kunst in Paris, verliebte mich in einen Tunesier und bekam mein erstes Kind. Es war eine bunte Zeit, die sich in den eintönigen Grautönen eines Ascheregens auflöste, als mein Mann mich und unser Kind verließ. Die Scheidung wurde in seiner Abwesenheit gesprochen. Dem Gesetz nach konnte ich als Alleinstehende meinen Sohn nicht adoptieren, aber durch eine neue Ehe wurde es möglich, ihn gemeinsam mit meinem zweiten Mann anzunehmen … Wir bekamen noch zwei gemeinsame Kinder, hatten ein Haus auf dem Land und arbeiteten beide als Kunsterzieher. Alles schien normal, bis ich die Stimme verlor, die durch ihre Verweigerung auf größere Paar-Probleme hinwies. Sie lösten sich trotz Ehe-Therapie nicht. Später hatte ich mit der Trauer um meinen verunglückten Bruder zu kämpfen, mit Depression, Migräne, Schlaflosigkeit und Starrkrampfanfällen. Der Versuch, all dies möglichst wenig zu beachten, um weiter funktionieren zu können, zog mich in eine noch tiefere, scheinbar unverständliche und ungreifbare Trauer. Sie galt früh verstorbenen oder ungeborenen Kindern der Familie, besonders meinem fehlgeborenen Bruder, mit dem meine Mutter einige Monate früher als mit mir schwanger war.
Oft war ich erschöpft; öfters konnte ich tagelang nicht richtig gehen. Nur zu kleinen Schritten fähig, besuchte ich ein Trauerseminar und tanzte dort nach drei Tagen den Lebenstanz. Das Konzept der Lebens- und Trauer-Umwandlung brachte mich „zur Entdeckung der eigenen Ressourcen und den Ressourcen der Natur“. Ich lernte sehr viel durch Gongklänge und inszenierte Erfahrungen. Der tiefe innere Kontakt, der sich bei der Begegnung mit dem vielfach behinderten Sohn unseres Leiters einstellte, erfüllte mich mit übergroßer Dankbarkeit. Es war das erste Mal, dass ich etwas sah und spürte, von dem ich wusste, dass es in der Realität nicht da sein konnte, und dessen Kraft ich dennoch sehr deutlich wahrnahm. Paradoxerweise war es dieser blinde, spastische, an den Rollstuhl gefesselte Junge, der mich lehrte, mit klarem Blick meine Seele wahrzunehmen. Darauf zu reagieren, mich aus einengenden Erwartungen zu befreien und endlich Selbstverantwortung statt nur „Verantwortung“ zu übernehmen, veränderte mein Leben. Ich entschloss mich zur Trennung und später für die Weiterbildung als Myroagogin, als Lebens- und Trauerbegleiterin. Dies brachte mich zum Verständnis der Trauerdynamik, und erleichterte mir dadurch den Umgang mit meiner Krankheit.
Diese hatte sich während neun Jahren eingeschlichen und zeigte sich monatlich für einige Tage, ehe sie 2005 unbarmherzig zuschlug und mich in den Rollstuhl brachte. Endlich wurde die Diagnose gestellt. Es gäbe weder Therapie noch Medikamente, und Heilung wäre nicht zu erwarten, sagte man mir. Dennoch war ich froh, endlich etwas Greifbares an der Hand zu haben. Ich musste andere als schulmedizinische Wege finden und war froh, inzwischen geschieden zu sein. So brauchte ich mich nicht für mein Tun und Lassen zu rechtfertigen, sondern konnte meinem Gespür folgen. Es leitete mich gut. Nach und nach konnte ich meinen Beruf wieder voll ausüben. Es war ein Wunder, und ich spürte, wie Lebenskraft mich von innen her auflud. Kleinere Schübe zwischendurch sah ich als entschuldbare Pannen an, mit denen ich zu einer ganzheitlich arbeitenden Therapeutin fuhr, die mich mit ihrer Energiearbeit schnell wieder auf die Beine brachte.
Im August 2009 brannte der Teil meines Hauses mit dem Malatelier ab. Ich war dankbar, dass niemand verletzt und das Haupthaus nur wenig beschädigt war, und plante den Neubau vorsorglich mit einer behindertengerechten Wohnung. Im Oktober 2010 waren die letzten Malerarbeiten abgeschlossen. Dass es mir trotz der zusätzlichen Belastungen gesundheitlich immer noch gut ging, schien mir ein sicheres Zeichen dafür, dass ich meine Krankheit endgültig überwunden hatte.
Aber im Januar 2011 schlug sie wie aus heiterem Himmel wieder zu. Kraftlosigkeit und Gehbehinderungen waren enorm. Ich konnte dieses Mal keinen Auslöser finden und hatte auch keine Hoffnung auf eine zweite „Wunderheilung“. Dass ein solches Glück mir erneut zukommen würde, schien schon rein statistisch unmöglich! Dennoch wehrte sich eine leise innere Stimme gegen die rationalen Überlegungen: „Es ist dir schon einmal geglückt! Besinne dich darauf, wie du es geschafft hast, und dann tu es einfach wieder!“ Ich wusste nicht, wie das gehen sollte, aber ich kannte die Richtung. Gedanken über die Unmöglichkeit, das Ziel zu erreichen, verbat ich mir. Trauer, Ohnmacht und Schmerz dagegen ließ ich zu, denn ich wusste um ihre Berechtigung und heilsame Kraft. Ich wollte nicht als lebende Tote auf der Erde sein und stattdessen meine Sinne so gut wie möglich gebrauchen. So war es eine experimentellexistenzielle Herausforderung, aber auch eine Sache des Trotzes, der Gerechtigkeit und der Würde, nicht zu kapitulieren: Ich war es mir schuldig!
Meine letzte große Aufgabe würde es sein, in Würde zu sterben. Ich verstand es als Würdigung meines Lebens und als letztes Geschenk an meine Kinder.
Es ging mir schlecht, und ich musste lange auf die Aufnahme in der Klinik warten. Wieder auf den Rollstuhl angewiesen, wurde mir ein Zahnarzt empfohlen, der mir mit seiner besonderen computerbasierten Therapie helfen könne. Bis zum Termin nahm meine Kraft so weit ab, dass meine Hausärztin meinte, eine Überweisung ins Krankenhaus hätte keinen Sinn mehr. Am nächsten Morgen fuhr mein Sohn mich zum Zahnarzt, der mir Kabel anlegte, Zähne drückte und mich erstaunlicherweise wieder in meine volle Kraft brachte. Auf Anraten meines Neurologen ging ich dennoch in die Uniklinik. Am dritten Tag konnte ich mich dort nur noch mit dem Gehwägelchen vorwärtsschleppen. Es war schlimm, und ich hatte den Eindruck, dass nicht nur ich ratlos war. Wieder zu Hause, suchte ich sofort meinen Zahnarzt auf, der mir wieder helfen konnte. Nach und nach verlor auch seine Behandlung ihre Wirksamkeit, und ich musste mich nach neuen Möglichkeiten umschauen.
So begann ich im zweiten großen Krankheitsjahr mit dem Schreiben, und ich nahm an Seminaren teil, die sich um energetische Heilung und Oberton-Gesang drehten. Die verschiedenen Ansätze verwoben sich wunderbar mit meinen Erfahrungen der „Lebens- und Trauerumwandlung“. Leibseelischen Verbindungen auf die Spur zu kommen und diese inneren Vorgänge durch Schrift und Bild im Außen sozusagen als „Kopie“ festzuhalten, war eine gute Grundlage für mein Weitergehen im Ungewissen. So konnte ich für dieses Buch auf alte und neue Texte und Zeichnungen zurückgreifen, die mein Denken und Erleben beeinflussten und im Fluss hielten.
Von immer größerem Wert wurden innere Bilder, die zunächst bei besonderem Erleben, in Fantasiereisen und Meditationen auftraten und dann immer öfter von selbst entstanden. Sie haben eine besondere plastische Qualität, die neben dem Sehen und Fühlen auch ein Wissen oder Erkennen beinhaltet, und in der jede dieser Eigenschaften als Teil der anderen erfahrbar wird. Sie sind mehr als bloße Vorstellungen oder fantastische Ideen, denn sie wirken spürbar im ganzen Körper. In der Erinnerung leben sie genau so präsent wieder auf, was mir erlaubt, auch im Nachhinein portionsweise auf sie zurückzugreifen, um Einzelheiten besser zu verstehen oder mir Kraft zu holen. Sie sind wie ein Schlüssel zu einem mir unbekannten oder unbewussten oder heilen oder göttlichen Zwischenreich, in dem ich das Staunen, das Mich-Einlassen und das Lebendig-Sein wieder lernen durfte.
Schön, dass ich mich darauf einlassen konnte. Es lebe das Leben!
Teil 1
PLÖTZLICH KONNTE ICH KAUM MEHR GEHEN
Spielverderberin
Plötzlich konnte ich mich kaum mehr bewegen. Das Gehen war sehr anstrengend, und ich war froh, wenn ich es bis zu meinem Liegestuhl, in dem ich die Füße hochlegen konnte, geschafft hatte. Es war 1996, und ich war 37 Jahre alt. Mein Mann meinte, ich wolle ihn auf diese Weise unter Druck setzen. Das war seine Sicht auf die Dinge.
Seit wir geheiratet hatten, war er sehr auf seine Freiheit bedacht. Er erklärte, als Einzelkind wäre er es gewohnt, das zu tun, was ihm gefiele. Ich dagegen wäre schon in einer größeren Familie aufgewachsen. „Als Älteste von vier Kindern bist du von klein auf gewohnt, dich nach anderen zu richten. Du hast Ausdauer, weißt, was zu tun ist, kannst Verantwortung übernehmen.“ Auf das „Du weißt, dass man nicht aus seiner Haut kann. Die erste Prägung ist nun mal die stärkste!“ wusste ich nichts zu entgegnen.
Im zweiten Ehejahr wurde unsere Tochter geboren, gut zwei Wochen nach seinem Geburtstag. Als Geschenk hatte ich ihm ein Bild gemalt. Es hatte einen breiten, mit Naturelementen dekorierten Rand, der eine Szene mit Vater, Mutter, Kind und Baby umfasste. Als er es ansah, meinte er, die Farben wären gut gelungen, und fragte, wo ich die Zeit hergenommen hätte, es zu malen. Er ließ es auf dem Tisch liegen, neben dem er es ausgepackt hatte. Nach einer Woche räumte ich es in den Schrank.
Es gab große Schwierigkeiten, uns zu verständigen. Ich hatte sie mit ihm, aber auch mit seinen Eltern. Ich war die Einzige, die das so sah. „Der Klügere gibt nach“, dachte ich und nahm mir später an ihren Besuchstagen einen familienfreien Nachmittag.
Rückzieher
Immer wieder versuchte ich, eigene Vorstellungen und Wünsche vorzubringen. Versuche, die immer wieder ins Leere führten. Gespräche, die sich im Kreise drehten, Gespräche, die eigentlich nur ein Sprechen waren; ein Sprechen, das ein Aussprechen von Worten war, weil man ja miteinander reden musste und weil es sich so gehörte. Ein Sprechen ohne Bedeutung, weil ohne Konsequenz und Verpflichtung für den Familienalltag oder die Beziehung. Derartige Gespräche bereiteten mir heftige Kopfschmerzen und führten schon im dritten Ehejahr bei mir zu Stimmverlust.
Der Hausarzt behandelte mit Hustensirup, dann mit Antibiotika, und überwies mich, als alles nichts nutzte, zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Der setzte mir in seiner schalldichten Kabine Kopfhörer auf die Ohren und gab die Anordnung, ich sollte zählend versuchen, den Lärm, den er mir schicken würde, zu übertönen. „Wie soll das gehen, wenn ich kaum sprechen kann?“, fragte ich mit leiser Stimme. „Versuchen wir‘s“, sagte er und drehte an den Knöpfen seines Mischpultes. Meine Stimme ging im anschwellenden Lärm unter, der abrupt in Stille überging und mich schreien ließ: „Zwölf!! Dreizehn!!!“ Der Arzt muss mein Erstaunen gesehen haben und trieb mich an: „Weiterzählen, weiterzählen! Mindestens eine Minute lang irgendetwas sagen, denn das Gehirn muss wieder die Kontrolle bekommen. Es muss wissen, dass es zulassen darf, dass Sie etwas sagen. Dass es das Recht hat, eigene Gedanken zu haben. Reden Sie, egal was, zählen Sie weiter, reden Sie! Das Gehirn muss Ihre Stimme hören, damit es sich mit ihr rückkoppeln kann!“
Drei Wochen lang hatte ich mich nicht gehört. Überwältigt zählte ich weiter, sah ihn dabei angestrengt an, als müsste ich in seinem Gesicht ablesen, ob dies alles hier wahr wäre. „Genug“, sagte er, und ich bekam einen Weinanfall. Tränen der Erleichterung, Tränen der Scham und der Hilflosigkeit vermischten sich. Es war deutlich, dass nicht nur die Stimme vorübergehend weg gewesen war. Ich hatte die Macht über mein Denken, meinen Körper verloren. Schleichend, notwendenderweise. Jetzt „gehorchte“ er wieder. Gott sei Dank! Der Arzt erklärte, dass es irgendein Problem gäbe, das dem Verstand sagte, er hätte nichts zu melden. Das ökonomisch ausgerichtete Gehirn aber würde sich den Energieaufwand für etwas, das es als sinnlos einschätzte, sparen. Ich wusste sofort, wovon er sprach. Es ging nicht nur um einen funktionierenden Körper, sondern um mich als ganze Person. Er schickte mich zum Psychiater, der nach einigen Sitzungen die ehelichen Kommunikationsprobleme als Ursache ausmachte und mich mit meinem Mann zusammen bestellte. Er erklärte, es wäre nicht so sehr das Bild an sich, sondern das darauf abgebildete Familienthema auf seinem Geburtstagsbild gewesen, auf das dieser so uninteressiert reagiert hätte, aber das tröstete mich nicht. Er riet uns zur Paar-Therapie und erklärte sich hierfür als nicht kompetent. Die Paar- und Familientherapeutin erklärte, Vertrauen wäre die Grundlage einer guten Beziehung. „Wenn Sie sich nicht an Abmachungen halten und Ihre Versprechen nicht einhalten, können Sie kein Vertrauen erwarten. Wenn kein Vertrauen da ist, kann weder Freundschaft noch Liebe gedeihen.“ – „Gut, das habe ich verstanden. In Zukunft werde ich halten, was ich verspreche“, sagte mein Mann. Es gab keine Verbesserung, aber ich hoffte auf sie. Ich wollte keine Scheidung mehr.
Der nächste, verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Paartherapeut schlug vor, mit Listen zu arbeiten und darin Woche für Woche die für jeden anfallenden Arbeiten festzuhalten. Da wir beide gleich viel im Beruf arbeiteten, sollten auch die alltäglichen Arbeiten zu Hause gleich aufgeteilt werden. Mein Mann fand über das Arbeitsamt eine Haushaltshilfe und beauftragte sie, dreimal in der Woche an seiner Stelle zu kochen und zu spülen. Somit war gut die Hälfte ihrer Arbeitszeit aufgebraucht, ohne dass nachhaltige Hausarbeiten gemacht waren. Er sah sie nicht und hatte ein gutes Gewissen, Zeit zum Angeln und Reiten und für seine Kunst. Auch ich wollte etwas freie Zeit. „Mein Hobby sind die Pferde, und deines nun mal die Kinder“, meinte er dazu, und es hatte keinen Sinn, weiter zu argumentieren.
Scheinschwangerschaft, Pferdeschwangerschaft und endlich Schwangerschaft
Trotz der Anspannung hatte mein Körper sich entschieden: Er wollte ein drittes Kind. Mein Verstand wusste wohl, dass das ein ziemlich verrückter Wunsch war. „Gib dich doch mit zwei Kindern zufrieden“, sagte mein Mann, „und sei froh, dass sie gesund sind. Ein drittes wäre mir zu viel.“ Ich wusste, dass er recht hatte. Zwischen Verstand und Körper aber bediente mein Körper den längeren Hebel. Sah ich ein kleines Kind, schoss mir sofort Milch in die Brust. In früheren Zeiten hätte ich eine gute Amme abgegeben, jetzt aber brach ein zerrender innerer Krieg in mir aus. Ein Zwiespalt, groß wie ein Canyon. Wurden die Gefühle zu stark, schossen sie durch mich hindurch wie ein reißender Fluss durch ein zu enges Bett. Rissen mich hin und her auf ihren Wellen, rissen mich auf, raubten mir Kraft und klares Denken. Spülten mich irgendwo ermattet ans Ufer. Manchmal war mein Mann mit einer Schwangerschaft einverstanden, und ich schwebte sofort im siebten Himmel. Dann überlegte er es sich anders, und ich fühlte mich tonnenschwer und tieftraurig. Mich dagegen wehren konnte ich nicht: Ich war ein Spielball meiner Gefühle und Hormone. Mein Mann bestand auf der Spirale als Verhütungsmittel, weil er befürchtete, ich würde die Pille vergessen, um meinen Willen doch durchzusetzen. Aber es ging nicht um meinen Willen. Der Wunsch nach einem Kind konnte nicht durch ihn gebrochen werden; er war wie ein selbstständiges Wesen, das sich in mir ausbreitete. Die gefühlsmäßigen Achterbahnfahrten, die durch den Wechsel zwischen Zustimmung und Ablehnung meines Wunsches ausgelöst wurden, waren kaum auszuhalten. Mein Mann konnte natürlich nichts mit ihnen anfangen. Schließlich war er einverstanden. „Aber nur, wenn der Haflinger auch schwanger werden darf.“ Und er erklärte, wie schlimm es für eine Stute sein müsse, kein Fohlen zur Welt bringen zu können. Mich befremdete diese Argumentation. Aber sie zeigte auch eine Möglichkeit auf. Endlich Erleichterung! Als die Stute „voll“ war, war mein Mann nicht mehr einverstanden, dass auch ich schwanger würde. Ich konnte es nicht fassen, denn in dieser Angelegenheit war ein Kompromiss unmöglich. Ich musste mich geschlagen geben. Aufgeben, denn Gespräche über dieses Thema kosteten mich unheimlich viel Kraft. Mein Körper reagierte blitzschnell auf ein bloßes Wort, und so heftig, dass ich keine Chance zum Einordnen und Verarbeiten hatte. Ich hoffte, das Thema beiseiteschieben zu können, und gab widerwillig auf. „Wenn ich schon meinen Wunsch aufgebe, möchte ich wenigstens, dass nie mehr das kleinste Gespräch über das Thema aufkommt. Und dass auch nie von Abtreibung die Rede sein wird, sollte es doch zu einer Schwangerschaft kommen.“
Es gelang mir nach und nach, das Wüten in meinem Körper und jeden Gedanken an ein Baby zu unterdrücken. Als jedoch meine Schwester wieder schwanger wurde, flammte das Thema erneut und heftig auf. Ich überlegte, wie ich es bändigen könne. Vielleicht war es die Vorstellung, drei Geschwister wären die perfekte Konstellation für eine gute Entwicklung von Kindern und Eltern, die mich schon seit der Kinderzeit begleitete, die so eigenmächtig und stark in mir schrie. Doch vielleicht brauchte ich mir nur vorzustellen, zwei wäre die ideale Kinderzahl, und ich könnte so meine Gefühlsschwankungen und Hitzewallungen austricksen? Ich gab mir viel Mühe, aber ohne Erfolg. Die Regel setzte aus, und die Brust gab Milch. Der Frauenarzt war überzeugt, ich wäre im dritten Monat, und stellte dann doch eine Scheinschwangerschaft fest. Später träumte ich von einem Kleinkind auf dem Arm, das meiner Tochter sehr ähnelte und dennoch nicht sie war. Ich wusste, dass ich schwanger war. Zu meiner Überraschung fragte der mit alternativen Heilmethoden arbeitende Arzt, der mich zu der Zeit untersuchte, ob ich ein Kind erwarte. „Ich denke schon. Aber wissen kann ich es nicht; normalerweise bekomme ich erst nächste Woche meine Blutung“, sagte ich. Er schmunzelte und teilte meine Ahnung. „Es wird ein Sonnenkind werden“, sagte er.
Bei meiner Schwiegermutter war der Brustkrebs wieder aufgeflammt. Es ging ihr nicht gut, und mein Mann hoffte, ihr mit der Neuigkeit der Schwangerschaft Freude zu machen. Ich erlebte sie in ihrer Krankheit einfühlsamer als davor. Manchmal konnten wir so miteinander reden, dass ich den Eindruck von gegenseitigem Gehört- und Verstanden-Werden hatte. Sie starb Anfang des Jahres, in dem unser Jüngster im Sommer zur Welt kam.
Wehen
Das Haus war für fünf zu klein; wir mussten anbauen. Die Arbeiten sollten bis zur Geburt abgeschlossen sein, aber es gab Probleme zwischen Architekt und Baufirma, und zwischen beiden und uns. Man versuchte uns mit der Drohung zu erpressen, das Dach halb isoliert im Winter offen stehen zu lassen, sodass wir zusätzlich die Kosten für das Abtragen und die Erneuerung tragen müssten. Wir schalteten Rechtsanwalt und Experten ein und zogen in ein anderes Haus im Dorf. Das Gericht bot einen Vergleich an. Wir waren die Firma los und mussten nun auf eigene Faust die restlichen Arbeiten organisieren. Es gab viel zu tun.
Der Schwiegervater war oft bei uns, auch vor der Geburt des Kindes, und fragte ständig, ob es noch nicht so weit wäre. Ich bat ihn, nicht mehr zu fragen; ich würde ihm Bescheid geben, sobald die Wehen einsetzten. Kaum hatte ich mich im Hof in die Sonne gelegt, kam mein Mann und fragte nach: „Ist es noch nicht so weit?“ Da ich seinem Vater verboten habe, danach zu fragen, würde er jetzt dauernd ihn darauf ansprechen, und da müsste er eben nachfragen, um eine Antwort geben zu können. Wütend platzte es aus mir heraus, auch ich hätte das Recht, ernst genommen und in Ruhe gelassen zu werden, und dass ich Bescheid gäbe, sobald eine Veränderung kommen würde. Vielleicht lag es daran, dass er sich selbst in seinem Loyalitätskonflikt komisch vorkam und sich in diesem Moment ähnlich fühlte wie ich. Jedenfalls kam an, was ich sagte. Ich hatte herrlich ruhige, sonnige Stunden an diesem Nachmittag. Meine Handflächen kribbelten auf eine ungewöhnliche Art. Ich überlegte, ob mir wohl ein Arzt dazu etwas sagen könnte, und beschloss, die Sache auf sich beruhen zu lassen.
Als der Junge zur Welt kam, hatte mein Mann seine Vorbehalte abgelegt und schien recht zufrieden. Sein Antrag auf eine halbe Stelle war bewilligt worden. Er hatte mit der größeren Familie und dem Wunsch, künstlerisch zu arbeiten und beides unter einen Hut zu bekommen, argumentiert. Das hörte sich gut an.
„Du zuerst!“
Nach dem Tod seiner Frau war der Schwiegervater noch komplizierter als zuvor. Er blieb öfters auch längere Zeit bei uns. Da er sich schlecht beschäftigen konnte, wartete er den ganzen Morgen auf die Zeitung; er kommentierte alles, was er sah. Er saß neben mir, wenn ich bügelte. Er freute sich, wenn sein Sohn ihn mit zum Fischen nahm. Dann freute auch ich mich auf ein wenig Ruhe. Ich konnte nicht mehr abschalten, nicht mehr ruhig sitzen, nicht mehr schlafen. Alles war mir zu viel. Ich fühlte mich nicht imstande, ein zusätzliches Familienmitglied zu übernehmen. Mein Mann aber wollte seinen Vater nicht alleine zu Hause lassen. Über ein Altenheim wolle er erst mit ihm reden, wenn ich zuvor meinen Eltern denselben Vorschlag gemacht hätte. Als dies geschehen war, wollte er nichts mehr von unserer Abmachung wissen. Es ging mir immer schlechter; ich bekam Starrkrämpfe oder kurze Ohnmachtsanfälle und kippte einfach um. Mein Mann organisierte bei einem ihm bekannten Arzt Antidepressiva, die er mir dann überbrachte. Ich verstand weder ihn noch den Arzt und hatte das unangenehme Gefühl, dass über mich wie über ein technisches Problem befunden wurde. Als Mensch fühlte mich nicht ernst genommen, doch mein Mann meinte wohl, mir auf diese Art Gutes zu tun.
Reiki
Schließlich meldete ich mich zu einer einwöchigen Anti-Stress-Kur in Bad M. an. Ich fühlte mich wie in eine dicke, graue Wolke gehüllt; ich konnte nichts wirklich wahrnehmen, fühlen oder genießen. Im Massage-Pavillon warb ein Poster für Reiki-Behandlungen mit den Worten „Wirkt bei physischen und psychischen Problemen“. Ich hatte keine Ahnung, was ich mir vorstellen sollte, machte aber doch einen Termin aus. Ich wollte mir nicht vorwerfen müssen, ich hätte nicht alles versucht, um wieder gesund zu werden.
Als ich einige Tage später auf der Liege lag, erklärte mir die Therapeutin, Reiki wäre eine japanische Methode der Energiearbeit. Während der Behandlung wäre sie sozusagen ein Kanal für die Lebenskraft, die sie mir ohne Berührung über ihre Hände zukommen ließe. Diese Energie verteilte sich von selbst im Körper und versorgte die Stellen, an denen sie am nötigsten gebraucht würde. Ich selbst bräuchte nichts zu tun und könnte auf das achten, was in meinem Inneren vor sich ginge. Ich ließ es geschehen, spürte, wie mein Rücken weicher wurde und sich angenehm auf der Unterlage ausbreitete. Spürte Wärme den Körper durchziehen und auch Kälte. Die Empfindungen waren sehr klar und deutlich und weckten in gewisser Weise die Neugierde meines Körpers. Er bekam mit, dass in ihm etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Die Hände der Therapeutin waren über meinem Kopf oder über der Brust, und ich spürte Kribbeln in den Beinen. Plötzlich sah ich mit geschlossenen Augen Farben, strahlend und bunt. Ich war fasziniert. Endlich hatte ich etwas gefunden, das eine Reaktion bewirkte; das irgendetwas in mir in Bewegung brachte. Sofort buchte ich weitere Termine, kaufte ein Buch zum Thema. Ich war von dieser Energiebehandlung so begeistert, dass ich sie auch „können“ wollte.
Die Einführung in Reiki geschieht über Einweihung oder Initiation, die von einem Meister übertragen wird. Über die Therapeutin kam ich zu einer sehr sensiblen, großzügigen Meisterin. Als ich eingeweiht wurde, sagte sie: „Du hattest schon eine spontane Einweihung; bei dir ist dies eigentlich nicht mehr nötig.“ Dies konnte eine Erklärung für das besondere Kribbeln auf meinen Handtellern seit der letzten Schwangerschaft sein. Eine Bekannte stellte sich wöchentlich für eine Reiki-Behandlung zur Verfügung. Gleichzeitig tankte auch ich Kraft und hatte während der Behandlung Urlaub vom Alltag. Das Vertrauen in etwas Größeres und das Erleben seiner heilenden, oder wenigstens entspannenden Wirkung war wie ein Geschenk, das ich gerne bereit war anzunehmen.
Problematische Feiertage
Der Ehealltag funktionierte weiter im Nebeneinander und mit wenig Zweisamkeit. Einmal fuhren wir zu einer Aufführung von Goethes Faust. Ich hatte mich sehr auf den besonderen Abend gefreut und war in erwartungsfroher Stimmung. Mit den Lichtern des Theaters gingen auch die meiner Augen aus; dann kamen kalte und heiße Schweißausbrüche und das Gefühl, mich aufzulösen. Da ich mich kaum auf den Beinen halten konnte, riet der Sanitäter, sofort in ein Krankenhaus zu fahren. Ein Kreislaufkollaps wurde festgestellt; das limbische System hatte verrückt gespielt. Spritze, Ruhe, und das war‘s. Eine mögliche Übersetzung hieß: „Sie hat nur verrücktgespielt. Es ist nichts, nur ein Zeichen, dass sie eigentlich nicht ins Theater wollte. In Zukunft werden wir das bleiben lassen.“
Was aber hatte mein Körper gefühlt, wogegen ein anderer Teil in ihm rebellierte? Hatte er sich dagegen gewehrt, mittlerweile ungewohnte Freude zu erleben? War es ihm lieber, an unterdrückter Wut und Resignation festzuhalten? Es war mir unerklärlich und auch peinlich, zumal wir das Auto des Freundes, mit dem wir gekommen waren, ausgeliehen hatten, und dieser seinen Heimweg anders organisieren musste. Ich fühlte mich schuldig, auch wenn ich wusste, dass dieses Gefühl fehl am Platz war. Der Vorfall machte meinem Mann und mir klar, dass es so nicht weitergehen könne; dass wir Zeit für uns brauchten, Zeit, um wieder zu uns zu finden und zu vertrauen. Wir beschlossen, zu unserem zehnten Hochzeitstag eine Woche Ferien in Florenz zu machen, und mein Mann bot an, die Buchung zu übernehmen. Er ließ sich Zeit, vergaß das Vorhaben und plante einen Dreitagesritt mit seinen Reitfreundinnen. Als er mir davon sprach, bedauerte er, nicht mit mir wegfahren zu können. Ich schrie auf ihn ein, schrie wie eine Besessene meine ganze Wut und Enttäuschung heraus. Schrie, er sollte sich um die Unterbringung der Kinder kümmern, ehe er zum Reiten führe, denn dafür würde ich nicht zu Hause bleiben, sondern wie geplant verreisen. Schließlich meinte er, er würde dann doch das Reiten sein lassen und mit mir nach Florenz kommen. Es wurden keine wirklich entspannten Ferien.
Verlassenheit
Obschon wir zusammen lebten, fand ich kein Echo. Was ich auch tat, es war nie gut genug. „Ich könnte dich lieben, wenn …“ Ich strengte mich an. Dennoch war ich nicht gut genug, um wirklich „dazuzugehören“. Ich war nicht makellos. Mit zwanzig hatte ich zum ersten Mal geheiratet. Nach dem Studium verließ mich mein tunesischer Mann und den gemeinsamen kleinen Sohn. Monatelang war ich wie versteinert, funktionierte wie ein Automat. Ging zur Arbeit, kümmerte mich um mein Kind. Stierte, wenn es im Bett lag, auf dem Sofa kauernd in die Glotze, wo graue Schatten und undefinierbare Geräusche etwas Bewegtes in die starre Stube brachten. Entschloss mich zur Scheidung, für die er über die Zeitung gesucht wurde. Von tunesischer Seite her hätte ich eine dreifache schriftliche Erlaubnis des Vaters haben müssen, um meinen Sohn zu adoptieren, was der einzige Weg war, über den er meine Nationalität bekommen konnte. Wäre er irgendwann irgendwie in Tunesien bei der Großmutter abgesetzt worden, hätte ich nie eine Chance gehabt, ihn wieder zu mir zu nehmen. Dem Gesetz nach hatte ich jedoch als alleinstehende Frau nicht das Recht, ein Kind zu adoptieren; dass eine Mutter das eigene Kind adoptieren will, ist nicht vorgesehen. Für mich bedeutete dies: Obschon du ein Kind ausgetragen und zur Welt gebracht hast und dich kümmerst, wirst du nicht als Mutter anerkannt. Dein Muttersein ist weit weniger wert als die Unterschrift eines Mannes; du hängst nicht nur privat, sondern auch legal von einem Mann ab, so oder so. So ist es nun mal …
Als ich meinen späteren Mann kennenlernte, glaubten wir an unsere Liebe. Im Nachhinein denke ich, dass wir alle beide Liebe mit der Hoffnung auf einen Neuanfang und eine gute Zukunft verwechselten. Gemeinsam adoptierten wir nach der Eheschließung meinen Sohn, der damit eine neue Nationalität und den Familiennamen meines zweiten Mannes bekam.
Nach den Anforderungen der letzten Examina und des Umzugs verflog die abenteuerliche Frische des gemeinsamen Aufbruchs. Mein Mann meinte, ich könnte dankbar sein, dass er mich als geschiedene Frau geheiratet hätte; in Bezug auf die Adoption hatte er recht damit. Auch seinen Eltern müsste ich dankbar sein. „Dass sie sich nicht gegen das Kind wehrten, musst du ihnen hoch anrechnen. Da hätten sie auch ganz anders reagieren können!“ Ich fühlte mich ausgeliefert. Dennoch blieb ich. Wollte unbedingt, dass die Kinder bei Vater und Mutter aufwuchsen. Wurde depressiv. Ich erinnerte mich an die „Schande“ der Scheidung der ersten Ehe, an das Gerede und die Genugtuung mancher, die „von Anfang an wussten, dass das nichts werden würde“, an das Zusammenbrechen meiner Ideale einer gemeinsamen Welt, über Rassen und Religionen hinweg. Was ich als Schande empfand, gründete eigentlich in dem Gefühl, mit diesen Werten alleine da zu stehen. Gerede, unwirkliches Gerede, denn mit mir wurde nicht offen geredet. Für mich war es atmosphärisch da, ungreifbar, doch spürbar, und wurde mir höchstens zugetragen. Unwirklichkeit, das Herausfallen aus allen Zusammenhängen; ich wollte das nicht noch einmal erleben. Für meinen Mann war klar, dass nur ich Probleme hatte: „Schließlich bist du krank, nicht ich!“
Der Stimmverlust im dritten Ehejahr gehört medizinisch in dieselbe Kategorie wie die Gehstörungen, die sich zehn Jahre später bemerkbar machten.
Was sollte ich dazu sagen?
Die Lähmungen traten monatlich während weniger Tage auf und verschwanden dann von selbst. Ich musste wieder auf die Beine kommen, Kinder und Haushalt versorgen und unterrichten. Praktischerweise traten die starken Beschwerden meist am Wochenende auf, sodass sie zunächst mein Berufsleben nicht störten. Der Hausarzt, später der Internist und der Neurologe konnte nichts mit ihnen anfangen. Durchgängig war es so, dass sie ein solches Krankheitsbild noch nie gesehen hatten. Und durchgängig waren sie auch alle der Meinung, dass der Ansatz des Kollegen, den ich zuvor aufgesucht hatte, nichts genutzt haben konnte. Sie zeigten sich erstaunt und interessiert und wussten dann auch nicht weiter.
Das Jahr meiner ersten Lähmungserscheinungen war auch das Jahr, in dem ich ein Kunststipendium gewonnen hatte. Zusammen mit meinem Mann und anderen Künstlerkollegen hatte ich an einer Kunstmesse in Pirmasens teilgenommen. Ich hatte meinen Stand verlassen, um auf Erkundungstour zu gehen. Als ich zurückkam, wurde ich von einem Mann und einer Frau angesprochen. Nachdem sie geklärt hatten, dass ich zu dem Stand mit den „roten Bildern“ gehörte, baten sie mich, mich zu setzen, denn sie hätten mir etwas Wichtiges zu sagen. Ihr Kunstverein hatte mich unter allen Ausstellern als Preisträgerin ihres Stipendiums ausgewählt. Neben einem sechswöchigen Aufenthalt in Jockgrim hatte ich einen Geldpreis und zusätzlich eine Ausstellung gewonnen. Als wir nach Hause kamen und die Neuigkeit erzählten, sagte mein Schwiegervater zu seinem Sohn: „Du musst auf deine Frau aufpassen, sonst überholt die dich noch.“ Was sollte ich dazu sagen? Er wird es ironisch gemeint haben. Aber ich verstand, dass ich als Gefahr angesehen wurde. Es könnte sein, dass ich mich durch diese Bemerkung unbewusst weiter zurücknahm. Ich hatte keine Antwort auf die neuen und eindringlichen Fragen: Habe ich Gunst oder aber Missgunst verdient? Steht diese öffentliche Anerkennung mir zu? Darf ich meinen Mann „überholen“? Möglicherweise hatte ich vor beidem gleichermaßen Angst. Vielleicht war die Lähmung in diesem Dilemma die einzige Möglichkeit für meinen Körper, mich irgendwie zu retten, denn in dieser Verfassung war ich für niemanden eine Gefahr. Heute gehe ich davon aus, dass der Körper so „denkt“. Damals war ich es gewohnt, auf andere Rücksicht zu nehmen, ihnen mir gegenüber den Vorrang zu geben. Zuerst kamen mein Mann und sein zwangsneurotischer Vater. Es galt, das Hamsterrad von Druck und Kontrolle und erneuter Kontrolle möglichst ruhig zu halten. An ihm zu drehen, schien mir ihre Art zu sein, allem Unangenehmen oder Einschränkenden aus dem Weg zu gehen. So konnten sie aus der Distanz heraus wissen und kommentieren, was andere zu tun hatten, und sich dabei sicher und überlegen fühlen. War das Rad einmal angedreht, entwickelte es einen Sog, der alle Menschen der Umgebung einbezog. Manchmal verkeilten sich die beiden Räder meines Mannes und seines Vaters. Dann wurden sie zu einer Art Zahnräder; eines trieb das andere an, und man konnte sich glücklich schätzen, wenn man nicht hineingeriet. Meine einzige Möglichkeit, weiter „Rücksicht“ zu nehmen, war die, noch „rücksichtsvoller“, unbeweglicher und unsichtbarer zu werden. Es war verrückt.
Zwickmühlen-Suppen nähren nicht!
Die natürliche Entwicklung des Lebens war schon lange aus der Ordnung geraten, hatte sich für mich „verrückt“. Ich konnte sagen, was ich wollte, mein Mann interpretierte es, wie er es wollte. Es war, als ob er den Ideen in seinem Kopf mehr Glaubwürdigkeit schenkte als mir. In unserer letzten Paartherapie meinte er: „Eigentlich bin ich ein ganz anderer.“ Leider konnte er diesen anderen nicht nach außen bringen. Es war, als wäre dieser andere nach der Hochzeit verschwunden; als wäre er verdrängt worden durch starre Vorstellungen darüber, wie „man“ sich als Ehemann oder Ehefrau zu verhalten hätte. Die Freier-Zeit wäre vorbei, hatte er schon früh gesagt. Ich verstand nicht, warum ein zugewandter und gleichzeitig offener Umgang in der Ehe nicht weitergeführt werden könnte. Für ihn war es offensichtlich: „Davor warst du meine Freundin. Jetzt aber bist du meine Frau.“ Die Therapeutin beendete die Zusammenarbeit, weil sich die Gespräche immer nur im Kreis drehten. Wie dies zu ändern wäre, wusste ich nicht. Auch hatte ich keine Ahnung, wie ich mit den Hinweisen meines Körpers umgehen sollte. Aber ich wusste, dass er seine eigene Sprache und Weisheit hatte und ich vielleicht wenigstens mit dieser in Dialog treten könnte. Ich hatte einen weisen Körper, der eigenmächtig reagierte. Mit dem Verstand hätte ich solche Symptome nicht produzieren können. Ich wollte darauf achten, was sie mir zu sagen hätten. Durch die Hinweise vielleicht weiterkommen. Ich wollte neugierig auf die Sprache meines Körpers achten, und ich wollte ihr trauen. Die Lähmungen behinderten mich stark und schränkten meine Lebensqualität erheblich ein. Erstaunlicherweise nahmen Seitwärts-Gehen und Treppensteigen weniger Kraft als das Geradeaus-Gehen in Anspruch. Auch das war eine Aussage: Es wäre besser, den eingeschlagenen, geraden Weg zu verlassen. Einen eigenen Nebenweg zu finden, der zur Selbstannahme und Entfaltung führt. Wie das geschehen konnte, war mir unklar. Aber das Ziel war deutlich.
Ich würde lernen, mich selbst wirklich ernst zu nehmen. Meinem bisherigen Leben zu antworten und deutlich zu machen, dass ich genug hätte von seinem Zwickmühlen-Spiel. Genug davon, dauernd tun zu müssen, nie fertig zu sein, genug davon, anderer Leute Suppe auszulöffeln. Wie oft hatte ich das Gefühl gehabt, dies tun zu müssen, weil der Teller ein gemeinsamer Teller war und irgendwie immer wieder Suppe dazukam. Ich hatte nun endgültig genug von dieser Wahl zwischen dem einen und dem anderen Übel, von der Wahl, die keine war. Genug von diesen Zwickmühlen-Suppen, die sich selbst immer wieder neu kochen. Die ich mir einverleiben musste, in der Hoffnung, dass alles besser würde, wenn ich den Teller geleert hatte. Dranbleiben aus Notwendigkeit. Nein, diese Zeiten waren vorbei! Zukünftig würde ich den Teller stehen lassen. Zwickmühlen-Suppen nähren nicht.
Teil 2
TRAUER, ENTWICKLUNG UND VERANTWORTUNG
Zu der Zeit war ich öfters wie in einem grauen Zylinder gefangen; ich hatte starke Migränen, konnte weder ruhig sitzen noch schlafen. Ich fühlte mich ausgeliefert. Die Trauer um meinen um ein Jahr jüngeren Bruder, der acht Jahre zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, kam wieder hoch. Auch das Verbot, im Beisein meines Mannes zu weinen. Ich nahm mich sehr zusammen und weinte und schrie nur, wenn ich allein war. Später bekam ich Starrkrampfanfälle. Die Trauer um dieses Erleben war schambesetzt.
Trauergestalt
Die zweijährige Ausbildung in Gestaltpädagogik, einer ganzheitlichen Pädagogik, die stark auf Selbst- und Fremdunterstützung sowie persönlichkeitsfördernde Aspekte setzt, war fast zu Ende. Eines der letzten Themen, die aufgegriffen wurden, war „Beziehungen“. Erstaunlicherweise trat bei diesem Thema nicht etwa die Ehe, sondern Verstorbene in den Vordergrund. Mit ihnen hatte ich schon länger zu tun. Neben der Trauer um meinen verunfallten Bruder gab es noch eine besonders tiefe, ungreifbare Trauer um einen anderen Bruder, der in der frühen Schwangerschaft verstarb und nur einige Monate älter als ich gewesen wäre. Dazu gehörte auch die Trauer um meine erste eigene Tochter, die ebenfalls als Fehlgeburt starb, und die um einen Bruder meiner Mutter, der mit sechs Jahren an verschleppter Blinddarmentzündung gestorben war. Meine Mutter hatte das Gefühl, ihre Mutter hätte lieber einen Jungen gehabt. Es gab ein ganzes Trauergewirr um ungeborene und früh verstorbene Kinder und um das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Ein ganzes Paket, das ich von Mutter und Großmutter übernommen zu haben schien, und das ich nicht an meine Tochter weitergeben wollte. Dieses Muster der Übernahme und Weitergabe diffuser Schuld- und Trauergefühle von einer Generation an die nächste musste unbedingt unterbrochen werden.
Besonders den Gedanken an meinen nicht geborenen Bruder konnte ich kaum ertragen. Zu Hause traf ich nur auf Unverständnis mit dieser ungreifbaren Trauer, auch mit der um meine Tochter; schließlich hatte ich sie ja nicht einmal gesehen! Meine Mutter meinte, sie selbst würde nicht mehr an ihr fehlgeborenes Kind denken, und sie verstände nicht, wieso ich mich damit plagte. Ich verstand es auch nicht und wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen konnte.
An diesem Gestalt-Wochenende traf mich die biblische Geschichte von Jakob, der seinen älteren Zwillingsbruder um das väterliche Erbe betrog, sehr tief. Sie bestätigte mein Gefühl, anstelle meines Bruders zu leben. Schuld und Scham. Jakob, der Lügner. Auch ich eine Lügnerin: Ich war nicht die Älteste. Ich wusste, dass es so war, auch wenn es nicht den Anschein hatte. Das Gefühl, den Platz in meinem Leben, mein Leben, nicht zu verdienen, war sehr stark. Für alle anderen war und blieb ich die „Älteste“. Weil dies in der Realität auch offensichtlich so ist, musste ich tun, als hätten sie recht. Die Einsicht in diese sich widersprechenden Wahrheiten machte sich körperlich heftig bemerkbar, ein Gefühl, als würde ich entzweigerissen. Ich zitterte am ganzen Leib, schluchzte laut und anhaltend, ohne mich dagegen wehren zu können, und konnte anschließend auch nicht mehr gehen.
Einige Zeit später schrieb eine der Kurs-Leiterinnen mich an. Als eine Klientin von ihrer befreienden Teilnahme an einem sogenannten „Lebens- und Trauer-Umwandlungsseminar“ erzählte, hätte sie sofort mein Bild vor Augen gehabt, weswegen sie mir Adresse und Namen weitergeben wollte. Ich spürte sofort meine innere Zustimmung. Mein Mann warnte mich vor dem griechischen Therapeuten, „diesem Guru“. Trotzdem meldete ich mich zu einem Trauerseminar an. „Mein Einverständnis hast du nicht“, sagte er scharf, als ich wegfuhr.
Trauerseminar: Einführung in das Leben
Ich war sehr gespannt, was mich erwarten würde, und sehr entschlossen, mich darauf einzulassen. Auch an jenem Tag konnte ich nur mit großer Anstrengung gehen. Der Leiter des Seminars, Dr. Jorgos Canacakis, ein unscheinbarer Mann in den Sechzigern, begrüßte mich im Foyer und wies mir den Weg zu den Zimmern. Unweigerlich fragte ich mich, ob mein Mann sich so einen Guru vorstellte oder in ihm vielleicht doch den Doktor der Psychologie und den Psychotherapeuten sehen könne.
Es war eine Herausforderung, mich während der Vorstellungsrunde auf den Beinen zu halten. Zunächst erklärte Jorgos uns Teilnehmern sein „Lebens- und Trauer-Umwandlungsmodell“ mit einem breit gefassten Verständnis der Trauer. Gesundes Trauern verstand er als schmerzhaftes, aber bewusstes Anerkennen dessen, was ist. In diesem Sinne wäre es eine wichtige Ressource auf dem Weg der persönlichen Entwicklung und mehr als die Reaktion auf den Tod eines geliebten Menschen. Auch wäre Trauer ein Gefühl, das von Anfang an zum Leben gehörte und ebenso zu dessen unterschiedlichsten Bereichen. Sie träte immer auf, wenn wir etwas zu verabschieden hätten und Gewohntes aufgeben müssten. Das Trauerspektrum, das er aufzeichnete, reichte von der kosmischen Entstehung der Erde bis zur Informationsspeicherung in der Zelle, vom Abschied des Embryos vom schützenden Mutterbauch bis zum Abschied des Sterbenden vom Leben. „Veränderungen gehören zum Leben; erst durch sie ist Entwicklung möglich“, sagte Jorgos. „Somit ist das Leben ein immerwährender Reigen von Verabschiedung und Neubeginn. Daran können wir nichts ändern, das ist so.“ Trauer könnte entweder lebensfördernd oder lebenshindernd sein. Könnten wir unserem Schmerz angemessen begegnen, würden wir unsere Trauer auf lebensfördernde Weise durchleben. Die breite Auffächerung der Trauerthematik beruhigte mich und ließ mich neugierig werden. Die Fragen nach der Begründung meiner Trauer waren der Gewissheit gewichen, dass sie berechtigt war und mich auf einen guten Weg gebracht hatte. In den Notizen von damals lese ich: „Ich fühlte mich lebendig und stark. Auch meine Beine waren hellwach, lebendig und stark, sie konnten mich wieder tragen, ich konnte ihnen wieder vertrauen. Mir war, als hätte ich mich um 180 Grad gedreht, als wäre ich von der Schattenseite auf eine hellere, wärmere gewechselt. Es war nicht die Sonnenseite, aber die würde ich auch noch finden. Bis jetzt war ich in die falsche Richtung gelaufen.“
Neue Vokabeln: Sinn und Vertrauen, Verantwortung und Entwicklung
Das Beeindruckende an Jorgos‘ Herangehensweise war die Vielfältigkeit seines Angebotes. Körperarbeit, Rituale und Fantasiereisen, Schreiben, Malen, Gong und Trommel … Immer wieder wurde die Bedeutung der verschiedenen Sinne hervorgehoben: Als Eindrucks- und Ausdrucksmedien verbinden sie uns mit unserer Umwelt, lassen uns „bei Sinnen“ sein. Verantwortung können wir nur übernehmen, wenn wir unseren Sinnen trauen, denn durch sie ermächtigen wir uns selbst, verbinden wir uns mit unserer Macht. Verantwortung für andere können wir nur übernehmen, wenn wir sie zuerst für uns selbst in Anspruch nehmen. Was so logisch und selbstverständlich scheint, klang in meinen Ohren revolutionär. Die Theorie wurde anschließend am Beispiel einer bergsteigenden Seilschaft geübt, deren oberstes Gebot hieß: bei Sinnen bleiben! Klar denken und handeln! Unter keinen Umständen war es erlaubt, sich eigene Schwächen nicht einzugestehen; eine kleine Unachtsamkeit könnte schlimmstenfalls die gesamte Seilschaft in den Abgrund reißen. Eigenverantwortung zu übernehmen, bedeute also, gleichzeitig Verantwortung für alle zu übernehmen.
Jorgos ermahnte uns öfters, Vertrauen zu haben. Man sollte die Dinge auf sich zukommen lassen und beobachten, wie sie sich dabei entwickelten. Dies bedeutete gleichzeitig, bei Sinnen zu sein und auch im richtigen Moment das Richtige zu tun, Verantwortung zu übernehmen. Ich beschloss, die hier geltenden Spielregeln einzuhalten und probehalber zu versuchen, völlig zu vertrauen, in die Seilschaft und ihren Leiter und auch in mich. Es kostete mich viel Überwindung. So nahm ich es mir nur für die eben bevorstehende Übung vor, denn ich hatte das Gefühl, mich freier und sicherer zu spüren, wenn ich meine Kontrolle nicht abgab. Im richtigen Leben wusste ich nicht, wem und auf was ich vertrauen konnte. Hier könnte es ja anders sein. „Worauf kann ich vertrauen?“ Jorgos‘ Antwort war immer dieselbe: „Vertrau! Sei im Vertrauen! Suche das Gefühl in dir, nicht im Außen.“ Hier lag ein bedeutender Knackpunkt. Ich wusste, dass ich keine andere Wahl hatte, wenn ich aus meinem grauen Lebensgehäuse herauswollte.
Die Aussage, dass auch Vertrauen und Verantwortung zueinandergehören, eröffnete mir völlig neue Sicht- und Denkweisen. Mein Verständnis von Verantwortung bedeutete, auf andere zu achten und die eigenen Bedürfnisse hintanzustellen oder gar zum Wohle des größeren Ganzen zu vergessen. Hier aber hörte ich, dass das eigene Befinden nicht nur in eine selbstständige Analyse einbezogen werden soll, sondern sogar die Grundlage dafür ist, sich selbst und auch den Ansprüchen der Allgemeinheit gerecht zu werden. Verantwortung zu übernehmen bedeutet, zwischen verschiedenen Handlungsoptionen wählen zu können und sich im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen, Fähigkeiten und momentanen Möglichkeiten zu entscheiden. Als sei die Übernahme dieser Art von Verantwortung Grundlage für Vertrauen. Als biete dieses Selbstvertrauen die Grundlage, auf der die Übernahme von Verantwortung erst möglich sei. Ich hatte es eigentlich gespürt, gewusst: Selbstvertrauen, Vertrauen und Verantwortung gehören zusammen, gehen miteinander einher. Aber ich hatte es mir nicht eingestanden, nicht zugestanden.
Neben der Verantwortung wurde auch das Wort „Entwicklung“ in meinem Verständnis ganz anders definiert. Offensichtlich fehlte in meinem bisherigen Lernprozess Vertrauen in das Leben. Bisher hatte ich hauptsächlich erlebt, dass meine Entwicklung durch Gebote und Verbote geregelt wurde. Ich war nicht frei. Ich wurde gebraucht und achtete weder auf meine Bedürfnisse noch auf meine Grenzen.
Bei der Erziehung meiner Kinder achtete ich auf Selbstständigkeit: Sie sollten sich freier entscheiden können als ich und besser für sich einstehen. Gleichzeitig wurde mir der Zusammenhang der Bedeutungen bewusst: Indem meine Erziehung auf Selbstständigkeit abzielte, war sie gleichzeitig entwicklungsfördernd. Für meine eigene Entwicklung hatte das Wort „selbstständig“ eine andere Bedeutung. Dadurch, dass ich sehr vieles allein und schon sehr früh „selbstständig“ in die Hand nehmen musste, hatte ich gelernt, die Dinge „einfach durchzuziehen“. Ich hatte keine Wahl. Auch nicht das Recht zu scheitern; es hing zu viel davon ab. Für mich bedeutete Verantwortung zu übernehmen selbstständig zu sein, was bedeutete, stark zu sein. Was bedeutete, neben der eigenen die Arbeit derer zu übernehmen, die dazu aus irgendeinem Grund nicht in der Lage waren. Dass das Wort eigentlich bedeutet, eine eigene Antwort auf die jeweilige Situation zu geben, war für mich revolutionär. Dazu gehört auch die Fähigkeit der Unterscheidung zwischen Realem und Idealem: Sie ermöglicht es, Mögliches und Unmögliches zu unterscheiden; sich und seine Erwartungen, die eigenen Grenzen und Bedürfnisse besser einzuschätzen.
Mit meiner ungeborenen Tochter auf Wanderung durch meine Trauerlandschaften
Die Arbeit, die in dieser trauernden Gruppe geleistet wurde, war eindrucksvoll. In der Vorstellung und im Erleben konnte ich meine ungeborene Tochter zunächst bis zum Kindergartenalter begleiten. Am dritten Tag traten wir Trauernden in Begleitung unserer Toten die Reise zum Totenschiff über den Kamm unserer Trauerberge an und unterhielten uns mit den Toten. Ich notierte damals: „Mein Bruder ging rechts neben mir, und wir hatten guten Kontakt, auch ohne Worte. Links ging Sonja, meine Tochter, oder sie schwebte vor oder neben mir. Manchmal kam sie wie ein Vogel daher und flog. Wir redeten miteinander. Sie hatte sich mittlerweile zu einem sechzehnjährigen Mädchen entwickelt und machte einen zufriedenen und sogar etwas durchtriebenen Eindruck. Ihre Späße ärgerten und amüsierten mich zugleich. Schließlich war ich froh, dass sie sich ihrer eigenen Fähigkeiten so gut bedienen konnte. Vielleicht wollte sie mir diese vorstellen, damit ich begriff, dass sie ‚nicht von der Erde‘, sondern ‚von jener anderen Welt‘ war. Ihre Art gefiel mir; ich war stolz auf sie und froh, dass sie sich auch ohne mein Zutun so gut entwickelt hatte. Ich konnte Vertrauen haben, dass sie gut versorgt war. Am Ende der Trauerberge angekommen, sahen wir einen schönen, flachen Sandstrand, an dem ein großes, weißes Schiff angelegt hatte. Es war das Totenschiff, auf dem unsere Lieben ihre Reise fortsetzen sollten. Es war schon teilweise besetzt. Passagiere, darunter meine Großeltern, winkten vom oberen Deck. Am Strand standen noch viele, um sich zu verabschieden, verlegen redend, sich umarmend. Alle hatten eine ernste Miene; alle wussten, dass der Abschied ganz kurz bevorstand. Ich umarmte erst meinen Bruder und sah mir dann meine Tochter an. Ich wollte ihre Gestalt, ihr Gesicht in Erinnerung behalten. Auch sie sah mich lange und ernst an. Dann umarmte sie mich und ging auf das Schiff. Auf der Gangway drehte sie sich zu mir, und während sie weiterging, winkte sie mir zu, bis sie oben bei ihrem Onkel und ihren Urgroßeltern war. Ihre Ernsthaftigkeit war ihrer Fröhlichkeit gewichen; dieser lebendigen Fröhlichkeit, die mir Trost und Vertrauen war. Das Schiff fuhr ab, langsam, gemächlich. Ich konnte meine Familie noch eine ganze Weile sehen, ehe sie in der Ferne verschwand. Meine Sonja gehörte dazu. Endlich verstand ich wirklich, wohin sie gehörte. Endlich gehörte sie irgendwohin, dazu … Endlich war sie gut aufgehoben.“
Am Seminarende tanzten wir gemeinsam aus unserem Arbeitsraum hinaus in den Park, in das Leben. Und ich wusste, dass ich mit diesem Ansatz weitermachen würde. Das Lebens- und Trauer-Umwandlungs-Modell machte mich neugierig. Die kreative Art seiner Vermittlung erlebte ich auf buchstäblich belebende Weise. Die Eindringlichkeit, mit der ich den Fantasiereisen folgte, faszinierte mich. Ebenso ihre symbolischen Inhalte, die sich von selbst formten, aus dem Nichts aufstiegen. Die ich in meiner Vorstellung als fantastisch-kohärenten Film fast wie auf einer Leinwand ansehen konnte. Ich wollte ihnen weiter nachspüren, denn sie taten mir gut.
Dingdang: GONG!!!
Ein knappes halbes Jahr später, im Herbst 2000, bot sich die Gelegenheit, an einem „Gong-Seminar – zur Entdeckung der eigenen Ressourcen und der Ressourcen der Natur“ auf der ostägäischen Insel Ikaria teilzunehmen, das auch von Dr. Canacakis geleitet wurde. Es sollte eine der wichtigsten Erfahrungen meines bisherigen Lebens und die Grundlage meiner späteren Entwicklung werden. Dementsprechend bekommt sie hier den gebührenden Raum.
In unserem Gruppenraum waren acht verschiedene Gongs aufgebaut. Einen Tag über den anderen arbeiteten wir draußen, an einem zum Thema ausgesuchten Ort in der Natur, der oft zusätzlich in Zusammenhang mit einer Geschichte oder Figur der griechischen Mythologie gebracht wurde. Jorgos betonte immer wieder, dass es in der Arbeit nicht um Therapie ginge, sondern um Heil-Werden, was bedeute, „heil werden zu lassen“. Darin spiegelten sich Verantwortung und Eigenverantwortung, was ich jetzt, da ich die neue Bedeutung dieser Worte verstanden hatte, als neugieriges Abenteuer verstand. Erwartungsfreudig ließ ich mich auf das dazu gehörende gewisse aktive Nichtstun ein, gespannt auf das, was sich mir zeigen würde. Oft schleppten wir Universalgong und Trommeln zum Arbeiten mit auf die Berge oder in die Schluchten. Anderntags wurden die Erlebnisse aufgemalt oder in Texte gefasst, dann in Kleingruppen besprochen und schlussendlich der großen Gruppe vorgestellt. Bis es soweit war, hatte der erlebte Eindruck verschiedene Arten des Ausdrucks durchlaufen.





























