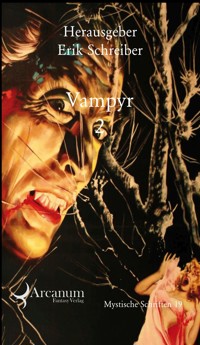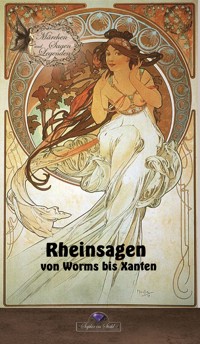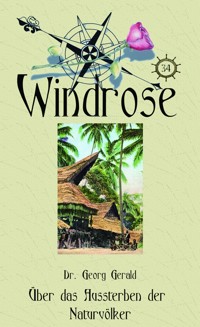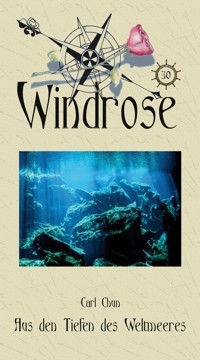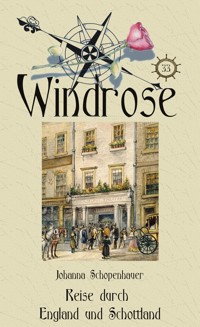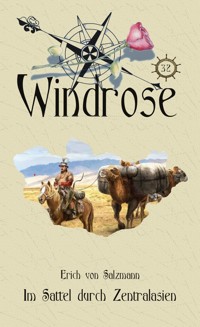4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Freibeuter
- Sprache: Deutsch
Die Kriminellen der Meere haben in frühen Filem und Erzählungen schon immer fasziniert. Dabei unterscheidet man in der Regel nicht zwischen Barbaresken-Korsaren, Korsaren, Kaperer, Piraten und Freibeuter. Es bestehen jedoch diverse Unterschiede. Barbaresken-Piraten oder auch Barbaresken-Korsaren werden die meist muslimischen Kaperfahrer im Mittelmeer bezeichnet, die vom 16. Jahrhundert bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts vor der nordafrikanischen Küste ihr Unwesen trieben. Der Begriff Pirat stammt aus dem griechischen, damit bezeichnet man jemanden, der auf hoher See plündert und Verbrechen begeht. Viele berühmte Piraten waren um das Jahr 1700 aktiv: Als Kaperer wurden Kapitäne und Besatzungsmitglieder bezeichnet, die mit offizieller Genehmigung feindliche Schiffe überfielen. Diese schriftliche Genehmigung war der "Kaperbrief", dessen erste Exemplare aus dem 13. Jahrhundert belegt sind. Der Begriff Korsar kommt aus dem Französischen und bedeutet "Kaperfahrt". Die Kaperfahrer Frankreichs und des Mittelmeerraums nennt man Korsaren. Französische Korsaren gab es seit dem 9. Jahrhundert, als sich Handelsschiffe aus der Bretagne gegen plündernde Wikinger zur Wehr setzten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Freibeuter 2
Frederico de Arroyo
Korsarenrache
Saphir im Stahl
Freibeuter Nr. 2
e-book Nr.: 298
Frederico de Arroyo - Korsarenrache
Originaltitel: unbekannt
Erste Auflage 01.07.2025
© Herausgeber Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
Übersetzung: unbekannt
Titelbild: Archiv Andromeda
Lektorat: Peter Heller
Vertrieb: neobooks
Herausgeber
Erik Schreiber
Freibeuter 2
Frederico de Arroyo
Korsarenrache
Saphir im Stahl
Mit fanatischem Eifer verfolgte Elizabeth, Königin von England und Herrscherin über ein Weltreich, das katholische Spanien mit ihrem Hass und das einstmals so mächtige Land am Mittelmeer erwiderte diesen Hass, unerbittlich leidenschaftlich, trotzig ...
Noch hatte Philipp II. den Verlust seiner Armada nicht verwunden. Der Untergang der siegessicheren Flotte im Kampf mit den Schiffen Britanniens verfolgte den König der Pyrenäenhalbinsel bis in seine schlaflosen, von wirren Träumen geplagten Nächte. Halb krank, unzugänglich, mürrisch, durchmaß der spanische Herrscher die hallenden Riesensäle des Escorial, auf Rache sinnend, geifernd vor verhaltenem Zorn.
In London hohnlachte Elizabeth, eiskalt, zynisch lächelnd, sich die mageren Hände reibend, wenn einer ihrer Kaperkapitäne heimkehrte, den Schiffsrumpf bis an die Planken mit Beute angefüllt, spanischer Beute ... Gold, Schmuck, Waffen, spanischen Galeonen und - Kauffahrern auf den Fluten des Atlantiks und auf den Wogen der Karibischen Meere abgejagt. Und Spanien parierte auf seine Art.
Philipp unterstützte die ebenfalls katholischen Iren in ihrem Freiheitskampf gegen die englische Krone, die verhasste Unterdrückerin, unter deren Willkür und grausamen Methoden die grüne Insel ächzte und stöhnte.
Da eroberte der Graf von Essex in einem kühnen Handstreich die spanische Hafenstadt Cadiz und gab einen neuerlichen Auftakt zu Vergeltungsmaßnahmen.
Und wieder durchpflügten verwegene Männer mit ihren schwerbestückten Schiffen die Meere - Spanier wie Engländer ... lauerten einander auf, bekämpften einander wie ausgehungerte Wölfe, zerfleischten sich - und der Hass nahm zu.
Die Iren, aufs Neue angespornt, verdoppelten ihre Anstrengungen, den englischen Feind aus dem Lande zu jagen ... umsonst.
Der Kampf ging weiter: Spanier und Iren gegen die Engländer - und selbst die freien Korsaren, die Schreckgespenster der Meere, begannen sich auf ihr ehemaliges Vaterland zu besinnen. Wo immer ein Spanier die Route eines Briten kreuzte, kam es zum erbarmungslosen Kampf - und umgekehrt war es nicht anders.
Das war die Situation Anno Domini 1597.
Anguilla ist ein winziges, kaum erwähnenswertes Eiland am nördlichen Ausläufer der Inseln über dem Winde, an die 108 Seemeilen ostwärts von Puerto Rico ... nicht mehr. Eine winzige, lächerlich unansehnliche, teils felsige, teils bewaldete Erhebung zwischen dem Atlantik und dem Karibischen Meer, mit ein paar Palmen längs der sandigen Küste, ein paar baufälligen Hütten und Buden, in denen die störrischen und gleichzeitig gelangweilten und unbeteiligten Eingeborenen hausen, träge in der Sonne herumhocken und darauf warten, dass mal wieder irgendwas geschehen möge.
Anguilla gehörte eigentlich der, spanischen Krone, aber nur eigentlich! Kein Mensch kümmerte sich um die paar Quadratkilometer Land. Jahre lagen zurück - da war eines Tages mal eine spanische Galeone in der kleinen Bucht vor Anker gegangen. Herrisch dreinblickende Offiziere in bunten, protzig ausstaffierten Uniformen waren an Land gekommen, hatten sich alles angesehen und waren kurz darauf wieder in ihren Dingis an Bord der Galeone zurückgekehrt. Die Galeone hatte die Anker gelichtet und seitdem war nichts Aufregendes mehr geschehen: Spanien tat so, als gäbe es keine Insel namens Anguilla.
Dafür kamen im Laufe der Zeit andere Schiffe - Schiffe, die an den Tops der Großmasten schwarze Banner mit grellweißen Totenköpfen trugen. Woher sie kamen, wohin sie gingen ... keinen interessierte es ... und die Eingeborenen verhielten sich ruhig und albwartend.
Das kleine verwahrloste Kaff, eine Ansiedlung von nicht mehr als anderthalb Dutzend windschiefen Hütten, trug den stolzen Namen EI Castillo Poderoso - die mächtige Burg! Ein Spaßvogel musste der Taufpate gewesen sein. Es war zum Lachen! Irgendwo unten am Strand klebte zwischen einer Gruppe schlankwüchsiger Palmen eine Hütte, die sich schon äußerlich von den übrigen unterschied. Sie war größer! Hier hausten übrigens Weiße, zumindest aber waren die Bewohner Mischlinge, finster aussehende Gesellen, bis an die Zähne bewaffnet, mit heimtückischen Augen, Männer, denen man nur ungern im Dunkeln begegnen mochte.
Was sie hier auf diesem verdammt abgelegenen Inselchen trieb, ging aus einem kunstvoll bemalten Schild hervor, das an zwei rostigen Nägeln über der wackligen Eingangstür baumelte:
Diego Brusillo: Internationales Handelskontor Vermittlung von Frachten usw.
Auch das war zum Lachen! Schmugglerumschlagplatz, das war es und die finsteren, mürrischen Burschen waren die Mittelsleute der herumziehenden Korsaren aller Schattierungen.
An diesem frühen Nachmittag lag vor der Küste in der kleinen Bucht, an deren Ufer das armselige El Castillo Poderoso sich erhob, eine seetüchtige Fregatte von schmuckem Aussehen, ein dreimastiges, vielleicht 13o Tonnen schweres Schiff ohne jegliches Nationalitätszeichen. Die ehemals goldenen Buchstaben unter den Kabinenfenstern im Heck waren verwaschen und unleserlich, und man musste schon ganz nahe herankommen, um feststellen zu können, dass die Fregatte den Namen Victorious Lion trug. Ein Engländer also!
Die Fregatte wiegte sich in der leichten Dünung, zerrte an den Ankerketten. Die Takelung war eingeholt. Kahl und schlank wie Birken im Herbst ragten die Maste in die klare, flimmernde Luft; wie Spinnenarme reckten sie ihre Rahen. Die Hitze um diese Stunde war fast unerträglich, aber trotz der brodelnden Treibhauswärme herrschte an Bord der Fregatte eine rege Tätigkeit. Die Lukendeckel mittschiffs und auf dem Vorderkastell waren weit geöffnet. Halbnackt arbeitete die Mannschaft.
Der Victorious Lion nahm Proviant und Frischwasser an Bord. Vom Strand her näherte sich eines der kleinen wendigen Dingis. Zwischen den Duchten lagen Kisten und Fässer gestapelt. Unter dem antreibenden „Pull! - Pull!“ des Bootsmanns näherte sich das Dingi rasch der Fregatte. Rhythmisch tauchten die Riemen ins Wasser.
An der Reling des Victorious Lion lehnte ein hochgewachsener, schlanker, junger Mann; breitschultrig, mit schmalen Hüften. Sein fast hageres Gesicht war von edlem Schnitt, das Kinn energisch, die Augen brannten in einem hellen Feuer und verrieten Kühnheit, gezügeltes Temperament und furchtloses Draufgängertum.
Aufmerksam folgten seine Blicke den Manövern des Beibootes. Fast unbeweglich stand er da, die Ellenbogen auf die Holzverkleidung gestützt. Enganliegende, schwarze Beinkleider endeten unterhalb der Knie in weichledernen Stulpenstiefeln. Um die Taille trug er eine ebenfalls schwarze Schärpe, aus der an der linken Seite der kunstvoll ziselierte Knauf eines Dolchmessers ragte. Den Oberkörper, muskulös; wohltrainiert und kräftig, bedeckte ein schneeig weißes, blusenähnliches Hemd; dessen Ärmel sein Träger bis hoch über die Ellenbogen aufgekrempelt hatte. Über der tiefgebräunten Brust stand es weit offen und gab den Blick auf ein goldenes Amulett in Kreuzform frei. Das Haar, leicht wellig, war von dunkelbrauner Tönung und im Nacken von einer ledernen Schlinge gehalten. Die Enden fielen zopfartig bis über den Hemdkragen.
Eine stattliche, imponierende Erscheinung! Dieser junge Mann war der Kapitän des Victorious Lion, Sir Richard Menegith, einer der angesehensten Kaperkapitäne Ihrer Majestät, Königin Elizabeth II. von Großbritannien. Ein Günstling der Britischen Admiralität und einer der erfolgreichsten Seefahrer der englischen Krone.
Das Boot hatte inzwischen beigedreht und rieb sich knirschend an dem hölzernen Rumpf der Fregatte.
„He, Swifty!“ Sir Richard beugte sich über die Reling, betrachtete wohlwollend seinen Bootsmann. „Habt ihr noch oft zu fahren?“
„No, Sir“, brüllte Swifty, der Bootsmann, nach oben und bemühte sich, Haltung anzunehmen, was ihm nicht recht gelingen wollte, da das Dingi ziemlich schlingerte. „Noch zwei-, dreimal!“
„Gut, dann beeilt euch, Leute! Und schafft die Fässer, die ihr da mitgebracht habt, nicht in den Kielraum, sondern in eines der Hellegatte mittschiffs, verstanden, Swifty?“
Sir Richard lächelte :unmerklich. „Aye, aye, Sir, verstanden“, wiederholte Swifty eifrig, wandte sich zu seinen Leuten und gab die Anordnung des Kapitäns mit befehlerischer Stimme weiter. Und wieder musste Sir Richard lächeln .... über den Eifer und die Dienstbeflissenheit seines Bootsmanns.
Ein prächtiger Kerl, dieser Swifty, bei Gott! Verläßlich, treu, anhänglich wie ein schottischer Collie, den man von der Gasse geholt und aufgepäppelt hat, ein Kerl, mächtig und stark wie eine hundertjährige Palme, aber mit dem Herzen eines jungen, zartbesaiteten Mädchens aus einem der Ordensstifte in Cornwall. In der Tat, ein Riese von einem Mann, mehr als einen vollen Kopf größer als alle anderen auf dem Victorious Lion, mit Armen so stark wie Lianen, mit Fäusten, die den Pratzen von Bären eher glichen, als menschlichen Händen. Ein wahres Muskelpaket war dieser Swifty, mächtig und kraftvoll wie ein Berberlöwe ... aber mit dem sanften Gemüt eines neugeborenen Säuglings.
Sein Haar, kurzgeschoren und stets ungekämmt war flammendrot, sein Gesicht fast immer unrasiert. Buschige Brauen über dunklen, freundlichen Augen, die allerdings Feuer und Blitze versprühten, wenn er zornig wurde. Dann war nicht mit ihm zu spass en. Dann war es ratsam, ihm aus dem Wege zu gehen. Er zermalmte, was ihm in seine Tatzen geriet, und war mehr als einmal vorgekommen, dass er seine Gegner kurzerhand an ihren Hälsen gepackt und mit den Schädeln zusammengedonnert hatte; dass es dumpf und dröhnend krachte.
Die aber, die Swifty schätzte, die liebte er fast, behandelte sie wie mit Sammetpfötchen. Und einer von diesen, und allen anderen voran. War Sir Richard Menegith, sein Kapitän, den er verehrte wie seine eigene Mutter, die irgendwo bei London auf einer Cottage drei oder vier Schafe besaß.
Sir Richard war froh, Swifty um sich zu haben. Auf ihn konnte er sich verlassen, bedenkenlos, unbesehen. Swifty besaß sein volles Vertrauen, und Sir Richard war seinem eigenen Vater, einem hohen Beamten der Königin, noch heute dankbar, dass er ihm diesen „Teufelskerl Swifty“ sozusagen geschenkt hatte. Früher nämlich hatte, Swifty im Dienste des alten Sir Lenegith gestanden. Dann, als der junge Sir Richard das Kapitänspatent erhalten, war er einst zum alten Sir Richard gekommen und hatte ihn gebeten, den jungen Herrn auf seinen Fahrten begleiten zu dürfen.
Nun, er durfte! Und seitdem hing er mit hündischer Ergebenheit an seinen neuen Herrn, war sawas wie dessen Vertrauter, ein guter Freund! Nebenbei war er dann noch Bootsmann auf der The Victorious Lion eine Aufgabe, die er trotz seiner einundvierzig Jahre vortrefflich zu meistern wusste.
Sir Richard warf noch einen letzten Blick auf den rothaarigen, treuen Burschen und wandte sich langsam um. Seine Augen glitten hinüber zum Strand, verweilten ein paar Augenblicke lang auf den baufälligen Hütten, hinter denen sich der Palmenwald erhob und sich den Hügel hinan erstreckte.
In der Bucht kurvten vier oder fünf kleine Boote. Die Sonne brannte stechend vom ewig blauen Himmel.
Plötzlich fühlte Sir Richard, wie jemand ihn aufmerksam und eindringlich ansah, so zwingend, dass er blitzschnell seinen Kopf herumwarf.
Unter der Tür zum Niedergang stand ein untersetzter stämmiger Mann, in den Hüften etwas eingeknickt, auf ein biegsames Stöckchen gestützt, das er mit seiner behandschuhten Rechten hielt. Angetan war er mit einer Kniehose, einem langen, in der Taille abstehenden Rock, unter dem die buntbestickte Weste und das spitzenbesetzte Jabot hervorlugten, das seinen Hals zierte. Auf der schwarzen kurzgelockten Perücke thronte ein imposanter Dreispitz.
Das Gesicht dieses Mannes war seltsam weiß, so als scheute sich sein Besitzer, die Haut den Sonnenstrahlen auszusetzen, zudem war es ein wenig aufgedunsen, zeigte den Ansatz zu einem Doppelkinn. Es war im übrigen ein wahres Durchschnittsgesicht, von jener Sorte, die man sofort wieder vergißt, kaum dass man sie gesehen hat. Es war nicht abstoßend oder unsympathisch, es war aber, auch nicht gewinnend und schon gar nicht dazu angetan, besondere Sympathien zu wecken.
Der Mann stand schon eine ganze Weile hier, stocksteif und unbeweglich, den Kopf ein wenig zur Seite geneigt. Seine Augen waren zu schmalen Schlitzen zusammengezogen, sein Mund mit den schwellen den, aufgeworfenen Lippen wirkte verkrampft und verzerrt, so mit herabhängenden Mundwinkel. Ein spöttischer, gleichsam schadenfroher Ausdruck spiegelte sich in seinen dunklen, blitzenden Augen, wider. Ja, irgend etwas in diesem Gesicht liess einen unbefangenen Beschauer stutzig werden. Hass war es, was da in den Zügen des Mannes aufleuchtete, kalter, abgrundtiefer, bedingungsloser Hass.
In diesem Augenblick wandte sich Sir Richard um. Ihrer beider Augen begegneten sich und sofort verwandelte sich das Gesicht des untersetztenr heimlichen Beobachters an der Tür. Seine Blicke wurden plötzlich offen, frei und freundlich, sein Mund verlor den starren, krampfartigen Ausdruck und begann gewinnend zu lächeln. Seine Züge glätteten sich, während er jetzt mit eilfertigen raschen Schritten auf Sir Richard zukam.
Auch Sir Richard lächelte. Er verschränkte die Arme vor der Brust und sah dem anderen neugierig entgegen, ihn dabei von Kopf bis Fuß musternd. Dann stieß er anerkennend die Luft durch die Zähne:
„Schau an, schau an“, grinste er über sein ganz ehrliches, offenes Gesicht. „Ich hätte dich fast nicht erkannt, Lester! Du siehst aus, als hättest du dich zu einem Bummel durch den Hyde Park hergerichtet. Solltest du vergessen haben, wo wir sind, mein Lieber? Wir sind nicht im Hafen von Plymouth oder Portsmouth, wir schwimmen noch weniger auf der guten, alten Themse, mein Teurer. Wir befinden uns am Ende der Welt, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Solltest du Appetit auf einen guten alten Whisky haben, so komm mit in meine Kabine. An Land wirst du kaum ein solches Gesöff finden! Und Clubs und Bars gibt es schon gar nicht, mein lieber Lester! Wozu also diese Salonstaffage, he?“ Sir Richard konnte sich eines spöttischen Lachens kaum erwehren.
Lester Bryan, der Steuermann des The Victorious Lion hielt mitten in der Bewegung inne. Aufmerksam hörte er zu, den Kopf wieder ein bißchen schräg gelegt und wieder schlossen sich seine Augen zu schmalen Schlitzen. Dann richtete er sich auf, so als fühle er sich neben dem hochgewachsenen Sir Richard ungebührlich klein.
„Hab' keine Sorgen, Richy“, sagte er ungewöhnlich scharf, „ich weiß genau, wo wir uns befinden, und nach Whisky steht mir der Sinn keineswegs. Ich habe einfach Lust, die verdammten, ewig schwankenden Planken unseres Kahns mal für ein Weilchen mit festem Boden zu vertauschen - und das kann man allemal auch hier in diesem finsteren Eckchen unseres Erdenkloßes, nicht wahr?! Ich will einfach mal an Land, das ist alles!“
„Ein guter Einfall“, stimmte Sir Richard zu und überlegte. „Wie wär's, wenn ich mitkäme, Lester, he?“
Lester Bryans Gesicht wurde noch bleicher, als es ohnehin schon war. Unmerklich zuckte er zusammen, dann hatte er sich wieder in der Gewalt. Er zwang sich zu einem verbindlichen Lächeln.
„Ich weiß nicht, Richy ...“, entgegnete er gedehnt. „Einer muss doch wohl an Bord bleiben, solange die Leute ihre Arbeit nicht beendet haben, nicht wahr?!“ Er sah lauernd den anderen an. Sir Richard musste erneut lachen.
„Ach ... und das muss ausgerechnet der Kapitän sein, wie?“, fragte er amüsiert. „Wie wär's denn, wenn der hochwohlgeborene Steuermann meinen Platz mal einnimmt, wie? Ich schätze, ich habe lange genüg hier in der Sonne herumgestanden!“
„Stimmt“, gab Lester zu. Er wand sich! Hell and devil! Wenn es diesem Kerl einfiel, ihn zurückzuhalten oder etwa gar wirklich mitzukommen? Verdammt! Daran hätte er denken müssen!
„Na ja ... Richy“, fuhr der Steuermann betulich fort und spielte den Gelangweilten. „Wenn du meinst, dass ich bleiben soll, so will ich ...
„Nein, nein, nun hau schon ab, Lester! Ich habe sowieso keine Lust, mir dieses Drecknest da drüben anzusehen. Wenn es dich also schon so interessiert, so verschwinde in Gottes Namen. Cheerio, alter Freund.“
Lester Bryan atmete auf und setzte sich wieder, in Bewegung.
„In diesem Aufzug wirst du dich tot schwitzen; Lester“, bemerkte Sir Richard anzüglich und wies auf den salonfähigen Anzug seines Steuermanns.
„Kümmere dich nicht darum, Richy! Ich bin es, der schwitzen muss und mir ist es egal! Also, bis später dann!“ Lester Bryan beugte sich über die Reling. „He, Swifty, warte ein bißchen, ich komme mit. Also Cherio, Richy!“ .
„Cherio, Lester! War ein guter Vorschlag von dir, dieses stinkige Anguilla anzulaufen. Das Wasser ist ausgezeichnet, und die Fressereiwaren, die dieses Handelskontor an uns zu Wucherpreisen verschleudert, scheinen ebenfalls gut zu sein. Wie kamst du eigentlich ausgerechnet auf Anguilla, Lester, he?“ Er fragte es ganz harmlos.
„Bin früher mal hier gewesen, Richard“, entgegnete der Steuermann kurz angebunden und schwang sich über die Reling, ergriff die herabhängende Jakobsleiter und turnte hinunter in Swifty's Boot.
Wenige Minuten später pullten die Leute das Dingi zum Strand hinüber.
Sir Richard sah ihnen nach.
Lester Bryan sah sich vorsichtig um und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sein Gesicht lag im Schatten des Dreispitzes, aus den Augenwinkeln hervor blinzelte er zu der baufälligen Hütte hinüber, in der das sogenannte Handelskontor seinen Sitz hatte. Mit der Gemächlichkeit eines Müßiggängers schlenderte Lester Bryan, der Steuermann des Victorious Lion am Strand entlang, warf ab und zu einen abschätzenden Blick zu seiner Fregatte hinüber und wartete, bis Swifty mit seinen Leuten zwischen den Hütten verschwunden war, um die nächsten Fässer und Kissen zu holen.
Dann beschleunigte er plötzlich seine Schritte, tauchte nun ebenfalls zwischen den Hüten unter. Von Schiff aus würde man ihn nun nicht mehr sehen können.
Lester Bryan schlug einen ziemlichen Bogen um das! Drecksnest mit dem stolzen, protzigen Namen, schlug die Richtung zum Palmenhain ein, wartete dort wieder ein paar Minuten und huschte dann geduckt und mit einer Behändigkeit, die man seiner untersetzten, dicklichen Figur gar nicht zugetraut haben würde, über die ausgetrocknete Wiese. Wenig später hatte er den Hintereingang der Hütte erreicht, in der das Handelskontor untergebracht war.
Eine stickige, brodelnde Hitze umfing ihn, schlug ihm dumpf und warm ins verschwitzte Gesicht, während er durch den zwielichtigen Gang tapste. Dann drückte er die Klinke.
Der Mann hinter dem wackeligen Tisch hob flüchtig sein schweißnasses Gesicht - ein Galgenvogelgesicht mit stechenden Augen, die böse funkelten, als sei er über die unwillkommene Störung empört. Schon beschäftigte er sich wieder mit seinen Papieren, die vor ihm lagen, schmutzbesudelt, fettig, halb zerrissen.
Der Mann saß halbnackt auf seinem roh zusammengezimmerten Hocker, mit dem er sich langsam und in regelmäßigen Abständen nach hinten wippen ließ. Hinter dem Ohr steckte ein Gänsekiel. Auf einem anderen kaute er, wobei er ab und zu in hohem Bogen auf den unratübersäten Boden spuckte.
Lester Bryan betrachtete den Mann mit sichtlichem Ekel. Abwartend stand er unter der Tür, die er vorsichtig hinter sich zugezogen, hatte.
Nur das Kratzen des Federkiels war, zu hören und das fiebrige, drohende Summen der Moskitos; die, wie schwarze Punkte zu tausenden in der Luft herumschwirrten.
Der Mann hinter dem wackligen Tisch prustete, dass die Schweißtröpfchen in der Gegend herumspritzten. Dann wischte er sich mit der bloßen Hand über Stirn, Nacken und die behaarte Brust.
Nichts geschah. Schließlich wurde es Lester Bryan zu dumm. Er stieß herausfordernd seinen Stock auf den Lehmboden.
„Madre de dios“, schimpfte er auf spanisch. „Zum Henker, Senor seid ihr Diego Brusillo, he?“
Der Mann hinter dem Tisch rührte sich nicht. Dann fing er plötzlich an, auf seinen Nägeln herumzukauen; langsam hob er die verschlagenen Augen zu Lester Bryan auf, lauernd, gefährlich blitzend.
„He?“, machte er grunzend.
„Ich erlaubte mir, Euch zu fragen, ab ihr Diego Brusillo seid“, wiederholte Lester Bryan beharrlich und übertrieben höflich.
„Steht's draußen auf dem Schild, dass hier Diego Brusillo sein Büro hat, he?“ Lester Bryan wusste nicht was, der andere wollte und nickte. „Na, also, mein ehrenwerter Herr, dann bin ich also wohl Diego Brusillo, wie?“ Er riss sich mit den gelben Zähnen ein Stück Nagel ab und spuckte es zielsicher aus dem Fenster. „Wer seid Ihr?“, brummte er grimmig.
„Ich bin Lester Bryan!“ Der Steuermann fühlte, wie er wütend wurde.
„Sagt mir gar nichts, habe Euren Namen nie gehört! Seid wohl einer von diesen verdammten Engländern da draußen, wie?“ Er deutete mit dem dreckigen Zeigefinger auf die Fregatte in der Bucht „Schert Euch zum Satan, Senor, ich Hasse die Engländer!“ Wieder spuckte er in hohem Bogen aus, diesmal Lester Bryan direkt vor die Schnallenschuhe. Der Steuermann behielt seine Ruhe.
„Ich bin Ire, Senor Brusillo“, sagte er mit Stolz, „Auch ich Hasse die Engländer - wie Ihr! Ihr seid Spanier?“
„Was sonst, he? Vielleicht ein Neger, wie?“ Plötzlich wurde er freundlicher. „Ire seid Ihr, sagt Ihr? Dann nichts für ungut. Wir Spanier schätzen die Iren, weil Ihr die Engländer hasst wie wir!“ Seine Brauen zogen sich jäh wieder zusammen. „Wie kommt Ihr als Ire zu diesen verdammten Engländern aufs Schiff?“
„Das gehört nicht hierher, Senor Brusillo, eine lange Geschichte, zudem dazu uninteressant. Begnügt Euch damit, dass ich Ire bin und somit ein Feind aller Briten!“ Er machte eine geringschätzige knapp bemessene Handbewegung.
„Bueno, Senor, behaltet's für Euch, wenn Ihr's nicht sagen wollt. Und was führt Euch zu mir? Wenn Ihr etwa Fracht für diesen verdammten englischen Kahn übernehmen wollt, so schert Euch, und wenn Ihr tausendmal Ire seid, zum Satan ... maledito.“
„Ich will keine Fracht, Senor Brusillo“, sagte Lester Bryan sanftmütig.
„Was also sonst?“ Der Spanier wandte sich ostentativ wieder seinen schmutzigen, fettigen Papieren zu: Er schien jegliches Interesse mit einem Schlag verloren zu haben. Lester Bryan trat einen Schritt näher heran. „Ich möchte, dass Ihr mich zu Pascual Moreto bringt, Diego Brusillo“, sagte er mit leiser, eindringlicher Stimme.
Der Spanier zuckte unmerklich zusammen. Blitzschnell hob er die Augen, betrachtete sekundenlang seinen Besucher, argwöhnisch, abschätzend, witternd wie ein Raubtier. Dann senkte er ebenso rasch wieder den Kopf und brummte: „Kenne keinen Pas ..., wie hieß der Kerl?“
„Pascual Moreto, Senor!“ Lester, Bryan sagte es ganz ruhig, jede Silbe betonend.
„Ja, ja, hör's schon, kenne keinen Mann dieses Namens. Wer soll das sein? In El Castillo Poderoso gibt es keinen Pascual Moreto!“
„Ich weiß, Senor Brusillo“, pflichtete Lester Bryan bei. „In EI Castillo Poderoso nicht, aber in der Nähe, nicht wahr?! In einer hübschen Bucht, zu der Ihr mich bringen werdet!“ Das Letzte stieß er hart und schnell hervor, als dulde er, keinen Widerspruch. Wieder zuckte der Spanier zusammen, richtete sich plötzlich mit einem Ruck auf, fuhr von seinem Hocker hoch, brüllte:
„Raus mit Euch, Senor, wenn Ihr mich zum Narren halten wollt. Ich sagte ja schon, ich kenne keinen Mann dieses Namens!“
„So kennt Ihr vielleicht den Viento?“
„Por diablo, was ist nun das wieder?“ Die Augen des Spaniers verengten sich gefährlich.
„Ein Schiff, Diego Brusillo, ein Schiff“, erklärte Lester Bryan ebenso fest wie eindringlich. Auch seine Augen blickten jetzt hart und unbeugsam: „Genau gesagt: eine gutbestückte Bark!“
„Ein Spanier?“, bequemte Diego Brusillo sich zu fragen. „Oder unter welchem Zeichen segelte er?“ „Unter dem ...“ Lester Bryan machte eine wirkungsvolle Pause. „Unter dem Totenkopf, Amigo, wenn du weißt, was das bedeutet?!“
„Nein, Senor, kenne ich auch nicht“, sagte Diego Brusillo und setzte sich wieder. „Und nun geht! Ihr stehlt mir, meine Zeit!“
Lester Bryan dachte nicht daran, der Aufforderung des Spaniers Folge zu leisten. Er trat noch einen Schritt näher, beugte sich über den Tisch. Sein Atem streifte das Gesicht des anderen, als er jetzt flüsterte, „Con El Viento por la libertad!“
Diego Brusillo fuhr von seinem Hocker hoch; ungläubig starrte er seinen Besucher an, seine Augen weiteten sich vor Staunen, seine Lippen bewegten sich, ohne dass sie ein einziges Wort geformt hätten. Von oben bis unten musterte er Lester Bryan, dann lief ein Lächeln über sein dunkles, verschlagenes Gesicht, sein Mund verzog sich. Schließlich schlug er mit der Faust auf den Tisch.
„Por diablo, Amigo, warum sagtet Ihr das nicht gleich? Maledito, kommt da einer her und redet dummes Zeugs, dass ich schon denke, irgendwas ist faul ... und macht der Kerl das Maul, auf und sagt ganz harmlos: „Con El Viento por la libertad!“ Bei allen Heiligen, Senor, das hättet Ihr eher sagen sollen!“ Seine Stimme senkte sich plötzlich zu einem Flüstern, während er Lester Bryan um den Tisch herum zu sich heranzog.
„Ihr wollt also zu Pascual Moreto, Senor Bryan?“
„Ja!“
„Bueno! Ich bringe Euch zu ihm, da Ihr das Kennwort wisst, besteht kein Zweifel, dass Ihr Pascuals Freund seid! So seid Ihr, natürlich auch der meine! Wartet ein Stündchen, bis ich Euren Leuten alles ausgehändigt habe, was Euer Kapitän durch Euren Superkargo bestellen ließ. Es muss gleich so weit sein! Dann stehe ich Euch zur Verfügung. Es ist nicht so arg weit bis zu Pascuals Ankerplatz!“
In diesem Augenblick flog draußen im Gang die Tür auf, und Schritte polterten heran, verhielten vor dem Büro. Dann klopfte es laut und gewissermaßen herausfordernd.
Lester Bryan und Diego Brusillo wechselten einen raschen Blick. Gelangweilt spuckte der Spanier ein Eckchen Fingernagel zum Fenster hinaus.
„Komm schon rein, maledito!“, brüllte er wütend und wischte sieh mit dem Handrücken den Schweiß von der nassen Stirn, wobei er laut prustete.
Die Tür ging auf, Swifty trat ein, riesig, die Schultern nach vorn geschoben, kam er näher, blinzelte unter seinen buschigen Brauen hervor. Seine Augen verengten sich, als er seinen Steuermann bemerkte, und es entging, ihm nicht, dass Lester Bryan ein wenig zusammenzuckte, als er Swifty so plötzlich hereinspazieren sah. Oder sollte er sich geirrt haben? War Lester Bryan gar nicht zusammengezuckt? Und warum sollte er denn auch?
„Que hay?“, hörte Swifty den Spanier fragen: Swifty überhörte das ganz einfach, wandte sich statt, einer Antwort direkt an den Steuermann.
„Gut, dass ich Euch hier antreffe, Sir“, begann er umständlich, so könnt Ihr Euch mit diesem ehrenwerten Handelsmann ...“ Er machte eine geringschätzige Geste zu Diego Brusillo hin. „... herumschlagen.“ Swifty sprach englisch und war ein ganz klein wenig verdutzt, als der Spanier ihm in dieser Sprache antwortete.
„Sauberer Handelsmann ist gut“, lachte Diego Brusillo. „Also, was gibt's? Irgendetwas nicht in Ordnung, he!?“
„Allerdings, Amigo“, gab Swifty anzüglich zurück. „Oder haltet Ihr es für in Ordnung, wenn von zehn Kisten Dörrfleisch zwei nur Steine und Dreck enthalten und in drei anderen wohl Fleisch ist, aber Fleisch mit mehr Maden und Schimmel, als ein ehrlicher Seemann seinem Magen zumuten kann, he?“
Diego Brusillo verlor keinen Augenblick lang seine heitere Gelassenheit. Hämisch grinsend saß er da, kaute an seinen Nägeln und musterte den hünenhaften Engländer. Dann ließ er seine Blicke zu Lester Bryan hinüberschweifen. Der stand da und schien ein bisschen hilflos.
„Hell and devil, spanischer Halsabschneider“, schimpfte Swifty jetzt los. „Wenn Ihr's etwa nicht glaubt, so kommt mit 'raus und seht Euch die Schweinerei an, verflucht und zugenäht. Wir bezahlen Euch anständiges Gold, will ich meinen. Liefert Ihr also auch anständige Ware, dass Ihr uns Engländer nicht verknüsen könnt, das wissen wir, schätze aber, dass es Euch egal sein kann, wer Euch Euren Schlangenfraß abkauft. Und zudem haltet Ihr's mit dem Teufel, glaube ich und legt auf England und Spanien gleichermaßen einen Haufen Mist, stimmt's, he?“ Swifty hatte sich in Zorn geredet. Schnaufend und breitbeinig stand er zwischen Diego Brusillo und Lester Bryan. Den sah er herausfordernd an. „Sir, nun tut doch was dagegen!“
Jetzt endlich bequemte der Steuermann sich dazu, einzuschreiten. Im Grunde interessierte ihm dies alles einen feuchten Kehricht, aber Swifty gehörte zur Mannschaft - und Swifty konnte von ihm erwarten, dass er was dagegen unternehme. Also schön! „Gut, Swifty“, sagte er beruhigend, schieb ab, ich mach das schon klar mit diesem verdammten Dörrfleisch. Sieh zu, dass du das restliche Zeugs, das gut ist, in die Boote schaffen lässt. Das hier überlass mir!“ Und an den Spanier sich wendend, schrie er plötzlich los: „Wirklich 'ne Sauerei, Senor!“
„Geb ich zu“, brummte Diego Brusillo. „Soll nicht mehr vorkommen, verlasst Euch drauf!“ Der Spanier erhob sich langsam und träge, schob sich schwerfällig hinter seinem wackligen Tisch hervor, wobei er die Hosen mit den Ellbogen in der Taille zurechtrückte. „Geh jetzt, Swifty“, befahl lest er Bryan.
„Aye, aye, Sir!“ Swifty wandte sich um, tapste zur Tür, leise vor sich hingrunzend. Schon streckte er die Hand nach dem Türgriff aus, als er sich plötzlich mit einem jähen Ruck nochmals umdrehte.
Misstrauisch und argwöhnisch hefteten sich seine scharfblickenden Augen auf die beiden Männer ... auf den Spanier und den Steuermann. Er konnte nicht umhin, leise durch die Zähne zu pfeifen. Aber niemand hörte es! Dann drehte sich Swifty wieder ab, um jetzt endgültig den Raum zu verlassen.
Verdammt, murmelte der bärenstarke Swifty draußen, was tut sich denn da? Wie haben diese beiden Burschen sich denn angesehen, wie? Und haben sie sich nicht zugegrinst, he? Hell and devil, da ist doch 'was faul - ich müsste nicht der missratene Sohn meiner alten Mutter sein, wenn ich mich irre! Oder irre ich mich etwa doch?
Swifty grübelte hin und her, während er zum Strand hinüberstakte - dann kam er zu der Erkenntnis, dass er Gespenster sähe. Das kam wohl von dieser Affenhitze. Zum Henker, es war wirklich kein Wunder, wenn man Gespenster sah. Thunderstorm!
Lester Bryan stand am Fenster der Hütte und sah Swifty nach, bis er hinter irgendwelchen Holz- und Kistenstapeln seinen Blicken entschwunden war.
„Es geht mich zwar nichts an, was Ihr mit Euren Kunden anstellt, Senor Brusillo“, sagte er leutselig und lächelte verschmitzt, „und es interessiert mich noch weniger, ob die Leute vom Victorious Lion Dreck statt Dörrfleisch zu fressen kriegen, aber in meinem ... und auch in Eurem Interesse, darf ich Euch bitten; die Kisten wieder umzutauschen. Es ist Euer Schaden nicht, Amigo. Und ich kann Euch - schätze ich - versprechen, dass Ihr in zwei, drei Tagen den ganzen verkauften Krempel wieder hier in Euren Schuppen haben werdet. Das Geld obendrein! Ein gutes Geschäft also stimmt's, Diego Brusillo.“ Er trat näher.
„Stimmt, Lester Bryan, wenn Ihr mir nichts vermacht!“
„Tue ich nicht! Aber, wie ist es, Amigo ich möchte jetzt zu Pascual Moreto.“
„Könnt Ihr, ich bringe Euch hin.“ Er wies hinaus auf die Bucht, die begrenzenden Hügel, von denen sich diesige Schleier auf das Wasser herabsenkten. „Die Dämmerung! In einer Viertelstunde reiten wir los!“
„Bueno - und muchas gracias, Diego Brusillo!“
Knapp fünf Meilen oberhalb von El Castello Ponderoso bildet das Meer eine zweite Bucht, die sich tief und schlauchartig in die Insel einfrisst. Die Küste ist hier steil, unzugänglich und felsig, die Hügelkämme, die die Bucht umgeben, sind von dichtem Gestrüpp umgeben und Bäumen bestanden, durch das nur ein Eingeweihter und Ortskundiger zu finden weiß. Die Bucht selbst ist vom offenen Meer her nicht zu sehen. Eine schmale Meerenge zwischen den riesigen Felsbrocken liegen und eine enge Fahrgasse bilden, gerade breit genug, den Rumpf eines Seglers passieren zu lassen.
Um diese nächtliche Stunde, zu der Sir Richard Menegith nichtsahnend in seiner Kabine saß und an England und Maureen O'Hattaway dachte, bewegte sich am Rand eines der Hügel, die Pascual Moretos Schlupfwinkel umstanden, zwei Maultiere auf schmalen Saumpfad zum Ufer hinab: Lester Bryan und Diego Brusillo.
Der Mond schob sich im gleichen Augenblick, da sie den Fuß des Hügels erreichten und zum schmalen Strand hinabritten, über die Gipfel der Baumkronen jenseits der Bucht und überflutete das silbern schimmernde Wasser mit einem fahlen, opalisierenden Glanz.
In seinem Licht erkannte Lester Bryan den wuchtigen, gedrungenen Schatten eines Schiffes, das an die 18o Fuß vom Ufer entfernt aus dem Wasser ragte, sich leise im Rhythmus der sanften Wellen wiegend. Masten und Rahen ragten wie zarte Filigranarbeit in den nächtlichen, sternübersäten Himmel.
Im Felsgeröll am Strand gluckerte plätschernd das Wasser.
Diego Brusillo ließ sich aus dem Sattel seines Maultiers gleiten, sprang auf einen mehr als hüfthohen Stein und formte Hände wie einen Trichter vor seinem Munde:
„He, Hollahe“, brüllte er. Der Ruf gellte laut über die Bucht, brach sich dumpf an den Hügeln, vervielfältigte sich, dann kam von allen Seiten das Echo zurück, überlaut, hohl. „Con EI Viento per la Iibertad!“, schrie er dann, neigte den Kopf auf die Schulter und lauschte.
Lester Bryan sah, wie es sich an Bord des Viento bewegte. Dann kam die Antwort:
„Wer ist da?“ Wieder das Echo, langgezogen, dumpf widerhallend.
„Diego Brusillo!“
„Bueno“, schallte es zurück. „Warte, das Boot holt dich!“
Wieder Stille. Dann bemerkten der Spanier und Lester Bryan, wie drüben knirschend ein Boot abgehievt wurde und klatschend aufs Wasser schlug. Aus dem Schatten des Schiffes löste sich jetzt ein kleinerer, dunkler Punkt, der rasch größer wurde und sich näherte. Wassertropfen spritzten und glänzten auf, wenn die Riemen ins Wasser eintauchten ...
Pascual Moreto saß in seiner geräumigen Kabine vor einem weit geöffneten Fenster. Vielfarbig brach sich der Schein der zwei Öllampen auf dem Tisch hinter ihm in den bunten Scheiben. Seine Beine, in langen, weichen Stiefeln steckend, lagen übereinandergeschlagen auf der Tischkante, während er sich langsam und stetig in seinem Sessel hin- und herwiegte.
Pascual Moreto wartete auf seinen Gast, von dessen Ankunft er durch den Wachhabenden erfahren hatte. Aufmerksam lauschte der Korsarenkapitän auf jedes Geräusch, das zu ihm herunterdrang. Was konnte Diego Brusillo von ihm wollen? Immerhin, es musste von Wichtigkeit sein, sonst würde der Mittelsmann nicht jetzt ... fast mitten in der Nacht ... zu ihm herauskommen.
Stimmen wurden an Deck laut. Pascual Moreto hörte ein dumpfes Klatschen gegen die Bordwand: Die Jakobsleiter.
Gleich darauf hastige Schritte, laut und polternd ... sie kamen die Treppe zum Niedergang herunter, näherten sich seiner Kabine ...
Der Korsar ließ sich mit einem Ruck nach vorn fallen. Seine Rechte griff nach der kupfernen Kanne, die Linke zog einen Becher zu sich heran. Plätschernd floss der blutrote Wein in das Trinkgefäß. Die Schritte verhielten jetzt vor der Tür.
Pascual Moreto sah auf, den Becher in der Hand, die Ellbogen aufgestützt. Langsam drehte er eine der Öllampen so, dass ihr Schein voll auf die Tür fiel, in deren Rahmen jetzt Diego Brusillo sichtbar wurde.
„Buenas tardes, Pascual“, sagte Diego verbindlich und trat rasch näher. Dabei warf er den breikrempigen Hut in irgendeine Ecke und beobachtete den Kapitän scharf.
Pascual Moreto saß unbeweglich, immer noch die Ellbogen auf die Tischplatte gestützt, in den Händen den Becher um seine eigene Achse drehend. Das schneeweiße Hemd, makellos sauber und fast bis zum Hals geschlossen, hatte im Licht der Lampen einen zerbrechlichen Schimmer. Die tiefbraune Haut seines scharfgeschnittenen Gesichts schien noch dunkler.
Stechend lagen die schwarzen Augen unter vorspringenden Brauen. Quer über die Stirn zog sich eine fast drei Zoll lange Narbe, rot und glühend, endete irgendwo in seinem Haaransatz. Geschickt hatte der Korsar eine Locke über die Narbe gezogen. An seiner Rechten blitzten drei kostbare Ringe, die in prunkvollen Fassungen übergroße Diamanten trugen. Er war ein gut aussehender Mann Mitte der Dreißig, nicht auffallend groß oder stark, aber wohltrainiert, beweglich, geschmeidig ... und sein kühnes Gesicht verriet Mut und Tapferkeit.
Fast unmerklich richtete er sich jetzt auf, stellte den Becher ab, musterte neugierig seinen Besucher. „Que hay, Diego?“, fragte er ruhig und in einem Ton, der keinerlei Neugier oder Überraschung enthielt. „Was bringst du?“
„Einen Mann, der dich zu sprechen wünscht, Pascual. Einen Engländer“ Pascual Moretos Augen verengten sich, aber auch jetzt verbarg er geschickt seine Verblüffung. Stattdessen goss er sich erneut Wein in seinen Becher.
„Einen Engländer sagst du?“
„Einen Iren, Pascual Moreto genauer gesagt!“, mischte sich da Lester Bryan ein und trat aus dem Schatten heraus in den Lichtkreis der Lampen. „Lester Bryan, Moreto, du wirst dich erinnern, he?“
Pascual Moreto trank erst gemächlich seinen Becher leer. Dann hob er den Blick, betrachtete lang und eingehend den Mann, der da vor seinem Tisch stand - dann nickte er, lächelte ein wenig.
„Schau an, Lester Bryan“, entgegnete er obenhin. „Das ist in der Tat eine Überraschung! Haben uns lange nicht mehr gesehen, will ich meinen. Und was willst du von mir? Was führt dich her? Und überhaupt ... wie kommst du in diese Gegend?“
„Ich bin Steuermann auf dem Engländer, der drüben bei EI Castillo Poderoso vor Anker liegt. Und was ich will? Nun, das ist nicht in einem Wort gesagt, und zudem möchte ich gern ...“ Er sah zu Diego Brusillo hinüber.
Pascual Moreto machte eine knappe Handbewegung.