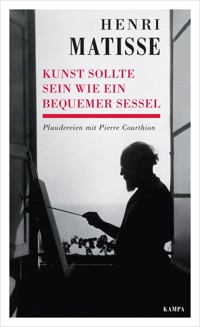
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
Im Frühling 1941 treffen sich Henri Matisse und der Schweizer Literaturkritiker Pierre Courthion zu mehreren Gesprächen - »Plaudereien«, wie Matisse sie genannt haben will. Er erholt sich gerade von einer schweren Operation, Frankreich ist schon von den Nazis besetzt, und so ist es Matisse ein Anliegen, nicht nur auf sein eigenes Leben zurückzublicken, mit großer Offenheit von seiner Kindheit, den Lehrjahren im Atelier von Gustave Moreau und seinen unzähligen Reisen zu erzählen; es geht ihm auch darum, das kulturelle Erbe Frankreichs zu verteidigen. Er gibt umfassend Einblick in das Leben der Avantgarde der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Matisse spricht über seine Weggefährten - Maler, Schriftsteller, Musiker, Politiker -, über seine Erfahrungen mit Sammlern und über Ruhm, und natürlich immer wieder über die Malerei, wie er sie sieht. Aus dem fertigen Manuskript wird aber nicht, wie geplant, ein Buch, es verschwindet in Pierre Courthions Schublade - erst vor Kurzem, nach fast 70 Jahren, wurde es in seinem Nachlass entdeckt. Eine außergewöhnliche Entdeckung, ein beeindruckendes Dokument über einen der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Henri Matisse
Kunst sollte sein wie ein bequemer Sessel
Plaudereien mit Pierre Courthion
Kampa
»Ich träume von einer Kunst des Gleichgewichts, der Reinheit, der Ruhe, ohne beunruhigende oder besorgniserregende Sujets, einer Kunst, die für jeden Geistesarbeiter, für den Geschäftsmann so gut wie den Wortkünstler, eine entspannende und den Geist beruhigende Wirkung hat – wie ein bequemer Sessel, in dem man sich von körperlichen Anstrengungen erholen kann.«
Henri Matisse, Notizen eines Malers, 1908
Editorische Notiz
Dieses Buch sollte es zuerst geben, dann nicht, und jetzt ist es nach über siebzig Jahren doch noch erschienen.
Warum das Hin und Her? Die Idee zu einem solchen Buch entstand Anfang April 1941. Henri Matisse (1869–1954) war in Lyon wegen eines Darmverschlusses operiert worden und erlitt danach mehrere Lungenembolien. Drei Monate lag er im Krankenhaus. Während seiner Rekonvaleszenz im Grand-Nouvel-Hôtel in Lyon besuchte ihn der Schweizer Kunstverleger Albert Skira (1904–1973). Am 5. April lud Skira auch den Schweizer Kunstkritiker Pierre Courthion (1902–1988) mit dazu, der ein Buch über den Maler publiziert hatte.
Matisse hatte einmal gesagt, Maler sollten sich die Zunge rausschneiden lassen und sich nur mit dem Pinsel ausdrücken. Froh, dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein, sprudelte er nun aber nur so von Reminiszenzen. Das brachte Skira auf die Idee, ein Buch zu machen: Courthion sollte Fragen stellen, Matisse antworten, das Ganze würde stenographisch festgehalten und dann so bearbeitet, dass es als Buch funktionierte.
Am 11. April wurde ein Vertrag unterzeichnet, in dem unter anderem stand, dass das Buch 192 bis 240 Seiten umfassen solle und dass es nur erscheinen dürfe, wenn Matisse den endgültigen Text gutgeheißen habe.
Acht Gespräche fanden in Lyon statt, das neunte in Nizza, wohin Matisse zurückgekehrt war in der Hoffnung, wieder malen zu können. Eines Metallkorsetts wegen, das er seit der Operation tragen musste, konnte er nie länger als eine Stunde stehend arbeiten.
Courthion und Matisse verstanden sich gut, aber bei den Freunden des Malers war der Schweizer schlecht angeschrieben: Der Schriftsteller, Journalist, Zeichner und Karikaturist André Rouveyre (1879–1962) fand, der Name Courthion sollte auf dem Umschlag des Buchs nicht vorkommen. Und der Schriftsteller Roger Martin du Gard (1881–1958) hielt Courthions blumige Einleitung zum Siebten Gespräch für so schrecklich, dass er dafür plädierte, sie ganz wegzulassen. Es ist gut möglich, dass Neid im Spiel war: Rouveyre hätte wohl gern selbst einen Gesprächsband mit Matisse gemacht, andere fanden, Courthion verhalte sich dem Meister gegenüber nicht devot genug. (Noch 1973 schrieb der Matissist Jack D. Flam in seinem Buch Matisse über Kunst als Einleitung zu einem Text von Courthion, es gelinge Matisse, »ungeachtet der offensichtlichen Beschränktheit seines Interviewers« einige wichtige Dinge zu sagen.)
Richtig schlimm wurde es aber, als Matisse erfuhr, dass Skira den Umfang des Buchs von 310 auf 260 Seiten kürzen wollte – einerseits wegen des kriegsbedingten Papiermangels, andererseits, um den Ladenpreis niedrig zu halten. Matisse, der dabei war, eigens für das Buch Zeichnungen zu schaffen, schrieb am 14. Juli einen bösen Brief an den Verleger, der darauf nicht reagierte. In einem zweiten Brief vom 22. Juli schrieb der Maler, Courthion und er seien dabei, alles Überflüssige zu streichen, aber weniger als 300 Seiten werde das Buch nicht umfassen.
Skira lenkte ein, Matisse zeichnete weiter, doch seine Freunde machten dermaßen Stimmung gegen das Buch, dass der Maler im August entnervt an Skira schrieb, trotz drei Monaten Arbeit an dem Buch ziehe er es zurück: Er habe es, nun da er wieder bei Kräften sei, noch einmal gelesen, das seien keine »Plaudereien« (bavardages), sondern das sei nichts als »Gefasel« (radotages). Der Maler verlangte von seinem Chirurgen ein Attest, dass er im April noch sediert gewesen und von einem Verleger reingelegt worden sei, der nichts als ein gutes Geschäft habe machen wollen. Matisse erklärte sich sogar bereit, Skira sämtliche Kosten zurückzuerstatten. Und so wurde das Projekt aufgegeben.
Nachtragend war man offenbar nicht: Bereits 1942 illustrierte Matisse für Skira das Buch Florilège – Des amours de Ronsart. Und Courthion publizierte 1942 das Buch Le visage de Matisse, nachdem er dem Maler versprochen hatte, nichts von den Interviews zu verwenden. Zum Glück behielt er aber das Manuskript der von Matisse abgesegneten Fassung der Bavardages. Der Kunsthistoriker Serge Guilbaut entdeckte es vor ein paar Jahren in den Beständen des Getty Research Institute und gab es dort, ins Englische übersetzt von Chris Miller, 2013 heraus. Die vorliegende deutsche Erstausgabe beruht auf der 2016 bei Skira erschienenen französischen Fassung. Die meisten Anmerkungen gehen auf diese zurück.
Für Hilfe beim Rätseln über die maltechnischen Begriffe danke ich der Restauratorin Françoise Pictet, der Malerin Brigitta Malche und ihrem Mann Yves Schumacher, ganz besonders aber der Kunsthistorikerin Astrid Näff.
Thomas Bodmer
Erstes Gespräch
Wir wählen einen Tisch im Morateur, dem Restaurant des Hotels Carlton. Henri Matisse setzt sich auf die Sitzbank, ich mich auf einen Stuhl ihm gegenüber. Es ist ein langer, kalter, wenig gemütlicher Raum. Matisse bestellt Bordeaux. Der Oberkellner bringt eine Flasche Jahrgang 1880. Sie ist zu alt, wir lassen sie zurückgehen, denn der Wein sei »vorbei«, sagt Matisse. Er isst sein Huhn und den Spargel mit sichtlichem Genuss, als wollte er sagen: »Sie sehen, es klappt.« Der runde Ausschnitt seines blauen Pullovers beginnt direkt unter dem Krawattenknoten (Matisse darf sich ja nicht erkälten). Ich betrachte seine rosige Gesichtsfarbe, die großen Ohrläppchen, die Rosette der Ehrenlegion im Knopfloch seines Jacketts aus englischem Wollstoff.
Die Sekretärin von Matisse hat ihren grauen Pelzmantel anbehalten. »Madame ist Russin, aus Sibirien«, erklärt Matisse. Ihr Gesicht ist ein elegantes Oval, ihre Brauen wirken, als hätte der Meister sie gezeichnet, und sie spricht leise und ruhig. Auch der Kunstbuchverleger Albert Skira ist da.
Wir sprechen von Lyon, den tiefsitzenden Fenstern der zur Rhone hin abfallenden Häuser und vom silbrigen Himmel darüber. Matisse findet, es sei eine konkave Stadt, eine Stadt mit Tiefgang: »Lyon ist eine Stadt mit Gehalt, doch Nizza ist ein Bühnenbild, fragil, sehr schön, aber da finden Sie keinen Menschen – Pech für die Stadtbewohner! Wenn ich sage, man finde keinen Menschen, meine ich damit, dass Leute, die wie ich jeder für sich arbeiten, einander nicht kennen, einander nicht treffen, nicht zur Landschaft gehören. Nach Nizza kommen nur Leute, die sich entspannen wollen: mit Spielen, Spaziergängen, die allerdings nicht lange vorhalten, denn nach jeder Mahlzeit heißt es: ›Was machen wir? In Monte Carlo sind wir gestern gewesen, in Cannes vorgestern. Wo können wir hin?‹ Es gibt in dieser Stadt zwei, drei Träumer, aber sonst vor allem Juweliere, Hoteliers und schöne Mädchen. Und da will man jetzt eine École de Rome[1]eröffnen!«
Matisse sagt das mit undurchdringlicher Miene, einzig seine Lippen sind von Spott gekräuselt, als wäre die Rede von einer alten Schwätzerin, deren Geschwafel man zur Genüge kenne. Als ich das Gespräch auf seine Geburt am 31. Dezember 1869 in Le Cateau bei Cambrai lenke, sagt er:
Ich bin im Haus meiner Großmutter, einer Gérard, geboren worden. Mein Vater wohnte ein paar Kilometer von dort in Bohain. Er war Getreidehändler. Als ich zwölf war, kam ich als Internatsschüler auf das Lycée de Saint-Quentin, ein humanistisches Gymnasium.
Dann war also nicht vorgesehen, dass Sie das Geschäft Ihres Vaters übernehmen würden?
Doch, aber ich litt an wiederkehrenden Blinddarmentzündungen. So etwas ließ sich damals nicht operieren. Deshalb hieß es: »Der Junge braucht etwas Ruhiges, ein friedliches Metier. Was könnte er werden?«
Der Arzt hat darüber nachgedacht und kam zum Schluss: »Wie wäre es mit Apotheker? Da könnte er im Hinterzimmer bleiben, während ein Gehilfe für ihn die Arbeit macht. So könnte er sich pflegen, wenn er einen Rückfall hat, sich ruhig halten, bis es vorbei ist.« Die Rückfälle dauerten einen Monat, anderthalb, manchmal zwei Monate. Wer so etwas hatte, durfte keinen Beruf haben, in dem er ständig aktiv sein musste, sondern einen, in dem er ersetzt werden konnte.
Und das hat nicht geklappt?
Nein, aber ich machte ein Praktikum in einer Anwaltskanzlei. Während der Ferien wusste man nicht, was man mit mir anfangen sollte. Ich war sehr fügsam, ich tat alles, was man von mir wollte. Während meiner langen Rekonvaleszenz ging ich einmal mit meinem Vater auf dem Land spazieren, und er sagte: »Wie wäre es, wenn du Prozessakten abschreiben würdest? Es ist gut, wenn man sich in solchen Dingen auskennt.« Er sprach darüber mit einem Freund. Ich ging hin. Ich schrieb ab. Dabei habe ich erstaunliche, sehr pittoreske Dinge gesehen, komisches Zeug, das aus lauter Eigennutz geschieht, im Bereich des Geschäftlichen wie im Familiären.
Eines Tages kam ein Anwalt vorbei, der seine Kanzlei in Paris hatte. Er sagte: »Was tust du da? Komm doch nach Paris, da kannst du immerhin einen ersten akademischen Grad in Rechtswissenschaft absolvieren. Damit könntest du eine Anwaltskanzlei eröffnen.« Ich sprach darüber mit meinem Vater, der sehr vernünftig war, wenn es um praktische Dinge ging. »Warum nicht?«, sagte er.
Ich kam für ein Jahr nach Paris. Mich hat nichts wirklich interessiert. Ich besuchte regelmäßig die Vorlesungen, aber ich verstand nur Bahnhof. Vor der Prüfung habe ich mich den ganzen Tag in mein Hotelzimmer zurückgezogen und gebüffelt. Zur Ablenkung hatte ich ein Blasrohr aus Glas und etwas Kitt. Vom sechsten Stock aus habe ich so Passanten mit Kittkügelchen beschossen. Damals trugen alle, auch die Angestellten, Zylinder. Ich ließ meine Kügelchen von den Zylindern abprallen, oder, wenn jemand im Gehen Zeitung las, versuchte ich, diese zu durchlöchern. Die haben dann …
Wie Baudelaire mit dem Glaser und dem Blumentopf!
Was ist das für eine Geschichte?
Baudelaire hat ähnliche Streiche gespielt: Eines Tages ließ er einem armen Glaser einen Blumentopf auf den Rücken fallen. Ihre Kittkügelchen waren da weniger gefährlich.
Das ging so lange gut, bis ich eines Tages eine Schneiderin ins Visier genommen hatte, die im Haus gegenüber im Zwischengeschoss arbeitete und gut bestückt war. Mein Kügelchen traf ihre üppige Brust. Die Frau schreckte auf und schaute, woher es gekommen sein könnte. Sie sah mein durch den Fensterladen ragendes Blasrohr in der Sonne aufblitzen, und ich war enttarnt. Sie hat sich im Hotel beschwert. Der Direktor kam zu mir und sagte: »Das geht nicht.« Das ist fast die einzige Erinnerung, die mir von meinem Jurastudium geblieben ist.
Aber Sie haben immerhin ein Examen gemacht?
Ja, das erste in Rechtswissenschaft. Das ist nicht besonders schwierig: Wenn die Gutachter merken, dass man überhaupt mal ein Gesetzbuch aufgeschlagen hat, sind sie bereits zufrieden. Um einem Studenten auf die Schliche zu kommen, sagten sie ihm: »Da haben Sie ein Gesetzbuch. Zeigen Sie uns den Artikel, der das Eherecht betrifft.« Wenn der Student das Buch nahm und offensichtlich nicht wusste, auf welchen Seiten vom Eherecht die Rede war, fiel er durch. Schlug er dagegen die richtigen Seiten auf, wurde ihm dafür ein Punkt gutgeschrieben.
Als ich aus Paris zurückkam, trat ich eine Praktikumsstelle bei einem Anwalt in Saint-Quentin an.
Mit anderen Worten: Dank einer Blinddarmentzündung mussten Sie nicht weiter Rechtswissenschaft studieren? Anderenfalls wären Sie Maître Matisse geworden? Hätten Sie Ihre Berufung vielleicht später entdeckt?
Nein, das wäre nicht mehr infrage gekommen. Es macht Spaß, über solche Entstehungsgeschichten nachzudenken: Oft ist ein Zufall der Auslöser.
Wie sind Sie zum Zeichnen gekommen?
Rein zufällig, auf dem Gymnasium von Saint-Quentin. Mein Freund Émile Jean ging auch auf diese Schule. Wir waren im Zeichenunterricht die beiden Aufmerksamsten, studierten das Modell, das wir vor Augen hatten – ein Feigenblatt, eine römische Büste –, und kümmerten uns nicht darum, was sonst in der Klasse geschah, wer gerade wieder was für Blödsinn machte.
Unser Zeichenlehrer war der alte Anthéaume, ein Asthmatiker zwischen fünfzig und sechzig. Er hatte den Schlüssel zum Klassenzimmer. Einmal hat er sich verspätet. Um zwei waren wir immer noch auf der Treppe, einer Wendeltreppe, die ich noch vor mir sehe, vor der verschlossenen Tür. Es herrschte ein Heidenlärm, der Aufpasser versuchte, uns zum Schweigen zu bringen, aber der Lärm wurde immer größer. Da sahen wir den alten Anthéaume die Treppe hochkommen. Er trug einen Zylinder, und einer von uns spuckte darauf. Stotternd und nach Atem ringend rief er den Aufpasser als Zeugen an: »Oh, Monsieur, die haben … die haben gewagt, auf meinen Hut zu spucken!«
Und danach wollten Sie Maler werden?
Als Émile Jean und ich am Ende des Schuljahres die Bestnote in Zeichnen erhielten – oder jedenfalls eine sehr gute Note –, wurde mir klar, dass mir das Zeichnen leichtfiel, aber nicht in dem Sinn, dass ich da irgendwie weitermachen wollte. Erst viel später kam ich auf die Idee, Maler zu werden.
Ich hatte diese Blinddarmentzündungen. Ich hatte viel freie Zeit, die ich irgendwie ausfüllen musste. Da bekam ich diesen Malkasten. Ich war damals einundzwanzig. Es gab, wie gesagt, immer lange Zeiten der Rekonvaleszenz (weil man damals nicht operierte). Damals, als ich mich bei meinen Eltern erholte, hatten wir einen Nachbarn, er war Direktor einer kleinen Tuchfabrik. In seiner Freizeit malte er Farbdrucke von Schweizer Landschaften ab: ein Chalet vor einer Gruppe von Tannen mit einem rauschenden Bach. Er sagte: »Siehst du, so kannst du dir was an die Wand hängen.« Weil er sah, dass ich während meiner Rekonvaleszenz meist mir selbst überlassen war, riet er mir, mir auch auf diese Art die Zeit zu vertreiben. Mein Vater hielt nichts von dieser Idee, aber meine Mutter machte es zu ihrer Sache, mir einen Malkasten zu kaufen, dem auch zwei kleine Farbdrucke beilagen: eine Windmühle und ein Dorfeingang.
Und die haben Sie abgemalt?
Ja. Die Mühle ist mit ESSITAM signiert, meinem Namen rückwärts. Schließlich war das ein Gemälde, und ein Gemälde gehört signiert.
Davor hatte ich auf nichts Lust gehabt. Alles, was man mich tun lassen wollte, ließ mich kalt. Doch sowie ich diesen Malkasten in die Hände bekam, spürte ich: Das würde mein Leben sein. Wie ein Tier, das einfach auf das losgeht, was es mag, habe ich mich darauf geworfen, zur durchaus begreiflichen Verzweiflung meines Vaters, der mich zum Studium anderer Dinge angehalten hatte. Doch dies hier zog mich in den Bann, war eine Art Paradies, in dem ich völlig frei war, allein und in Ruhe gelassen wurde, während ich bei all den anderen Dingen, die zu tun man mich geheißen hatte, immer eine gewisse Beklemmung und Langeweile empfunden hatte.
»Sowie ich diesen Malkasten in die Hände bekam, spürte ich: Das würde mein Leben sein. Wie ein Tier, das einfach auf das losgeht, was es mag, habe ich mich darauf geworfen.«
Wissen Sie, was aus diesen ersten Matisses geworden ist?
Diese beiden interessanten kleinen Kopien bekam mein Freund Fernand Fontaine, aber im Zug militärischer Umtriebe sind sie verschwunden.
Ich kaufte mir dann ein Buch, Goupils La manière de peindre [Wie man malt], und mit diesem Buch in der Hand malte ich weiter. Das Jurastudium? Daran habe ich gar nicht mehr gedacht.
Ich äußere mein Erstaunen darüber, dass Matisse, nachdem er ohne Nährboden angefangen und zunächst so schlechte Karten gehabt habe, zu dem habe werden können, der er sei.
Das war der Samen, der musste wachsen, die Knospe musste erblühen. Davor hatte mich nichts interessiert. Danach habe ich nur noch das Malen im Kopf gehabt. Da wächst etwas wie verrückt, und man weiß nicht, woher es kommt. Es gab bei uns keine Maler, weder in der Familie noch in der Region. Aber so entwickelt man sich mit größerer Sicherheit, als wenn man in einem gebildeten Umfeld darauf vorbereitet wird.
Aber gab es in Bohain, wo Sie Ihre Kindheit verbracht haben, keinerlei Künstlerkreise oder zumindest Kunsthandwerkerkreise?
Bohain ist ein Zentrum der Handweberei. Da hat man früher indische Halstücher gewoben. Damals trug man Halstücher, die mit Palmetten und Fransen verziert waren und deren Spitzen wie auf alten flämischen Gemälden auf den Rücken hingen. Die Fabrikbüros waren in Bohain. Hier holten die Bauern das Material, das sie dann zu Hause auf Handwebstühlen verarbeiteten. Ein Bauernhaus bestand aus einem großen Zimmer mit einem Bett, einem Tisch in der Mitte und einem Webstuhl. In allen Dörfern der Gegend gab es Weber, die sich tisseurs nannten, im Gegensatz zu den tisserands, die an mechanischen Webstühlen arbeiteten.
Etwas Ähnliches habe ich vor vierzig Jahren in Beuzec-Cap-Sizun, in Finistère, gesehen: Die vierte Ecke des Zimmers nahm eine Kuh mit ihrer Futterkrippe ein.
Hat man nicht der Weberei wegen die Schule von Saint-Quentin gegründet?
Ja und nein. Die Schule von Saint-Quentin war für Saint-Quentin, und Bohain war als Zentrum groß genug, um eine eigene Dessin- und Webschule zu haben. Die Schule von Bohain (wie die von Saint-Quentin, die École de dessin Quentin de La Tour hieß) diente dazu, junge Leute auszubilden, die in mechanischen Webereien arbeiten wollten, die Möbelstoffe und Vorhänge produzierten; sie befand sich im ehemaligen Palais de Fervaques.
Sie sind auf diese Schule gegangen, nicht wahr?
Dort ging ich jeweils zeichnen, morgens von sieben bis acht, bevor die Kanzlei öffnete. Das war, als ich nach meiner langen Rekonvaleszenz, während der ich zu malen begonnen hatte, nach Saint-Quentin zurückgekehrt war.
Haben Sie nicht heimlich zu malen begonnen, weil Ihr Vater gegen Ihre Pläne war?
Das hat er gut gemacht: Er wolle schauen, ob ich dabei bleiben würde. In Saint-Quentin gab es also diese De-La-Tour-Schule, an der ein Lehrer aus Paris, ein Schüler von Bonnat, Vorhangzeichner unterrichtete. Da ging ich von sieben bis acht Uhr früh zeichnen. Mittags, nach einer rasch heruntergeschlungenen Mahlzeit: Malen. Abends um sechs, wenn ich aus der Kanzlei kam: Malen. Gegessen habe ich dann, wenn es nicht mehr hell war. In der Kanzlei fragte der Chef immer: »Monsieur Matisse, was ist der Stand der Dinge?« Er gewöhnte sich daran, dass ich keine Antwort hatte, und sah dann selbst in den Akten nach. Ich war ein major de carte[2], der bei der Arbeit einschlief. Danach hat mich der Chef nichts mehr gefragt. Manchmal schaute mein Vater bei ihm vorbei. Bei jedem dieser Besuche hoffte ich, der Chef würde »So geht das nicht« sagen und mich rausschmeißen. Doch ich hörte ihn sagen: »Es geht, er wird sich eingewöhnen.« In der Schule sagte mir der Lehrer eines Tages: »Sie könnten doch Maler werden.« Mein Vater hatte mein Studium bezahlt. Als ich ihm sagte: »Ich möchte Maler werden«, war das, als würde ich ihm sagen: »Was du getan hast, war nutzlos, und es wird nie etwas daraus werden.«
»Lass ihn ein Jahr lang machen«, sagte meine Mutter. Und sie machte ihm das Leben dermaßen zur Hölle, dass er sich umstimmen ließ. So kam ich nach Paris und hatte ein Jahr der Freiheit vor mir.
»Man steckt in allem drin, was man macht, in den ersten Bildern wie in den letzten. Erst die Entwicklung der Persönlichkeit, die schon im ersten Bild steckt, lässt diese Persönlichkeit in der Welt zur Geltung kommen.«
Was war Ihr erstes echtes Gemälde nach Ihrer Kopie der Mühle?
Eines Tages habe ich auf dem Dachboden meiner Großeltern das erste Bild gefunden, das ich gemalt hatte, mein erstes Stillleben: meine Jurabücher, nach der Natur gemalt.
Es hat mich überrascht, dass ich in diesem Bild alles gefunden habe, was ich danach gemacht hatte, und ich sah nicht, warum ich noch zehn Jahre lang Unterricht genommen hatte. Beim Nachdenken wurde mir klar, dass das, was ich in dem Bild gefunden hatte, meine Persönlichkeit war. Ich musste mir aber auch sagen: Hätte ich nur dieses eine Bild gemalt, wäre diese Persönlichkeit von niemandem bemerkt worden, weil sie sich nicht entwickelt hätte.
Man steckt in allem drin, was man macht, in den ersten Bildern wie in den letzten. Erst die Entwicklung der Persönlichkeit, die schon im ersten Bild steckt, lässt diese Persönlichkeit in der Welt zur Geltung kommen. Sie war zwar schon da, aber nur in Form einer einzigen Zelle.
Was Sie da sagen, erinnert mich an meinen Besuch in Ihrer Wohnung am Boulevard Montparnasse, wo ich alte Bilder von Ihnen hängen sah. Ich habe Sie in jedem einzelnen Bild wiedergefunden, aber ich dachte: Würde ich nicht Ihr Gesamtwerk kennen, dann hätte ich aufgrund dieser sehr bunten Getreidehaufen, des Seineufers beim Quai Saint-Michel und des Stilllebens mit dem geschälten Apfel wahrscheinlich nicht die richtige Vorstellung von Ihrer Kunst. Man sieht gern Verbindungen in diesen Frühwerken, in denen der Hauch des Neuen oft in der Tradition unterzugehen droht. Aber beim wirklich eigenständigen Werk, in dem sämtliche Brücken verbrannt zu sein scheinen, dauert die Initiation länger, ist sie schwieriger.
Es ist gut, dass es länger dauert.
Mit seinem Dessertmesser zeichnet er kleine Striche aufs Tischtuch. Seine Finger sind nie untätig. Sie müssen einen Bleistift befühlen, über eine Gabel fahren. Sie sind weiß, gepflegt, auf dem Handrücken mit Sommersprossen übersät, es sind Hände, die ständig unterwegs sind.
Wir hören Stühle scharren. Deutsche in Zivil, die in einem gesonderten Raum gespeist haben, gehen hinaus. Ich sehe sie in hierarchischer Ordnung und in strammer Haltung an der Tür vorbeigehen. Während Matisse sie beobachtet, denke ich: Er ist nach der Katastrophe in Frankreich geblieben, zu Hause geblieben. (Matisse hat uns erzählt, wie er dem Exodus nach Saint-Jean-de-Luz gefolgt ist; danach ging er nach Nizza, des Lichtes wegen und um seine Ärzte zu konsultieren.)
Matisse holt seinen Pass hervor. Ich sehe ein Visum für Brasilien, ausgestellt am 1. Mai 1940.
Gerade als ich einen Monat wegreisen will, treffe ich in der Rue La Boétie Picasso. Er sieht mir an, dass ich mich freue.
»Was ist denn mit Ihnen, mein Freund?«
»Ich, äh, ich reise nach Brasilien.«
»Wissen Sie denn noch nicht, was passiert ist? Die Deutschen sind in Reims.«
Und Picasso macht eine Geste: »Da, gleich um die Ecke. Doch, doch, mein Freund. Genau wie bei der École des Beaux-Arts[3].«
Beim Reden klopft Matisse mit der Hand leicht auf den Tisch. Wir sind allein in dem etwas trübseligen, leblosen Raum, wo die Wirtin sich hinter dem Tresen aufplustert.
Matisse gesteht, etwas müde zu sein: »Was ich Ihnen gestern erzählt habe, hat mich in der Nacht nicht losgelassen.« Wir trauen uns nicht, ihn um ein Treffen am nächsten Tag zu bitten. Doch er lädt uns dazu ein. »Auf Wiedersehen«, sagt er. »Die Wahl des Restaurants überlasse ich Ihnen.«
Zweites Gespräch
Im La mère Brazier in der Rue Royale wird die traditionelle alte französische Küche gepflegt. Selbst in diesen Zeiten der Rationierung gelingt es der mère, ein Festessen aufzutischen. In der kleinen abgesonderten Gaststube mit den weißen Wänden aus glasiertem Backstein genießen wir die getrüffelten Artischockenböden mit Walnüssen. Der Bordeaux hat Körper. Für die Hinfahrt haben wir mit Henri Matisse ein Taxi genommen. Zu Beginn des Gesprächs habe ich auf seiner Stirn kleine Schweißperlen bemerkt, offenbar war es für ihn etwas anstrengend, herzukommen. Doch als die Tauben mit Erbsen aufgetragen werden, ist Matisse bereits in Schwung gekommen und erzählt von seiner Studienzeit und seinen Lehrern, wobei er die Ticks von Bouguerau, Ferrier und Cormon, all diesen pompiers[4], die ihm das Studentenleben schwer machten, nachahmt. Das Gesicht von Matisse wirkt auf mich griechischer denn je und seine Mimik ungewöhnlich ausdrucksvoll. Beim Reden zeichnet er mit dem Fingernagel auf das Tischtuch und versucht dann, wohl aus einem Bedürfnis nach Kontinuität, dessen Streifen und diejenigen des Saums aufeinander auszurichten.
Ab und zu wird Matisse von seinen Gefühlen übermannt. Schließlich schildert er uns da mit wenigen Worten nicht nur seine Jugend, sondern die Epoche, in welcher Gustave Moreau und Eugène Carrière verglichen mit Bonnat und Gérôme geradezu rebellisch wirkten.
Als ich in Saint-Quentin in der Anwaltskanzlei arbeitete, erzählte man mir: »Hier wohnt schon seit Langem der Maler Couturier, ein Freund des Landschaftsmalers Charles Jacques. Nun da Sie ja nach Paris gehen, besuchen Sie ihn doch mal.« Couturier zeigte Interesse für meine ersten Versuche und ermutigte mich, indem er sagte: »Außer Gustave Moreau und Puvis de Chavannes kenne ich keinen Maler, der aus reichem Hause stammt. In Paris hatte ich zusammen mit Gustave Moreau und Bouguereau Unterricht bei Picot. Gehen Sie zu Bouguereau und zeigen Sie ihm, was Sie gemacht haben.«
Wie sind Sie nach Paris gekommen?
Ich kam mit Jules Petit, einem talentierten Maler. Wir mieteten zwei Zimmer in der Rue du Maine. Wir kochten zusammen. Nachdem ich mich von meinem Kameraden getrennt hatte, zog ich in ein Haus am Quai Saint-Michel, wo ich, von ein paar Unterbrechungen abgesehen, mehr als dreißig Jahre gewohnt habe.
In der Nummer 19, nicht wahr?
Ja. Für 350 Francs jährlich hatte ich ein Zimmer im sechsten Stock. Da gab es nur ein Dachfenster. Dafür sah ich abends, wenn ich im Bett lag, den Himmel. Eines Nachts (ich hatte furchtbar Angst davor, nach Saint-Quentin zurückkehren zu müssen) hatte ich einen Albtraum. Ich sah mich darin in der Anwaltskanzlei. Ich sagte mir: »Jetzt ist es passiert. Ich bin wieder dort.« Ich war schweißgebadet vor Angst. Dann öffnete ich die Augen, sah den Himmel, die Sterne. Ich war gerettet!
Wo in Paris haben Sie danach noch gewohnt, bevor Sie das Atelier in Issy-les-Moulineaux übernahmen und in die Nummer 132 am Boulevard du Montparnasse zogen?
Matisse denkt eine Zeit lang nach. Dann sagt er:
Als Erstes habe ich in der Rue du Maine gewohnt. Als Zweites am Quai Saint-Michel im sechsten Stock. Als Drittes, weil ich ein größeres Atelier brauchte, in der Rue Saint-Jacques im Erdgeschoss in einem Bildhaueratelier, das so feucht war, dass meine Schuhe schimmelten: Die eine Wand grenzte an den Kühlraum des Fleischers nebenan. Ein Freund verhinderte, dass ich dort schlief, und so habe ich bei ihm gewohnt, um in diesem Raum nicht zu verrecken. Als Viertes zog ich nach einem Vierteljahr zurück an den Quai Saint-Michel, wo ich ein Atelier mit Blick auf die Seine hatte. Dort habe ich geheiratet. Danach habe ich von Jahr zu Jahr größere Wohnungen gemietet. Ich bin dort geblieben, bis ich ins ehemalige Couvent des Oiseaux gezogen bin, und 1914 bin ich, statt nach Marokko zu reisen, dorthin zurückgekehrt.
Sie sind meines Wissens 1892 nach Paris gekommen und haben sich in diesem Jahr an der Académie Julian für die Vorbereitungsklasse für die École des Beaux-Arts eingeschrieben, in die Sie aufgenommen werden wollten.
Ich habe mich zuerst bei Bouguereau gemeldet und ihn gebeten, mich als Schüler zu nehmen. Ich zeigte ihm zwei Bilder, die ich in Saint-Quentin gemalt hatte, und er sagte mir: »Aha, perspektivisches Zeichnen kennen wir nicht! Macht nichts, das können Sie lernen. Sie können in mein Atelier in der Julian[5] kommen.«
In der Rue du Dragon?
Nein. Die Académie Julian befand sich zunächst noch in der Rue du Faubourg-Saint-Denis. Zwei Wochen nach meiner Ankunft zog sie dann um in ein Gebäude in der Rue du Dragon, das man eigens zu diesem Zweck eingerichtet hatte. Im Atelier korrigierte Bouguereau gutmütig und freundlich, indem er mit dem Malstock auf das Bild deutete und sagte: »Ach, Malen ist schwierig!«
Mit der Spitze des Messergriffs zeichnet Matisse einen Halbkreis aufs Tischtuch und zeigt, wo seine Staffelei stand, wo das Modell posierte und durch welche Tür Bouguereau jeweils hereinkam, dessen weinerliches Näseln er imitiert.
In der ersten Stunde machte Bouguereau großes Bohei darum, dass ich meinen Kohlestift mit dem Finger abwischte und dass meine Zeichnung auf dem Blatt schlecht platziert war. (Ist eine Figur zu weit oben, spricht man in Zeichenateliers von einem Gehängten.) Schließlich hieß er mich ein paar Gipsabgüsse abzeichnen, und sprach von der akademischen Konzeption, die überall die gleiche war: ein Senkblei zu verwenden und solche Dinge. »Lassen Sie sich das von einem der Älteren zeigen.«
In der Woche danach kam Gabriel Ferrier statt Bouguereaus. Das war ein kleiner Mann mit einer etwas nervösen Sprechweise, einem gezwirbelten Schnurrbart und Schmachtlocken an den Schläfen. Ich hatte einen Gipsabguss kopiert, die Büste eines Gärtners von Louis XV. Als er daran vorbeiging, rief Ferrier: »Wer hat das gemacht?« Die anderen Schüler holten mich. Der Lehrer zeigte auf mich und sagte:
»Das ist ein Künstler! Warum arbeiten Sie nicht mit lebenden Modellen?«
»Das trau ich mich nicht. Ich bin noch ganz am Anfang.«
»Zeichen Sie lebende Modelle, und Sie werden alle die da überflügeln«, sagte er und zeigte auf die versammelten Schüler.
Bei der nächsten Sitzung korrigierte Ferrier eine Figur, deren Kopf ich ausradiert hatte, weil ich damit nicht zufrieden war. Als ich in der Zwischenzeit etwas an der Hand änderte, geriet er außer sich und sagte: »Was? Sie arbeiten an der Hand und haben den Kopf noch nicht gemacht? Überhaupt ist das schlecht, dermaßen schlecht, dass ich es gar nicht sagen kann!«
Ein komischer Vogel, fand ich.
Die Korrekturstunden waren jeweils dienstags und samstags. Ich habe sie dann nicht mehr besucht.
Um 1920 herum habe auch ich an der Julian gearbeitet. Es gab einen guten Kameradschaftsgeist, aber die Schüler wurden auf reine Technik, auf falsche Virtuosität getrimmt. War das zu Ihrer Zeit auch schon so?
An der Julian sah ich Bilder, die nackte Frauen und Männer darstellten. Die Ausführung war perfekt, aber sie waren völlig leer, wirklich vollkommen leer. Da war nichts als Technik. Ich sah nicht ein, warum ich so was malen sollte. Ich hätte aber auch gar nicht gewusst, wie ich in diese Richtung hätte gehen sollen. Drei Monate später hingegen war ich in Lille, wohin mein Vater oft fuhr. Dort ging ich ins Museum. Als ich Goyas Die alten Frauen und Die jungen Frauen sah, haben die mich gepackt, und ich sagte: »Solche Bilder werde ich malen.« Ich begriff, dass ich mich auf so etwas einlassen konnte. Da hat sich eine Tür aufgetan. An der Julian hingegen stand ich vor einer verschlossenen Tür.
Mit meinem Freund Émile Jean aß ich immer in einem kleinen Bistro in der Rue du Faubourg Saint-Denis, unweit der Académie Julian. Ich versuchte, das Geld, das mein Vater mir für ein Jahr gegeben hatte, zwei Jahre lang reichen zu lassen, und aß deshalb nur halbe Portionen. »Es tut mir in der Seele weh, dich so Wasser trinken zu sehen«, sagte mein Freund Jean. »Das hältst du nicht durch.« Und er goss mir etwas Rotwein in mein Wasser.
Ernst listet Matisse auf:
Also: 6 Sous für eine halbe Portion, 3 Sous für das Brot, 3 Sous für den Brie und dann noch Kaffee für 2 Sous, macht zusammen 13 Sous. Monsieur Jean dagegen gab jedes Mal 25 Sous aus.
»Ich versuchte, das Geld, das mein Vater mir für ein Jahr gegeben hatte, zwei Jahre lang reichen zu lassen, und aß deshalb nur halbe Portionen.«
Ich glaube, Sie haben Glück gehabt, dass Sie an der École des Beaux-Arts Kurse beim einzigen Lehrer belegten, der auch wirklich etwas zu bieten hatte: Gustave Moreau. 1892 war er an die Rue Bonaparte berufen worden.
Es war entmutigend, wie zerfahren der Unterricht war. Man hatte mir gesagt: »Wenn du Klassisches machen willst, musst du an die École des Beaux-Arts gehen.« Dort gab es drei festangestellte Professoren: Bonnat, Gérôme und Gustave Moreau. Jeder war für ein Atelier an der École zuständig, samstags und mittwochs kamen sie jeweils vorbei und gaben den jungen Männern, die im überdachten Innenhof mit all den Abgüssen antiker Kunstwerke arbeiteten, Ratschläge. Um als junger Mann zugelassen zu werden, musste man allerdings empfohlen worden sein, beispielsweise von jemandem, der im Salon de Paris mit einer Medaille ausgezeichnet worden war. So ein Atelierchef gab sich schließlich nicht mit jedermann ab. Ich kannte niemanden. Aber einer der Professoren war neu: Gustave Moreau. »Er ist sehr nett«, hieß es. »Wenn du willst, dass er dich korrigiert, brauchst du dich, wenn er im Innenhof ist, bloß hinter deinen Hocker zu stellen und Moreau zu grüßen, und dann korrigiert er dich.«
So habe ich ihn kennengelernt. Er sagte:
»Arbeiten Sie in meinem Atelier.«
»Ich bin aber nicht an die École aufgenommen worden.«
»Das macht nichts.«
Haben Sie nicht in Moreaus Atelier die meisten Kollegen kennengelernt, die danach unabhängige Kunst geschaffen haben?
Doch. Das war schon bemerkenswert. In der Regel redeten die Professoren nicht. Bonnat betrachtete die Bilder seiner Schüler mit einer gewissen Geringschätzung, sagte ab und zu mal ein Wort, aber keineswegs immer. Man erzählte sich, einmal habe er einem Schüler gesagt: »Versauen Sie es ruhig«, und sei dann gegangen. Gérôme versuchte seine Schüler zu entmutigen. Er sagte ihnen: »Sie alle werden an Hunger sterben.« Einer seiner Sprüche ging so:
»Was ist Ihr Vater von Beruf, mein Freund?«
»Kohlenhändler.«
»Na also! Gehen Sie Kohlen verkaufen!«
Er hat sie also gedrängt, die väterliche Tradition fortzuführen.
Gustave Moreau lebte allein, er war mit Degas in Italien gewesen, sie hatten zusammengearbeitet. Er kannte Puvis de Chavannes ein bisschen, traf aber eigentlich niemanden, empfing keine Besuche. Er hatte sich bereiterklärt, an der École zu korrigieren als Stellvertreter von Élie Delaunay.
Dem, der Die Pest in den Pontinischen Sümpfen[6] im Palais du Luxembourg gemalt hat?
Ja. Moreau, der nur befristet angestellt worden war, ist dann geblieben.
Und wie hat er unterrichtet?
Er nahm das Unterrichten sehr ernst, sprach viel über die Meister und deren hehre Geister, wetterte gegen den Realismus und heizte die Phantasie seiner Schüler an.
»Moreau zeigte uns nicht, wie man malt, sondern er befeuerte unsere Phantasie, indem er auf das Leben hinwies, das in diesen Bildern steckte.«
Man sagt, unter seinen Schülern habe Moreau vor allem diejenigen geschätzt, die sich ihm zu trotzen trauten, die das Risiko eingingen, auf die Schnauze zu fallen, die Hitzköpfe, die Koloristen.
Es gab darunter welche, die am Rompreiswettbewerb teilnehmen wollten und alles taten, um die dafür nötige Medaille zu ergattern. Die mochte er nicht besonders, aber er korrigierte sie dennoch. Und dann gab es solche, die eigenwilliger vorgingen. Die mochte er lieber.
Eines sprach ganz besonders für ihn: Er führte uns in den Louvre. Vor ihm hatte Bouguereau, wenn auch selten, gesagt: »Gehen Sie in den Louvre, dort werden Sie dies und jenes sehen.« Er steuerte seine Schüler Richtung Dekadente: Guido Reni, Sodoma. Moreau hingegen begleitete seine Schüler in den Louvre. Er ließ uns Kopien anfertigen, deren Ausführung er lenkte. Er stellte uns vor Bilder von Holländern, Italienern. Seine Auswahl war besser, er brachte uns zu den wirklich guten Malern. Er zeigte uns nicht, wie man malt, sondern er befeuerte unsere Phantasie, indem er auf das Leben hinwies, das in diesen Bildern steckte.
Hat er Sie im Louvre arbeiten lassen?
Ja, dort mussten wir kopieren. Das hatte außerdem den Vorteil, dass wir unsere Arbeiten der Kommission präsentieren konnten, die im Louvre für den Kauf von Kopien zuständig war. Die bezahlte 200 bis 300 Francs für eine gute Kopie, die dann einem Provinzmuseum geschickt wurde. Dafür musste man allerdings Kopien machen, die eigentliche Faksimiles waren, musste also servil und nicht intelligent kopieren. Die Kopien, die angekauft wurden, stammten alle von Töchtern oder Frauen der Aufseher. Uns hat man nichts abgekauft. So hat Albert Marquet im Louvre Veroneses Kreuzigung kopiert. Das war ein quadratisches Gemälde mit einem Meter Seitenlänge. Er hat an der Kopie bestimmt drei Monate gearbeitet. Die Kommission wies sie zurück. Er arbeitete weitere drei Monate und dann sechs Monate daran. Die Kommission wies sie erneut zurück. So ging das zwei Jahre lang. Diese Kopie, die sehr schön war, wurde schließlich endgültig abgelehnt, und Marquets Mutter, die aus Arès im Bassin d’Arcachon stammte, schenkte diese Kreuzigung der dortigen Kirche. Doch die Frömmlerinnen empörten sich und verlangten, dass das Bild entfernt werde, da die beiden Schächer ungenügend bekleidet seien.
Sie haben, glaube ich, die Kopien, die Sie im Louvre angefertigt hatten, wiedergefunden?
Ja, auf dem Dachboden des Louvre. Ich hatte sie dort gelassen. Mein Atelier war nicht groß. Die Studie war abgeschlossen, das Resultat erreicht. Eines Tages sagte mir jemand: »Man wird die Kopien verkaufen. An der Tür ist ein entsprechender Anschlag.« Eine Kopie von Chardins Rochen war dabei. Ich habe sie zu sehen verlangt. Es war meine. Also hat man sie mir gegeben.
Was für andere Werke haben Sie im Louvre kopiert?
Mehrere Poussins, unter anderem den Narziss. Ich habe Annibale Carraccis Jagd kopiert, ein sehr schönes Werk. Diese Kopie wurde von der Stadt Grenoble angefordert, um sie ins Rathaus zu hängen. Ich glaube, der Museumsdirektor hat danach verlangt. Dann den Toten Christus von Philippe de Champaigne, Raffaels Baldassare Castiglione, Ruysdaels Sturm, verschiedene Chardins, darunter sein Buffet mit der Früchtepyramide.
Was hat Gustave Moreau bei Ihrer ersten Begegnung gesagt? Wie haben Sie mit ihm Kontakt aufgenommen?
Ich habe zuerst bei den antiken Kunstwerken gearbeitet, danach im Louvre, wo ich zwei Chardins kopierte. Das erste war Pfeifen und Trinkgeschirr. Das war einschüchternd, wenn man so was zum ersten Mal machte. Die Farbmaterie dieses Gemäldes ist bemerkenswert, sehr dicht. Meine Kommilitonen sagten: »Du hast nicht genug Weiß verwendet.« Also habe ich mehr Weiß verwendet. Diese Kopie misslang, weil ich auf die anderen gehört hatte. Moreau sagte mir: »Kopieren Sie Davidszoon de Heems Stillleben mit Prunkgeschirr.« Ich machte mich daran. Es war sehr kompliziert. Man könnte meinen, das Bild sei mit einer Lupe gemalt worden, es ist unendlich detailliert. Ich habe mich deshalb ans andere Ende des Saals gesetzt und so gemalt, als arbeitete ich nach der Natur.
Sie haben später eine freie Interpretation dieses Bildes gemalt. Sie ist in meinem kleinen, bei Rieder erschienenen Buch[7] neben Ihrer Kopie abgebildet. Es ist interessant zu sehen, wie Sie das betont haben, was Sie an dem Bild des Holländers interessiert hat: sein Aufbau und die Rhythmen der Linien.
Der Verleger Skira erzählt von der Schwierigkeit, manche Farben zu reproduzieren:
ALBERTSKIRA: Was Chardins Pfeifen





























