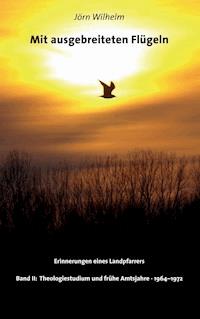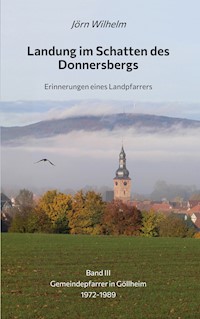
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Erinnerungen eines Landpfarrers
- Sprache: Deutsch
Kann man in der tiefsten Provinz, wo der Naziwahn noch immer seine Sumpfblüten treibt, mit Hilfe der Jugend eine bessere Zeit beginnen? In Göllheim, in der Nordpfalz, und in den umliegenden Dörfern, macht sich Jörn Wilhelm an die Arbeit, um eine neue brüderliche "Koinonia" (Gemeinschaft) auf den sozialistischen Weg zu bringen. Das bringt ihm viel Kampf und eine Feindschaft ein, die ihn an den Rand des Berufsverbots treibt. Doch wächst er nun immer mehr in die Rolle des "Landpfarrers" hinein und erfährt zunehmend Anerkennung. Die Jugendarbeit ist dabei immer seine besondere Liebe, die manchmal auch zur "amour fou" wird. Es gelingt ihm aber, der Jugend den Weg in die große Welt zu zeigen: Im damals noch geteilten Berlin, in München, in Paris und an den Orten der Friedensbewegung, die Anfang der 80er Jahre zur Massenbewegung wird. An allen großen Kirchentagen wird teilgenommen. Schließlich trennt er sich von Göllheim, immer noch im Konflikt mit der politischen Obrigkeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Notizen aus der Jetztzeit I
1972: Landung in Göllheim
Wohnprobleme und die Mühen der Verständigung
„Pfarrer gründet Juso-Verband“
Wahlkampf in Göllheim
Das Olympia-Attentat aus der Ferne
Pfälzische Pfarrer in Wählerinitiativen
Notizen aus der Jetztzeit II
Bewegte Anfangsjahre
Umstrittene Predigten
Erste Reise mit dem „Frauenbund“
„Erdnussparty“ in der Kirche
Das große Zementwerk
Weltjugendspiele in Ostberlin mit Rudi Dutschke
Notizen aus der Jetztzeit III
Rüssinger Geschichten
Dienstfahrt mit Altar
Eine Kirchendienerin mit „angeborenem Schwachsinn“
„…und ihr habt mir Herberge gegeben“
Notizen aus der Jetztzeit IV
Im Gegenwind
„Der rote Pfaff muss weg!“
Revolution mit der Wasserpistole
„Was hatten sie nur gegen uns?“
Notizen aus der Jetztzeit V
Standpunkte
Wyhl: „Nai hämmer gsait!“
Die Reise nach Cottbus
Mein DKP-Trip und sein Ende
„Pfarrer, die dem Terror dienen“
Notizen aus der Jetztzeit VI
Streifzug durch die Seelsorgeregion
Von Seelen und Menschen
Beerdigungen auf dem Lande
Beistand für Kriegsdienstverweigerer
Ein Bruder von der Landstraße
Notizen aus der Jetztzeit VII
Familienbande
Mein Onkel fällt aus dem Rahmen
Notizen aus der Jetztzeit VIII
Trampfahrt durch England, Schottland und Irland
Jugendarbeit, mon amour
Kindergottesdienst und Kindergruppe
Arbeit mit Konfirmanden
Ehemalige Mitarbeiter*innen im Gespräch
Die letzten Jahre der Jugendarbeit
Notizen aus der Jetztzeit IX
1981: Ein wichtiges Jahr der Friedensbewegung
Evangelischer Kirchentag in Hamburg
Der 10. Oktober 1981 im Bonner Hofgarten
Gelöbnisfeier in der Provinz
Straßentheater in der Keiper-Stadt
Nachwort zum Friedensjahr 1981
Notizen aus der Jetztzeit X
Der wiedergewonnene Atem
Leseerfahrungen: Jurek Becker, Dorothee Sölle
Fremd in Japan
Jona: Flucht ins Idyll vor den Katastrophen der Welt
Notizen aus der Jetztzeit XI
Abschied
Tod des Vaters
Noch einmal Tokio: Krankenhaus Toranomon
Warum ich Abschied von Göllheim nahm
Zum Schluss: Die Wiederkehr der Synagoge
Dank und weitere Perspektive
Literaturauswahl:
Personenregister
… (er) entdeckt in sich… eine wundersame neue Fähigkeit. Die Fähigkeit sich zu erinnern. Er erinnert sich nicht wie bisher, unverhofft oder weil er es wünschte, an dies und jenes, sondern mit einem schmerzhaften Zwang an alle seine Jahre, flächige und tiefe, und an alle Orte, die er eingenommen hat in den Jahren. Er wirft das Netz Erinnerung aus, wirft es über sich und zieht sich selbst, Erbeuter und Beute in einem, über die Zeitschwelle, die Ortschwelle, um zu sehen, wer er war und wer er geworden ist.
Ingeborg Bachmann in: Das Dreißigste Jahr
Notizen aus der Jetztzeit I
Immer wieder dieser Traum. Am frühen Morgen, wenn der Schlaf oberflächlicher wird und sich im Geträumten der kommenden Wirklichkeit des Tages annähert. „Quältraum“ nenne ich für mich selbst diese Gattung. Fast immer beschäftigen sich diese Träume mit dem, was ich in vier Jahrzenten als evangelischer Pfarrer hatte tun müssen. So träume ich nun auch am frühen Morgen des heutigen Tages:
Ich betrete die Kathedrale mit ihren hohen gotischen Säulen, die fast bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Ich fühle mich gut. Ich glaube, eine ausgezeichnete Predigt geschrieben zu haben, welche die Menschen bewegen wird. Wie so oft ist es eine „politische Predigt“, die mutige Worte enthält gegen die Gleichgültigkeit und Apathie der zum Schweigen Gebrachten, die kein Unrecht mehr bemerken wollen, selbst wenn es himmelschreiend ist. Auch den nicht mögen, der solches benennt. Beschwingt dennoch und trotzig trete ich vor den Altar. Wie immer beginne ich mit der trinitarischen Formel, die behauptet, dass ich nicht in eigenem Namen, sondern in höherem göttlichen Namen spreche. Noch genieße ich volle Aufmerksamkeit. Auch für das Folgende: Psalm, Gebet und Lesung. Die an der Liedtafel angeschlagenen Liedverse werden dazwischen raumfüllend und mit Inbrunst gesungen. Nun müsste ich zur Kanzel hinaufsteigen und nehme dafür Bibel und Ringbuch samt Predigt in die Hand. Aber ganz plötzlich befällt mich eine Lähmung, die mich am Aufstehen und Gehen hindert. Es geht nicht! Im wahrsten Sinne des Wortes geht nichts mehr.
Nun beginnt die Quälerei: Weil es nicht mehr weitergeht, fangen die Gottesdienstbesucher an miteinander zu reden. Der Lärmpegel steigt immer höher. Einige stehen auf, wandern durch die Kirche, sprechen Bekannte an und setzen sich wieder mit Ungeduld im Gesicht. Ich starte einen neuen Gehversuch, doch die Beine sind erstarrt und gehorchen mir nicht mehr. Ein mir offensichtlich bekannter Mann geht auf mich zu, schüttelt mir die Hand und klopft mir aufmunternd auf die Schulter, um sich danach Richtung Ausgang zu bewegen. Das ist der Anfang einer Kettenreaktion. Nicht ohne mir freundlich zuzulächeln, gehen sie, einer nach dem anderen, an mir vorbei. Ihnen reicht offenbar, was ich bisher gesprochen habe und sie vermissen nichts. Soll ich es noch einmal versuchen für die Wenigen, die sitzengeblieben sind? Mühsam erhebe ich mich und tatsächlich gelingt es mir, einige Schritte zur Kanzel hin zu tappen. Aber die Kanzeltreppe ist zu viel für mich: Vor ihr sinke ich ermattet nieder. Inzwischen haben auch die Wenigen sich auf den Weg zum Ausgang gemacht.
Dann wache ich auf. Wie nach einem Alptraum freue ich mich, dass das alles nicht wirklich geschehen ist. Aber es war kein Alptraum. Niemand und nichts hatte mich bedroht. Im Gegenteil: Ich hatte Freundlichkeit und Sympathie gespürt. Aber es war ein Quältraum und die Qual bestand darin, das Richtige nicht zur rechten Zeit sagen zu können.
(August 2018)
1972: Landung in Göllheim
Nicht jedem, der hier landete, erging es gut. Dem kanadischen Piloten jedenfalls nicht, der in der Nähe von Göllheim am Gundheimerhof mit dem Fallschirm notlandete. Mein ehemaliger Nachbar, der Landwirt Günter Hartmüller – damals im Frühsommer 1944 gerade einmal neun Jahre alt –, hat mir jetzt darüber erzählt:
Der Pilot wurde von einer Gruppe Soldaten aufgegriffen, die ihn ins Dorf trieben. Seinen Fallschirm musste er vor sich hertragen. Im Dorf angekommen, versammelte sich um ihn eine Anzahl von Menschen. Von einer Frau – ihr Name war bekannt wurde er beschimpft, bespuckt und geschlagen. Danach wurde er zum Bürgermeisteramt verbracht. Bald darauf sah man ihn auf der Ladefläche eines LKW zurückkommen, in Begleitung mehrerer uniformierter Männer. Sie fuhren zum südlichen Ortsausgang und hielten dort an. Er musste absteigen. Ein auf Urlaub weilender Soldat, der Uniform trug, richtete dann seine Waffe auf ihn und bedrohte ihn mit dem Tod. Sie wollten ihn wirklich erschießen. In diesem Moment flog ein alliiertes Bombergeschwader über sie hinweg und der Pilot riss hilfesuchend die Arme hoch. Vielleicht hat ihm dies das Leben gerettet, denn plötzlich ließen sie von ihm ab. Mit dem LKW wurde er wieder in den Ort gefahren. Wie es ihm dann weiter erging, haben wir nicht mehr erfahren. Er war ein ganz junger Kerl und er hat mir sehr leidgetan.
Wohl schon 1940 war in der Nähe von Göllheim, auf Lautersheimer Gemarkung, ein Bomber der Royal Air Force vom Typ Handley Page Hampden, notgelandet. Ein Originalfoto zeigt den durch einen Flaktreffer beschädigten linken Tragflügel:
Was mit der vierköpfigen Besatzung geschah, darüber gibt es nur recht widersprüchliche und unzuverlässige Angaben. Ein weiteres Foto zeigt, welch große Aufmerksamkeit bei den Göllheimern diese Landung gefunden hat. Helmut Maul, der zu den Jugendlichen der ersten Stunde gehörte, die ich betreute, sandte es jetzt an mich - mit dem obigen Foto und noch zwei weiteren Bildern. Die Bildunterschrift stammt von ihm:
„Es war fast nicht zu glauben, dass ein englisches Flugzeug bei uns notlandet, umso größer aber war die Neugier der Bevölkerung. Mit Kind und Kegel machte man sich auf, um den englischen Bomber, der einen Treffer der Flakabwehr hatte, zu begutachten.“ (H. Maul)
Als ich 1972 landete, war die Neugier ebenfalls groß. Mein Amtsvorgänger Pfarrer Klaus Enders hatte diese Neugier vor meinem Kommen regelrecht geschürt: „Ich bin ja schon rot, aber der, der jetzt kommt, ist röter, als ihr es euch überhaupt vorstellen könnt“. Klaus Enders war im weiteren Verlauf ein sehr lieber Kollege, der leider vor einigen Jahren gestorben ist. Er gehörte zu einem Typus von Pfarrern, den wir „Urpfaks“* „Volksbeglücker“ nannten: Keine Frau, der er unterwegs begegnete, war sicher davor, von ihm nicht gedrückt und umarmt zu werden – und den meisten gefiel das mehr oder weniger gut. Er hatte aber auch eine Eigenschaft, die in der pfälzischen Pfarrerschaft weit verbreitet war: Er plauderte gerne aus der Schule oder vielmehr aus den Pfarrhäusern und über ihre Bewohner – auch wenn sie noch gar nicht anwesend waren …
Eine Notlandung aber war mein Kommen nicht. Als ich meinen ersten Gottesdienst hielt, war die Kirche fast bis zum letzten Platz gefüllt. Ob die Besucherinnen und Besucher danach schlauer waren, wage ich zu bezweifeln, denn ich hatte sowohl mich wie auch sie überfordert. Den vorgeschriebenen Text aus den johanneischen „Abschiedsreden“ zugrunde legend, war ich in solchem Zusammenhang auf Pier Paolo Pasolinis 1968 angelaufenen Film Teorema – Geometrie der Liebe gestoßen, dessen Inhalt ich in der Predigt nacherzählte:
Ein Postbote stellt an der Tür einer Villa ein Telegramm zu, in dem für den folgenden Tag die Ankunft eines Gastes angekündigt wird. Als der Unbekannte, ein gutaussehender junger Mann, eintrifft, erliegen alle Hausbewohner seiner Faszination, er schenkt ihnen allen seine Liebe und er leitet eine Wende in ihrem Leben ein. Nach seiner Abreise hinterlässt er verwirrte Gefühle und seelisches Chaos, das besonders bei den reichen Villenbewohnern zum Zusammenbruch ihrer bisherigen Wertigkeiten führt. Nur die aus einfachen Verhältnissen stammende Haushälterin findet wieder Halt in ihrem Heimatdorf und in der Meditation.
Ich übertrug die schweren Gedanken dieses filmischen Meisterwerks auf die Situation der Urgemeinde, die nach Ostern vom irdischen Jesus Abschied nahm. Zum Schluss appellierte ich an die Fähigkeit, neue Orientierungen zuzulassen und die bisherigen Wertigkeiten in der Begegnung mit dem wirklichen Jesus in Frage zu stellen. Was aber sollte das konkret bedeuten?
Wohnprobleme und die Mühen der Verständigung
Den ersten „Eingeborenen“, den ich traf, verstand ich überhaupt nicht. Es war der Tag, an dem ich mir das Pfarrhaus zum ersten Mal ansah. Auf der Wiese hinter dem Pfarrhaus, die der Stelleninhaber traditionell zum ohnehin großen mauerumsäumten Pfarrgarten hinzupachtete, begegnete ich ihm: Ein älterer Mann, kleingewachsen und stämmig, mit Stummelzähnen und borstigen grauen Haaren. Er sprach mich an. Doch ich verstand kein Wort. Er brabbelte weiter und durch die Sprachmelodie wurde mir klar, dass er mir eine Frage gestellt hatte. Einfach auf Verdacht hin nickte ich bestätigend. Das war wohl die richtige Antwort, denn freudig ergriff er nun seine Sense und fing an zu mähen. Gleich darauf, nach wenigen Schwüngen mit der Sense, hörte er schon wieder auf, verstaute das gemähte Gras in seinem kleinen Leiterwagen und trollte sich.
Das war, wie ich später erfuhr, Albert Böhmer, der letzte in Göllheim, der Ziegen hielt. Das Gras war für sie bestimmt. Wenn alle so sprachen wie er, musste ich mir die Frage stellen: Wo bist du hier nur gelandet?! Doch zum Glück hatten nicht alle Stummelzähne. Nach einiger Zeit wurde mir der eigenartige Nordpfälzer Dialekt sogar vertraut. Obwohl ich hier die bei weitem längste Zeit meines Lebens verbrachte, habe ich von diesem Dialekt kaum etwas angenommen. Noch immer schimmert das Hamburger Idiom durch die Sprechweise hindurch. Für den Beruf des Pfarrers war diese mangelhafte Integration im Sprachlichen überhaupt nicht förderlich: Immer wenn ich anfing zu sprechen, wechselten meine pfälzischen Gesprächspartner in das, was sie für Hochdeutsch hielten. Der Spontaneität und der Natürlichkeit der Kommunikation tat das entschieden Abbruch und es signalisierte auch die Botschaft: „Du gehörst nicht dazu; du bist und bleibst ein Fremder!“ Wenn aber das Gespräch länger dauerte, fielen meine Gegenüber nach einer gewissen Zeit wieder in ihren angestammten Dialekt zurück und die uneingeschränkte Verständigung konnte beginnen.
Das Göllheimer Pfarrhaus gehörte auch zu jenen „festen Burgen“, die einst erbaut wurden, um einer Pfarrfamilie mit einer großen Kinderschar Obdach zu geben. In einem solchen Domizil hatte ich noch nie gewohnt – und sollte ich zunächst auch nicht wohnen. Denn das Haus war in einem desolaten Zustand: Völlig verwohnt, mit stinkenden Ölöfen nur beheizbar und mit unerträglich knarrenden Dielen. Im Hof stand mit bröckelndem Putz ein Nebengebäude, in dem einst der Pfarrer seine hochherrschaftliche Pferdekutsche untergebracht hatte. Der Dekan des Kirchenbezirks Kirchheimbolanden, Werner Schramm, dessen üppiges Aussehen dem eines wohlgenährten Barockfürsten glich, hatte deshalb schon vor meinem Kommen verfügt, dass eine grundlegende Innenrenovierung in Angriff zu nehmen war. Schramm war ein tüchtiger Machtmensch, dem es Spaß machte, solche Bauvorhaben durchzusetzen und auf den Weg zu bringen. Für mich bedeutete das allerdings, dass ich in diesem Pfarrhaus noch nicht wohnen konnte. Mit Familie ohnehin nicht: Weil meine Frau in Ludwigshafen zunächst noch als Lehrerin beschäftigt war und die Kinder bei ihr und ihrer Familie blieben. Wo aber sollte ich mein Haupt betten?
Die Lösung war einfach: Ich bezog ein kleines Häuschen neben dem protestantischen Albert-Schweitzer-Kindergarten, das die Bauherren vom Presbyterium – in völliger Verkennung der Weltläufe - 1966 als Wohnort der Kindergartenleiterin erbaut hatten. Welche Kindergartenleiterin aber hätte hier einziehen sollen, in so unmittelbarer Nähe zu ihrem Arbeitsplatz und solcher räumlichen Einschränkung in diesem Mini-Haus? Für mich aber, der ich nun für eine gewisse Zeit in mein Singledasein zurückzukehren hatte, kam diese Wohnung gerade recht. Aus dem Amtszimmer des Pfarrhauses entnahm ich die Kirchenbücher und das Amtssiegel und richtete mir in einem leerstehenden Raum des Kindergartens ein „Amtszimmer“ ein: Ohne Tisch und nur mit Kinderstühlen ausgerüstet. Hier hielt ich zwei Mal in der Woche Sprechstunden ab, die aber kaum je besucht wurden. Mir gefiel dieses Provisorium gar nicht so schlecht.
Schon bald wohnte ich in diesem Häuschen nicht mehr allein. Denn Ulrike, inzwischen 4 ½ Jahre alt, vermisste ihren Vater sehr. Sie setzte es durch, dass sie bei mir wohnen durfte. Die erste Zeit genoss Ulrike das unstete Leben noch, in das sie da hineingeriet: Mit unregelmäßigen Mahlzeiten, mit längerem Alleinsein durch meine berufliche Beanspruchung und mit der Unordnung, die bei mir immer mehr ins Kraut schoss. Sie entschädigte sich damit, dass sie außerhalb der Kindergartenzeiten das Spielzeug benutzte, das in den Gruppenräumen lag und sich neue Freundinnen einlud, mit denen sie auf dem Spielplatz spielte. „Warum“, fragte ich sie, die nun schon über 50 ist, „warum bist du eigentlich wieder von mir weggegangen und wie ist das geschehen?“ Ulrike half meiner Erinnerung auf: Die Bücher im Mini-Haus hatten überhandgenommen, sodass es kaum noch ein freies Fleckchen gab; von mir eingeladene Jugendliche waren immer länger geblieben, deren Lärm sie am Einschlafen hinderte; das Schlimmste aber sei der Rauch gewesen, den unser Zigarettenqualm überall verbreitet und der sich wie ein grauer Nebel über alles gelegt hatte.
In ihrer Not rief sie in meiner Abwesenheit bei den Großeltern in Ludwigshafen an und beschwerte sich über ihre Lebensumstände hier. Daraufhin setzte sich ihre Oma, die sonst kaum Auto fuhr, in den VW-Käfer und fuhr im Kostüm und mit entschlossener Miene nach Göllheim, setzte Ulrike kurzer Hand ins Auto und nahm sie mit nach Ludwigshafen. Es war zweifellos eine großmütterliche Entführung, die mich – wie ich mich nun entsinne - zunächst auch ziemlich erboste. Doch dann gewann die Vernunft die Oberhand und ich war froh, von dieser Verantwortung wieder frei zu sein. – Bald darauf änderte Ulrike ihre Meinung erneut und wollte unbedingt wieder zu mir zurück. Aber nun war es zu spät.
„Pfarrer gründet Juso-Verband“
Nach meinem ersten Gottesdienst wanderten die Mitglieder des Presbyteriums mit mir zu einer Besichtigung des Albert-Schweitzer-Kindergartens. Danach beschlossen wir, „noch einen trinken zu gehen“ in der Wirtschaft neben dem Pfarrhaus. Auf dem Weg dahin sprach mich der stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums an, Emil Hild, und stellte sich ins gebührende Licht: Er sei außerdem noch Vorsitzender des Kriegsopferverbandes VdK und des SPDOrtsvereins. Da rutschte es mir einfach heraus: „Dann sind wir ja Genossen!“ Das erfreute ihn sehr, aber ein älterer hochgewachsener Presbyter wurde Zeuge dieser Aussage und verzog ziemlich abgestoßen sein Gesicht. Kein Wunder: Denn er war im Vorstand der örtlichen CDU. Und nun war es ja kein halbes Jahr mehr bis zur Bundestagswahl, die nach dem Verlust der sozialliberalen Regierungsmehrheit im Bundestag notwendig geworden war.
Wieso ich behauptet hatte, ein „Genosse“, also ein SPD-Mitglied zu sein, weiß ich heute nicht mehr. In Wirklichkeit fühlte ich mich immer noch der APO zugehörig, jener Bewegung, die Änderungen im gesellschaftlichen Leben im außerparlamentarischen Raum vorantreiben wollte. Und eigentlich war mir diese Partei auch viel zu „rechts“, etabliert und verbürgerlicht, als dass ich mich in ihr zu Hause hätte fühlen können. Einen Juso-Verband gab es hier, auf dem platten Lande, noch nicht. Unvergessen war auch die „Begegnung“ mit Helmut Schmidt in Heidelberg … (s. Band II Mit ausgebreiteten Flügeln , S.159f.). Aber gesagt, war gesagt: Ich wurde tatsächlich Mitglied der SPD und holte mir das Parteibuch bei Emil Hild ab. Damals wusste ich noch nicht, wie viele Schwierigkeiten mir diese Entscheidung noch bescheren würde…
Mir war aufgefallen, dass die Jugend des Ortes sich nahe der Kirche am Brunnen vor dem Rathaus versammelte. Jugendräume gab es nicht. Sie wirkten so, als wüssten sie nicht so recht, was sie treiben sollten. Darum sprach ich sie eines Abends einfach an und fragte, ob sie sich vorstellen könnten, mit mir zusammen eine Jugendgruppe zu gründen. Sie waren überhaupt nicht abgeneigt und so verabredeten wir ein Treffen im Evangelischen Gemeindehaus. Unerwartet viele Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren kamen zu diesem Abend. Wohl auch deshalb, weil ich über die Zeitung einige Erwartungen geweckt hatte. In der Rheinpfalz stand zu meiner Amtseinführung: „In seinem neuen Wirkungskreis will sich Pfarrer Wilhelm vor allem der Jugendarbeit widmen. Auf diesem Gebiet hat er schon einige Erfahrung in Ludwigshafen-Oggersheim sammeln können.“ Als ich sie fragte, was sie von einer solchen Gruppe erwarteten, schälte sich schnell heraus, worum es ihnen ging: Zwangloses Beisammensein, Diskussionen auch politischer Art – immerhin stand bei der Jugend damals der „Weltgeist“ unzweifelhaft links -, Filmabende, Feste feiern. Bloß: Wo sollte das alles stattfinden? Etwa hier im Gemeindehaus? Das war ein ehemaliges kleines Dorfkrankenhaus, mit einem einzigen langgezogenem Raum und einer Einliegerwohnung, in der ein älteres Ehepaar die Wache über alles hielt. Darum blieb es auch bei nur einem lärmerfüllten Abend, an dem so viel geraucht wurde, dass ein bläulicher Nebel keinen Durchblick mehr zuließ. „Tante Mina“, wie ich die unvergessene Hausmeisterin nannte, bedeutete mir unmissverständlich: „So geht es nicht!“ Und sie hatte auch zweifellos recht. Was war zu tun?
Aus meiner gründlichen Kenntnis des Kindergartens wusste ich inzwischen, dass sein geräumiger Keller fast leer stand. Außerdem führte eine Treppe mit separatem Eingang hinunter – die Räumlichkeit war also mit dem eigentlichen Kindergarten überhaupt nicht verbunden. Ein relativ idealer Ort! Nur gab es keine Toiletten. Zunächst war das kein Hindernis, weil ich die Toilette in meiner oben gelegenen Wohnung zur Verfügung stellte. Aber das war auf längere Sicht kein Zustand. Über das Kreisjugendamt erreichte ich, dass mit einem Zuschuss von 10.000 DM zwei Toiletten eingebaut werden konnten. Der Eigeninitiative der Jugendlichen überließ ich es nun, den Keller nach ihrem Gusto wohnlich zu gestalten. Sie machten sich mit großem Eifer ans Werk. Natürlich war die große Bar das Prunkstück und auch der schockfarbene Anstrich lag ganz im Trend jener Zeit. Die Dorfjugend hatte mit wenig eingesetzten Mitteln in relativ kurzer Zeit ein eigenes Domizil geschaffen.
Schon bald stellte sich heraus, dass es bei der Jugend zwei Gruppen gab: Die erste wollte einfach nur unter sich sein, der Hans seine Grete suchen oder umgekehrt und ansonsten möglichst in Ruhe gelassen werden; die andere war aufgeschlossen für Diskussionen, hatte etwas mitbekommen von der weltweiten Jugend- und Protestbewegung und war bereit, sich auch für politische Inhalte zu engagieren. Aus der letztgenannten Gruppe filterten sich dann auch noch jene heraus, die mit mir die Gesellschaftsveränderung unter der Fahne der Jusos angehen wollten. Es waren immerhin mehr als 10 Jugendliche, die deshalb in die SPD eintraten.
Der Vorsitzende des Ortsvereins Emil Hild – stolz über diesen Mitgliederzuwachs – lud zur Gründungsversammlung eines Juso-Verbandes ein. Er stand meinen Bemühungen um die Jugend sowohl in kirchlicher, wie auch in politischer Hinsicht aufgeschlossen gegenüber. Als aus meiner Sicht schon älterer Herr, mit licht gewordenen Haaren, was er durch Koteletten kompensierte, warnte er mich aber auch: Ich solle bei meinem Einsatz nicht „die mit den langen Unterhosen“ vergessen… -
Nicht lange danach erschien in der Donnersberger Rundschau der Rheinpfalz unter der Überschrift „Pfarrer gründet Juso-Verband“ der Leserbrief eines Göllheimer Mitglieds der „Jungen Union“. Unter Behauptung vieler Unrichtigkeiten wurde in ihm mein politisches Engagement harsch kritisiert und von mir als Pfarrer parteipolitische Abstinenz verlangt.
Sofort antwortete das „Vorstandskollektiv“ der neugegründeten Jusos – von mir unbeeinflusst - auf diese unqualifizierte Attacke:
„Für eine bodenlose Frechheit halten wir die Unterstellung, Herr Wilhelm würde seine Jugendarbeit nur mit Jusos betreiben und den anderen Teil … nicht beachten. In diesem Falle hätte sich Herr Stephan wenigstens einmal Informationen einholen können. Herr Wilhelm opfert jede freie Minute damit, einen Jugendraum zu bekommen, den sich die Jugend selbst gestalten kann und, wo sie selbst der Hausmeister sein kann.“
Auch meine Antwort ließ – unter der Überschrift „Keine Parteipolitik in der Jugendarbeit“ - nicht auf sich warten: Mein Plädoyer auf der Kanzel für die Ostpolitik der sozialliberalen Regierung (ich hatte den Inhalt meiner diesbezüglichen Pfingstpredigt in der Rheinpfalz -Rubrik Gestern auf der Kanzel publik gemacht, s.o.) sei nicht Parteipolitik, sondern es sei ja die „Evangelische Kirche Deutschlands“ (damals noch: EKD), „die in einer Denkschrift den jetzt angebahnten Weg der Verständigung vorgezeichnet“ habe. „Immer wieder haben namhafte evangelische Christen zum Weg der Verständigung gemahnt, um endlich aus der Sackgasse der Illusionen herauszukommen. So hat zum Beispiel der ehemalige Landesbischof Lillje – gewiss nicht verdächtig, der SPD nahezustehen – sich kürzlich eindeutig für eine alsbaldige Ratifizierung der Ostverträge ausgesprochen. Versöhnung ohne Wenn und Aber, Abbau von Feindbildern: In der Tat das Wort, das die Kirche von ihrem Auftrag her unmissverständlich zu sagen hat.“ Der Weg der Verständigung gelte auch für den inneren Zustand dieses Landes: „Eine Öffentlichkeit, die im Banne der Baader-Meinhof-Angst, weitgehend alles, was „links“, kritisch oder auch nur zur Besinnung mahnend ist, in einen Topf wirft mit den irregegangenen Desperados der Baader-Meinhof-Gruppe, überall nur noch Schreibtischtäter und Gesinnungsgehilfen vermutend, sollte im Sinne der Bergpredigt dazu aufgerufen werden, sich nicht aufhetzen zu lassen zu erneuter Hexenjagd.“
Damit war aber – schon bald nach meiner Landung - die Schonzeit für mich vorbei. Vor der Kirche traf ich den Presbyter Rudolf Haag – Geschäftsführer des benachbarten Kaufhaus Becker , ein ansonsten sehr umgänglicher und gescheiter Mann, der fast jeden Sonntag in den Gottesdienst kam. „Herr Wilhelm“, sprach er mich an, „Sie haben, glaube ich, zwei Gesichter. Das erste ist sehr christlich, gutbürgerlich und gewinnend. Aber das zweite gefällt mir weniger: Viele sagen, Sie seien in Wirklichkeit ein Kommunist!“ An meine Antwort kann ich mich noch genau erinnern: „Nein, Herr Haag, mein Gesicht ist überall dasselbe. Ich bin kein Kommunist, sondern ein überzeugter religiöser Sozialist. Und dazu stehe ich.“ Widerstrebend gab er sich damit zufrieden.
Inzwischen war ich aus der Wohnung am Kindergarten ausgezogen, weil nach Ende des Schuljahrs meine Frau mit den Kindern nach Göllheim kam. Die Kirchengemeinde hatte für den Übergang ein älteres, ziemlich verwahrlostes Haus angemietet - bis zur Fertigstellung der Renovierung im Pfarrhaus. Jugendliche halfen mir dabei, dieses Haus wohnlicher zu machen: Wir schütteten Sägespäne in gelbe Wandfarbe und strichen damit die Wände. Für einen flüchtigen Betrachter konnte das aussehen wie Raufasertapete.
Dann hing ich meine Poster auf, die ich von Heidelberg mitgebracht hatte: Ho Chi Minh und mit Zigarren im Mund Che Guevara und Fidel Castro. Natürlich auch das Poster des SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund) mit den Konterfeis von Marx, Engels und Lenin und dem ironischen Text „Alle reden vom Wetter. Wir nicht“. Das Mao-Tse-Tung-Poster war nicht dabei, weil ich im Gegensatz zu den meisten SDSlern in Heidelberg mit dem Personenkult um diesen konfuzianischen Despoten überhaupt nichts anfangen konnte. Das Wohnzimmer war notgedrungen auch mein Amtszimmer. Wer mich hier aufsuchte – von der Anmeldung der Taufe, der Trauung bis zur Beerdigung – sah sich von diesen Bildern angesehen und die Kunde davon verbreitete sich überallhin. Kein Wunder, dass viele von denen „mit den langen Unterhosen“ hier eine kommunistische Verschwörung witterten. Da aber die Jugend großenteils auf meiner Seite zu sein schien, ließ mich das ruhig schlafen.
Wahlkampf in Göllheim
1972 war auch das Jahr jener Bundestagswahl, in dem die SPD den größten Erfolg ihrer Geschichte errang: 45,8 Prozent! Dieses bei einer wohl nie wiederholbaren Wahlbeteiligung von 91,1%. Die SPD hatte solchen Erfolg Bundeskanzler Willy Brandt und Außenminister Walter Scheel mit ihrer mutigen Ostpolitik zu verdanken, aber auch der gekonnten Mobilisierungskampagne des Südpfälzers Albrecht Müller. Ihm gelang es als Wahlkampfleiter, die Parteibasis zu einem bisher nicht gesehenen Einsatz zu bewegen, wobei hier in der ersten Linie die Jusos zu nennen sind, denen ich ja nun auch angehörte.
So kam es, dass ich mitten in Göllheim auf dem Platz vor der Kirche einen Tisch aufstellte, ihn mit Werbematerial bedeckte und einen roten Sonnenschirm mit weißem SPD-Emblem entfaltete. Ich allein betreute diesen Informationsstand, weil alle anderen Jusos bei der Arbeit waren. Leider erntete ich dafür ziemlich befremdete Blicke und bin wohl nicht viele zu verschenkende Kugelschreiber, Tragetaschen oder Radiergummis losgeworden. Die Blicke besagten eindeutig: „So etwas gehört sich nicht für einen Pfarrer!“ - Als ich eine Woche später einen Stand für Brot für die Welt betreute, bei dem ich abgepackte Reisbeutel überteuert für die Spendenaktion verkaufte, war das dagegen ein Riesenerfolg und der Inhaber eines Lebensmittelladens in der Nachbarschaft kam auf mich zu und sagte: „Heute gefallen Sie mir viel besser als letzte Woche!“
Es war allenthalben eine extrem aufgeladene Stimmung im Lande. Die Parteiversammlungen waren überall brechend voll. So auch in Göllheim, als der Pfarrer und Bundestagsabgeordnete Rudolf Kaffka (SPD) in die Wirtschaft Zum Königkreuz kam. Wie es hier und in anderen Dörfern noch üblich war, kamen auch die Anhänger der CDU und anderer Parteien zu solchen Veranstaltungen. Sogar der Dorfbürgermeister Hans Appel – Frontmann seiner Wählergruppe – war zugegen. Wie Herbert Wehner an seiner Pfeife nuckelnd, war Kaffka in dieser Wirtshausatmosphäre in seinem Element. Er besaß zweifellos ein großes rhetorisches Talent.
Später (1980), als er wegen Betrugs und Untreue zu zehn Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung verurteilt wurde, äußerte er vor dem Urteilsspruch, um sich zu entlasten: „Ich diskutiere lieber acht Stunden lang in verräucherten Wirtsstuben mit Bürgern, als nur 30 Minuten am Schreibtisch zu hocken.“ Zusammen mit seinem Assistenten Weigel hatte er in diesem Jahr 1972 einen obskuren Verein für staatsbürgerliche und jugendpolitische Bildung gegründet, dessen Veranstaltungen großenteils fingiert und deren zugehörige Hotelrechnungen teilweise gefälscht waren. Die Zuschüsse dafür flossen üppig aus Egon Frankes „Gesamtdeutschem Ministerium“ und wurden für die Wahlkreisarbeit der SPD und die Spesenkasse Kaffkas zweckentfremdet.
In der Aussprache zu Kaffkas Werberede geriet ich zum ersten Male mit Ortsbürgermeister Appel aneinander. Appel hatte in seinem Diskussionsbeitrag – wohl im Hinblick auf die starke Polarisierung in diesem Wahlkampf – für Ruhe und Frieden geworben. Sofort trat ich ihm entgegen: Nein, nicht Ruhe, sondern Unruhe sei die erste Bürgerpflicht! Nur durch Unruhe könnten die notwendigen Veränderungen in der Gesellschaft erkannt und vorgenommen werden. Ich zitierte sogar auswendig den Propheten Jeremia, der gegen die an die Mächtigen angepassten Heilspropheten ausrief: „…sie heilen den Schaden meines Volkes nur leichthin, indem sie sagen: ‚Friede! Friede!‘ - und ist doch kein Friede!“ Niedriger tat ich es nicht. Und dies blieb unwidersprochen im Raume stehen.
Das Olympia-Attentat aus der Ferne
Das Jahr 1972 war für die deutsche Politik ein aufwühlendes Jahr: Im April das gescheiterte Misstrauensvotum gegen Brandt und seine sozialliberale Regierung; gleich danach vorzeitige Auflösung des Bundestags und Ansetzung von Neuwahlen im November; der populäre Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller trat zurück, verließ die SPD und kritisierte perfider Weise zusammen mit dem Altkanzler Ludwig Erhard in gemeinsamen Anzeigen die Wirtschaftspolitik der Regierung. Im Sommer dann der palästinensische Anschlag auf die Mannschaft Israels während der Olympischen Spiele in München und der total gescheiterte Versuch, die israelischen Geiseln auf dem Flugplatz von Fürstenfeldbruck zu befreien. Die Wahl schien damit schon gegen den Friedensnobelpreisträger Willy Brandt gelaufen zu sein.
Am Tag des Olympia-Attentats von München, am 5. September 1972, war ich in der norwegischen Hafen- und Hansestadt Bergen. Vorher hatte ich zusammen mit einem befreundeten Jugendlichen eine Wanderung durch die Hardangervidda, der größten Hochebene Europas, gemacht. Da ich finanziell ziemlich klamm geworden war, warteten wir in Bergen auf eine von mir angeforderte telegraphische Geldanweisung. Aus Sparsamkeitsgründen bezogen wir in der dortigen Jugendherberge Quartier und es gab nur noch magere Kost. Wir hielten uns tagsüber vor allem in Bryggen an der Seefront dieser alten Hansestadt auf, wo Schiffe landeten und anlegten. Eines von ihnen betrieb einen offenen Fischverkauf. Ein rotfleischiger Fisch war als „hval“ gekennzeichnet und wurde in steakartigen Portionen verkauft. Ein solches „Steak“ wurde unglaublich billig angeboten, so dass ich für uns beide zwei mächtige Stücke erwarb. Sie schmeckten ganz ausgezeichnet, nachdem wir sie in der Gemeinschaftsküche der Jugendherberge gebraten hatten. Während wir noch aßen, klärte uns ein junger Norweger darüber auf, was für einen Fisch wir da verzehrten: „Hval“ war nichts Anderes als „Wal“, worauf wir selbst hätten kommen können… Es sollte noch 14 Jahre dauern bis endlich das weltweite Walfangverbot in Kraft trat – nun steht es schon wieder in Frage.
In der Jugendherberge hörten wir dann vom Münchner Olympia-Attentat mit der Geiselnahme der israelischen Sportler. Zwei hier ebenfalls weilende junge Frauen aus Israel standen im Mittelpunkt der Anteilnahme. Mit ihnen verfolgten wir am Bildschirm die entsetzlichen Geschehnisse und das stümperhafte Vorgehen der deutschen Sicherheitskräfte. Wir fühlten uns als Deutsche irgendwie mitverantwortlich dafür, dass Juden auf deutschem Boden schon wieder ermordet werden konnten – auch wenn die Täter Palästinenser waren. Als wir das äußerten, lachten uns die beiden Frauen aus Israel völlig zu Recht aus: Das eine habe doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun! Wahrscheinlich spürten sie, dass der gängige deutsche Philosemitismus der Nachkriegszeit eine fragwürdige Bewältigungsstrategie für die historische Schuld am Holocaust gewesen ist. Viel Heuchelei ging damit einher und sie verhinderte es, dass die richtige Auseinandersetzung stattfand: Um endlich die Täter zu finden und zur Verantwortung zu ziehen. So wie das der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer in den Frankfurter Auschwitzprozessen gegen gewaltigen Widerstand durchgesetzt hat; und was Beate und Serge Klarsfeld so eindrucksvoll zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben.
Pfälzische Pfarrer in Wählerinitiativen
Nach Göllheim zurückgekehrt, konnte ich feststellen, dass der Wahlkampf allenthalben in seine heiße Phase eingetreten war. Im Rückblick titelte die ZEIT: „Die Mutter aller Wahlschlachten“. Die CDU/CSU, die von der Wirtschaft mit den meisten Spenden begünstigt wurde, versuchte aus dem Desaster des Olympiaattentats Kapital zu schlagen: „Wenige Tage nach dem Guerillaüberfall auf Israels Olympiamannschaft verteilten Unionschristen Flugblätter, in denen die Sozialdemokraten als knieweiche Kapitulanten angeschwärzt werden: ‚Mordanschläge, Sprengstoffverbrechen…die SPD handelt erst, wenn es geknallt hat‘“ (DER SPIEGEL, Nr. 40/1972, S.34). Schlug man die Zeitung auf, so fanden sich ständig Anzeigen, in denen mittelständische Unternehmer und sogar Industriearbeiter vor der vermeintlichen wirtschaftlichen Inkompetenz der SPD warnten, vor der nur die Wahl der CDU schützen könnte. Dahinter standen industrienahe Tarnorganisationen. Nicht zu Unrecht wurde dies als „der Wahlkampf des großen Geldes“ bezeichnet.
Auf diesem Hintergrund der einseitigen Mobilisierung von Berufsgruppen für den Wahlkampf der CDU/CSU – großenteils anonymer Art - wird es verständlich, dass im Sinne der „Gegenöffentlichkeit“ auch die Pfarrerschaft auf ein Engagement hin befragt wurde. Der Südpfälzer Albrecht Müller, Leiter der damaligen Wahlkampagne, brachte es auf den Punkt: „… (zu legen ist) ein starker Akzent auf die personale Kommunikation und auf die Mobilisierung von Menschen – der Aufbau einer Gegenöffentlichkeit“ (in: Albrecht Müller: Willy wählen ‘72 – Siege kann man machen , Annweiler 1997). Er ist der Begründer der Nachdenkseiten , die seit 2003 u.a. der neoliberalen Wende der SPD und ihrer fortschreitenden inhaltlichen Entleerung kommentierend und kritisierend nachgehen.
So kam es, dass am 17. November – zwei Tage vor der Bundestagswahl – eine lang vorbereitete Anzeige in der Rheinpfalz erschien, in der unter der Überschrift „PROTESTANTEN zur Bundestagswahl – Wir wählen deshalb diesmal SPD“ 78 Unterzeichnende aus dem Bereich der protestantischen Landeskirche – vorwiegend Pfarrer – sich in der Forderung vereinten: „Willy Brandt muss Kanzler bleiben!“
Als mir der Aufruf zur Unterschrift vorgelegt wurde – ich erinnere mich dunkel, dass er von Landgerichtsdirektor Dr. Ernst Schläfer aus Kaiserslautern initiiert wurde – tat ich mich schwer damit. Im Rückblick noch viel schwerer. Dies obwohl ich bis heute die Inanspruchnahme des Prädikats „christlich“ im Parteinamen der CDU für eine Usurpation halte, die inzwischen überhaupt keine Berechtigung mehr hat. Vor Jahren las ich die Meldung, die beinhaltete, dass im Wörther Mercedes-Benz LKWWerk sämtliche Vorstandsmitglieder das CDU-Parteibuch besaßen und gleichzeitig alle aus der Kirche ausgetreten waren. Das eine bedingte offenbar das andere…
Trotzdem war in dem Wahlaufruf die Tendenz zu einer klerikalen Bevormundung unübersehbar: Das Florett einer differenzierten ethischen Betrachtung war mit dem massiven Holzhammer zweier Forderungen aus den 10 Geboten vertauscht worden (Missbrauch des Gottesnamens und Abgabe falschen Zeugnisses). Hier von „sektiererhafter Biederkeit“ zu reden, wie dies ein empörter Lesebriefschreiber tat, ist so verkehrt gar nicht gewesen. Nach reiflicher Überlegung habe ich dann trotz schwerer Bedenken unterschrieben. Ich tat es, weil der Aufruf immerhin einen Kontrapunkt zum schon erwähnten „Wahlkampf des großen Geldes“ für die CDU darstellte, von dem es im SPIEGEL hieß (Nr. 40/1972): „CDU und CSU sind sich stärker denn je des ideologischen Beistands und der großzügigen Spenden gewiss, mit denen Industrie, katholische Kirche und Interessenverbände die Union in das Palais Schaumburg zurückführen möchten.“ Auch war es bemerkenswert, dass so viele Pfarrer tatsächlich unterschrieben hatten: Das musste ja Wirkung zeigen und hat es wohl auch getan.
Die CDU hat sicherlich schon vorher Kenntnis von diesem Aufruf gehabt; denn am 18. November, einen Tag später schon, erschien in großer Aufmachung in der Rheinpfalz , am Samstag vor der Wahl, ein „Offener Brief an den Protestantischen Landeskirchenrat der Pfalz“, unterzeichnet von 15 Amtsträgern der CDU, darunter auch Dr. Jürgen Todenhöfer. Dabei wurde das Logo des Wahlaufrufs der Pfarrer „Protestanten zur Bundestagswahl“ wahrscheinlich in ironischer Absicht verwendet. Und so las es sich dann:
Sehr geehrter Herr Kirchenpräsident, vor der Synode der Landeskirche haben Sie die Amtsträger der Kirche zu politischer Zurückhaltung im Wahlkampf aufgefordert. Trotzdem haben in der Pfalz evangelische Pfarrer als Aussage in ihrer Amtsfunktion eine Anzeigenaktion zugunsten der SPD veranstaltet. Mit Empörung haben wir als evangelische Christen, die aus Überzeugung der CDU angehören, gelesen, dass der Auftrag Jesu Christi für eine einseitige Aussage in Anspruch genommen wird. … Wir bitten Sie, dieser Entwicklung entschieden Einhalt zu gebieten.
Mehr als eigenartig, dass die von Kirchenpräsident Ebrecht unterzeichnete „Antwort“ des Landeskirchenrats einen Tag vor Erscheinen des „Offenen Briefes“ veröffentlicht wurde, der eine Distanzierung verlangte. Da hatte es wohl schon im Vorfeld Absprachen gegeben. Hier ein Auszug aus der Verlautbarung des Landeskirchenrates:
Zur Bundestagswahl 1972 - Wort des Protestantischen Landeskirchenrates an die Gemeinden
Einseitige politische Wählerinitiativen protestantischer Pfarrer … in der Pfalz haben den Wahlkampf auch von kirchlicher Seite noch stärker polarisiert und Verwirrung in die Gemeinden getragen.
Die Verwirrung wird dadurch gesteigert, dass mit theologischen Begründungen versucht wird, die Wahl einer bestimmten Partei als die für einen Christen allein mögliche Entscheidung hinzustellen. …
Deshalb distanziert er [also: der Landeskirchenrat] sich von einseitigen Wählerinitiativen, die den Eindruck erwecken, als ob hier die Kirche spräche.
Aus der auch uns bewegenden Unzufriedenheit mit dem „Wahlaufruf“, den wir nur mit Bauchschmerzen unterschrieben hatten, schrieben Wolfgang Pessenlehner (s. Band II meiner Erinnerungen, vor allem S.247) und ich eine eigene „Erklärung“ für Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter im Wahlkreis 158 (damals noch: Frankenthal und Donnersbergkreis), die als Anzeige schon am 14. November in der Grünstadter Rundschau der Rheinpfalz erschien. In ihr verzichteten wir auf Anklagen gegen die CDU und auf vollmundige „theologische“ Finessen. Wir konzentrierten uns außenpolitisch auf die von der EKD-Denkschrift antizipierte Versöhnungspolitik mit dem Osten und innenpolitisch auf soziale Reformen im Sinne auch biblischer Gerechtigkeit. Hier der Wortlaut:
Erklärung von evangelischen Pfarrern und Predigern im Wahlkreis 158
Wir sprechen uns für die Fortsetzung der Regierung Brandt/ Scheel aus!
Wir sehen in den Aussöhnungsbemühungen mit dem Osten eine politische Verwirklichung des christlichen Friedensgedankens, wie ihn die Evangelische Kirche – im Auftrag Jesu Christi – öffentlich in ihrer Ostdenkschrift (1965) vertreten hat!
Wir wenden uns entschieden gegen eine Diffamierung der Reformbestrebungen, gegen eine Panikmache, die mit dem Schreckgespenst Inflation und Sozialismus notwendige und zukunftssichernde Veränderungen in unserer Gesellschaft schon im Ansatz verhindern wollen. Diese Reformen zielen insgesamt auf eine größere soziale Gerechtigkeit ab, die allein Wohlstand für alle garantieren kann!
Versöhnung und Veränderung, Frieden und Gerechtigkeit, diese Kernpunkte christlicher Botschaft sind unsere Hoffnung für die Welt!
Wir meinen: Die Regierung Brandt/Scheel leistet dazu ihren Beitrag!
Diese „Erklärung“ wurde von zwanzig Amtsträgern unterschrieben, von denen neun den „Wahlaufruf“ nicht unterzeichnet hatten, darunter Werner Schramm, Dekan in Kirchheimbolanden, später Oberkirchenrat und Kirchenpräsident der pfälzischen Landeskirche. Mit dieser moderateren und weniger eifernden Version konnten sie sich besser befreunden, wie viele der heute noch Lebenden es bestätigen.
Ein beschämendes Nachspiel hatte seine Unterschrift des „Wahlaufrufs“ für Pfarrdiakon Karl Schneider aus Finkenbach: Dekan Ernst Kohlmann aus Pirmasens zeigte ihn wegen „Amtsanmaßung“ an, weil er im Gegensatz zur „Erklärung“ im „Wahlaufruf“ als „Pfarrer“ unterschrieben hatte. Die durchgängige Diskriminierung von Pfarrdiakonen, die denselben Dienst wie Pfarrer taten und ihr Amt auf dem zweiten Bildungsweg errungen hatten: Hier fand sie ihren Höhepunkt. Wenige Jahre später wurden alle Pfarrdiakone zu Pfarrern ernannt.
Notizen aus der Jetztzeit II
Fast täglich, wenn es das Wetter zulässt, gehen Gisela und ich diesen Weg. Er beginnt nur wenige Meter unterhalb unseres Hauses. Um dieses Weges willen habe ich das Haus als Alterssitz gekauft –in Steinbach am Fuße des Donnersbergs. Dieser magische Berg, den ich seit bald 50 Jahren nicht mehr aus den Augen lassen kann.
Heute riecht es köstlich nach Herbst: Nach nur langsam vor sich hin faulenden und gärenden Äpfeln, die massenhaft goldgelb unter den Bäumen liegen; nach verwandten Aromen von Birnen, die von den letzten noch lebenden Wespen angefressen werden; leicht faulig nach letztem Laub, rötlich gelb an den Bäumen und nur langsam verrottend auf dem Weg. Vorbei geht es an den großen Brennnesseln, deren Blätter nur noch winzig sind wegen des Wassermangels durch diesen ausdörrenden vergangenen Sommer; an dem wilden Hopfen, dessen Lianen die inzwischen laublosen Holunderbäume überfallen haben; an den Büschen des Pfaffenhütchens, dessen karminrote Früchtchen tatsächlich wie kleine Kardinalshüte aussehen. Braune Eicheln bersten unter unseren Schritten. Der oft so wilde Bach im Talgrund rauscht nicht und sein Wasser blinkt silbrig nur aus Pfützen. Wann werden endlich die gewaltigen Herbststürme kommen, um für die Kahlheit und die Starre des kommenden Winters zu sorgen?
Nun nähern wir uns schon dem rechts auf einer Anhöhe liegenden Sandsteinhaus des aus Berlin gekommenen „Wandervogels“ Erich Krüger, der hier ohne Strom- und Wasserleitung über 60 Jahre lang gelebt hat (s. auch S. 178). Ob seiner schönen langen Haare sagte im Dorf einst ein Knabe zu dem anderen: „Das ist der Herr Jesus, da brauche ich keine Angst zu haben.“ Da schon viel Laub von den umgebenden Bäumen gefallen ist, wird das sonst gut verborgene Haus sichtbarer, düster von zwei riesigen Tannen flankiert, die Erich Krüger einst gesetzt hat. Seine Spur, die Spur eines Mannes, der hier anders, wahrhaftiger und „natürlicher“ leben wollte, der will ich noch nachgehen.
Gisela und ich haben den Bach überquert, in dem Erich Krüger sich nackt gewaschen hat, als seine beiden Brunnen noch nicht gegraben waren. Nur noch wenige hundert Meter zum künstlich – durch Stauung des Baches – geschaffenen Landschaftsweiher. Plötzlich ein Geräusch ganz nahe, das uns zusammenfahren lässt: Dann schwirrt ein weiblicher Fasan über uns hinweg. Wir setzen uns auf eine Holzbank am Weiher, vor der man das Schilfrohr weggeschnitten hat, damit bessere Aussicht genossen werden kann. Der Blick auf das Wasser, mit seinen sich kräuselnden Wellen: Unsere tägliche Meditation.
Was haben wir hier schon alles gesehen! Ganz in der Nähe, den Weg überquerende wandernde Kröten, die aus dem Schilfdickicht gekrochen waren. Viele von ihnen wurden von den wenigen Autos überfahren, die diese Schotterpiste benutzen. Ihre zusammengepressten Leichen sehen wie Abdrücke winziger Menschen aus. – Als ich einmal alleine wanderte, sah ich hier auf dem Weg sitzend einen Fuchs, der mich freimütig ansah und sich erst nach geraumer Weile ganz langsam trollte. – Einmal sahen wir auf einem Baum in der Nähe des Weihers einen Schwarzstorch, der sofort nach unserem Erscheinen wegflog. – Neben den Stockenten gehören zu den ständigen Besuchern die Graureiher, die hier eine große Varietät an Fischen finden. Auch Silberreiher sahen wir hier auf Gastbesuch. Neuerdings haben sich fünf Kanadagänse angesiedelt, die kaum Angst vor den Menschen zeigen.
In diesem Weiher hat sich vor wenigen Jahren eine Frau aus Steinbach ertränkt. Ihr gilt unsere heutige Meditation und alle, die – wie mein Sohn Knut – das Leben nicht mehr ausgehalten haben. Spätherbstgedanken. Totensonntag ist nicht mehr fern.
(November 2018)
Bewegte Anfangsjahre
Umstrittene Predigten
Anfangs, an den ersten Sonntagen meiner Predigttätigkeit in Göllheim, war die Kirche gerammelt voll. Man lobte mich sogar wegen meiner Stimme, die angenehm sei und den Raum füllen könne. Nach alter Sitte saßen die Männer oben auf der Empore. Sie strömten so zahlreich in den Gottesdienst, dass die Presbyterin Anna Muth – von ihr wird noch öfters die Rede sein – meinte, mit mir sei ein richtiger „Männerpfarrer“ gekommen.
Doch das änderte sich bald. Denn ich setzte die sonntäglichen politischen Predigten fort, die schon in Oggersheim für Aufregung gesorgt hatten. Ich habe sie fast alle noch und wenn ich sie aus heutiger Perspektive betrachte, fällt auf, dass die meisten einen antifaschistischen Impetus hatten – allerdings durch Bibelexegese sorgfältig legitimiert. Nachträglich antifaschistisch zu sein, mag billig erscheinen – weil kein KZ mehr daraufhin drohte und die Gehaltsbezüge unangetastet weiterflossen. Aber da oben saßen ja noch einige von ihnen: Die in der Reichspogromnacht 1938 die wunderschöne „orientalisierende“ jüdische Synagoge Göllheims (s. S.280) in schimpflichster Weise verwüstet hatten; die Schülerklassen dorthin befohlen hatten, um ihnen antisemitischen Anschauungsunterricht zu geben; die Lynchjustiz an Kriegsgefangenen befürwortet und veranlasst hatten; die den katholischen Ortspfarrer Schwalb misshandelt und in den Tod getrieben, sowie das Klempner-Geschäft des katholischen „Blechhannes“ (Knauber) und das Schuhgeschäft von Willi Hecht, dessen Vater ein deutschnational denkender Jude war beschossen hatten, den Tod seiner Bewohner in Kauf nehmend. Ich kannte später ihre Namen.
Und nun saßen die Männer da oben fast gar nicht mehr. Ich hatte sie hinausgepredigt. Nur einer saß viele Jahre Sonntag für Sonntag – manchmal ganz allein - dort oben: Fritz Hecht, mit seiner jüdischen Herkunft. Seine Augen leuchteten bei meinen Predigten, als erhalte er späte Genugtuung für das, was er und seine Familie erlitten hatten. „Baschder“ nannten sie ihn in Göllheim, die pfälzische Verballhornung von „Bastard“. Ein Name, den dieser schlitzohrige und humorvolle Mann mit Würde trug. Fast wie die von der katholischen Reaktion beschimpften „Protestanten“, die den Schimpfzum Ehrennamen machten. Fritz Hecht: Der mehr oder weniger protestantische Jude.
Der historische Wahlsieg der SPD wurde in Göllheim am 19. November mit einem triumphalen Autokorso des Ortsvereins beantwortet. Ich selber ließ mein Auto stehen. Aber von der Treppe vor dem Pfarrhaus begrüßte ich winkend und die linke Faust erhebend die vorbeifahrenden Autos mit den vom Erfolg besoffenen Insassen. Das wurde selbstredend sofort überall kolportiert und trug in „bürgerlichen“ Kreisen nicht gerade zu meiner Beliebtheit bei.
Wahrscheinlich deswegen war auch der Besuch des Gottesdienstes an Heiligabend 1972 in Göllheim nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte, sondern ziemlich mäßig. Dagegen war die Kirche im Nachbarort Rüssingen – meiner Lieblingsgemeinde – brechend voll – nicht zuletzt, weil viele Jusos – auf meine Einladung hin - aus dem Kreisgebiet hierhergekommen waren.
Der vorgeschlagene Predigttext stand im Lukasevangelium, Kapitel 3, die Verse 2-16. Er berichtet von der Wirksamkeit Johannes des Täufers und seiner zur rechtzeitigen Umkehr rufenden Ansage des kommenden Gottesgerichts. Daraufhin in Vers 10 die Frage des „Volkes“: "Was sollen wir nun tun?“ Nach einem Aufruf zum Teilen und der Ermahnung an die Zöllner nicht zu viel zu fordern, kommt es zur Frage der Soldaten, was für sie zu tun sei. Johannes antwortet (Vers 14): „Und er sprach zu ihnen: Begehet gegen niemand Gewalttat noch Erpressung und begnüget euch mit eurem Solde.“
Erpresserisch in der Tat waren die mörderischen Luftangriffe der USA, die von Beginn des 18. Dezember 1972 an mit B-52-Bombern gegen Nordvietnam und seine Hauptstadt Hanoi geflogen wurden. Die Hauptforderung der USA war die Einstellung der Unterstützung der Vietcong im südvietnamesischen Befreiungskampf. Im pazifistischen Internet-Forum Schattenblick ist dazu zu lesen:
…dass nun über Nordvietnam insgesamt 140 B-52 und bis zu 700 Jagdbomber Angriffe flogen, dabei über 100.000 Bomben und Raketen gewaltige Schäden anrichteten und tausende Opfer unter der Zivilbevölkerung forderten. Bis Ende Dezember 1972 flog die Air Force 500 Einsätze allein gegen die Hauptstadt. Während ihrer berüchtigten Flächenbombardements klinkten die strategischen Festungen über Hanoi und der Hafenstadt Haiphong 50.000 Tonnen Bomben aus. An die 4000 Tote und Verletzte zählte allein Hanoi, obwohl viele Frauen und die meisten Kinder aus der Hauptstadt ebenso wie aus Haiphong und anderen Städten evakuiert worden waren. (Gerhard Feldbauer im Schattenblick 2017 in Memorial/176).
Mit vielen Menschen in Deutschland entrüstet über das Wiederaufleben dessen, was wir den „schmutzigen Krieg in Vietnam“ nannten, formulierte ich einen „Offenen Brief an Willy Brandt“, der sich in dieser Frage viel zu diplomatisch-freundlich gegenüber Nixons Kriegspolitik verhielt. Ich brachte ihn zur Unterzeichnung mit in die Pfarrerkonferenz, wo ich bei den älteren Kollegen auf wütenden Widerstand stieß. Aber unser Dekan Werner Schramm verbot diesen stockkonservativen Ignoranten einfach den Mund und ließ sich zur Unterschrift bewegen. Die meisten folgten ihm. Ich habe noch eine Kopie dieses Schreibens, das Willy Brandt nie beantwortete, und auf der unteren Briefseite die große raumgreifende Unterschrift Werner Schramms.
Nun aber hieß es – wenige Tage danach – die Predigt für Heiligabend zu schreiben. Sie schrieb sich fast von selbst. Leider habe ich die Hälfte – den zweiten Teil – verloren. Damals schrieb ich handschriftlich und vierseitig auf zusammengeknickten DIN A 4-Seiten. Die zweite Seite ist leider unauffindbar. Zitieren kann ich nur aus der ersten Hälfte:
Liebe Gemeinde!
Sie haben es sicher schon gemerkt: Wir wollen heute vermeiden, christliche Kulissen aufzubauen. So schön wie die perfekten Kinderchöre im Fernsehen können wir ja doch nicht singen. Und es mag ja wohl ein abwegiger Gedanke sein: Wenn ich an diese Kinder denke, die so blitzsauber die verschüttete Unschuld dieser Welt verkörpern sollen, dann denke ich immer an die Kinder von Hanoi, die in den letzten Tagen wieder Bombennächte erleben mussten – viel schlimmer noch als damals in Dresden, Hamburg oder Coventry.
Die Gedanken gehen weiter: Ich denke auch an die amerikanischen Bomberpiloten und ich stelle mir vor, sie würden hier heute Abend unter uns sitzen. Da würde statt meiner ein Mann vom Format eines Johannes des Täufers hier oben stehen und den Mut finden zu sagen: „Ihr Schlangenbrut! Wer hat euch gelehrt, ihr könntet dem zukünftigen Zorngericht entfliehen? Bringt also Frucht, würdig der Umkehr!“ Ja, und noch unvorstellbarer: Sie würden sich das zu Herzen nehmen und fragen: „Wie aber können wir dieser höllischen Maschinerie des Todes entkommen? Was sollen wir denn tun?“ Johannes aber, hier oben stehend, würde antworten: „Tut es einfach nicht! Tut niemand Gewalt noch Unrecht.“
Und wirklich, das Unglaubliche würde geschehen: Die heuchlerische Bombardierung im Namen des Friedens würde aufhören, weil alle Bomberpiloten umkehren würden. Liebe Gemeinde, das wäre so schön, als wenn Gott hier mitten unter uns wäre und unser Gesang mit „O, du fröhliche…“ wäre endlich einmal die volle Wahrheit.
So wie ich sie in Erinnerung habe, endete die Predigt mit einem nochmaligen Appell an die Bomberpiloten umzukehren und – Johannes den Täufer noch übertreffend – nach Hause zu gehen…
Soweit dieser utopische Traum. Damals wusste ich nicht, dass er so utopisch gar nicht war. Im Schattenblick lese ich:
Besonders schockierend für die US-Militärführung war, dass es während des Bombardements auf Hanoi im Dezember 1972 unter der Elite der Streitkräfte, den Piloten der Air Force, zu Befehlsverweigerungen kam. Am 18. Dezember lehnte der „Phantom“-Pilot Hauptmann Dwight Evans es ab, weitere Einsätze gegen Nordvietnam zu fliegen. Hauptmann Michael Heck weigerte sich am 26. Dezember, mit seiner B-52 gegen Hanoi zu starten. Er hatte bis dahin 200 Kampfeinsätze geflogen.
Diese politische Predigt über die notwendige Umkehr amerikanischer Bomberpiloten fand keinen Widerspruch. Ich bemerkte, dass jeder meiner Sätze große Betroffenheit ausgelöst hatte. Eine Frau aus dem eher bürgerlich-konservativem Lager kam nach dem Gottesdienst zu mir und sagte: „Ich habe heute, am Heiligen Abend, ganz Anderes in dieser Kirche erwartet. Aber es ist wohl die Wahrheit gewesen und die ist immer gut“.
Erste Reise mit dem „Frauenbund“
Wohl oder übel musste ich mich mit meinen 27 Jahren mit einer weiblichen Seniorengruppe befassen, die sich „Evangelischer Frauenbund“ nannte. Sie traf sich wöchentlich im Gemeindehaus, nachmittags um 14:00 h, und es kamen 30-50 Frauen im Alter von 50 bis 90 Jahren. Das Programm war immer das Gleiche: Eine Bibelarbeit umrahmt von Kirchenliedern; dann Kaffee und Kuchen. Geleitet wurde der Frauenbund von einer fülligen Matrone namens K. R. Sie war gerade erst Witwe geworden und verkörperte noch ganz die Rolle der untertänigen Ehefrau. Dabei besaß sie einen ausgesprochenen Geschäftssinn: Für die alten Frauen, die in der Mehrheit nie über die Nachbarorte hinausgekommen waren, organisierte sie mit immer demselben Busunternehmen (!) Reisen, die sogar ins Ausland führten. - Flankiert wurde sie im Leitungsteam von zwei Frauen: Zunächst von „Fräulein“ Anna Muth, die Wert auf diese Anrede legte. Sie stammte aus einer Bauernfamilie, die es durch Zukauf von Ackerflächen zu beträchtlichem Reichtum gebracht hatte. Im Gegensatz zu ihrer „Chefin“ war sie flach wie ein Bügelbrett und die unvergessliche Hausmeisterin des Gemeindehauses Mina Weigel nannte sie deshalb „das Reff“. Ihr christliches Engagement aber war ehrlich und sie half auch sozial in Not geratenen Menschen. Last not least wiederum eine füllige Frau namens Johanna („Hannchen“) Faulhaber, die man mit Fug und Recht die „graue Eminenz“ des Leitungsteams nennen konnte. Sie war die Frau des ehemaligen Ortsgruppenleiters der Göllheimer NSDAP Robert Faulhaber und hatte das braune Gedankengut noch immer stark verinnerlicht, wie ich schon bald bemerken sollte. Alle drei Frauen trugen einen Dutt, so wie ich das bei den „Schwestern“ des Zinzendorfinternats in Tossens auch gesehen hatte. (S. Band I meiner Erinnerungen Wildenten sah ich fliegen S.105). Wir nannten das damals „Pietistenzwiebeln“. Heute ist es für junge Mädchen und solche, die es bleiben wollen, zu meinem Entsetzen wieder große Mode geworden…
Die erste Reise mit dem Frauenbund führte im Frühsommer 1972 für eine Woche nach Holland. Ziel war der Küstenort Noordwijk, wo die Gruppe in verschiedenen Privatzimmern untergebracht war. Ich half beim Finden der Quartiere, sammelte Verirrte wieder ein, trug Koffer und spielte mit Freuden die Rolle des „lieben Schwiegersohns“. Mir fiel auf, dass die Häuser in Noordwijk keine zugezogenen Gardinen hatten und besonders abends der ungenierte Einblick in das Privatleben der Insassen möglich war. Hatten sie denn nichts zu verbergen? Später – als ich Stefan Zweigs wunderbares Buch Castellio gegen Calvin gelesen hatte - wurde mir klar, dass diese Sitte auf den Einfluss des Calvinismus zurückzuführen war: So wie im Schreckensregiment des Genfer „Gottesstaates“ von Johannes Calvin es ein unbeobachtetes Privatleben nicht mehr geben durfte.
Es waren die üblichen touristischen Stationen, die angefahren wurden: Grachtenfahrt in Amsterdam, Tulpenfelder im Keukenhof, Käsemarkt in Alkmaar. Besichtigt wurde auch das „Haus Doorn“, in dem der abgedankte Kaiser Wilhelm II die letzten 21 Jahre seines Lebens verbrachte. Von dort schickte ich ironische Bildpostkarten an meine Freunde… - Die längste Zeit aber verbrachten wir im Bus. Der Lärmpegel war beträchtlich hoch: Die Frauenschar – Ex-Ortsgruppenleiter Faulhaber nannte sie verächtlich das „Krampfadergeschwader“ – konnte sich über die harmlosesten Witzchen kaputtlachen und das Gekreische wollte auf- und abebbend kein Ende nehmen. Ich vermutete wohl nicht zu Unrecht: Diese abgearbeiteten Frauen - meist mit erbärmlich niedrigen Renten – hatten sonst nicht viel zu lachen. Nach der Fahrt fiel für einige Zeit der wöchentliche Frauenbund aus, weil die meisten Frauen wie jedes Jahr unter der teilweise sengenden Sonne auf den Feldern der Umgebung das Unkraut bei den Zuckerrüben weghackten – bei relativ niedrigem Stundenlohn. Braungebrannt kehrten sie von den Feldern zurück. Heute wird diese Arbeit von den Pestiziden erledigt.
Das kreischendste Gelächter der ganzen Reise gab es auf der Rückfahrt. Als ich nachfragte, ob ich mitlachen dürfte, führte das nur zu weiteren Eruptionen, die noch eine ganze Weile andauerten. Die spätere Erklärung war sehr einfach: In der letzten Raststätte hatte ich eine Schweinshaxe verzehrt und die Knochen auf dem Teller zurückgelassen. Fräulein Muth hatte sie heimlich aufgelesen, in eine Tüte getan und sie in den Bus mitgenommen. Hier wurden sie dann ausgepackt und mit den Worten „Des sin dem Parrer sei Knoche“ herumgezeigt. An die Derbheit solchen Humors hatte ich mich noch zu gewöhnen…
Während der Fahrt wechselte ich öfters den Sitzplatz, um möglichst viele Teilnehmerinnen kennenzulernen. Das war mir sehr wichtig, weil ich so im Handumdrehen eine Menge von Informationen über eine ganze Reihe von Familien in der Gemeinde bekam. Auf der letzten Bank hinten thronte das „Dreigestirn“. Ich setzte mich auf den freien Platz neben Frau Faulhaber. Ehe sie den Ortsgruppenleiter geheiratet hatte, war ihr im Nachbarort Marnheim – eine berüchtigte Hochburg der NSDAP, nach dem Krieg der NPD – die Kindergottesdienstarbeit anvertraut worden. Sie erzählte mir, wie sie einst den Kindern das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt hatte: Da die Kinder ja nicht wussten, was ein Samariter war, habe sie daraus flugs einen SA-Mann gemacht. Nun also: Das Gleichnis vom barmherzigen SA-Mann. Sie erzählte das ohne jegliche Scham. Es gab nicht die geringsten Ansätze nur für eine Fähigkeit zum Trauern, geschweige denn einen selbstkritischen Abstand. Die Nazis waren ungebrochen immer noch die Nazis.
Je näher wir der Heimat kamen desto inbrünstiger wurde gesungen: Am Brunnen vor dem Tore , Ännchen von Tharau, Kein schöner Land in dieser Zeit und immer wieder Schwarzbraun ist die Haselnuss . Ein Liederbuch brauchten sie nicht: In völligem Gegensatz zu mir kannten sie alle Verse auswendig. Auf meine Nachfrage hin war die Antwort: Das hätten sie beim BDM (Bund deutscher Mädel) gelernt. Überhaupt: Das sei eine schöne Zeit gewesen. Es sei nicht zu verstehen, dass das alles schlechtgeredet werde. Im Übrigen gelte: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder“. - Später sagte ich deshalb: „Der Göllheimer Evangelische Frauenbund war damals die Fortsetzung des BDM unter anderer Fahne“. Ähnliches hatte auch Pfarrer Hermann Schneider vom Predigerseminar in Landau gesagt, der einer meiner Vorgänger in Göllheim war. Natürlich trifft dieses Urteil nicht für alle Mitglieder zu. Es gab z.B. auch Frauen von Arbeitern, die Sozialdemokraten oder sogar Kommunisten (gewesen) waren. Eine von ihnen erzählte mir, ihr Mann sei im KZ Dachau gewesen. Er sei dorthin gekommen, weil er in der Wirtschaft Zum Königskreuz geäußert hatte: „Ich mag die Morgensonne so gern. Besonders wenn sie rot ist!“ Er kam nicht wieder nach Hause. Welcher Denunziant hatte ihn verraten?
Nein, damals konnte ich die Lieder nicht mitsingen. Für meine Generation waren sie durch ihren ständigen NS-Missbrauch besudelt. Der Liedermacher Hannes Wader schreibt in seiner 2019 erschienenen, überaus lesenswerten Autobiographie „Trotz alledem“: „Immer noch betrachtet der kritischere Teil der jüngeren Deutschen, zu dem auch ich mich zähle, … das traditionelle deutsche Liedgut als naziverseucht und daher nicht singbar“ (a.a.O. S.213). Drastischer noch Franz Josef Degenhardt in Die alten Lieder :
Tot sind unsre Lieder unsre alten Lieder. Lehrer haben sie zerbissen, Kurzbehoste sie verklampft, braune Horden totgeschrien, Stiefel in den Dreck gestampft!
Erst später, als Zupfgeigenhansel und Liederjan ihre Versionen sangen und ihren wahren historischen Kontext wiederentdeckten, konnten wir manche von ihnen wieder anstimmen.
„Erdnussparty“ in der Kirche
Das „Antirassismusprogramm“ des Weltkirchenrats, dem 240 nichtkatholische Kirchen angehörten, erregte damals (1970 ff.) die kirchlichen und andere Gemüter. Zum ersten Male nicht nur vollmundige Lippenbekenntnisse (à la „Rassismus ist Sünde“), sondern Taten in Form finanzieller Zuwendungen für Befreiungsorganisationen in Asien, Südamerika und vor allem im südlichen Afrika. Allein den Guerillas in den portugiesischen Afrika-Kolonien Mosambik, Angola und Guinea-Bissau flossen 88.000 Dollar zu. So erhielten
15,000 Dollar die Frelimo
(Frente de Libertação de Moçambique);
Je 20.000 Dollar die Frelimo-Schwesterorganisationen MPLA (
Movimento Popular de Libertaçao de Angola)
und die GRAE
(Governo Revolucionario de Angola no Exil);
10,000 Dollar die UNITA (
Uniao Nacional para à Independéncia Total de Angola);
20,000 Dollar die PAIGC
(Partido Africano de Independéncia da Guinée Cabo Verde).
Zwar sollte dieses Geld ausdrücklich nicht für Waffenkäufe verwendet werden, trotzdem war es ein absolutes Novum, dass der Weltkirchenrat Gewalt anwendende Organisationen somit finanziell unterstützte. Was die Geldbeträge anging allerdings nur ein kleines Zeichen, um dem Jahrhunderte langen Unrecht der gewalttätigen Kolonialherrschaft etwas entgegenzusetzen.
Um das Bewusstsein in Kirche und Gesellschaft dafür zu schärfen, hatte eine ökumenische Projektgruppe in Arnoldshain, unterstützt von der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend für den 23. September 1973 einen „Angola-Sonntag“ ausgerufen. Gleichzeitig wurden verschiedene Broschüren, Unterrichtsmaterialien und Gottesdienstkonzepte erarbeitet. Insgesamt wurden davon 110.000 Exemplare verschickt, auch an alle Pfarrämter.
Eines davon habe ich wiedergefunden: ANGOLA – Informationen und Modelle für Schule, Kirche und Erwachsenenbildung – Lehr- und Info-Heft . Darin las ich damals diesen Veranstaltungstipp:
Theater
Man könnte die F.A.U.S.T. Gruppe einladen. Dies ist eine Frankfurter Straßentheatergruppe, die ein Stück über die Situation in Guinea-Bissau gemacht hat. Das Stück ist ein großes Spectaculum unter dem Titel „Erdnussparty“ und erzählt die leidvolle Geschichte der Kolonisation, des Sklavenhandels und der Unterdrückung, sowie den Beginn des Befreiungskampfes. Die Zuschauer spielen mit, den Zuschauern wird mitgespielt, alle sind in die Handlung miteinbezogen. An Erdnüssen, die zum Essen verteilt werden, wird nicht gespart. Die Gruppe, die die Erdnussparty mit den FAUST-Leuten vorbereiten will, wende sich bitte an:
Gruppe F.A.U.S.T. – Frankfurter Aktions- und Straßentheater – Egmont Elschner – (Adressenangabe).
Ich griff sofort zu und rief den Regisseur mit dem schönen theatralischen Namen Egmont Elschner an. Sie waren für diesen Tag noch nicht engagiert. Nach einigem Zögern sagte Elschner für den Auftritt in Göllheim zu, für ihn ein Kaff irgendwo in der Provinz. Als ich allerdings die angesetzten Kosten für diesen Auftritt vernahm, hielt ich den Atem an und wollte schon gleich einen Rückzieher machen. Er bemerkte meine Not damit und beruhigte mich: Sie würden mir Plakate, Handzettel und sogar bereits gedruckte Eintrittskarten zusenden. Ich müsste den Betrag halt über den Eintrittspreis aufbringen.
Das alles traf auch recht bald bei mir ein. In weitem Umkreis rührte ich die Werbetrommel – mit erstaunlichem Erfolg. Sogar der Evangelische Frauenbund nahm mir – trotz des hohen Eintrittspreises – einen Schwung Karten ab. Finanziell würde es kein Fiasko geben…
Schon am Freitag, den 21. September 1973 traf die Theatertruppe in Göllheim ein. Sie wollten im großen Saal der Wirtschaft Zum goldenen Ross mit den Aufbauten beginnen. Als sie den Saal besichtigt hatten, traten sie plötzlich mit einer Bitte an mich heran: Ob es nicht möglich wäre, das Ganze in der benachbarten Protestantischen Kirche stattfinden zu lassen. Ich hätte sie ihnen ja gezeigt und sie sei ganz bestimmt der geeignetere Ort für die Aufführung. Ich war wie vor den Kopf geschlagen ob dieses Vorschlags und dachte besorgt an die Konsequenzen in der für mich jetzt schon angespannten Situation. Aber ich war zu feige, dieses Ansinnen abzulehnen und sehe noch ihre freudigen Gesichter, als ich schließlich – ohne das Presbyterium vorher zu fragen – zustimmte.
Derweil hatten sich die Mitglieder der Truppe in den Gastwirtschaften des Ortes verteilt und erzählten bei Bier und Wein ziemlich unverblümt über die revolutionären Absichten ihres Theaterstücks. Hinterher wurde mir zugetragen, dass einer gesagt hatte: „Der Pfarrer ist auch einer von uns. Der ist voll auf unserer Seite“.
Wohl mit der Vorahnung dessen, was bevorstand, hatte ich Dekan Schramm eine Eintrittskarte verkauft. Er versprach, auch wirklich zugegen zu sein, was mich ungemein beruhigte.
Da meine Erinnerungen an das Theaterstück Erdnussparty inzwischen – nach 47 Jahren – nur noch recht verschwommen sind, versuchte ich über das Internet an den Text zu kommen. Es gelang mir schließlich, den Regisseur Egmont Elschner zu erreichen, der in Chemnitz wohnhaft und tätig ist. Er war überrascht, nach so langer Zeit auf seinen Auftritt in Göllheim mit der F.A.U.S.T.-Truppe hin angesprochen zu werden. Er schien sich nur undeutlich daran zu erinnern. Als ich ihn an den Ort des Geschehens (Kirche) und die z.T. wütenden Reaktionen des Publikums hinwies, entsann er sich wohl dieser Reise in die Provinz. Den Text der Erdnussparty besaß er aber nicht mehr, wie er mir kundgab. Er versprach mir, danach zu fahnden und sich bei günstigem Ergebnis zu melden. Darauf warte ich noch heute. – Mitglied des F.A.U.S.T.-Ensembles war auch Nicola Gehrke (später verheiratete Klaiber), die überraschend schon 2018 verstorben ist. 2014 spielte sie in Elschners Theaterstück zur Klimakatastrophe Der Erde eine Sonnenbrille verpassen