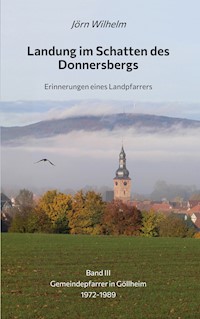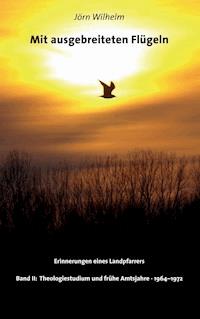
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Erinnerunge eines Landpfarrers
- Sprache: Deutsch
Im zweiten Band seiner Erinnerungen beschreibt der spätere Landpfarrer farbig und voller untergründigem Humor sein Theologiestudium in Erlangen und Heidelberg. Deutlich wird, wie Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts auf Kathedern und Kanzeln die Verstrickung der Universität und der Theologie in den Rassenwahn der Nazis noch immer geleugnet, verharmlost oder ignoriert wurde. Das Studentenleben kommt nicht zu kurz: Jazzkeller, Reisen nach Paris, Blutspenden und Maloche, Studentenbuden, die sich heute keiner mehr vorstellen kann. Mitten im Studium heiratet er und eine Tochter wird geboren. Lichtgestalten werden geschildert wie die theologischen Lehrer Gerhard von Rad, Herbert Braun, Rolf Rendtorff und Heinz-Eduard Tödt. Nach dem "Ohnesorg-Erlebnis" wird er Zeuge der turbulenten Studentenunruhen in Heidelberg, politisiert und verändert sich darin. Erste Predigten werden geschrieben, die politisch höchst umstritten sind. Wegen Verweigerung der Ordination wird er gleich am Anfang schon suspendiert. Nach der Aufhebung sorgt er weiterhin für heilsame Unruhe in seiner Kirchengemeinde in Ludwigshafen-Oggersheim.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
K
APITEL
I: D
AS
S
TUDIUM IN
E
RLANGEN
Ahnungslos auf dem Weg zur Theologie
Erlangen, Schronfeld 52
Das erste Semester im Sommer 1964
Erste Semesterferien in Hamburg
Mummenschanz, Magnifizenzen und theologische Erblasten
Der studentische Alltag in Erlangen
Verbindungswahn
Die letzte Zeit mit Wolfgang in Erlangen
Im Dienst der Bundespost
Das letzte Semester in Erlangen
Jörn Hund
Die Bergkirchweih
K
APITEL
II: D
AS
S
TUDIUM IN
H
EIDELBERG
Interludium: Die Reise nach Paris
Das erste Semester in Heidelberg
Ausflug in den Pietismus
Fragmentarischer Bericht über den 1. Mai 1966
Maloche im Rangierbahnhof und Pfalzwanderung
Tod des Großvaters
Nachrichten aus Papua-Neuguinea
Ein wichtiges Semester
Handschuhsheimer Sommer
Ohnesorg-Erlebnis, Geburt einer Tochter und Trennung
Wieder allein, aber nicht verlassen
Herbert Braun und die Mitmenschlichkeit
Rudi Dutschke
Ulrikes Taufe, Django und das Mönchlein
Mordanschlag auf Rudi Dutschke
Helmut Schmidt und der Sternmarsch nach Bonn
Pariser Mai und das Problem der Gewalt
Mit Linde nach Paris
Kritische Universität
Zwei Bücher für das ganze Leben
Geheimnisse eines Mietshauses und die Triebstruktur
Das goldene Prag
Mein Bruder steigt aus
Nachruf auf einen Philosophen
Die »Revolution«
Blockade der Rhein-Neckar-Zeitung
Die Examenspredigt
Stadthallenprozess und wilde Polizeiaktion
Letzte Scharmützel
Abschied von Heidelberg
K
APITEL
III: E
XAMEN
, O
RDINATIONSSTREIT UND
S
USPENDIERUNG
Finis Terrae
Erstes Theologisches Examen in Landau und Speyer
Ein Abend in Speyer
Lebach und die Folgen
Die Entdeckung der unordentlichen Ordnung
Vikare contra Oberkirchenräte
Kampf um die Aufhebung der Suspendierung
K
APITEL
IV: V
IKAR IN
L
UDWIGSHAFEN
-O
GGERSHEIM
Oggersheimer Schwimmübungen
Notizen aus der Familie
Fremde als Freunde
Politische Predigt?
Scheinbar unpolitische Weihnachtspredigt
Beerdigungen in Ludwigshafen
Cabora Bassa
Auf dem Weg zum 2. Theologischen Examen
Letzte Nachrichten vor dem Abflug in die Provinz
Literaturverzeichnis & Dank
Abbildungsverzeichnis
Personenregister
»Wie werden die »versunkenen Erfahrungen« bewusst? Indem wir lernen, die Rätsel unserer Lebensgeschichte im Kontext der Geschichte unserer Gesellschaft zu lösen, und zwar im Detail, und indem wir der Reflexion vertrauen, solange sie Erfahrung und Objektivität fühlbar vermittelt. Das, vor allem, ist kritische Theorie.«
Peter Brückner, Das Abseits als sicherer Ort
»Die Verfettung von Hirn und Herz macht in der Wohlstandsgesellschaft derartige Fortschritte, dass es für uns und unsere Welt lebenswichtig wird, aus der Bibel die rebellischen Stimmen, statt bloß die einschläfernden Stimmen zu vernehmen. Wenn der Gottesknecht um unseretwillen ins irdische Inferno steigt und auf Golgatha stirbt, verleugnet man das Evangelium, wenn man nicht mehr sichtbar und hörbar im Namen der göttlichen Freiheit für die Mühseligen und Beladenen eintritt.«
Ernst Käsemann
KAPITEL I
DAS STUDIUM IN ERLANGEN
Ahnungslos auf dem Weg zur Theologie
Kurz vor der Abfahrt nach Erlangen ging ich allein noch einmal in die Schnelsener Advents-Kirche am Kriegerdankweg. Nach 1945 war sie aus dem »Notkirchen-Programm« errichtet worden. Obwohl ich sie sonst nicht oft von innen gesehen hatte, mochte ich sie sehr, wegen ihrer Holzkonstruktion, die eine entfernte Ähnlichkeit zu skandinavischen Kirchen aufweist. Auch Altar, Kanzel und Taufbecken sind aus Holz, was dem Innenraum eine warme Ausstrahlung verleiht.
Ich wusste nicht, wer an diesem Sonntag predigen würde. Zu meinem Leidwesen war es mein ungeliebter Konfirmator Pastor Helmut Witt. Sogleich bereute ich es, mich auf den Weg gemacht zu haben, denn nun musste ich aufpassen, dass ich vor lauter Gähnen keine Maulsperre bekam. – Aber es kam anders: Seine Predigt war eine einzige zornbebende Philippika gegen die historisch-kritische Erforschung der Bibel und deren Vertreter an den theologischen Fakultäten. Er redete sich richtig in Rage, völlig verkennend, dass wohl kaum einer seiner Zuhörer wusste, worum es überhaupt ging. Sein bevorzugter geistiger Prügelknabe war ein gewisser Professor Rudolf Bultmann aus Marburg, den er ob seiner Zweifel an alten Glaubensgewissheiten der übelsten Ketzerei verdächtigte.
Das war überhaupt nicht langweilig und in Grenzen sogar amüsant. Auch ich wusste nicht, warum er sich so echauffierte. Eine Äußerung aber empörte mich, weil sie mir ungehörig und pöbelhaft erschien. Er schrie es fast heraus: »Bultmann, dieser Käsemann und wie sie alle heißen: Das sind die Totengräber unserer Kirche!« Darf ein Pastor so reden: Einem Bultmann den Schimpfnamen »Käse-Mann« geben?
Am Mittagstisch fragte mich mein Bruder Wolfgang, wie mir der Gottesdienst gefallen habe. Ich antwortete: »Heute ist Helmut Witt vollkommen aus der Rolle gefallen: Er hat einen gewissen Bultmann als ‹Käsemann› beschimpft!« Wolfgang – erst im 3. Semester seines Theologiestudiums, aber schon in Kenntnis der theologischen Streitfronten – erlitt einen heftigen Lachanfall. Als er sich erholt hatte, klärte er mich und die übrige Familie auf: Dass Professor Ernst Käsemann aus Tübingen einer der profiliertesten Schüler Bultmanns war und, dass dies alles mit stinkendem Käse überhaupt nichts zu tun habe.
Später, als ich endlich begriffen hatte, wurde Ernst Käsemann für mich und meine theologische Existenz zum wohl bedeutendsten Lehrer des Neuen Testaments, dessen »Exegetische Versuche und Besinnungen« mich heute noch beschäftigen.
Erlangen, Schronfeld 52
Immer noch hatte Wolfgang nicht den Führerschein erworben, um sein Auto – einen DKW Junior – selbst zu fahren. Zwar hätte ich fahren können, aber mir war es recht, dass ein befreundeter Kollege unseres Vaters uns nach Erlangen fuhr. Eine so weite Strecke war ich ja noch nie gefahren.
Wolfgang hatte seine »Bude« nun in Alterlangen, im Westen der Stadt. Mir hatte er sein Zimmer, in dem er während der vorangegangenen Semester gewohnt hatte, »vererbt«: Schronfeld Nr. 52. Es war das kleine Hinterzimmer eines 1-Familienhauses, mit Bett, Tisch, Stuhl, Schrank und einem Waschbecken mit kaltem Wasser. Die Toilette war in der Wohnung der alleinerziehenden Tochter des Hauses. Durch deren Flur musste ich gehen, um mein Zimmer zu erreichen. Die Aussicht aus dem einzigen Fenster war wunderschön: Ein Kornfeld, das mich im Sommer an Gemälde Van Goghs erinnerte; dahinter ein Weiher, aus dem Frösche ihr lautstarkes Konzert ertönen ließen, und der Auwald an der Schwabach, ein bekanntes Überschwemmungsgebiet.
Über seine ersten Eindrücke in Erlangen schrieb Wolfgang 1963 an die Eltern und an mich:
Ich traf bei Frau Mathes ein, die sehr nett ist und mich gleich mit Kaffee und Stachelbeertorte empfing. – Das Zimmer ist etwas kleiner als mein Raum in Schnelsen, und eine ganze Portion ungemütlicher, aber immerhin doch so, dass ich zufrieden bin. Die Umgebung sagt mir sehr zu. In dieser Beziehung habe ich es sehr viel schöner als in Hamburg. Das Haus liegt ein wenig ländlich, wenngleich es natürlich einige neugebaute Häuser und Siedlungen gibt. – Der Weg zum theologischen Seminar und zum Universitätshauptgebäude ist ziemlich weit.
Die Stadt Erlangen entspricht ungefähr den Vorstellungen, die ich mir davon machte. Obwohl ich noch an keiner Stelle in Entzücken über einen schönen Winkel oder ein schönes Gebäude ausgebrochen bin, missfällt mir die Stadt in ihrer fantasielosen, aber klaren Gliederung nicht. Schön ist, dass ich von meinem Zimmer aus in wenigen Minuten im Wald sein kann. Dafür nehme ich gerne einen etwas längeren Anmarsch zur Universität in Kauf.
Die Zimmermiete betrug 50,– DM im Monat. Somit verblieben mir 150,– DM vom Monatswechsel, um die übrigen Kosten zu bestreiten: Für das kärgliche Essen in der Mensa, was 1,10 DM pro Mahlzeit kostete und für das übrige Essen und Trinken; für die Anschaffung von Büchern, was allerdings durch ein Bücherstipendium der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche erleichtert wurde, auf deren Liste der Theologiestudenten ich stand; für Zigaretten; für einen gelegentlichen Gaststätten- oder Kinobesuch; für eine Flasche Bier am Abend; für das Betanken des DKW-Junior; für das Schwimmbad, um ab und zu duschen zu können; für das wöchentliche Telefongespräch nach Hamburg.
Die Zimmerwirtin war eine typische Fränkin, etwa im Alter meiner Eltern: Braunäugig, schwarzhaarig und mit dunklem Teint – schließlich waren die Römer lange genug im Frankenlande gewesen, um ihr genetisches Material zu hinterlassen.
Frau Mattes – war sehr freundlich, aber auch sehr resolut. Von vornherein machte sie klar, dass Damenbesuch absolut unerwünscht sei. Schließlich galt ja noch der Kuppelparagraf, der die Duldung außerehelichen Geschlechtsverkehrs in einer Mietwohnung unter Zuchthausstrafe stellte. Dies zuzusagen fiel mir nicht schwer: Um welche Dame sollte es sich auch handeln, die willens gewesen wäre, mein spartanisches Zimmer zu besuchen? Eine Karikatur von Josef Nyary verhöhnte um diese Zeit diesen reaktionären Paragrafen. Zu sehen ist ein Staatsanwalt, der mit drohend erhobenem Zeigefinger eine alte Frau mit Kapotthut anschnauzt: »Angeklagte, Sie haben geduldet, dass Ihr Untermieter Damenbesuch empfängt. Das ist Kuppelei!« – »Aber Herr Staatsanwalt, als Sie vor 20 Jahren bei mir ein Zimmer mieteten, hatten Sie doch auch eine sturmfreie Bude verlangt!« Die damals herrschende Heuchelei auf den Punkt gebracht…
Das erste Semester im Sommer 1964
Nun stand ich vor dem Aushang der Theologischen Fakultät im Kollegienhaus, um in mein Studienbuch danach – mit Hilfe des Vorlesungsverzeichnisses – die gewählten Vorlesungen, Seminare und Kurse einzutragen. Ahnungslos, wie ich war, konnte ich mit dem Angebotenen kaum etwas anfangen. Mein Bruder war mir keine große Hilfe, wenn ich fragte, was sich z. B. hinter dem Thema »Baruchs Darstellung vom Wirken und Schicksal Jeremias« verbarg oder was das »Psalmen-Targum« sei. So trug ich als erstes und Wichtigstes den Sprachkurs »Griechisch II« ein. Diese ziemlich hohe Hürde gleich am Anfang galt es zu nehmen, und alles Weitere hatte demgegenüber zurückzustehen. Walter von Loewenichs Vorlesung »Kirchengeschichte IV (vom Pietismus bis zur Gegenwart)« fügte ich auf Anraten Wolfgangs hinzu und aus eigenem Interesse Hans Köhler: »Naturwissenschaft und christlicher Glaube« – ein Thema, das mich noch heute beschäftigt. Endlich noch eine Vorlesung des weltbekannten, aber schon emeritierten Professors Paul Althaus: »Geschichte und Eschatologie«, von der ich überhaupt nichts verstand.
Es waren sechs Unterrichtsstunden Griechisch in der Woche, die Wolfgang und mich ständig in Atem hielten. Mein Privatunterricht nach dem Abitur (s. Band I, S. 110) hatte mich zwar weit vorangebracht, jedoch nicht so weit, dass ich den direkten Anschluss an den Kurs II schon erreicht hätte. So erhielten Wolfgang und ich jeweils nur die Noten 5 und 6 bei den Vorbereitungsklausuren. Wir waren deshalb – vor allem auf meine Initiative hin – ständig zusammen, um zu pauken und zu »bimsen«: Vokabeln, Grammatik und Übersetzungen. Gegenüber Wolfgang hatte ich den Vorteil eines fast eidetischen Gedächtnisses: Alles was ich schriftlich sah, hatte ich auch nach dem Lesen fast fotografisch vor Augen –eine für das Erlernen von Sprachen äußerst günstige Voraussetzung. Eine Gabe, kein Verdienst.
Das ständige Zusammensein mit Wolfgang bewirkte eine deutliche Abkapselung von der Außenwelt. Zu niemand sonst traten wir in Beziehung. Es war eine »splendid isolation«, die neben dem gemeinsamen Lernzwang ihre Ursache auch in unserer Familiengeschichte hatte. Am Hamburg-Schnelsener Königskinderweg lebten wir auf einer Art Insel, wo Mutter Hannchen ihr geistiges Zepter schwang und Vater Erich sich in Innenarchitektur und Kunstgewerbe verwirklichte. Nach außen hin gab es Kontakte nur zu ausgewählten Besucherinnen und Besuchern, während die angrenzende und weitere Nachbarschaft hochmütig als Feindesland betrachtet wurde, weit entfernt von den wirklichen und vermeintlichen Höhenflügen auf der Insel. Dieses Modell übertrugen wir auch auf unsere gemeinsame Zeit in der verschlafenen Universitätsstadt. Unser Zusammenleben war symbiotisch, was die Öffnung für weitere Begegnung verhinderte; auch den so sehnlich erwarteten »Damenbesuch«. Wir flüchteten – wie in der Kindheit (s. Band I, S. 75 f.) – in unsere »Eigewelt« und parodierten nur für uns selbst die Mitstudenten und Professoren.
Es war schon gegen Ende dieses ersten Semesters, als wir dieses Feindesland recht elementar erlebten: Im Zentrum Erlangens, am Hugenottenplatz, stand damals das »HEKA«-Kaufhaus. Dort warteten wir auf die Busse, die Wolfgang nach Alt-Erlangen, mich in die Nähe vom Schronfeld fahren würden. Wir waren leicht angesäuselt von der Bergkirchweih gekommen und besonders Wolfgang war von heiterster Stimmung. Um die Wartezeit zu überbrücken, setzte er sich, nachdem er Geld eingeworfen hatte, auf ein für die Kinder bestimmtes elektrisches Schaukelpferd im Eingangsbereich des Kaufhauses und begann im Stil der Sportreporter jener Zeit eine Reportage: »… und nun nimmt Hans-Günther Winkler die dreifache Kombination in Angriff. Halla zögert. Wird sie verweigern? Nein, nein! Mit mächtigem Satz nimmt sie das erste, jetzt das zweite und jetzt tatsächlich auch das dritte Hindernis. Wird sie zur Gold-Halla werden? Dankbar tätschelt Hans-Günther Winkler ihren Hals, nimmt den Zügel und setzt mit diesem Wunderpferd über den Wassergraben …« Und ständig wippte das elektrische Pferd hinauf und hinunter. Als sich schon eine Traube von Menschen um seine komische Darbietung herum geschart hatte, kam mein Bus, und ich stieg lachend hinein. – Am nächsten Morgen erschien Wolfgang nicht zum Griechisch-Kurs. Hatte er verschlafen? Ich machte mich nach der Kursstunde auf den Weg zu ihm. Als ich anklopfte, öffnete sich nach einiger Zeit die Tür. Im Türrahmen erschien ein Mensch, den ich nicht kannte: Ein durch Blessuren und Schwellungen fast nicht mehr kenntliches Gesicht war zu sehen, um die Augen herum blau angelaufen.
Dann erzählte er, was ihm widerfahren war: Er hatte noch einmal Geld eingeworfen. Doch die meisten Zaungäste hatten sich verzogen. Plötzlich erschienen drei Betrunkene vom Gelände der Bergkirchweih her und fragten ihn, warum er solchen Zirkus mache. Ob er das vielleicht komisch fände. Als er bejahte droschen sie brutal auf ihn ein, besonders sein Gesicht mit Faustschlägen traktierend. – Selten in meinem Leben war ich so zornig und aufgebracht. Mein alter Schutzinstinkt für Wolfgang ließ mich wüste Racheszenen fantasieren. Ich verstieg mich dazu, um das Gelände der Bergkirchweih herum zu patrouillieren, um die Täter nach Wolfgangs Beschreibung zu identifizieren und zur Anzeige zu bringen. – Erfolglos zwar, aber dies ließ uns Brüder noch näher zusammenrücken. In dieser Zeit zeichnete Wolfgang ein liebevolles Porträt von mir:
Abbildung 1: Wolfgangs Zeichnung
Inzwischen war der Sommer eingekehrt, und die Wiesen und Wälder um Erlangen grünten in aller Pracht. Das Kornfeld, das sich vor meinem Zimmer erstreckte, wogte im Sommerwind. Die Frösche ließen ihr Quakkonzert erschallen, und ich war glücklich wie schon lange nicht mehr. Zum ersten Mal im Leben war ich ohne Aufsicht, ganz allein für mich selbst verantwortlich. Das setzte bisher nicht gekannte Kräfte frei. Ich konzentrierte sie auf den griechischen Sprachkurs und zog Wolfgang mit.
Zwar ernteten wir immer noch schlechte Noten bei den Vorbereitungsklausuren, aber ein Aufwärtstrend war deutlich erkennbar. Und damit gingen wir in die Abschlussprüfung hinein. Als sie beendet war, wussten wir nicht, woran wir waren und warteten voller Bangen auf das Ergebnis. Als es kam, wollten wir unseren Augen nicht trauen: Wir hatten beide mit der Note »gut« bestanden. Wir waren außer uns vor Freude und sandten – teuer genug – ein Telegramm an die gerade in Südtirol weilenden Eltern: Beide mit gut bestanden – Eure Söhne.
In der Euphorie jener Tage schrieb ich recht großspurig in meinem Geburtstagsbrief an Hannchen:
Sicher habt ihr inzwischen die frohe Botschaft vom Ausgang unserer Griechisch-Prüfung erhalten. Wir selbst waren so überrascht, dass wir nicht wussten, ob wir vor Freude lachen oder weinen sollten. Wir haben uns fürs Lachen entschieden in dem wir uns die letzten Tage so angenehm wie möglich gestaltet haben. Das hatten wir aber auch verdient, denn die letzten Wochen kann man nicht gerade als erholsam bezeichnen. Das Fazit, das wir aus diesem Semester ziehen können, heißt: Möglichst sollten Wolfgang und ich zusammenbleiben; denn es ist nun wirklich nicht mehr so, dass aus unserem Zusammensein Verzettelungen entstehen oder dass der eine den anderen »herabzieht«.
Das war eine Spitze gegen den vorher immer wieder an mich erhobenen Vorwurf, ich würde den »zu Höherem« berufenen Wolfgang »herabziehen« und an seinem Fortkommen hindern … Mein Licht wollte ich deshalb nicht unter den Scheffel stellen und fuhr fort:
Wir wissen natürlich, was für schwere Opfer Euch dieses Semester gekostet hat. Überlegt man aber, dass ich ein ganzes Semester eingespart habe, dann ist es so doch billiger geworden, als wenn es zwei in Hamburg gewesen wären. Erlangen gefällt uns so gut, dass wir – wenn es für Euch möglich ist – die nächsten zwei Semester noch hier verbringen möchten. Doch das wird sich ja alles noch finden, und jetzt liegen drei lange Monate Semesterferien vor uns.
Erste Semesterferien in Hamburg
Ich kutschierte uns mit dem DKW-Junior in Richtung Hamburg. Als wir auf den Elbbrücken waren, zeigte sich bei klarem Wetter die Silhouette der fünf Hauptkirchen: St. Michael (»Michel«), St. Nikolai, St. Petri, St. Katharina und St. Jacobus. Noch für viele Jahre war das für mich ein bewegender Moment, wenn ich dachte: »Nun bist du wieder in Hamburg«.
Mein Vater Erich meinte, wir sollten uns in den Semesterferien schon auf das kommende Semester vorbereiten, mit seiner zweiten großen Hürde: Dem Erlernen des Hebräischen in Wort und Schrift. Aber dem stand ein anderes Problem im Weg: Mit dem Ausbleiben des Monatswechsels waren wir nicht mehr »flüssig«. Und selbstverständlich wollte ich auf die Annehmlichkeiten und Möglichkeiten der Großstadt nicht verzichten: Gelegentlich mit meinem Freund Knut in die »Palette« gehen, in den »Top Ten-Club« an der Reeperbahn, in die Weinstube Nagel am Rödingsmarkt oder zum New Orleans Jazz in den River-Kasematten am Fischmarkt.
Vielleicht habe ich in der »Palette« den Tipp erhalten: Die Axel Springer Druckerei suche Studenten für einen zeitlich begrenzten Job, der ziemlich gut bezahlt sei. Axel Cäsar Springer habe ein Herz für Studenten. – Ich fragte an und wurde genommen.
Die Arbeit war nicht sehr anstrengend und überhaupt nicht kurzweilig. Jeweils 5 Studenten pro Schicht, hatten wir auf Rohrpostbüchsen zu warten und den Inhalt der darin befindlichen Papiere in ein Buch einzutragen. Manchmal dauerte es ewig, bis so eine Büchse herangedonnert kam, dann wieder kam eine nach der anderen an. Da die Nachtschicht die Lukrativste war, sah ich zu, möglichst oft in ihr eingeteilt zu werden, am liebsten in der Nacht von Sonntag auf Montag, weil es da 345 Prozent Zulage gab. Zufrieden strich ich meine Lohntüten ein.
In der Nacht war so wenig zu tun, dass zwei die Arbeit ganz alleine tun konnten, während die anderen drei für eine verabredete Zeit in die nahe gelegene »Palette« oder anderswohin gingen. Natürlich wurde abgewechselt. Unsere nächtlichen Streifzüge führten uns auch in eine berüchtigte Penner-Kneipe am Ende der Passage Bäckerbreitergang. Die Kneipe beherbergte von Drogen und Alkohol so verwüstete Menschen, dass hier »Dokumentar«-Aufnahmen für den Film »Mondo Cane« gedreht wurden – »eine krasse Kontrastmontage … (der Film) stellt eine Sammlung menschlichen Fehlverhaltens und zerstörerischer Zivilisationserscheinungen zur Schau: Frauen, die Schweine säugen, religiöse Fanatiker, die sich den Körper blutig schlagen, Frauen halbwilder Eingeborener, die in Ställen gemästet werden, und dergleichen mehr.« (Lexikon des Internationalen Films). Diese »Verfluchte Welt«, mit wirklich auf den Hund gekommenen Menschen, lag gerade einmal um die Ecke.
In der Tagschicht war mir ein großer kräftiger Kerl aufgefallen, mit gutmütigen und großen, etwas melancholischen Augen. In der Kantine bestellte er zum Essen immer ein Glas Milch. Wir kamen ins Gespräch. Ich bot ihm an, ein kleines Bier zu spendieren. Er lehnte ab: Milch schmecke ihm besser. – Dann hatten wir beide Nachtschicht. Als wir an der Reihe waren, gingen wir in die »Palette«. Am Tresen verlangte er zur Erheiterung der Umstehenden ein Glas Milch. Das gab es hier nicht und so stieß er zögernd hervor: »Dann geben sie mir eben ein großes Bier.« Was nun folgte, geschah in kürzester Zeit: Er stürzte das Bier hinunter, bestellte ein weiteres mit einem doppelten Korn dazu, wiederholte diese Prozedur noch einmal und trank danach noch mehrere doppelte Korn. Dann war er stockbetrunken. Diese Betrunkenheit wich nicht mehr von ihm, solange wir bei Springer arbeiteten.
Ich fühlte mich schuldig an diesem Rückfall eines Alkoholikers und deckte ihn vor den Folgen ab. Begleitete ihn auch bei seinen nächtlichen Exzessen, um ihn vor dem Schlimmsten zu bewahren. Das Schlimmste war seine Suizidgefährdung. Er hatte schon zahlreiche Selbstmordversuche hinter sich und war nur durch fast unglaubliche Zufälle noch am Leben. – Eines Nachts schleppte ich ihn zu uns nach Hause am Schnelsener Königskinderweg, um ihn von weiterem Trinken abzuhalten. Da es im Haus keinen Alkohol gab, fing er an zu randalieren und fiel sturzbetrunken auf den teuren Mies van der Rohe-Glastisch im Wohnzimmer. Meine Eltern nahmen das mit großer Toleranz hin, verbaten sich aber zu Recht weitere solcher »Besuche«. – Er war ein hochbegabter Werbegrafiker, der vorher glänzend verdient hatte. Ich sah voller Hochachtung mehrere seiner Entwürfe. Ob er wohl noch am Leben ist? – Später erst lernte ich, was ein »Sturztrunk« ist und wie falsch ich mich als Co-Alkoholiker verhalten hatte.
Dann kam eine denkwürdige Lehrstunde, die ich nie im Leben vergaß. Ich wurde mit einer Nachfrage in die Druckerei geschickt. Ich wandte mich an den Meister, der gleichzeitig im Betriebsrat tätig war. Wir kamen ins Gespräch. Er fragte mich: »Wisst ihr Studenten überhaupt, wofür ihr hier arbeitet?« Ich wusste es wirklich nicht. Er klärte mich auf: »Was ihr da in das große Buch eintragt, sind die Zeiten, die von den Druckereiarbeitern für bestimmte Arbeitsabläufe benötigt werden. Eine Fremdfirma hat gegen den Widerstand des Betriebsrats den Auftrag bekommen, die nötigen Zeitmessungen vorzunehmen. Wir sollen unter verschärften Zeitdruck gesetzt werden. Ihr könnt euch denken, dass ihr bei den Arbeitern weiß Gott nicht sehr beliebt seid!« Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Dafür also brauchte der Herr Axel Cäsar Springer uns Studenten. Und wir hatten uns zu fragen: Wie kann man sich an einer Arbeit beteiligen, deren Zielsetzung man nicht kennt?! »Nach 6 Wochen geht ihr hier wieder fort«, ergänzte der Meister noch, »und später, wenn ihr ausstudiert habt, seid ihr diejenigen, die solche Aufträge erteilen und Druck auf die Arbeiterschaft ausüben. Ihr seid hier nicht willkommen.« Mein Mütchen war sehr gekühlt, als ich zu meiner Rohrpost zurückkehrte. Dies machte klar, dass alle meine bisherigen »kleinen Revolten« immer auf dem Hintergrund meiner eher kleinbürgerlichen Herkunft ausgebrochen waren. Es gab daneben in den Betrieben und Fabriken eine Welt, von deren Inhumanität ich nichts wirklich wusste noch ahnte und gegen die viel begründeter noch zu rebellieren war.
In diese Zeit fiel auch das Ende der »Palette«. Eingeläutet wurde es durch den Fall Petra Kellner: Die 17-jährige Tochter eines Amtsarztes und Universitätsdozenten hatte nach eigener Aussage in der »Palette« vier Wachmacherpillen (Captagon?) eingenommen und sei – so die Zeitung »France Soir« in Paris – »dadurch so muntergeworden, dass sie erst drei Stunden, nachdem sie daheim in Langenhorn hätte sein sollen, wieder runterkam.« Aus Angst vor ihrem Vater habe sie sich entschlossen, mit einem Kumpel aus der »Palette« nach Paris zu trampen. Sie ließ im Lokal in der ABC-Straße ihre Ausweispapiere und das Foto eines Unbekannten zurück. Nicht nur im bürgerlichen Hamburg schlugen die Wellen hoch, sondern das publizistische Echo war bundesweit. Drang vielleicht die Gammler-Szene nun auch schon in die höchsten Kreise der Hansestadt ein? War Petra Kellner vielleicht entführt worden? War sie – wie das »Hamburger Abendblatt« titelte – mit einem Autogangster unterwegs und in Marseille gelandet? Eine Reporterin dieses Blattes macht bei den Kellners einen Hausbesuch und registriert das bildungsbürgerlich sortierte Bücherregal mit AutorInnen wie Francoise Sagan, Gabor von Vaszary, Cronin, Margery Sharp und die Aussage: »Petra hat zu Hause keine bösen Worte gehört«. Sechs Tage nach ihrem Verschwinden wird Petra Kellner in Paris aufgespürt, kehrt zu ihren Eltern zurück, und die Welt scheint wieder in Ordnung. Die »Palette« aber trägt nun das Etikett »jugendgefährdend« am Revers, und die Razzien häufen sich. Anfang November wird sie u. a. wegen Drogenhandels geschlossen. Zu der Zeit war ich bereits wieder in Erlangen und bekam es gar nicht mit.
Zu posthumem Weltruf ist die »Palette« durch Hubert Fichtes Roman gleichen Namens gekommen. Als es 1968 erschien, kaufte ich ihn und war fasziniert vom Schreibstil Fichtes. Bereits im Oktober 1966 hatte Fichte im Star-Club von St. Pauli, auf der »Beatles«-Bühne, Auszüge aus dem im Entstehen begriffenen Roman zusammen mit der Beat-Band »Ian & The Zodiacs« präsentiert. Unter dem Titel »Beat und Prosa« wurde die Veranstaltung zu einem unerwartet großen Erfolg. Dieter E. Zimmer schrieb damals in der ZEIT:
Hier, im »heiligen Sanktus-Paulus Village«, erschlug der Beat die Prosa nicht; beide koexistierten, mehr: sie machten gemeinsame Sache, sie dementierten das angebliche Schisma zwischen der Sub-, der Popkultur, die ihre Kleidung und Sprache und Umgangsformen hat, und der seriösen, der höheren, der dunkel gekleideten »eigentlichen Kultur.« … Hier im »Star-Club« wurde eine andere Form ausprobiert, und sie funktionierte: Die Diskrepanz schien fast ausgelöscht. Der Dichter fand zwanglos ein neues Publikum.
Die Tonaufzeichnung von »Beat und Prosa« habe ich mir später besorgt und höre sie mir als über 70-jähriger ab und zu im Rhythmus jener Zeit wieder an. So bleibt die »Palette« bei mir »forever young«.
Meine ersten Semesterferien gingen zu Ende. In meiner Erinnerung sind sie stets begleitet vom hämmernden Rhythmus des Beatles-Songs »A Hard Day’s Night«, der aus allen Lautsprechern dröhnte. Den Text begriff ich in seiner Bedeutung nicht. Ich verstand – oberflächlich nur hinhörend – irrtümlich: »Es war eine harte Nacht«. Denn die Nächte in diesen drei Monaten hatten es in sich gehabt…
Mummenschanz, Magnifizenzen und theologische Erblasten
Am 4. November dieses Jahres 1964 bewegte sich eine außerordentlich merkwürdige Prozession vom Kollegienhaus her durch den Schlossgarten, auf dem Weg zur Aula des Erlanger Schlosses: Hauptsächlich ältere Herren in farbigen Talaren und mit verschiedenartigen Baretten auf dem Kopf. Gemessen und würdevoll schritten sie an uns vorbei, um der Rektoratsübergabe beizuwohnen: Vom bisherigen Rektor, dem Historiker Götz Freiherr von Pölnitz, an den neuen Rektor, den Ordinarius für Neues Testament Gerhard Friedrich.
Für mich hatte dieser Mummenschanz etwas überaus Erheiterndes. Vor allem, als ich in der Nahaufnahme die Gesichter mir bekannter Professoren unter der Verkleidung entdeckte: z. B. die Gesichter von Walther von Loewenich und von Wilhelm Maurer, den wir heimlich den Glöckner von Notre Dame nannten. Ich lachte so laut, dass mich Wolfgang mit dem Ellenbogen zurechtweisend in die Seite stieß. Noch allerdings war es ein weiter Weg bis hin zur Rektoratsübergabe in Hamburg und dem berühmten Transparent »Unter den Talaren Muff von tausend Jahren« – obwohl es nur noch drei Jahre dauern sollte.
Helmut Thielicke war der damalige »Superstar« der Theologie. Er hatte auch in Erlangen Theologe studiert. In seiner eitlen autobiografischen Selbstbespiegelung »Zu Gast auf einem schönen Stern« (erschienen 1984) schrieb er über seine Feier der Rektoratsübernahme in Tübingen 1951:
Die »Inthronisations«-Feier verlief glanzvoll nach der Überlieferung dieser alten, fast 500-jährigen Alma Mater: Der langen Doppelreihe der Professoren, deren Talare aus einer alten Ordenstracht hervorgegangen waren – all das wurde später, in schäbiger, »demokratisierender« Weise abgeschafft (Fettschrift durch den Verfasser)–, schritten in feierlicher Gewandung zwei Pedelle mit den alten Zeptern der Universität voraus. Musik begleitete diesen Introitus. Der festliche Raum tat das übrige, um der Stunde Glanz zu verleihen. … Die Amtskette, die mir umgelegt wurde, hatten schon die württembergischen Könige getragen, wenn sie jeweils als Rector magnificus (hier irrte Thielicke: Der König war der »rector magnificentissimus«) zu einer festlichen Veranstaltung der Universität erschienen waren. Sie war aus purem Gold.
Als 1967 in Hamburg dem Mummenschanz – nur scheinbar endgültig – der Garaus gemacht wurde, kommentierte es der vermeintliche theologische Superstar in seinen Erinnerungen so:
Am 9. November 1967 begann für mich im Auditorium Maximum der Hamburger Universität einer der traurigsten Lebensabschnitte, und zwar bei dem »feierlich« sein sollenden Rektoratswechsel. Hier brach in einem Paroxysmus entfesselter Happenings jene Studentenrevolte aus, deren deprimierende Erscheinungen nicht nur die folgenden Jahre verfinsterten, sondern die auch die Strukturen der deutschen Universität bis in die Grundfesten erschütterten. Die Feigheit von Politikern und Professoren ließ eine geradezu perverse und lähmende Form von »Demokratisierung« zu, von Mitspracherechten nicht Zuständiger, von hanebüchenen Titelanhebungen – wie inhaltsleer ist seitdem das Wort »Professor« geworden – und von konkurrierenden, sich gegenseitig lähmenden Gruppen. Diese Revolte bildete eine historische Zäsur, nach der es zum Niedergang der deutschen Universität kam. Den Prestigeverlust dieser einst so angesehenen Institution konnte ich in aller Welt beobachten.
Den »Niedergang« haben die deutschen Universitäten, besonders durch den Reformschub jener Jahre, ziemlich lebendig überstanden. Hier spricht eine männliche Primadonna, die tief in ihrem Stolz gekränkt ist. Nach über 30 Jahren liest sich das immer noch peinlich. Das Wort des Boethius kann einem einfallen: »Si tacuisses, philosophus mansisses« – »Wenn du geschwiegen hättest, wärest du Philosoph geblieben«…
An den Vortrag, den der neue Rektor Gerhard Friedrich hielt, kann ich mich nicht mehr erinnern, obwohl ich als Zuhörer in der Aula des Schlosses saß. Seine neutestamentlichen Vorlesungen erschienen mir damals so tranig und langweilig, dass ich mich nicht entschließen konnte, sie zu belegen. – Umso erstaunter war ich jetzt, als ich mir den Vortrag, der in der Reihe »Erlanger Universitätsreden« erschienen war, bibliothekarisch besorgte. Seine Rede hatte den Titel »Auf das Wort kommt es an!« Er zitierte zustimmend darin Karl Marx und sogar Stalin. Friedrich hatte die Rede äußerst gründlich recherchiert, und sie ist immer noch lesenswert.
Neben vielen anderen noch heute gültigen Bewertungen und Feststellungen gefällt mir besonders die über das Koinè -Griechisch (die damalige hellenistische Umgangssprache), in der das Neue Testament überliefert ist. Das bedeutete für Friedrich:
Durch die Funde wurde es immer deutlicher, dass die Boten Jesu sich nicht einer besonderen Sprache, sondern der Sprache ihrer Zeit bedient hatten. Sie redeten nicht eine durch den sakralen Gebrauch geheiligte Sprache, erst recht verwendeten sie nicht eine Geheimsprache, sondern sie gebrauchten Wörter und Vokabeln, die damals üblich und gebräuchlich waren, so dass sie von jedem verstanden werden konnten. … Das hat ganz bestimmte Konsequenzen für die Predigt heute. Predigen heißt nicht traditionelle Worte hersagen, die durch den Gebrauch oder auch Missbrauch vielleicht ihren ursprünglichen Sinn bereits verloren haben. Predigen heißt nicht ghettohaft oder anders ausgedrückt »binnenkirchlich« alte Formeln nachbeten, die heute nicht mehr verstanden werden, weil die religiösen, philosophischen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse sich geändert haben … Predigen heute bedeutet, die Botschaft von damals allen Schichten des Volkes so zu sagen, dass sie aufgenommen wird und sich das ereignet und verwirklicht, was in der Predigt ausgesagt und gefordert wird.
Besser kann man eigentlich nicht formulieren, wie eben auch »politische Predigt« als Zeitansage wichtig und nötig ist. Dietrich Bonhoeffers »Weltlich von Gott reden« kommt sofort in den Sinn. – Am Ende heißt es sehr fortschrittlich und mit reformerischem Elan:
Wo das Wort, das Gott den Menschen in den Mund legt, laut wird, da ist es wieder gefüllt, da ereignet sich auch etwas, da werden neue Menschen, und mit den neuen Menschen entstehen neue Verhältnisse.
Dann zitiert er aus Bonhoeffers »Widerstand und Ergebung« und stellt das an den Schluss:
Der Tag wird kommen, an dem wieder Menschen berufen werden, das Wort Gottes so auszusprechen, dass die Welt sich darunter verändert und erneuert. Es wird eine neue Sprache sein, vielleicht ganz unreligiös, aber befreiend und erlösend, die Sprache Jesu, dass sich die Menschen über sie entsetzen und doch von ihrer Gewalt überwunden werden.
Gerhard Friedrich konnte nichts dafür, dass ich ihn damals noch nicht verstanden habe.
In mein Studienbuch trug ich als wichtigste Veranstaltung dieses Semesters ein: »Einführung in die hebräische Grammatik«. Neben kirchengeschichtlichen Vorlesungen bei v. Loewenich und Maurer belegte ich ein kirchengeschichtliches Proseminar beim außerplanmäßigen Professor Karlmann Beyschlag mit dem Thema »Clemens Romanus – der erste Clemensbrief«.
Beyschlag war damals 41 Jahre alt und hob sich angenehm jugendlich von den meist viel älteren Professoren an der Theologischen Fakultät ab. Er strahlte eine nervöse Dynamik aus und war in seinen Urteilen entschieden bis hin zur Polemik. Er konnte einen »absolute beginner« wie mich damit sehr beeindrucken. Bei den Universitätsgottesdiensten war er ein äußerst kritischer Zuhörer und bezeugte seine andere Meinung und sein Missfallen durch Mimik und Gestik so unübersehbar, dass es seinen mehr oder minder geschätzten Kollegen auf der Kanzel nicht entgangen sein kann.
Das Seminar fand in den Räumen der Theologischen Fakultät in der Kochstraße 6 statt, wo wir einen guten Teil unseres Aufenthalts in Erlangen verbrachten. Es sieht heute noch fast genauso aus wie damals – nur hat der Zahn der Zeit den Beton der frühen Jahre zum Bröckeln gebracht. Auch den »Kakaobunker« – für die Tasse Kaffee zwischendurch – gibt es noch. – Clemens, mit dessen langem Brief aus 65 Kapiteln wir uns nun zu beschäftigen hatten, war angeblich der dritte oder vierte Nachfolger auf dem Stuhl Petri und damit Bischof von Rom, wohl in den Jahren 88–97 n. Chr. Er schildert die Situation der römischen Gemeinde in der Verfolgungszeit und befasst sich schiedsrichtend mit Streitigkeiten innerhalb der großen Gemeinde von Korinth. Der Brief war in der jungen Christenheit viel gelesen und hat von daher eine prägende Wirkungsgeschichte gehabt.
Voller Dynamik eröffnete Beyschlag das Seminar. Seine Einleitung war so souverän, dass wir alle vor Bewunderung ehrfürchtig schwiegen. Dann plötzlich stieß er seine erste Frage hervor und blätterte dabei in den Seiten des Briefes: »Was aber machen wir jetzt?« Ein nunmehr bedrückendes Schweigen war zunächst die einzige Antwort auf diese überfallartige »Didaktik«, wie sie wohl für die damalige Zeit auch typisch war. In mir aber hatte sich eine Idee festgesetzt, die noch aus der Aufsatzkunde meiner Schulzeit stammte und ich hob zitternd den Arm: »Wir sollten eine inhaltliche Gliederung vornehmen.« Seine Reaktion war heftig und enthusiastisch: »Eine Gliederung, sagt er. Eine Gliederung!« Er tanzte fast vor Begeisterung. »Der Wunderknabe will eine Gliederung vornehmen. Was für eine großartige Eingebung!« Ich errötete und hasste mich im selben Augenblick dafür. – Im weiteren Fortgang des Seminars fasste er immer, wenn er eine Frage stellte, mich erwartungsvoll ins Auge. Aber meine Eingebung blieb leider eine Eintagsfliege.
Von allen Professoren Erlangens hat mich Karlmann Beyschlag damals am meisten beeindruckt. Umso entsetzter war ich jetzt, als ich seinem weiteren Wirken, das ich völlig aus den Augen verloren hatte, nachging. Ich las seine Darstellung »Die Erlanger Theologie«, die 1993 erschien. Er geht darin der in der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts wurzelnden »Erfahrungstheologie« der Erlanger Schule nach und sieht in der Ära der Theologieprofessoren Werner Elert und Paul Althaus in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eine weitere »Blüte« der Erlanger Theologie. Zu bewundern ist an diesem Werk, dass es Beyschlag gelingt, ganze Bibliotheken theologischer Literatur formal zu bewältigen und dabei den Blick für das Wesentliche zu behalten. Beim Lesen allerdings kam mir der Gedanke: Was soll eigentlich dieses Unternehmen, das im Staub völlig zu Recht vergessener Folianten wühlt? Was soll z. B. die Beschäftigung mit theologischen Sätzen bringen, wie sie einer der »Großen« der Erlanger Schule, der Professor für systematische Theologie v. Hofmann, in einer Streitschrift gegen einen Kollegen niederschrieb:
Dass ich den Unterschied richtig getroffen habe, bestätigt mir Herr Dr. Philippi selbst, indem er mir entgegenstellt, dass infolge der Sünde Gottes Liebe nicht mehr habe wirken können, ohne dass zuvor seiner Heiligkeit eine Genüge geleistet war, oder, wie er es ein anderes Mal ausdrückt, dass sich Gott, während er sich früher zu sich selbst verhalten hatte als der in seiner Liebe vergeben Wollende und doch in seiner Heiligkeit strafen Müssende, nunmehr, nachdem dieses Muss seiner Heiligkeit befriedigt ist, als der vergeben Könnende, ja Müssende verhält, nur dass er den Zwang dieses Müssens durch Selbstdarbringung des Versöhnopfers in dem geliebten Sohne sich selber angetan hat.
Solche monströsen theologischen Sätze wurden in einer Zeit geschrieben, als in Deutschland – auch in Erlangen – die Industrialisierung begann und die Arbeiterschaft hemmungslos ausgebeutet wurde und unter elenden Bedingungen in den Mietskasernen der Städte ihr armseliges Leben führte – so wie die Familie meines Großvaters in Berlin. Diese bei Beyschlag für wichtig gehaltene Streitschrift – sonst hätte er sie nicht als »Beilage« abdrucken lassen – ist doch nur ein Zeugnis dafür, wie weit die Theologie vom realen Leben und von den tatsächlichen Konflikten in der Gesellschaft entfernt war und wie sie die tatsächlichen Antagonismen verschleierte. – Nicht viel anders schien es sich in meinen Erlanger Jahren 1964/65 mit der ganzen dort dargebotenen Theologie zu verhalten.
Aber das war es nicht, was mich jetzt am weiteren Werdegang Beyschlags entsetzte. Erschreckend fand ich seinen Versuch der Reinwaschung der Erlanger Theologie in der Nazizeit, wie er es in seinem Exkurs Die Erlanger Fakultät und der Kirchenkampf (»Die Erlanger Theologie«, S. 160 ff.) in den Raum gestellt hat. Beyschlags Buch erschien 1993. Mit keinem Wort von ihm erwähnt: Im Rahmen des 18. Deutschen Evangelischen Kirchentags 1979 in Nürnberg gab es eine aufsehenerregende Veranstaltung zum Thema »Wie war das möglich? Das Erlanger Gutachten zum Arierparagraphen 1933. – Erlanger Theologen stellen sich einer Entscheidung ihrer Fakultät.« Ich selbst habe leider diese Veranstaltung nicht besucht, hörte aber von ihrer großen Nachwirkung. Mein Freund und Kollege Helge Müller, der daran teilnahm, lobte die gründliche Vorbereitung und gelungene Methodik. So hatte z. B. jeder Teilnehmer im Abdruck alle wichtigen Dokumente zur Verfügung, um sich ein eigenes Bild zu m achen. Beyschlag kann diese Veranstaltung, die hohe Wellen schlug, gar nicht entgangen sein. Sie in seinem Buch über die Erlanger Theologie zu verschweigen kommt einer Geschichtsfälschung nahe. Auch durch Auslassen kann man fälschen!
Der Hintergrund: Am 7. April 1933 (»Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums«) wurde u. a. verfügt, dass »Nichtarier« aus rassistischen Gründen entlassen oder in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden sollten. Die Preußische Generalsynode hatte schmählicher Weise am 5. September 1933 diesen »Arierparagraphen« für die größte deutsche Landeskirche übernommen und strebte eine Übernahme durch alle Landeskirchen an. Daraufhin wurden Gutachten theologischer Fakultäten angefordert, um das theologisch verantwortlich entscheiden zu können. Die von Rudolf Bultmann geprägte Stellungnahme der Marburger theologischen Fakultät sagte »Nein« – ohne jedes Wenn und Aber. Von Rudolf Bultmann selbst stammt der Satz (Dezember 1933):
Die Kirche darf nichts von ihrer Verkündigung preisgeben, die auch das Volksbewusstsein unter die Kritik des Wortes Gottes stellt. Lehnt sich das Volksbewusstsein gegen diese Kritik auf, so ist es das Bewusstsein eines unchristlichen Volkes, das seine Begrenzung durch Gott vergessen hat.
In Erlangen waren es Paul Althaus und Werner Elert – die damals herausragenden »Köpfe« der Fakultät –, die mit der Erlanger Stellungnahme seitens der anderen Fakultätsmitglieder beauftragt wurden. Was dabei herauskam, wurde auf dem Kirchentag in Nürnberg 1979 wie folgt zusammengefasst (zitiert aus den Kirchentagsprotokollen):
Die Gutachter – also Althaus und Elert – stellen zunächst fest, dass das Evangelium für alle Menschen gleichermaßen gilt und davon kein Mensch, und also erst recht kein ganzes Volk, auszuschließen ist. Vor Gott sind alle Christen gleich. Aber diese Einheit im Glauben hebt die biologischen und gesellschaftlichen Unterschiede nicht auf, sondern sie bindet, wie im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 20 zu lesen ist, jeden an den Stand, in dem er berufen ist. Also müssen die Christen die biologische Bindung an ein bestimmtes Volk mit Gesinnung und Tat anerkennen. Aus dieser Trennung folgt, dass die Geistlichen dem gleichen Volkstum angehören sollen wie ihre Gemeindeglieder.
Wie ist dieser Grundsatz nun auf die Christen jüdischer Abstammung anzuwenden? Ob die Juden in Deutschland im vollen Sinne dem deutschen Volke angehören oder ein eigenes Volkstum bilden und somit ein Gastvolk sind, kann die Kirche als solche nicht entscheiden. Diese Frage kann nur das Volk im Blick auf seine besondere biologisch-geschichtliche Lage beantworten.
Das Volk empfindet aber die Juden in seiner Mitte mehr denn je als ein fremdes Volkstum. Es hat die Bedrohung seines Eigenlebens durch das Judentum erkannt und wehrt sich gegen diese Gefahr mit rechtlichen Ausnahmebestimmungen. Das grundsätzliche Recht des Staates zu derartigen gesetzgeberischen Maßnahmen ist von der Kirche unbedingt anzuerkennen.
Da die Kirche sich nun wieder neu auf ihre Aufgabe besinnt, Volkskirche der Deutschen zu sein, muss sie auch die Bestimmungen des Arierparagraphen bejahen. Wegen des schlechten Verhältnisses zwischen Juden und Christen im Staat würde die Zulassung von Judenstämmigen zu kirchlichen Ämtern die Kirche schwer belasten und hemmen. Sie muss daher die Zurückhaltung ihrer Judenchristen von den Ämtern fordern. Ausdrücklich weisen die Gutachter darauf hin, dass zwar Judenchristen nicht mehr zu Ämtern zugelassen werden können, ihre volle Gliedschaft in der Deutschen Evangelischen Kirche aber dadurch –angeblich – nicht bestritten oder eingeschränkt wird.
Ausnahmen sollen in erster Linie für jene Geistlichen gelten, die schon im Amt stehen. Würde die Kirche Pfarrer jüdischer oder halbjüdischer Abstammung, die sich bereits im Dienst bewährt haben, entlassen, würde die ganze Amtseinsetzung der Kirche unglaubwürdig. Die Kirche kann hier nicht einfach überall die Bestimmungen der staatlichen Gesetzgebung übernehmen, sondern muss nach eigenen Regeln handeln. Die Entscheidung in den einzelnen konkreten Fällen weisen Althaus und Elert den Bischöfen zu.
Als erster äußerte sich öffentlich – nach 46 Jahren Funkstille in dieser Sache – der damalige Dekan der theologischen Fakultät Erlangen, Professor Manfred Seitz. Bemerkenswert ist dies besonders deshalb, weil Seitz wie Beyschlag als »evangelikal« eingeordnet wurde; gemeinsam hatten sie die »Lebenswort-Gruppen« initiiert, die das spirituelle Leben der Studenten im Blick hatten, u. a. durch wöchentliche memoratio und meditatio eines Bibelverses. – Auf die Nachfrage eines Diskutanten, warum diese Funkstille solange gedauert habe, sagte Seitz: Es gibt dafür einen ganz menschlichen Grund: Es ist die Scheu, unangenehme Stellen der Vergangenheit, die der Staub der Geschichte zu verhüllen beginnt, anzurühren und aufzudecken. Als nun das Kirchentagsprojekt ruchbar wurde, taten sich, wie Seitz berichtet, emotionale Abgründe auf. Aus ihnen kommen uns brieflich zugegangene Worte der Verwerfung, wie: »Scherbengericht« und »Nestbeschmutzung«; oder: In anderen Theologischen Fakultäten sei Schlimmeres geschehen, und was in Erlangen geschah, habe keinerlei Auswirkung gehabt.
Genau des letzteren Arguments bedient sich Beyschlag in seiner Beurteilung des Erlanger Gutachtens (»Die Erlanger Theologie«, S. 165): Nachdem er die »taktische Wendigkeit« des Dokuments gelobt hat, schreibt er, die Sache vermeintlich abschließend: Indessen wird man der ganzen Auseinandersetzung im historischen Rückblick kaum überragende Bedeutung zumessen können, nachdem der »Arierparagraph« bereits im November 1933 kirchlich gescheitert war. Die hier besprochenen Gutachten und Stellungnahmen sind in den Turbulenzen der folgenden Zeit förmlich untergegangen. So einfach machte es sich Beyschlag, um die »Erlanger Theologie« des Jahres 1933 aus der Verantwortung zu stehlen. Dem stehen die auf dem Nürnberger Kirchentag gesprochenen Worte von Professor Manfred Seitz entgegen:
So ist es letzten Endes ein theologischer, ein im Glauben liegender Grund, warum wir das über unsere Fakultät lastende Schweigen ebenso wie das Gerede über sie brechen. Wir sind als Theologen und Christen fest davon überzeugt, dass wir nicht nur das Gute, sondern auch die Belastungen eines geschichtlichen Erbes übernehmen und eine Einstellung dazu finden müssen.
Das war das Wort zur Stunde! Nun konnte die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Gutachten beginnen. Vertreter aus drei verschiedenen Disziplinen der Fakultät kamen zu Wort: Der biblischen, der historischen und der systematischen Theologie. Neben allen anderen geäußerten Richtigkeiten ragt das Votum des Systematikers Christofer Frey als besonders stichhaltig heraus. Er beschreibt die dogmatische Vorstellungswelt des Gutachtens so:
Das menschliche und das christliche Leben sind biologisch und völkisch bestimmt. Damit tritt nun das Schicksal in Gestalt biologischer und geschichtlicher Bindung an ein Volk neben Gott. Mit diesem Schicksal schleichen sich Vorurteile ein, die damals in deutsch-nationalen und antisemitischen Strömungen verbreitet waren. So können Theologen, die sich an die biblische Verkündigung und auch an die Reformation halten, nicht vom Schicksal reden. Das Schicksal so hoch zu erheben bedeutet, Einstellungen, die nicht aus dem Glauben gewonnen sind, nachträglich theologisch zu überhöhen.
Dann aber nimmt er den eigentlichen Skandal in den Blick:
Im Jahre 1933 führte nun diese »Theologie der Anpassung« dazu, dass man zwar den Staat vom Einfluss der Kirche freihalten wollte. Ob die Juden dem deutschen Volke angehören, das »kann die Kirche als solche nicht entscheiden«, steht dort. Das heißt, zum Bruch der Rechtsstaatlichkeit, zur Diskriminierung einer Minderheit hatte die Kirche nichts zu sagen.
So war es! Und es ist wahrhaft erschreckend bei Beyschlag dann darüber solche Verunglimpfungen zu lesen: »Dass man ihn (Werner Elert) – ebenso wie Paul Althaus – im Zuge sogenannter ›Vergangenheitsbewältigung‹ posthum zum Schrittmacher der NS-Ideologie hat degradieren wollen, spricht nicht für die Wahrheitsfähigkeit der Gegenwart, wohl aber für die Versumpfung heutiger theologischer Verhältnisse.« Starker Tobak. Aber es kommt noch schlimmer.
Für uns, die wir feststellen mussten, wie sehr die evangelischen Landeskirchen 1933–1945 braun »versumpft« gewesen waren – meine pfälzische Landeskirche und die meisten ihrer Pfarrer waren fest in der Hand der naziverseuchten »Deutschen Christen« – war es demgegenüber eine Wohltat vom »Barmer Bekenntnis« (29.–31. Mai 1934) zu hören. Ich beschränke mich auf den ersten Artikel, der gleich wie ein antinazistischer Paukenschlag ertönt:
Wir bekennen uns angesichts der die Kirche verwüstenden und damit auch die Einheit der Deutschen Evangelischen Kirche sprengenden Irrtümer der »Deutschen Christen« und der gegenwärtigen Reichskirchenregierung zu folgenden evangelischen Wahrheiten:
1. (nach Zitierung von Johannes 14, 6 und Johannes 10, 9)
Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.
Unter dem »anathema sit« (»Wir verwerfen die falsche Lehre« …) von Barmen steht schon im 1. Artikel die »Schöpfungsordnungstheologie«, wie sie besonders in der »Erlanger Theologie« vertreten wurde. Über sie sagt in gebotener Schärfe der Kirchenhistoriker Berndt Hamm in seinem Aufsatz »Schuld und Verstrickung der Kirche – Vorüberlegungen zu einer Darstellung der Erlanger Theologie in der Zeit des Nationalsozialismus«:
… die Vertreter einer Theologie der Schöpfungsordnungen (gaben) den nationalistisch, autoritär-faschistisch und völkisch bestimmten Ordnungskonzeptionen eine religiös überhöhte, in das verklärende Licht göttlicher Gesetzgebung gerückte Bedeutung. Dadurch werden diese Ordnungen zu etwas Absolutem und ethisch Bindendem.
Gegen das Bekenntnis von Barmen, das diese Ordnungstheologie verdammte, war deshalb der »Ansbacher Ratschlag« vom 11. Juni 1934 gerichtet, wenige Tage nach der Barmer Bekenntnissynode. Werner Elert und Paul Althaus waren dem »Ansbacher Kreis« »hinzugetreten« – wie Beyschlag das formulierte. Dieser Kreis verstand sich als theologische Arbeitsgruppe innerhalb des »Nationalsozialistischen Evangelischen Pfarrerbundes«. Berndt Hamm hat den »Ratschlag« inklusive kritischer Kommentierung zusammengefasst:
Ein sprechendes Beispiel für diesen Weg der Schöpfungsordnungstheologie bietet der von Werner Elert und Paul Althaus gegen die Barmer »Theologische Erklärung« verfasste »Ansbacher Ratschlag« vom 11. Juni 1934. Den beiden Erlanger Systematikern zeigt sich das Gesetz Gottes »in der Gesamtwirklichkeit unseres Lebens«. In fordernder und verpflichtender Weise binde es jeden »an die natürlichen Ordnungen, denen wir unterworfen sind, wie Familie, Volk, Rasse (d. h. Blutzusammenhang)« und »an den bestimmten historischen Augenblick der Familie, des Volkes, der Rasse, d. h. an einen bestimmten Moment ihrer Geschichte.« Diese konkreten Ordnungen, in denen sich nicht nur Gottes bindender Wille, sondern auch seine schenkende Güte bekunde, finden die Verfasser in der nationalsozialistischen Staatsordnung und in der Person Hitlers: »In dieser Erkenntnis danken wir als glaubende Christen Gott dem Herren, das er unserem Volk in seiner Not den Führer als ›frommen und getreuen Oberherrn‹ geschenkt hat und in der nationalsozialistischen Staatsordnung ›gut Regiment‹ mit ›Zucht und Ehre‹ bereiten will. Wir wissen uns daher vor Gott verantwortlich, zu dem Werk des Führers in unserem Beruf und Stand mitzuhelfen.«
Die fromme und antiquierte Sprache dieses Luthertums mit ihren Zitaten aus Luthers Kleinem Katechismus (Auslegung der vierten Vaterunser-Bitte) zeigt, wie ungeschützt die Hüter einer ehrwürdigen theologischen Tradition, obwohl sie keine Nationalsozialisten sind, samt ihrem »klassischen« Vokabular der Verstrickung in den Nationalsozialismus und der Instrumentalisierung durch das NS-System anheimfallen.
Beyschlags darauffolgender apologetischer Feldzug zur Verteidigung der Erlanger »Blüten«-Theologen ist von wütender Aggressivität. In einer Fußnote seiner »Erlanger Theologie« kennzeichnet er Ernst Wolfs Artikel »Barmen« in der RGG (Standardlexikon »Religion in Geschichte und Gegenwart«) als »eine weithin gegen Erlangen gerichtete Apologie«. Die Barmen-Darstellung des renommierten Kirchenhistorikers Klaus Scholder nennt er sprachschöpferisch »anti-erlangisch« … Zu gerne möchte er den Mythos der »Erlanger Theologie« gegen alle vermeintlich feindlichen Widerstände verteidigen. – Dann aber geht es gegen den Hauptfeind der Erlanger Wagenburg: Seinen Fakultätskollegen Berndt Hamm:
Mit dem Versuch von Herrn Kollegen Hamm (Theologische Fakultät Erlangen), die Erlanger Professoren Althaus und Elert als »Täter und Mittäter« der NS-Gräuel (besonders an Juden) i. S. »aktiv mitwirkender Schuld« zu kriminalisieren, habe ich mich in meinem Aufsatz »In Sachen Althaus/Elert; Einspruch gegen Berndt Hamm« ausführlich auseinandergesetzt.
Es kann hier nicht der Ort sein, diesem Dokument historischer Uneinsichtigkeit und persönlicher Diffamierung durch Kommentare ein Gewicht zu geben, das es nicht verdient. Die Weinerlichkeit, mit der darin beklagt wurde, »dass ›Erlangen‹ der Prügelknabe der deutschen evangelischen Theologie war und blieb«, wirft aber ein diffuses Licht auch auf das Erlangen, in dem ich damals studierte. Zum Schluss schleudert Beyschlag seinem Kontrahenten Hamm Luthers Erklärung zum 8. Gebot entgegen:
Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsern Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, afterreden oder bösen Leumund machen, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren.
Die »fromme und antiquierte Sprache des Luthertums« findet hier noch einmal – als Totschlaginstrument – Verwendung.
Heute weiß ich, warum ich nicht gerne in Erlangen Theologie studiert habe. Erlangen selbst aber, die Stadt und die schöne Umgebung, betrifft das nicht.
Der studentische Alltag in Erlangen
Professor Althaus begegnete ich öfters: Auf der Straße und im Seminar. Ein alter und – wie es schien – immer freundlicher Herr, der gerne mit Studenten ein paar Worte wechselte. Mein Studienfreund Christoph Lindenmeyer, von dem noch ausführlich die Rede sein soll, wohnte wie Althaus auf der »Atzelsberger Steige« – in bevorzugter Wohnlage, hoch über den Niederungen und Abgründen des gewöhnlichen Lebens. Er erzählte mir bei unserem Erlanger Wiedersehenstreffen jetzt, dass er Althaus dort ziemlich oft am Briefkasten begegnet sei. Er kannte Lindenmeyers Vater gut, zu jener Zeit Dekan in Augsburg, der ebenfalls bei ihm studiert hatte. Für seinen guten – auch seelsorgerlichen – Kontakt zu Studenten war er zu Recht bekannt.
Ähnlich freundlich und aufgeschlossen gab sich der Professor für Kirchengeschichte, Wilhelm Maurer, ein kleiner, etwas verhutzelt wirkender Mann, der eine gewisse Ähnlichkeit mit Jean-Paul Sartre besaß. Geistig lagen zwischen ihnen natürlich mehrere Welten … Immerhin war der Biograph Philipp Melanchthons Mitglied der »Bekennenden Kirche« gewesen und nicht wie Althaus und Elert in den Nationalsozialismus verstrickt. – Im Theologischen Seminar war eine Begegnung mit ihm fast nicht zu vermeiden. Wenn ich meine theologischen Arbeiten dort im Flur – mangels einer eigenen Schreibmaschine – schrieb, ging er treppauf, treppab mehrfach an mir vorbei. Dabei wiederholte sich jedes Mal dieselbe Ansprache: »Guten Tag! Schönes Wetter heute. Sie sind ja richtig fleißig! Wie ist Ihr Name?« Als er zum vierten Male vorbeigegangen war, fragte er immer noch nach meinem Namen. Damals erschien mir das wie jene unechte »Brüderlichkeit«, deren Heuchelei ich schon im Internat durchschaut hatte. Wahrscheinlich aber litt er, der vor der Emeritierung stand, an jener Krankheit, die wir heute »Demenz« nennen.
Am Monatsanfang kam per Postanweisung fürs Postsparbuch der Monatswechsel. Das war ein Tag der Freude! Als er im Mai 1964 für mich zum ersten Mal eintraf und einiges Geld abgehoben war, führte mich Wolfgang in ein Lokal in der Drausnickstraße, nicht fern von meinem Zimmer. Das Innere hatte die Schönheit einer Bahnhofsgaststätte. Hinter dem Tresen stand ein wohlbeleibter Mann mit gutmütigen Gesichtszügen. Wir fragten: »Was können Sie uns heute empfehlen?« Mit einer tiefen, fast dröhnenden Stimme, die genussreich das fränkische »R« rollen konnte, antwortete er: »Heut’ nehmt’s am besten Bullenleber.« Die Leber war paniert, und es gab Salat und auch Kartoffelsalat dazu. Ein großes Glas Bier kostete 48 Pfennige, die Bullenleber 2 Mark 50, zusammen also noch keine drei Mark. Wir waren so ausgehungert, dass wir das Ganze erneut und dann noch einmal bestellten. Den Wirt, den wir heimlich »Bulle« nannten, beehrten wir von nun an immer wieder am Monatsanfang. Die Bestellung erfolgte dann nicht mehr über die verbale Schiene, sondern Wolfgang erhob nur die Hand mit drei Fingern. »Aha!«, sagte dann der Bulle, »heute wieder drei Mal Bullenleber.«
Diesen erstaunlichen Appetit kann nur der nicht verstehen, der das damalige Essen der Erlanger Mensa nicht miterlebt und miterlitten hat. Es war lieblos angerichtet, vorwiegend aus Konservenware stammend, und so wenig, dass wir schon eine Stunde danach wieder Hunger hatten. Verhältnismäßig teuer war es auch: Für 1 DM 10 konnte von einem so hoch subventionierten Essen wesentlich bessere Qualität und Quantität erwartet werden. Der AStA (Allgemeiner Studentenausschuss) rief deshalb zum Mensastreik auf. Das war die erste aufmüpfige Studentenaktion, an der ich teilnahm. Er dauerte nur wenige Tage, war aber sehr erfolgreich: Das Essen wurde – auch auf die Dauer gesehen – wesentlich gehaltvoller, und auch die Menge stimmte nun.