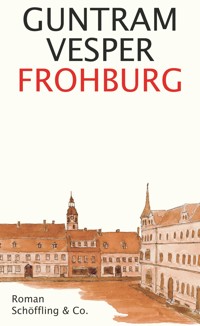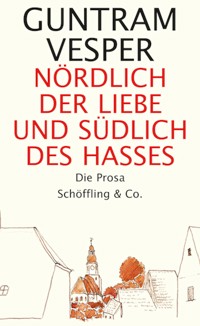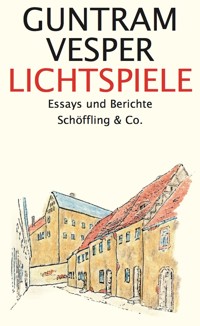
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling & Co.
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nach Guntram Vespers Jahrhundertroman »Frohburg« erschienen mit »Nördlich der Liebe und südlich des Hasses« die Prosa und mit »Tieflandsbucht« die Gedichte des Autors bei Schöffling & Co. Seine gesammelten Aufsätze ergänzen nun unter dem Titel »Lichtspiele«. Essays und Berichte die Werkausgabe dieses so bedeutenden Schriftstellers. Den Kern des Bandes bildet die 1992 erschienene Auswahl Lichtversuche Dunkelkammer, in der Vesper eine Bilanz seiner bis dato entstandenen essayistischen Arbeit zieht. Ergänzt wird dies insbesondere um nach 1992 publizierte Essays, vor allem aus der, vom Frohburg-Erfolg ausgelöst, besonders regen späten Schaffensphase.Der von Thomas Schaefer herausgegebene Band mit einem Nachwort von Andreas Platthaus versammelt Texte rund um das Schreiben, Geschichte(n), Orte, Porträts und Bücher und bezeugt den hellwachen, neugierigen Geist des 2020 verstorbenen Guntram Vesper.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
I Schreiben
Über Frohburg und sich selber schreiben
Stimmen in meinem Zimmer
Lichtversuche DunkelkammerEntstehung einer Erzählung
Eingeladen, meiner Hinrichtung beizuwohnen
II Geschichte(n)
Nachhall
Eine Verabredung am Ende des Tals
Geschichtenland
Wer ertrinkt kann auch verdursten Vom Überleben eines gelösten Rätsels
III Orte
Durch Oderbruch und Uckermark
Nachsaison
Im Landmeer
Entfernung von der Heimat Bahnnotizen auf dem Weg nach Bamberg
Oberhessen
Jenseits der Kohle hinter den Seen Das Frohburg-Kohrener Ländchen
Lichtspiele
IV Portraits
Wir Träumer
Der Lichtblick im Dunkel
In Klotzsche
Ins Freie stürzen
An der Oder
V Bücher
Meine Gedichte
Bürger, Lichtenberg und wir, die heute lebenden Figuren
Ein vergessenes Buch
W 124
Wiederentdeckung eines Großen
Wer hat meinen Arno Schmidt? Eine Suchanzeige
Editorische Notiz
Nachweise
Nachwort
Faksimile
Autor:innenporträt
Herausgeber
Autor des Nachwortes
Kurzbeschreibung
Impressum
I Schreiben
Über Frohburg und sich selber schreiben
DAS DOPPELBILD
Irgendwo im Land gibt es den Ort, die Straße, das Haus, wir haben dort die Kinderzeit verbracht, wir kommen schwer davon los. Den Eindrücken, Gedanken, den Empfindungen und Ahnungen von damals bleibt man lange verbunden. Mit ihnen hat unser Leben angefangen, mit ihnen hat es sich fortgesetzt, sie sind tiefer gegangen als vieles, was später kam, ihre Wirkung ist groß gewesen und dauert noch an.
Wenn ich an meine Kindheit denke, erinnere ich mich an Erlebnisse wie Chiffren, die das enträtselten, was um mich herum und mit mir geschah. Ich denke an die harten Stempel der Erziehung und der Umbruchzeit. An ein Gefühl von Freiheit, an das Bewußtsein großer innerer Möglichkeiten.
Wozu sind wir erzogen worden, von wem mit welcher Geschichte. Wie haben wir Gefühl und Weltsicht weiterentwickelt. Jedes Schreiben über unsere ersten fünfzehn, zwanzig Jahre muß diesen Fragen nachgehen. Die Antworten sind wie Spiegel, in denen wir uns selber, die anderen, das Land sehen, in einem Doppelbild des Gestern und Heute.
EINE KLEINSTADT
Frohburg ist ein Ort südlich von Leipzig, zwischen den bewaldeten Ausläufern des Erzgebirges und den großen Braunkohlengruben. Die Stadt hat fünftausend Einwohner. Um einen weiten Marktplatz gruppieren sich fünfzehn Straßen und fünfhundert Häuser, es gibt einen Fluß, eine Fabrik, einen Bahnhof. Schon Ende der Kaiserzeit wählte die Mehrheit der Einwohner links. Aber auch die bürgerliche und die kleinbürgerliche Provinz waren vorhanden, das Honoratiorentum, Nationalismus, sozialer Dünkel. Viel Armut.
DIE FAMILIE
Generationen von Schmiedemeistern. Handwerker mit einem Gesellen, manchmal einem Lehrjungen. Arbeit jeden Werktag zehn, elf Stunden. Vom Ertrag konnte man gerade die meist nicht kleine Familie ernähren, das Haus unterhalten. Reichtümer wurden nicht angesammelt, Wohlstand stellte sich nicht ein.
Achtzehnhundertsiebzig mußte der Urgroßvater nach Frankreich ziehen, der Großvater wurde neunzehnhundertsiebzehn mit beinahe vierzig Jahren als Landsturmmann eingezogen, keine drei Monate später war er tot. Ein Granatsplitter hatte ihm in Galizien den Schädel zertrümmert. In der Nachricht des Regiments an die Witwe war die Leiche genau beschrieben, in schönster Sütterlinschrift. Vier unversorgte Kinder blieben zurück, darunter meine Mutter, damals fünf. Ihr ältester Bruder fiel einundvierzig vor Moskau.
Ende des vorigen Jahrhunderts konnte der Großvater väterlicherseits die neueingerichtete Tierärztliche Hochschule in Dresden besuchen, weil er einziges Kind war. Er ist dann sechzig Jahre Tierarzt in Frohburg gewesen. Zeitweise wurden zwei Mädchen, ein Kutscher beschäftigt. Darüber hinaus lebte man bescheiden. Geld war selten im Haus. Zehn Kinder, von denen fünf in den ersten Monaten und Jahren starben. Zwei Söhne und zwei Töchter wurden aufs Gymnasium geschickt.
Jeden Sonntag, jahrzehntelang, traf sich die Familie im Haus der Großeltern. Es gab endlose Gespräche, die Zeiten griffen tief in das Leben des einzelnen und aller ein.
DIE ZEIT
Meine frühesten Erinnerungsbilder hängen mit dem Einmarsch der Roten Armee zusammen. Ich sehe die Lastwagen, die Pferdefuhrwerke in stundenlanger Folge an unserem Haus vorbei und in die Stadt ziehen. Juni fünfundvierzig. Irgendwo rechnete man schon die Toten des Krieges zusammen, unvorstellbare fünfzig Millionen. Jeder neunte dieser Toten war im Namen einer schrecklichen fixen Idee unserer Großväter und Väter ums Leben gebracht worden.
Zweihundert gefallene Soldaten allein aus Frohburg. Lauter Söhne, Männer, Väter. Dazu zahlreiche Vermißte. Fünf Einwohner in Konzentrationslagern. Zwei von ihnen kamen nicht zurück. Die Familie des Fabrikanten am Ort teils in Auschwitz ermordet, teils nach England geflüchtet.
Umbruch und Vereisungen. Ich wuchs unter Erwachsenen auf, die im Frühjahr dreiunddreißig die Nazis gewählt, die dann die ersten Zwangsmaßnahmen gegen die Juden für angebracht gehalten, die endlich den Sieg über Frankreich bejubelt hatten und denen es fünf Jahre später und für lange Zeit schwerfiel, den Hunger, die Häuser voller Flüchtlinge, die fremden Soldaten, den Mangel an Kleidung, Heizung und Wohnraum als Folgen zu begreifen.
Nach dem Krieg der Versuch, den Sozialismus einzurichten. Viel guter Wille, viel Anstrengung. Dazu Hintergedanken von Anfang an, verdeckte Programme. Die stalinistische Praxis ließ Zerrbilder entstehen. So erlebte ich die bürgerliche Familie auf der einen, die neuen Lehrer, die Pionierleiter und Kleinstadtpolizisten auf der anderen Seite und fühlte, daß die Verhärtungen da und dort zunahmen, ich merkte, daß die einen mir Distanz von den anderen abverlangten und gleichzeitig Gefolgschaft forderten. Es gibt keine Pflicht zum Gehorsam für Kinder, ich dachte an ein Leben auf eigene Faust.
DIE GERECHTIGKEIT UND DIE GEWALT
Im Spätherbst sechsundfünfzig entwickelte sich der Aufstand in Ungarn, eine verwirrende Woche immer blutigerer Szenen. In der Leipziger Volkszeitung sah ich Fotos gelynchter und verbrannter Mitglieder des Sicherheitsdienstes, angebliches Werk von Horthybanditen und amerikanischen Agenten, während der Londoner Rundfunk von Verrat sprach und die letzten Kämpfe der Csepeler Arbeiter gegen die sowjetische Panzerarmee beschrieb. Ich hatte gerade den ersten Band von Gorkis Altersroman Klim Samgin gelesen und die komplizierte Entwicklung eines Jungen und jungen Mannes in einer Zeit der Wirren, in einer Gesellschaft der Unklarheit und Zweideutigkeit verfolgt. Meine Unsicherheit und mein Mißtrauen wurden größer. Man muß Fragen stellen. Man muß, was man erlebt, hört, liest, an diesen Fragen messen.
Welche Stellung nimmt der einzelne beim Versuch ein, Gerechtigkeit für alle zu erreichen. Welchen Wert hat er. Wie weit kann und darf man über ihn hinweggehen, über seine Einzigartigkeit, seine Unwiederholbarkeit. Wie hoch ist der Preis, der dafür bezahlt werden muß, daß man im anderen nur die Zahl, den Nutzen oder die fremde Gesinnung sieht. Was kosten unsere Träume, wenn wir sie wahrmachen.
Diese Fragen, die ich von weither in meine Gegenwart mitgebracht habe, beschäftigen mich bis heute. Und bis heute habe ich keine endgültige Antwort gefunden. Das Suchen seit damals hat nicht weiter als zu einigen Sätzen geführt.
In unseren Vorstellungen und Forderungen müssen wir leidenschaftlich und rücksichtsvoll zugleich sein. Denn jeder von uns ist viel mehr als nur eine Figur. Und unser Leben ist kein pädagogisches Schauspiel. Es hat einen eigenen Wert und eine eigene Bedeutung.
Stimmen in meinem Zimmer
Es hat eine Zeit gegeben, da ist das Radio für mich von allergrößter Bedeutung gewesen. Das war ab Herbst dreiundsechzig. Ich kam nach Göttingen, um Medizin zu studieren, und fand kein anderes Zimmer als eine Dachkammer im Vorort Grone, nahe der Autobahn. Schräge Wände, Dachfenster, wenn ich es aufstieß und mich auf die Zehen stellte, konnte ich die Straße vor dem Haus sehen. Sonst Wolken, Regenschlieren, Staub. In der Ecke ein halbhoher Ofen, den die Wirtin ausräumte und vorbereitete, ich mußte nur das Streichholz an die alten Zeitungen halten. Klo zwei Treppen hinunter und über den Hof, ein Verschlag. Unter dem Bett ein Nachttopf. Alle Möbel, das Bett, der Schrank, Stuhl und Tisch, aus billigem Leichtholz und blaßgelb lakkiert.
Früh halb sieben stand ich auf, eine dreiviertel Stunde später hetzte ich durch drei Straßen, über die Brücke eines kleinen Baches, der durch die Hintergärten floß, zum Bus in die Innenstadt. Den ganzen Vormittag war ich von Institut zu Institut, von Vorlesung zu Vorlesung unterwegs, kurz nach eins kam ich aus der Anatomie. Um drei begannen die Kurse, die Übungen oder Arbeitsgruppen, noch nach einem halben Jahr sprach man einander mit Sie an, Krawatten waren nicht selten. Halb sieben am Abend war ich wieder in Grone. Zuerst steckte ich den Ofen an. Dann holte ich aus dem Schrank, was mir die Mutter am Wochenende eingepackt hatte, Bratwurst, Camembert, Apfelsinen, und was aus dem Laden um die Ecke stammte, nämlich Butter, Brot, eine Flasche Milch. Die Eltern bezahlten mein Zimmer und gaben mir hundertzwanzig, später hundertfünfzig Mark. Anfang des Monats kaufte ich mir zwei, drei Taschenbücher, zwei Mark, zwei Mark fünfzig das Stück, und am Mittwoch, wenn der Nachmittag frei war, ein Stück Kuchen und bei den Wirtsleuten, die einen Getränkehandel hatten, eine Flasche Limonade. Hatte ich Abendbrot gegessen, war es halb acht, ich zog mich aus, legte mich hin und las oder schrieb, um zehn machte ich das Licht aus.
Das hielt ich drei Monate aus. Dann kaufte ich ein Radio. Fünfzig Mark vom letzten Geburtstag reichten als Anzahlung, die andere Hälfte des Kaufpreises zahlte ich in Raten von zehn Mark im Monat ab. Jetzt gab es abends Geräusche, Stimmen in meinem Zimmer. Eine detailreiche akustische Welt tat sich auf. Musik. Zum ersten Mal hörte ich Beethoven, Brahms und Bruckner genau. Literatur. Die Gespräche zwischen Hans Mayer und Marcel Reich-Ranicki aus dem Hannoverschen Weinhaus Wolf sind mir deutlich in Erinnerung geblieben. Und es gab das, was ich eine Art von Vergangenheits- und Gegenwartskunde nenne, Radiofeatures von Hans Magnus Enzensberger, manchmal auch von Arno Schmidt. Vor allem aber bin ich in jenem Jahr und in den folgenden Jahren einer literarischen Gattung begegnet, die von der Eigenart des Radios und vom gesprochenen Wort, vom Netz, vom Geflecht aus Stimmen lebt. Ich meine das Hörspiel. In der ersten Hälfte der sechziger Jahre wurden Arbeiten und Stücke von Günter Eich und Ingeborg Bachmann, von Heinrich Böll und Walter Jens, von Andersch, Dürrenmatt, Schnabel, von Ludwig Harig gesendet. Ich fand das erstaunlich und eindrucksvoll: etwas war aufgeschrieben worden, unter Umständen, die im Alleinsein vielleicht meiner Lage ähnelten, und nun war es nicht der Autor, der seinen Text vorlas, der Text war vielmehr aufgeteilt worden, er spielte sich ab, zwischen mehreren Stimmen. Aber nicht in der Art des Theaters, vielmehr leise, mit Pausen, ich hatte viel Zeit für die eigenen Gedanken, Empfindungen. So war der Raum des Hörspiels auch keine Bühne, es gab keine Tiefe, keine Breite und Höhe, meine Phantasie war entscheidend, von ihr hing alles ab.
Die ersten eigenen Versuche, Texte für das Radio zu schreiben, habe ich vier Jahre später gemacht. Ich hatte die Vorstellung, ein oberhessisches Dorf, das mich allein schon durch seine Lage auf der Kuppe eines vulkanischen Basaltkegels hoch über einem Tal des Vogelsbergs fasziniert hatte, mit Worten nachzubauen, so wie ich es sah, und diese Worte zum Material für Stimmen werden zu lassen. Auf diese Weise ist Gedenkreden und Stichworte als Aufklärung über ein abgelegenes Dorf entstanden, mein erstes Hörspiel.
Als ich die Sendung dann hörte, war ich erstaunt, was aus den Sätzen im Schreibheft geworden war, in das ich eingetragen hatte, was mir dürr vorkam. Ein Gespräch fand statt, die Stimmen sprachen miteinander, und sie sprachen mit mir. Eine solche stilisierte Unterhaltung auf hohem Niveau, dachte ich damals, fehlt unserem Alltag. Auch in der Literatur war sie anderswo als im Hörspiel nicht zu entdecken.
Und jedermann, der ein Radio besaß, konnte beim Wechseln des Senders auf die Stimmen stoßen, sich von einer von ihnen oder von zwei, drei Sätzen so angesprochen fühlen, daß er einhielt und zuhörte. Ich stellte mir dabei auch Menschen vor, die selten ein Buch aufschlugen oder eine Buchhandlung betraten. Ganz richtig haben mir seitdem immer wieder Freunde, Bekannte, andere Autoren erzählt, wie sie im Autoradio oder zu Hause zufällig etwas gehört hatten, von dem eine Anrührung ausgegangen war, das ihr Interesse gebunden hatte. Stell dir vor, es ist von dir gewesen.
Erst viel später, nachdem, über Jahre hinweg, Verhörspiel guter Menschen, Verdacht, Reise in eine verhangene Landschaft voller Katastrophen, Heimat Träume und Unten im Schwarzwald entstanden waren, wurde mir bewußt, weshalb mich das Hörspiel so festgehalten hatte, daß zwischen neunzehnhunderteinundsiebzig und achtundsiebzig kaum eine größere Arbeit anderer Gattung geschrieben worden, kein Buch von mir erschienen war.
Das lag, in zweierlei Hinsicht, an der großen Freiheit, die das Schreiben von Hörspielen gewährt. Ich war an keine Vorgabe gebunden, ich konnte, wie bei Gedichten und Tagebuchnotizen, von dem sprechen, was mich am stärksten beschäftigte, ein eigenes, nur mir gehörendes Thema war möglich, ja es empfahl sich geradezu, wollte man sich weiterentwickeln.
Diese Entwicklung ging ungehindert von fremden Einflüssen und Einmischungsversuchen vor sich. Der Literaturbetrieb schließt nämlich das Hörspiel nur sehr bedingt ein. In diesem Seitabliegen der Gattung, das sich im Fehlen eines institutionalisierten öffentlichen Echos ausdrückt, liegt eine beachtliche Möglichkeit, ungestört, konzentriert und auf eigene Faust zu arbeiten, vorwärtszugehen, auf sich selber zu. Es gibt kaum Kritik und Scheinkritik, keine Besserwisserei, keine Feindschaften und Fehden; jeder Anstoß, jede Korrektur, jeder Fortschritt muß vom Autor erarbeitet werden. Das führt zu dem, was ich organisches Wachstum literarischer Schreibweise nenne. Bei aller Anstrengung bin ich nie überfordert gewesen, vielmehr, in der Ruhe und Tiefe der Arbeit am Schreibtisch, am ehesten ich selber.
Wenn ich heute darüber nachdenke, wie ein Hörspiel aussehen soll, aussehen kann, weiß ich, daß es das Hörspiel ebensowenig wie den Roman oder das Gedicht gibt. Wieviele Nuancen und Schattierungen von der Ballade bis zum Epigramm, vom klassischen Entwicklungs- zum Science-fiction-Roman. Ich kann nur von mir sprechen.
Meinen Hörspielen liegt eine Geschichte zugrunde, der Kern einer Geschichte oder ein Seitentrieb. Diese Geschichte soll uns angehen, für uns eine Bedeutung haben. Und sie muß vom Hörer nicht nur verstanden werden, sie muß, soll er sich nicht abwenden, Aspekte des Neuen, Nochnichtgewußten auf unspektakuläre Weise enthalten.
Stimmen bedienen sich des Stoffes. Oder bedient sich der Text der Stimmen. Sie sprechen. Die Grundsituationen von Gespräch, Unterhaltung, Mitteilung dürfen nicht verschüttet werden. Dazu kommen die Reflexion, die Erweiterung, etwa des zeitgenössischen Themas ins Historische oder des historischen Themas in die Gegenwart, die Verdichtung, die Stilisierung und endlich, als Spiegel seiner inneren Welt, seiner Ästhetik und seiner sozialen Gedanken, die eigene, die unverwechselbare Sprache des Autors.
Lichtversuche DunkelkammerEntstehung einer Erzählung
LICHTVERSUCHE EIN WERKSTATTBERICHT
Vor einigen Jahren habe ich einen spanischen Film gesehen, ich kenne die Umstände nicht mehr und kann mich weder an den Titel des Films noch an seine Fabel erinnern, ich weiß nur noch, ich sehe nur noch vor mir, daß ein Mann in mittleren Jahren sich aufs Land zurückzog, in eine Gegend, in der er vielleicht aufgewachsen war, in ein abseits gelegenes Bauernhaus, das Haus seiner Familie möglicherweise. Wochenlang schrieb dieser Mann in der ländlichen Einsamkeit die Geschichte seiner Kindheit auf, Abend für Abend. Man sah ihn im Lichtkreis der Lampe am Tisch sitzen, Kopf, Hand, Füller und Papier fielen besonders ins Auge, wie der Mann manchmal den Kopf mit der Hand stützte und nachdachte, wie dann wieder die Feder übers Papier glitt, ein schönes ruhiges Bild des Schreibens, des idealen Schreibers in warmen Tönen, die Dunkelheit des Zimmers der harmonische Rahmen, entstehen so Gedichte, Erzählungen, Romane, werden so Bücher geschrieben.
Warum nicht, erfreulicherweise. Aber wir kennen auch ganz andere Geschichten, Romane, über deren Niederschrift die Autoren sich verzehrten und starben, mein toter Freund Hans J. Fröhlich ist eines der jüngsten Beispiele, Gedächtnisprotokolle, die der Untersuchungshäftling Jürgen Fuchs sich in den Verhörpausen einprägte, ins Gehirn brannte, eposähnliche Berichte wie die von Solschenizyn, im Haftlager mit mikroskopischer Schrift auf winzige Fetzen Papier geschrieben, Albrecht Haushofer, Peter Paul Zahl, so viele Bücher, so viele Entstehungsgeschichten, in denen die Zeiten, die Länder, ihre Menschen, der Autor und seine Umgebung vorkommen.
Eine bekannte Wahrheit: was ich schreibe, wie ich schreibe, ja daß ich schreibe, ist ohne die Geschicke der eigenen Familie, des eigenen Landes nicht zu erklären. Denn mit diesen Geschicken sind zentrale Erfahrungen verbunden, Hierarchie, Autorität, Unterwerfung, Uniform, Ordnung, Macht und Geld, die sich bis in die Wahl der Wörter, einzelner Wörter, bis in die Fixierung auf bestimmte Bilder, Imaginationen auswirken.
Meine Sprache, meine Stoffe auch stammen aus diesem Land, aus dem dunklen bis gestern doppelten Deutschland, das ich als Einwohner dort und als Einwohner hier und als zwei Seiten einer Medaille erlebt habe, deren eine Seite ohne die jeweils andere merkwürdig matt, beinahe tot wirkte.
Spätestens seit dem Beginn unseres Jahrhunderts ist das Zeitalter der Flüchtlinge und Exilanten angebrochen, mit immer besser erkennbarem Schreckensgesicht. Nicht allein fern in der Türkei, sondern auch und vor allem, eine Art Herd, mitten in Europa. Die weitverbreiteten Erfahrungen von Verlust und Verfolgung, die privaten und die öffentlichen Katastrophen und das leise Zittern des Bodens sind unser Thema, ein wahrhaft glückliches Zeitalter kennt keine Literatur, sagt Heinrich Mann. In kaum einem anderen Land als hier bei uns findet der Autor, unausweichlich, einen solchen Reichtum an bewegten Biografien und dramatischen biografischen Bruchstücken, durch die Jahrzehnte hindurch, bis heute. Kaiserreich, Erster Weltkrieg, Revolutionsversuch, Weimarer Zeit, Naziherrschaft, Exil und Völkermord und Krieg, Austreibung und die Nachkriegsgesellschaft in ihrer schwer zu durchdringenden Mischung aus Tätern und Opfern und in zweifacher Hinsicht Unbeteiligten; dazu das Auseinanderfallen des Landes erst in zwei Hälften und dann in zwei Staaten, zwischen denen der Grabenbruch der beiden Weltmächte verlief mit dem Herüber und Hinüber und allen Widersprüchen und Gegensätzen; endlich die jüngsten erdrutschartigen Veränderungen, das Ineinanderstürzen der beiden Landesteile; welche Möglichkeiten der literarischen Berichterstattung, des genauen Erzählens, des Identitätsversuchs.
Seit langem beschäftigt mich eine deutsche Kleinstadt, bin ich ihr auf der Spur. Es handelt sich um meinen Geburtsort Frohburg in Sachsen. Dort bin ich aufgewachsen, dort habe ich bis ins Jahr neunzehnhundertsiebenundfünfzig gelebt. Der Ort ist für mich eine Bühne, was die letzten hundert Jahre unserer Geschichte angeht. Eine Bühne für Zeitgeschichte, für deutsche Lebensläufe. Die ersten Notizen, Detailsammlungen stammen von neunzehnhundertneunundfünfzig, neunzehnhundertsechzig, der früheste Entwurf Laterna magica zum Beispiel. Und bis heute grabe ich Material aus, gewachsenes und verschüttetes, ich treibe in meine und in die Erinnerung anderer Stollen, Erkundungsgänge, ich sammle das Material, fixiere es und versuche, daraus Erzählung, Romankapitel, Gedicht zu machen.
Eine solche Erkundung will ich nachzuzeichnen versuchen, sie hat in den Jahren sechsundachtzig bis achtundachtzig stattgefunden und bestand in der Entdeckung und Erarbeitung eines Stoffes und in seiner literarischen Ausbreitung.
Seit der Kinderzeit habe ich mit der Erinnerung an ein Ereignis aus dem Frühjahr neunzehnhundertdreiundfünfzig gelebt, ich war zwölf Jahre alt. Eines Morgens kam ich in die Schule, der Unterricht fiel aus, über Nacht waren zwei Lehrer verhaftet worden. Ich stand am Fenster und sah, wie die Tochter des Erdkundelehrers über den Schulhof kam, tränenüberströmt. Erinnerungen an Zöpfe, weiße Kniestrümpfe. Das Mädchen ging in die Nachbarklasse. Immer habe ich darüber schreiben wollen. Schon damals machte ich eine Notiz in mein Kalendarium.
Aber die Jahre, Jahrzehnte vergingen, und erst vor sechs Jahren begann ich wieder, mich eingehender mit diesem Thema, mit dieser Erinnerung zu befassen. Ich schrieb Briefe, vorsichtig, wenn sie über die Grenze gingen, und fragte nach den Lehrern. Außerdem bemühte ich mich um die Adressen. Immerhin wußte ich, daß die beiden Männer nach der Entlassung in den Westen gegangen waren. Sie hatten zwischen Rückkehr und Weiterfahrt bei Vater in der Praxis vorgesprochen. Ende sechsundfünfzig wahrscheinlich.
Auf meine Briefe bekam ich kaum Antworten. Und wenn mir doch jemand zurückschrieb, wußte er nichts oder nichts Genaues. So schien mir am Ende die eigene Erinnerung noch am präzisesten zu sein. Doch dann lernte ich einen Redakteur aus dem Rheinland kennen, der in seiner Lebensgeschichte einen unfreiwilligen Wechsel von Westberlin in den Ostsektor zu verzeichnen hat, mit einigen Jahren in Bautzen, und Verfasser einer grundlegenden materialreichen Arbeit über die politische Justiz der DDR ist. Den lernte ich kennen, und ihn fragte ich. Einmal nach den Hintergründen und Folgen der nächtlichen Verhaftungen in Frohburg, zum anderen nach weiteren ähnlichen Vorkommnissen, was meine Kindheitsgegend und die ersten zehn Jahre nach dem Krieg anging. Tatsächlich konnte er mir nach einiger Zeit der Recherche die genauen Namen, die Geburtsorte und die Geburtsdaten meiner Lehrer nennen, er hatte sogar die Garnison herausgefunden, in der das sowjetische Militärtribunal getagt hatte, selbst die Urteilsparagraphen waren in seiner Auskunft angeführt, Strafmaß fünfundzwanzig Jahre, mehr ließ sich, nebenbei gesagt, auch aus anderen Quellen nicht erfahren.
Darüber hinaus aber lenkte der Helfer meine Aufmerksamkeit auf einen weiteren Fall. Er schickte mir nämlich die Kopie einer mehr als zwanzig Jahre alten Pressemitteilung, die der Untersuchungsausschuß freiheitlicher Juristen in Westberlin herausgegeben hatte. In Erinnerung an den siebzehnten Juni neunzehnhundertdreiundfünfzig waren im Text die Namen und Wohnorte einiger Männer genannt, die in Zusammenhang mit dem Aufstand zum Tode verurteilt und sofort erschossen worden waren, meist noch am Tag des Aufstands oder in der folgenden Nacht. Unter den aufgeführten Namen fand ich den eines Mühlenwärters Eberhard v. C. aus Geithain.
Geithain, die Kreisstadt zu meinem Geburtsort. Dort sind meine Eltern getraut worden, dort bin ich zur Oberschule gegangen, es handelt sich um eine durchaus vertraute Stadt von kaum sechstausend Einwohnern mit großem Emaillewerk, in einem Dorf im Vorfeld hat lange Jahre der Maler Conrad Felixmüller gelebt.
Der Hinweis auf den Mühlenwärter bewirkte eine schlagartige Anrührung. Wieso kannte ich den Namen nicht, weshalb hatten auch die Eltern nie von dem Mann und seinem Tod gehört, selbst in Gerüchten nicht. Der Kreis Geithain besteht aus vier Kleinstädten und aus einer Reihe von Dörfern, wenn sich in meiner Kinderzeit etwas Besonderes ereignete, Brand, Düsenjägerabsturz, Einbruch, sprang die Kunde von Ort zu Ort, selbst die Geheimnisse von Familien drangen früher oder später nach außen und wurden weitergesagt.
Hier nun, im Fall des Mühlenwärters auf der Liste, gab es keinerlei spontane Erinnerung, keine schnelle Bestätigung, Zweifel waren durchaus am Platz, denn der Name war vom inzwischen längst aufgelösten Untersuchungsausschuß genannt worden, jener umstrittenen Einrichtung, die in den fünfziger Jahren vor allem aus Berichten von Flüchtlingen und Westberlinbesuchern Details zu Alltag und Politik in der DDR filterte und neben wichtigen Informationen gelegentlich auch abstruse Zahlen und abenteuerliche Behauptungen veröffentlichte.
Ich mußte also zuerst einmal in Erfahrung bringen, ob es den Mühlenwärter in Geithain wirklich gegeben hatte. Und wenn ja, ob Hinweise auf merkwürdige Todesumstände vorlagen. Traf dies zu, wollte ich Daten und Einzelheiten zusammentragen und über den Fall schreiben und damit verhindern, daß der Name des Mannes, sein Schicksal noch einmal und vielleicht für immer untergingen.
Aus solchen Intentionen heraus schrieb ich Briefe, im Lauf eines Jahres etwa sechzig, an ganz verschiedene Adressaten in der DDR, in der Bundesrepublik und sogar im Ausland. Meist hatte ich mit den Empfängern schon wegen anderer Frohburger Fragen korrespondiert, oft war mir geholfen worden. Aber diesmal kam entweder gar keine oder nichtssagende Antwort, bestenfalls mit Sätzen garniert wie: Das ist so lange her, ich kann mich nicht erinnern. Als sei meine Frage nach Eberhard v. C. ungehörig.
Schon wollte ich aufgeben, da fiel mir ein, daß mich Monate vorher, nach einer Lesung im Ruhrgebiet, eine Zuhörerin angesprochen und mir gesagt hatte, sie stamme aus Geithain und sei die ältere Schwester einer Mitschülerin. An diese ehemalige Geithainerin erinnerte ich mich, sie hatte mir ihre Adresse gegeben, also konnte ich ihr schreiben. Die Antwort, nicht überraschend inzwischen für mich, war hinhaltend. Freilich stand im Briefkopf die Telefonnummer der Absenderin, ich rief sie abends an, nicht ohne Scheu und Hemmung. Und nun plötzlich, während des Telefonats, stellte sich heraus, daß der Hinweis auf den Mühlenwärter zutraf, daß der Mann tatsächlich in Geithain gelebt hatte und in Zusammenhang mit dem siebzehnten Juni dreiundfünfzig ums Leben gekommen war.
Ein einfacher Mann, Arbeiter. Kinder in meinem Alter vielleicht, wahrscheinlich zwei Töchter. Meine Gesprächspartnerin nannte mir sogar die Straße, die Hausnummer und beschrieb das Haus, in dem die Familie gewohnt hatte, seine Lage, sein Aussehen, als Oberschüler bin ich jeden zweiten Tag daran vorbeigegangen, dort, wo die Bahnhofstraße auf den Geithainer Markt mündete, gegenüber dem Café.
Kaum war das Telefongespräch mit der Schwester der Klassenkameradin zu Ende, entwarf ich, laut Notiz am sechsundzwanzigsten Juni neunzehnhundertsiebenundachtzig kurz nach Mitternacht, den Plan zu einer Erzählung, die sich mit dem Hinweis des Redakteurs und mit dem beschäftigen sollte, was ich gerade erfahren hatte und in Zukunft noch erfahren würde. Mir schwebte in jener Nacht eine Prosaarbeit vor, die meine Schulzeit in Geithain und den Arbeiter C. zusammenführen würde, durch eine seiner beiden Töchter vielleicht. Zuerst dachte ich an eine Mitschülerin, die ich auf der Geithainer Oberschule gehabt hätte, mit Namen C. Sie sei besonders strebsam und angepaßt gewesen.
Während einer sonntäglichen Haussammlung für das Nationale Aufbauwerk im Neubauviertel von Geithain war mir einmal eine der Wohnungstüren von einer Frau geöffnet worden, in der ich zu meiner Überraschung und zu meinem Ärger die Frau des gerade von Frohburg weggezogenen Stasimannes Mäser erkannte. Das Ehepaar Mäser hatte jahrelang uns gegenüber beim Fuhrmann Schramm im ersten Stock gewohnt. Während ich die Mäser um eine Spende anging, hätte ich, so meine Vorstellung, im Flur, in der halben Dunkelheit das Mädchen aus meiner Klasse gesehen. Hier verkehrt die also, hätte ich gedacht, das erklärt vieles.
An diesem Punkt des Entwurfs fiel mir eine bessere Möglichkeit ein. Denn nie hätten die Mäsers Umgang mit der Tochter eines Staatsfeindes gehabt, nie wäre ein solches Mädchen während der Stalinzeit und der auf Stalins Tod folgenden Jahre zum Besuch der Oberschule zugelassen worden. Ich dachte jetzt an ein weiteres Erlebnis meiner Oberschulzeit, nämlich an den Tanzabend auf dem Bubendorfer Gasthofsaal im Sommer siebenundfünfzig. Ich hatte eine neunzehnjährige Verkäuferin kennengelernt, die ich nach Hause bringen wollte. Es stellte sich schnell heraus, daß sie aus Geithain war und auf den ersten Zug warten mußte. Ich fühlte mich verpflichtet, ihr Gesellschaft zu leisten. So saßen wir fünf Stunden auf der Bank vor dem Bahnhof, am Denkmal der Vereinigten Verfolgten des Naziregimes. Tage später traf ich sie wieder. Erfuhr, daß der Vater tot war. Verabredung auf dem Geithainer Friedhof. Dort Grab des Vaters. Datum seines Todes. Meine Nachfrage. Wo gestorben. Abwehrende Antwort. Trafen uns nicht wieder. Und dreißig Jahre später die Liste mit den Namen.
Soweit der Entwurf. Unklar blieb der Schluß der Erzählung. Ich tastete das Thema noch ab und brachte die Realitätsfragmente in immer neue Beziehung zueinander. Allerdings gab es von Anfang an den ersten Satz: Im Winter vor meinem sechzehnten Geburtstag erlaubten mir die Eltern zum ersten Mal den Besuch eines Tanzabends. Diesen Auftakt der Erzählung habe ich im Anschluß an den Entwurf notiert, ich habe in allen Fassungen des Textes an ihm festgehalten.
Die Erzählung war entworfen, von einer Niederschrift aber konnte noch nicht die Rede sein. Die Bestätigung, die knappen Details waren nicht mehr als Ausgangspunkte weiterer Erkundungen. Wieder mußte ich den Postweg benutzen, wieder schrieb ich zwanzig, fünfundzwanzig Briefe, wo hatte C. gearbeitet als Mühlenwärter, das wollte ich unbedingt wissen, denn ich selber hatte keinerlei Vorstellung oder Vermutung. Mühlenwärter, was war das überhaupt. Und wo in der engeren Kindheitsgegend hatte es am siebzehnten Juni Unruhen gegeben, davon war mir nichts bekannt. Aber auch meine Briefpartner wußten anscheinend nichts. Deshalb rief ich im Herbst siebenundachtzig noch einmal im Ruhrgebiet an. Ich erinnere mich jetzt, sagte die Frau aus Geithain, C. hat in Böhlen gearbeitet.
Böhlen, das große Braunkohlenkombinat und Benzinwerk südlich von Leipzig, das Anfang der fünfziger Jahre nach dem damaligen Ministerpräsidenten Otto Grotewohl benannt wurde, ist mir seit Kindertagen vertraut gewesen, in der Literatur zum siebzehnten Juni taucht es so gut wie gar nicht auf. Ich fing an, mich über das Kombinat zu informieren, und sammelte alles Material, das ich bekommen konnte, zur Geschichte des Werks, zu seiner Produktion und Organisation, ein umfangreiches Dossier über die Braunkohlenindustrie im Leipziger Raum entstand.
Gleichzeitig bat ich den Pfarrer von Geithain per Brief um Mitteilung der Eintragung im Kirchenbuch, C. betreffend. Eine Antwort blieb aus. Warum. Dann kopierte mir jemand die Grabschrift auf dem Geithainer Friedhof. Und ich fand sogar einen alten Mann, der bereit war, mit einer Verwandten C.s zu reden, von der ich inzwischen gehört hatte, daß sie in Geithain lebte. Der alte Mann kannte die Verwandte und suchte sie auf, sie war nicht bereit oder imstande, etwas zu jener Katastrophe zu sagen, die einmal so furchtbar über die Familie hereingebrochen war.
Wie über das wenige schreiben, das ich bis dahin entdeckt, gefunden hatte. Sollte ich, sollte der Erzähler eine Figur, eine rekonstruierte oder eigentlich ja erdachte Figur zur Arbeit fahren lassen. Sollte ich die Fahrt zum Werk und die Arbeit vor Ort beschreiben, als kennte ich sie aus eigener Erfahrung. Sollte ich die Verhaftung C.s schildern. Und wie ginge es dann weiter. Wie ist es dann weitergegangen, in solchen Fällen.
Der Autor ist nicht allwissend. Ich konnte mir den Ablauf nicht differenziert und in Einzelheiten vorstellen, eine Beschreibung des Mannes und die Schilderung der Festnahme kamen nicht in Frage.
Ich wich aus. Als müßte ich warten, Zeit verstreichen lassen, so begann ich, Skizzen zum Thema anzufertigen, beispielsweise zeichnete ich das Kulturhaus des Kombinats Böhlen aus dem Ende der vierziger Jahre, ich skizzierte die Kühltürme und Schornsteine und die Riesenlöcher der Tagebaue, die sich bis zum Horizont erstreckten, die Großraumbagger und Förderbrücken. Außerdem legte ich detaillierte Karten und Pläne an mit den Braunkohlenlagern und der Braunkohlenförderung in Westsachsen. Dazu trug ich Druckschriften zusammen, spannte Bibliotheken, Archive hierzulande und teilweise auch jenseits der innerdeutschen Grenze ein, die Materialsammlung wurde immer umfangreicher und immer genauer, auch, was die Verwüstung der Landschaft, die Belastung des Wassers und die Verschmutzung der Luft, den Verschleiß der Menschen anging.
Aber bei aller Fülle der Information hörte ich monatelang nichts Neues zu C. Kein Brief, kein Zettel ohne Unterschrift auf meine Anfragen. Erst als ich jede Hoffnung schon aufgegeben hatte, bekam ich von ganz unvermuteter Seite die Kopie eines Aktenstücks vom neunten März neunzehnhundertvierundfünfzig mit der Überschrift Besucherbericht. Das Dokument hatte folgenden Wortlaut:
»Der Arbeiter Eberhard v. C., geboren achten September neunzehnhundertzehn, zuletzt wohnhaft in Geithain, Bahnhofstraße zwei, zuletzt als Mühlenwärter im Kombinat Espenhain, Brikettfabrik, beschäftigt, ist am siebzehnten Juni wegen Teilnahme an Unruhen im Werk von den Sowjets verhaftet und standrechtlich erschossen worden. Die Witwe konnte zunächst wochenlang nichts über das Schicksal ihres plötzlich verschwundenen Ehemannes erfahren. So erhielt sie am achten Juli noch ein Kündigungsschreiben des Betriebs, wonach die Belegschaft aufgrund der Vorkommnisse am siebzehnten Juni eine weitere Zusammenarbeit ablehne. Bis ihr am achtzehnten August von der Mordkommission in Leipzig, an die sie sich gewandt hatte, mitgeteilt wurde, daß ihr Mann standrechtlich erschossen worden sei. Nähere Auskünfte erhielt sie nicht; die Urne wurde ihr anschließend ausgehändigt, so daß am sechsundzwanzigsten August die Beisetzung stattfinden konnte.«
Diese Aktennotiz kam aus Westberlin. Anscheinend war seinerzeit ein Besucher aus Geithain in der geteilten Stadt gewesen und hatte über das Schicksal des Arbeiters v. C. gesprochen. Die Witwe. Sie hatte sich den Herbst und Winter dreiundfünfzig in ihrer Dachwohnung vergraben, hatte die Mädchen in die Schule und auf Arbeit geschickt, manchmal fand sie morgens im Briefkasten, der im Hof neben der Haustür hing, einen Zehnmarkschein. Dann war der Winter vorbei, die ersten wärmeren Tage kamen. In aller Frühe setzte sie sich auf die Bahn, fuhr nach Westberlin und gab dort die Geschichte zu Protokoll.
Ich las die Notiz, und die Bilder, die sie hervorrief, die Imaginationen waren ein Schock für mich und haben mich lange bedrängt. Die emotionale Anrührung war so stark, daß ich nicht in der Lage war, den Dokumentenfund mit dem Entwurf der Erzählung zu verbinden. Ich mußte einen anderen Weg nehmen, mich den neuen Fakten zu nähern, ich tauschte die vermutete Arbeitsstelle Böhlen gegen die tatsächliche im benachbarten Kombinat Espenhain aus und stellte nun bevorzugt Unterlagen über diesen Industriekomplex zusammen, der an der Fernstraße fünfundneunzig liegt, die von Leipzig nach Chemnitz führt und auch Frohburg berührt.
Mitten in den Orientierungsversuch hinein klingelte eines Abends im Frühsommer achtundachtzig das Telefon, eine ältere Frau war am Apparat, sie sei gerade als Rentnerin aus der Frohburger Gegend zu ihrer Schwester nach Süddeutschland gezogen und habe meinen Aufsatz über Conrad Felixmüller gelesen, Anfang der sechziger Jahre habe sie mit dem Fahrrad einen Ausflug nach Tautenhain gemacht und dort den Maler in seinem Haus besucht, vielleicht interessiere mich das. Gegen Ende des langen Gesprächs, aus einem plötzlichen Impuls heraus, fragte ich die Anruferin, ob sie mir nicht jemanden nennen könne, der nach dem Krieg in Espenhain gearbeitet habe. Ja, war ihre Antwort, ich selber, in der Buchhaltung, wieso.
Ich bin seit Monaten auf der Suche, sagte ich, von wann bis wann sind Sie in Espenhain gewesen. Von einundfünfzig bis neunundsechzig, gab sie zurück, warum. Ich will hören, was am siebzehnten Juni dreiundfünfzig im Kombinat los war. Ach, sagte sie, ja. Und nach einer Pause: Das habe ich verdrängt, darüber durfte nicht gesprochen werden, es gab zwei Tote. Eine Hinrichtung, fragte ich. Da war ein Adliger, erinnerte sie sich. Ja, sagte ich, v. C. hieß er. Es hatte etwas mit einer Holzkiste zu tun, sagte die Frau am Telefon, in ihr wurde er aus dem Werk geschafft, als er schon tot war, oder vielleicht lebte er auch noch.
Mehr wußte sie nicht oder wollte sie nicht wissen. Auf jeden Fall sei dreiundfünfzig im Werk gestreikt worden. Das alles liege aber weit zurück und sei ganz undeutlich. Die Zugehörigkeit zur Jungen Gemeinde habe ihr damals schwer zu schaffen gemacht, auch im Betrieb, man riß ihr das kleine Blechkreuz von der Jacke, hier ist sowjetisches Gebiet, auf dem wir stehen, außerdem, erzählte sie mir, habe sie in jenen Jahren in der Ausbildung gestanden und schon von daher, ausgelastet und beansprucht, nicht viel wahrnehmen können.
Auf das Telefonat hin entwarf ich einen Fragebogen, den ich nach Süddeutschland schickte. Ich fragte die Rentnerin nach dem offiziellen Namen des Kombinats, das bis Anfang neunzehnhundertvierundfünfzig sowjetische Aktiengesellschaft SAG war. Sie wußte den Namen nicht. Ich fragte weiter, ob das Werk einen sowjetischen Generaldirektor hatte. Wie war sein militärischer Rang, wo im Werk befand sich sein Büro, wo wohnte er. Sie konnte sich nur an das Büro erinnern, es war im Verwaltungsgebäude. Gab es auch einen deutschen Betriebsleiter oder Direktor, lautete meine dritte Frage, wie hieß er neunzehnhundertdreiundfünfzig, wo stammte er her, wo wohnte er. Es gab einen, war die Antwort, ja. Vierte Frage: Trifft es Ihrer Meinung nach zu, daß Espenhain Anfang der fünfziger Jahre aus den Betriebsteilen Grube, Großkraftwerke, Schwelerei und Brikettfabrik bestand. Antwort: Ja. Fünfte Frage: Espenhain soll damals ungefähr siebentausend Beschäftigte gehabt haben, trifft das zu. Antwort: Ja. Sechste Frage: Wo war damals der Tagebau, konnte man ihn sehen, wenn man auf der Fernstraße fünfundneunzig von Frohburg nach Leipzig fuhr. Antwort: Ja, auf der linken Seite hinter dem Dorf Espenhain. Siebte Frage: Was verdiente Anfang der fünfziger Jahre, neunzehnhundertdreiundfünfzig etwa, ein Arbeiter, ganz ungefähr, und was haben Sie seinerzeit im Monat verdient. Antwort: Der Kumpel vierhundert Mark, ich in Gruppe H IV dreihundertfünfundzwanzig Mark brutto. Achte Frage: Was war am siebzehnten Juni dreiundfünfzig im Werk los. Antwort: Unruhen, Streik im hinteren Teil des Werks. Neuntens: Wenn es am siebzehnten Juni Versammlungen im Werk gab, wo fanden sie statt und wann an diesem Tag, wodurch wurden sie beendet, kam Volkspolizei, kamen sowjetische Truppen, aus welcher Stadt. Antwort: Sowjetische Truppen und Volkspolizei. Stadt unbekannt. Zehnte Frage: Haben Sie den Arbeiter Eberhard v. C. im Werk bewußt erlebt; er wohnte wahrscheinlich in Geithain, war Anfang vierzig und arbeitete als Mühlenwärter. Antwort: Nein, nicht erlebt, Wohnort war hundertprozentig Geithain. Elftens: Wissen Sie etwas über das, was C. am siebzehnten Juni machte, hielt er eine Rede, verhandelte er mit der Direktion oder ähnliches, haben Sie etwas miterlebt oder später gerüchteweise gehört. Antwort: Jeder hüllte sich in Schweigen. Zwölfte Frage: C. ist irgendwann am siebzehnten Juni verhaftet worden, wissen Sie, zu welcher Tageszeit und unter welchen Umständen. Antwort: Nichts bekannt. Dreizehnte Frage: Wie wurde C. von den Kollegen getrennt, wurde er abgeführt, aus der Menge heraus, oder in ein Gebäude gelockt, haben Sie diesbezügliche Gerüchte gehört. Antwort: Irgendeine Kiste spielte eine Rolle in dem ganzen Geschehen, lag er tot oder lebendig drin, ich weiß es nicht. Frage vierzehn: Was ist Ihnen über sein Schicksal tatsächlich oder auch gerüchteweise bekanntgeworden. Ohne Antwort. Frage fünfzehn: Gab es offizielle Kommentare zu C.s Tod, später. Antwort: Nein, absolutes Schweigen.
Sechzehnte Frage, mit einer kleinen Volte rückwärts, Richtung wichtiger Details, die ich möglicherweise für meine Erzählung brauchte: Wann lag in Ihren ersten Jahren in Espenhain der Beginn der Frühschicht, und wann fing die nächste Schicht an, die Mittelschicht, wann mußte man, grob geschätzt, beispielsweise mit der Bahn in Frohburg losfahren, um zur Frühschicht in die Braunkohle zu kommen. Antwort: Es gab drei Schichten, von sechs bis vierzehn, von vierzehn bis zweiundzwanzig und von zweiundzwanzig bis sechs Uhr. Zur ersten Schicht fuhr man mit dem Zug vier Uhr achtundzwanzig nach Borna und weiter mit dem Werksbus. Siebzehnte Frage: Verkehrten von Anfang an Busse zwischen Bahnhof Borna und Werk, oder waren es zuerst Lastwagen mit kastenähnlichem Aufbau. Antwort: Es waren immer Busse beziehungsweise Lastwagen eingesetzt, die man Hühnerstiege nannte. Die Leiter hinten wurde eingezogen. Im Inneren gab es vier Längssitzreihen, für circa vierzig Personen. Schwarz angestrichen.
Bis hierhin der Fragebogen. Und dies insgesamt das Material zum Schicksal der Figur C.: der Besucherbericht, Gesprächshinweise, die Beschreibung der Lastwagen, Analyse des Kombinats. Ich hatte etwa ein Jahr lang Informationen zusammengetragen, hatte Zeugen und Gewährsleute gesucht und Archive durchforscht, ich hatte manches, vieles sogar in Erfahrung gebracht, was mir jetzt noch fehlte, würde nur ein unwahrscheinlicher Zufall nachtragen. Sicher, es gab Lücken, weiße Flecken, unbekannte Details. Aber diese Fehlstellen ließen sich ausweisen. Darüber hinaus konnte ich von mir reden und davon, wie ich mit dem Thema, mit dem Stoff in Berührung gekommen war. Erzählen aus der Überzeugung heraus, daß die Zeitgeschichte, deren Bild erst entsteht, nicht allein der Macht und den eingesetzten Historikern gehört, sondern Eigentum aller ist, in deren Leben sie eingegriffen hat und eingreift.
Ein erster ganz kurzer Entwurf zu einer Erzählung lag vor, auch den ersten Satz hatte ich längst aufgeschrieben, nun wollte ich ausführlich von der Bekanntschaft mit der Tochter des toten C. erzählen. Und im Lauf dieser Erzählung sollte etwas geschehen, sollte der Ich-Erzähler auf etwas stoßen, das ihn irritierte und das er nicht adäquat entschlüsseln konnte, weil er nicht ins Bild gesetzt war. Dann Schnitt, dann Begegnung mit dem Dokument, mit dem Besucherbericht.
Ich begann die Niederschrift. Kugelschreiber. Schnelle Handschrift für erste Fassungen. Festes rauhes Papier. Ich merkte bald, wie sehr das Erzählen, das literarische Sprechen in diesem Fall belastet war, und mir wurde bewußt, daß die Zahl der Seiten, die am Ende die Erzählung darstellen würden, in keinem Verhältnis zu den Problemen stand, die ich beim Schreiben hatte. Das Unternehmen ähnelte der Abfassung eines Prosa-Gedichtes, die erste Seite zum Beispiel existiert in dreißig verschiedenen handschriftlichen Fassungen. Wahrscheinlich hatte ich Angst vor dem falschen Weg oder der falschen Richtung. Ich ahnte, es würde die Geschichte, einmal formuliert und aufs Papier gebracht, nicht mehr anders, nicht neu erzählt werden können. Jedenfalls nicht von mir. Meine Kraft, meine Bilder würden in der ersten Fassung stecken.
Die Lähmung hing auch mit der Bedrückung zusammen, die der Besucherbericht noch im Herbst achtundachtzig auf mich ausstrahlte. Denn ich stellte mir ansatzweise sehr wohl vor, was ich literarisch zu beschreiben nicht imstande war: wie der Mann, der am Morgen wie alletage zur Arbeit gefahren ist, Stunden später in einem Winkel wer weiß wo hockt, im Arbeitszeug, und auf seinen Tod, auf die Erschießung wartet, stundenlang, eine ganze Nacht. Dieses Kellerbild sah ich vor mir.
Allmählich aber trat die Bedrückung zurück, ich konnte in einer Woche oder in zehn Tagen eine Seite und eine weitere Seite schreiben, in der Art eines Mineurs. Ich formulierte zwei Sätze, und dann ging es nicht weiter. Also stand ich auf und beschäftigte mich im Garten oder machte einen Spaziergang. Dann setzte ich mich wieder an den Tisch und schrieb die beiden Sätze noch einmal und darüber hinaus einen dritten. Das waren schon drei Sätze. Wieder unterbrach ich die Arbeit, machte mich auf den Weg ins Antiquariat, kaufte vielleicht ein Buch. Ich kam zurück, ich schrieb neu, was ich schon hatte, und der Schreibschwung, das intensive innere Mitsprechen trugen mich wieder über den vorhandenen kleinen Bestand hinaus.
So entwickelte sich die Erzählung, so ging allmählich, sehr allmählich ein Satz aus dem anderen hervor. Mit einem Verfahren, das dem Vortrieb eines Stollens nicht ganz unähnlich ist, kam ich immer tiefer in den Bereich der eigenen Sprache und der eigenen Bilder. Das war am Anfang am mühsamsten und wurde von Absatz zu Absatz, von Seite zu Seite etwas leichter. Und irgendwann war das Erzählen an einem Punkt angekommen, an dem ich das deutliche Bewußtsein hatte, nun könne ich jederzeit die Masche fallen lassen und auf das Dokument zu sprechen kommen, ich wäre eigentlich so gut wie fertig, die Geschichte spräche sich selbst zu Ende. Von da an hörte die Arbeit auf, nur Qual zu sein, nur mühsames Vorwärtstasten. Zum ersten Mal sah ich den Text ganz und konnte über ihn verfügen, ich legte Exkurse an und reduzierte kleinliche Nacherzählungen, ich prüfte und korrigierte und dachte über den Titel nach, acht Wochen etwa, und ich hatte meine Erzählung geschrieben, Dunkelkammer.
DUNKELKAMMER DIE ERZÄHLUNG
Ostern vor meinem sechzehnten Geburtstag erlaubten mir die Eltern den Besuch eines Tanzabends.
Die Tanzabende waren im Frühherbst fünfundvierzig wieder aufgekommen, drei Monate nach dem Abzug der Amerikaner und dem Einrücken der Roten Armee. Am Vorabend der Landverteilung hatte man im Steinernen Saal des Schlosses eine Art Bodenreformball veranstaltet. Seitdem fanden die Tanzabende statt, zwölf Jahre schon, jedes Wochenende, immer auf einem anderen Saal.
In Frohburg gab es die Grüne Aue in der Thälmannstraße, Militärverbot in der Kaiserzeit, und weiter draußen, dem Haus der Großeltern in der Greifenhainer Straße gegenüber, das Schützenhaus an der Wyhra, der Wirt war gleich nach Kriegsende von Unbekannten nachts aus dem Bett geholt und mitgenommen worden, man hatte nichts mehr von ihm gehört. Dann die Dörfer des Umlands, der Gegend zwischen Borna und Kohren, Altenburg und Geithain. Nach Norden Braunkohlenebene mit offenem Horizont, nach Süden zu immer mehr Waldstücke, versteckte Wiesentäler. Benndorf, Neukirchen, Wyhra. Sahlis und Windischleuba. Tautenhain, Eschefeld und Greifenhain. Beinahe jeder Ort hatte seinen Gasthof, jeder Gasthof einen Saal. Jägerhaus, Grauer Wolf, Zeisig.
Wir wohnten am Frohburger Markt. Mutter weckte mich jeden Schultag um fünf, eine halbe Stunde später mußte ich aus dem Haus sein. Sommer wie Winter die drei Kilometer zum Bahnhof, fünf nach sechs ging der Zug in die Kreisstadt. In Geithain kurzer Fußweg zur Oberschule, durch das Viertel der Landhäuser an der Bahn, wenn ich auf halber Strecke an dem mannshohen Bretterzaun vorbeikam, hörte ich die unsichtbaren Hunde schnüffeln, die die versteckte Villa bewachten. Hier ging unser Nachbar ein und aus, der beim Fuhrmann Schramm gegenüber wohnte, verheiratet, ohne Kinder. Manchmal, an hellen warmen Abenden, lag der schwere Mann im Fenster, rauchend, die Unterarme auf einem Kissen, während ich hinter den Gardinen im Erker des Eßzimmers stand und über die Straße hinweg das starre Gesicht in sechs oder acht Meter Entfernung beobachtete. Von der gleichen versteckten Stelle aus guckte ich nachmittags den Frauen und Mädchen nach, wenn sie in ihren dünnen Sommerkleidern aus dem Konsum traten und quer über den Markt zum Bäcker gingen.
Die Eltern fuhren über Ostern in die Sächsische Schweiz. Seit zehn Jahren kannten sie Stephans Elbhotel in Bad Schandau, großer Kasten direkt am Fluß, Park bis zum Ufer, weiße Gartenmöbel. Es gibt das Foto noch, April siebenundfünfzig steht auf der Rückseite, Mutter im Liegestuhl, Gesicht halb im Schatten, Knotenfrisur und Hemdblusenkleid aus dem Wismutladen in Aue. Einmal hatten sie mich mitgenommen. Nach Stunden sah ich durch das kleine Seitenfenster des Autos statt der Sommerlandschaft Schuttberge voll Unkraut, kilometerweit gelbe Wüste unter segelndem Staub. Der Staub drang durch die Ritzen ins Auto und legte sich wie eine zweite Haut auf mein Gesicht, wir fahren durch Dresden, sagte Vater.
An trüben Wintertagen, wenn wir eng an eng im halbdunklen Herrenzimmer beim Mittagessen saßen, wurde vom Elbhotel in Schandau, vom Golfhotel in Oberhof, vom Hotel Heinrich Heine in Schierke und vom Waldparkhotel am Dresdner Stadtrand gesprochen, von der langen Nacht in der Tanzbar dort. Immer wieder ließen die drei oder vier Russen, hohe, sehr hohe Offiziere in Zivil, eine Lage Wodka springen, sto gramm, riefen sie immer wieder, und immer wieder auch kamen sie an den Tisch der Eltern und forderten Mutter auf. Gut sahen sie aus, hieß es jedesmal, alles was recht ist. Und vielleicht noch: aufschreiben müßte man können, was man in diesen abenteuerlichen Zeiten erlebt hat. Wie die Eltern in Oberhof, im Speisesaal des Golfhotels Johannes R. Becher und den Maler Fritz Koch-Gotha aus der Ferne gesehen hatten, wie ihnen in der Hotelhalle in Schierke der hagere Romancier Bodo Uhse gezeigt worden war, auf die Hände müssen Sie achten, sagte der Portier, der Ausschlag. Er erzählte von einer nächtlichen Schlägerei, die auf Uhses Konto ging. In der gerammelt vollen Trinkstube hatten in großer Runde Schieber aus Leipzig gesessen, die immerzu Uhses amerikanische Frau angestarrt und dann die Köpfe zusammengesteckt und gefeixt hatten. Alma Uhse in ihrem gebrochenen Deutsch verbat sich das Glotzen, ein Wort gab das andere, Judenhure, hörte Uhse plötzlich halblaut aber deutlich und legte los, bis Volkspolizei einzog und für Ruhe sorgte und die Schieber abführte.
Damals, im Frühjahr zweiundfünfzig, erlebten die Eltern in Schierke mit, wie über Nacht die Grenze dichtgemacht wurde. Am sechsundzwanzigsten Mai gab es nämlich im überfüllten Saal des Hotels einen bunten Abend. Ein dicker wieseliger Conferencier, nicht mehr ganz jung, eine maskenhaft lächelnde Soubrette und ein Hellseher mit Sprachstörung bestritten das Programm. Der Ansager wurde immer ordinärer und hatte immer mehr Erfolg. Schallendes Gelächter bei jeder Zweideutigkeit, für die Zoten prasselnder Beifall. Am Ende der Servierpause kommt der Mann auf die Bühne zurück, ganz ernst nun, und liest unsicher und stockend die Anordnung einer Sperrzone vor, in die auch Schierke und das Hotel fallen. Im Saal nachdenkliche Gesichter. Mit der klebrigen Heiterkeit war es vorbei, sagte Vater, das Völkchen wurde sehr still. Man ging betroffen auf die Zimmer und legte sich früh schlafen. Am nächsten Morgen überall Posten. Die Eltern wollen eine Wanderung zur Rabenklippe machen und werden belehrt, daß sie Schierke nur über die Wegekreuzung Stern verlassen dürfen. Man stellt Schlagbäume auf, ein einziger Weg zum Brocken ist noch erlaubt. Beim Abendessen kreisen Gerüchte, angeblich roden die Männer des Dorfes einen Zehnmeterstreifen direkt an der Grenze, auf Braunlage und den Wurmberg zu, der Streifen soll später gepflügt werden. Außerdem würden unten im Ort zahlreiche Ausweisungen vorgenommen, ganze Familien mit Sack und Pack müßten Schierke verlassen. Wieso denn Ausweisungen, kommt es von den Berliner Tischen zurück, es sind nur die Grenzgänger und Schmuggler, die wir evakuieren. Schon um zehn spielt die Hauskapelle Guten Abend gute Nacht, und das Büfett wird geschlossen, die Lichter gehen aus. Das große Hotel, sonst immer voll besetzt, steht halb leer, auch die Eltern fahren am nächsten Morgen ab, nachmittags sind sie zu Hause, es ist der achtundzwanzigste Mai, mein elfter Geburtstag.
Fünf Jahre später. Als ich am zweiten Feiertag abends vor dem Gasthof Bubendorf vom Rad stieg, hörte ich die Tanzmusik schon. Stimmengewirr, Gedränge auf dem geschotterten Platz, hin und wieder ein verspäteter Laster, der über das Pflaster der Fernstraße polterte.
Drinnen im Saal zusammengeschobene Tische, Bänke ohne Lehnen, unter der Decke hingen noch die bunten Papiergirlanden vom vergangenen Fasching. Rechts saßen die Töchter der reichen Bauern aus Eschefeld und Greifenhain, ihnen gegenüber hatten die Männer von der Wismut ihren Tisch, die Sitzordnung war streng. Oben auf der Bühne, Saxophon um den Hals, ging der Kapellmeister vor seinen Musikern auf und ab, Sonnenbrille, Kreppsohlen, und gab mit schlenkernder Hand den Takt an. Abiturienten aus Borna, die nicht studieren dürfen, was die einmal hören, in Westberlin vielleicht, in der Badewanne oder in der Eierschale, das spielen sie dir gleich.
Nach der Pause war Damenwahl. Vorher der finstere Hof, der Abort. Man hatte eine Rinne in den Boden betoniert und mit Teer ausgestrichen, scharfer Geruch, der einen flacher atmen ließ, das sind wir, zusammengedrängt.
Was ich von nebenan hörte, wo hinter der dünnen Trennwand der Verschlag der Mädchen war. Hing mit den Nachmittagen am Eßzimmerfenster zusammen. Und mit dem Gefühl, das ich eine Viertelstunde später hatte, als die junge Frau quer über die Tanzfläche kam, auf unseren Tisch zusteuerte und mich aufforderte. Blasses schmales Gesicht, Haare dunkelblond, schon stumpf von der Dauerwelle. Wie angezogen. Schneiderinnenkleid wahrscheinlich, Tüll von heller verblichener Farbe, gelb oder rosa. Ich folgte ihr zwischen die tanzenden Paare. Sie war viel kleiner als ich.
Mitternacht wurde der letzte Tanz angesagt. Der Rausschmeißer dauerte mit fließenden Übergängen beinahe eine halbe Stunde, das Mädchen, mit dem man ihn tanzte, durfte man nach Hause bringen. Alles stürzte los, hin zu den zwei, drei Saalköniginnen. Ihr Blick herüber. Schon stand sie auf und kam mir entgegen. Eng und langsam, sagte sie.
Der kalte Nachtwind draußen, vor dem Gasthof. Von Neukirchen herüber der gelbe Lichtschein der Brikettfabrik, das Stampfen und Dröhnen der Nachtschicht. Dahinter die stummen Dörfer, im Osten ein ungewisser Himmel. Nach Hause bringen, wohin. Sie kam aus Geithain. Die nächste Gelegenheit zurück war der Frühzug, mit dem ich zur Schule fuhr. Wie sie neben mir im schwachen Licht der Straßenlampen über das Blaupflaster stöckelte, eine große Tasche am Arm, schmächtig, bleich, mit verschmierten Lippen. Unter dem Mantel guckte das Tüllkleid hervor.
Für den Rest der Nacht saßen wir in den Anlagen am Bahnhof. Der einzigen Bank fehlten zwei Latten. Seitwärts verkohltes Holz, ein Aschenfleck, die Latten waren ins Feuer gewandert. Auf der festgetretenen schwarzen Erde Überzieher, abgestreift und fallengelassen, Binden und in den Zweigen der Büsche drei, vier Fetzen, die wie Schlüpfer aussahen. Wir, zusammengedrängt.
Sie war neunzehn und verkaufte im Konsum am Markt Schürzen und Unterwäsche, zweihundert Mark Monatslohn, morgen habe ich frei. Mit Mutter und jüngerer Schwester bewohnte sie zwei Zimmer, eine Dachstube in der Leipziger Straße in Geithain. Die Wohnung lag gleich neben dem Untertor, über einer Bäckerei. Der Vater war tot, vor Jahren bei einem Unfall im Betrieb ums Leben gekommen. Sie hieß Irmgard. Irmgard, aha. Und weiter. Irmgard v. Pilgrim. Adlig also. Nicht wie du denkst.
Wenn sie sprach, roch sie nach der langen Nacht, nach Bier und nach Hunger, ich hatte den Arm um ihre Schultern gelegt, langsam wurde es hell.
Mit dem Morgenlicht setzte der Strom der Arbeiter ein, die aus der Stadt heraufkamen und eilig zum Bahnhof gingen, einzeln oder in Gruppen, vornübergebeugt. Sie waren halb vier aufgestanden und fuhren mit dem ersten Zug auf Frühschicht in die Kohlengruben und Brikettfabriken, in die Riesenkombinate Böhlen und Espenhain. Dort arbeiteten dreißigtausend, vierzigtausend Menschen rund um die Uhr, auch der Onkel aus Borna, auch der Onkel aus Kohren und Vater und Sohn der großen Familie, die über uns wohnte. Jedes Jahr schleppten die überfüllten verrauchten Waggons der Arbeiterzüge mit den trüben Lampen an der Decke mehr Männer und Frauen in immer größere, immer entferntere Tagebaue und Werke, Dörfer und ganze Städte wurden abgeräumt, Mammutmaschinen schoben sich über das Land, eine stählerne Krankheit, und wühlten den toten Lehm nach oben, zurück blieb der Mond.
Vierzehn Tage später, am achten Mai, fuhren wir zusammen nach Leipzig. Das neue Stadion der Hunderttausend draußen am Elsterflutbecken sollte Tagesziel der Friedensfahrt sein, ihrer sechsten Etappe. Nach der Übernachtung im Chemnitzer Hof würden die Radrennfahrer am Morgen in Karlmarxstadt auf die Maschinen steigen und über Altenburg, Zeitz und Halle nach Leipzig jagen. Friedensfahrt. Gerade hatte die Junge Welt ein Interview mit Gustav Adolf Schur gebracht, dem Matador. Was ist Ihr Steckenpferd, Täve. Schießen.
Der achte Mai war Tag der Befreiung, Feiertag. Wolkenloser Himmel, Windstille. Wir nahmen den Bus, der vom Markt abging. Der Bus hielt in Bubendorf, Neukirchen und Zedtlitz, jedesmal stiegen Leute zu. Sie saß gutgelaunt neben mir und hüpfte von Zeit zu Zeit auf ihrem Sitz, ach unser Gasthof. Zwischen Borna und Kesselshain rückten die Tagebaue und Abraumfelder von Lobstädt und Großzössen immer dichter an die Straße, Espenhain Werk, sagte ich, als der Bus wieder hielt. Ihr Kopf ruckte zur Seite, lange guckte sie nach draußen, auf das Tor und die braunroten Klinkergebäude hinter der Mauer, hier war der Unfall, hier hat er gearbeitet, sagte sie leise. Dann beugte sie sich nach vorn und übergab sich.