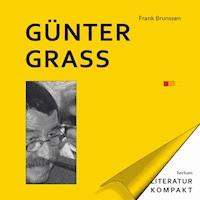
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literatur kompakt
- Sprache: Deutsch
Frank Brunnsen legt mit diesem Literatur kompakt-Band eine konzentrierte Darstellung zu Grass' literarischem und publizistischem Werk vor. Er ordnet seine Schriften biografisch, literarhistorisch und politisch-sozial ein und arbeitet in Interpretationen wichtiger Werke zentrale Themen von Grass heraus. Dazu gehören die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, dem Aufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR und dem Demokratischen Sozialismus, aber auch die mögliche Selbstvernichtung der Menschheit infolge von Umweltzerstörung und Rüstungswahnsinn, die Fragwürdigkeit der deutschen Einheit und die Problematik von Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor diesem Hintergrund erörtert Brunssen Grass' Rolle als "Gewissen der Nation" sowie seine Bedeutung als international wahrgenommener Intellektueller, dessen kritische Wortmeldungen wiederholt öffentliche Debatten ausgelöst haben. Einen besonderen Schwerpunkt legt der Band auf Grass' Selbstverständnis als Aufklärer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
LITERATURKOMPAKT
Herausgegeben von Gunter E. Grimm
Frank Brunssen
GÜNTERGRASS
Dr. Frank Brunssen, Jahrgang 1957, Studium in Konstanz und Berlin. Promotion über Das Absurde in Günter Grass’ Literatur der achtziger Jahre. Seit 1991 Dozent für German Studies an der Universität Liverpool in Großbritannien. Veröffentlichungen zur deutschen Zeitgeschichte und Literatur, unter anderem Das neue Selbstverständnis der Berliner Republik (2005) und Changing the Nation: Günter Grass in International Perspective (2008).
Frank Brunssen
Günter Grass.
© Tectum Verlag Marburg, 2014
ISBN 978-3-8288-5715-5
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3291-6 im Tectum Verlag erschienen.)
Bildnachweis Cover: Günter Grass, Fotografie von Wikimedia-User »Florian K«, 2004, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grass.JPG(GNU-FDL, CC-by-SA 3.0)
Reihenkonzept und Herausgeberschaft: Gunter E. Grimm
Projektleitung Verlag: Christina Sieg
Layout: Sabine Manke
Lektorat: Volker Manz
Besuchen Sie uns im Internetwww.tectum-verlag.dewww.facebook.com/tectum.verlag
Bibliografische Informationen der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
INHALT
I. »Ich komme von der europäischen Aufklärung her«
II. Zeittafel
Grafik: Grass kompakt
III. Leben und Werk
Grafik: Wichtige Punkte
IV. Voraussetzungen, Grundlagen, Werkaspekte
1. Das Gewissen der Nation
2. Der internationale Intellektuelle
V. Fiktionale Prosa
1. Die Blechtrommel
2. Katz und Maus
3. Die Rättin
4. Ein weites Feld
5. Im Krebsgang
VI. Autobiografische Prosa
1. Aus dem Tagebuch einer Schnecke
2. Mein Jahrhundert
3. Beim Häuten der Zwiebel
VII. Gedichte
1. Die Vorzüge der Windhühner
2. Novemberland
VIII. Theaterspiele
1. Hochwasser
2. Die Plebejer proben den Aufstand
IX. Wirkung
X. Literatur
Glossar
Abbildungsverzeichnis
Register
Günter Grass: Willy Brandt am Mahnmal des Warschauer Ghettos, Aquarell zum Jahr 1970 in Mein Jahrhundert (Ausschnitt), 1999
IMPULS
I. »Ich komme von der europäischen Aufklärung her«
Am 4. April 2012 veröffentlichten renommierte europäische Tageszeitungen ein Gedicht von Günter Grass, in dem Deutschlands bekanntester zeitgenössischer Autor schrieb, es sei an der Zeit, das öffentliche Schweigen über die »Atommacht Israel« zu brechen. Das Land gefährde den »ohnehin brüchigen Weltfrieden«, weil es einen nuklearen »Erstschlag« gegen den Iran in Erwägung ziehe. Deutschland treffe dabei eine »Mitschuld«, da es U-Boote an Israel liefere, die als Abschussrampen für Raketen verwendet werden könnten. Sowohl die israelische Nuklearpolitik als auch die iranischen Atomanlagen müssten unter internationale »Kontrolle« gestellt werden (Grass 2012, S. 88f.).
Das Gedicht Was gesagt werden muss löste eine heftige öffentliche Debatte aus, die sich alsbald zu einem internationalen Politikum auswuchs. Eine Minderheit meinte, Grass habe »etwas Vernünftiges« (Grosser 2012) gesagt, mit seinem Gedicht liege er »richtig« (Augstein 2012). Die Mehrheit hingegen sprach von einem »Pamphlet« (Grünbein 2012), einer inakzeptablen »Verkehrung von Opfern zu Tätern« (Goldhagen 2012), einem »moralischen und politischen Skandal« (Naumann 2012).
Collage der Grass-Kritik 2006–2012
Die Provokation, die von Grass’ Israel-Gedicht ausging, stellt alles andere als ein isoliertes Phänomen dar. Der Schriftsteller hat von Beginn seiner Karriere an mit literarischen und publizistischen Veröffentlichungen Anstoß erregt. Als 1959 sein Debütroman Die Blechtrommel erschien, wurde er wegen der Schilderung sexueller Szenen und der Profanierung christlicher Symbole der »Pornographie« und »Blasphemie« (zit. nach Görtz 1984a, S. 98f.) bezichtigt. Der Bremer Senat verweigerte die Verleihung des städtischen Literaturpreises an Grass, christliche Fanatiker verbrannten seinen Roman Mitte der sechziger Jahre am Düsseldorfer Rheinufer. Er sei ein »Vaterlandsverräter« (GA 12, 234), hieß es, als Grass seinen Landsleuten 1990 wegen des Völkermords an den europäischen Juden das Recht auf den nationalen Einheitsstaat absprach. Später warf ihm ein Bundesinnenminister »Antiamerikanismus« (zit. nach Anon. 2001) vor, weil er nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 die Legitimität der amerikanischen Vergeltungsabsichten angezweifelt hatte. Und als er 2012 mit lyrischen Mitteln die israelische Atompolitik kritisierte, bezichtigte man ihn des »Antisemitismus« (Joffe 2012). Er stimme Grass »ausdrücklich nicht zu« (zit. nach Bannas 2012), ließ der Bundespräsident verlauten. Der israelische Premierminister sah in Grass’ Gedicht eine »Verleumdung des jüdischen Staates« (zit. nach Wergin 2012), sein Innenminister erklärte Grass zur Persona non grata und forderte, ihm den Nobelpreis für Literatur abzuerkennen.
Dass Grass immer wieder provozierende Nadelstiche gesetzt hat, die neben Literaturkritikern auch Minister und selbst Präsidenten auf den Plan gerufen haben, gründet in seinem Selbstverständnis als Schriftsteller und engagierter Intellektueller. Grass begreift seine Literatur und seine Rolle als öffentliche Figur in der großen europäischen Tradition der Aufklärung. Angefangen von der Blechtrommel bis hin zu jenem Israel-Gedicht – stets ist es ihm vor allem anderen darum gegangen, »Tatsachen ans Licht zu fördern, Mystifizierungen zu zerstören« (WA X, 182). In den bis heute vorliegenden neunzehn Prosabänden, elf Theaterspielen, elf Lyrik-Bänden und in Hunderten von Reden, Essays und Gesprächen schildert Grass Geschichten, die vergessen oder verdrängt wurden. Dabei stellt er Fragen, die oft als zu provokativ, zu radikal, zu unerfreulich gelten, und bringt zur Sprache, was aus seiner Sicht gesagt werden muss. »Ich komme von der europäischen Aufklärung her« (WA X, 347), ist er im Lauf der Jahre nicht müde geworden zu betonen. Es war nicht zuletzt diese traditionsbewusste und mutige Position, die der Schwedischen Akademie 1999 Anlass gab, den Nobelpreis für Literatur an den »Spätaufklärer« (Engdahl 1999b) Günter Grass zu verleihen, wie es in der offiziellen Begründung heißt.
Der Gegenstand, mit dem sich der Aufklärer Grass seit nahezu sechs Jahrzehnten auseinandersetzt, ist die Geschichte seines Zeitalters: die vorwiegend konflikthaften Ereignisse und Entwicklungen des 20. Jahrhunderts, insbesondere die Zeit des Nationalsozialismus und dessen bis in die Gegenwart reichender Schatten. Der Autor weiß das selbst biografisch zu erklären: Wer, wie Grass, das Ende des Zweiten Weltkriegs als siebzehnjähriger Soldat der Waffen-SS »nur zufällig überlebt« habe, »dem ist der Erzählfaden vorgesponnen, der ist nicht frei in der Wahl seines Stoffes, dem sehen beim Schreiben zu viele Tote zu« (GA 12, 454). Das gilt vor allem für die Danziger Trilogie – die frühen Romane Die Blechtrommel (1959) und Hundejahre (1963) sowie die Novelle Katz und Maus (1961) –, die seinen Ruhm als einer der großen Schriftsteller unserer Zeit begründet haben. In diesen drei Prosawerken, so Grass,
[…] war ich bemüht, die Wirklichkeit einer ganzen Epoche, mit ihren Widersprüchen und Absurditäten in ihrer kleinbürgerlichen Enge und mit ihrem überdimensionalen Verbrechen, in literarischer Form darzustellen (GA 11, 363).
Entscheidend für die Verwirklichung dieses Projekts war, dass Grass – zunächst mit literarischen Mitteln und dann auch als Figur des öffentlichen Lebens – das große Schweigen brach, das nach der nationalsozialistischen Katastrophe in Deutschland herrschte. Dass er selbst schuldig wurde, weil er als Jugendlicher unterm Hakenkreuz keine kritischen Fragen stellte, gehört zu den eigentlichen Lehren, die er aus seiner Sozialisation im Dritten Reich gezogen hat. Denn nicht nur die Täter, auch diejenigen, die den Mund halten, wo sie das Unerhörte beim Namen nennen müssten, machen sich schuldig. Seit Grass als Schriftsteller und politisch engagierter Zeitgenosse in Erscheinung getreten ist, sind ihm Schweigen und Schuld zwei Seiten ein und derselben Medaille: »Wer schweigt, wird schuldig« (GA 11, 42), lautet das Fazit einer seiner ersten öffentlichen Interventionen im Jahr 1961. Das »Thema Schuld« ist deshalb sein »Thema des 20. Jahrhunderts. Jedenfalls hat mich das mein Leben lang begleitet. Und es wird auch so bleiben« (zit. nach Frenz/Matthiesen 2007, 00:06:22).
Die Geschichte des Zeitalters, an der Grass sich abarbeitet, stellt sich für ihn »zuallererst einmal« als »ein absurder Vorgang« (WA X, 100) dar. Das heißt, die Vernunftwidrigkeit sowohl der schuldhaften deutschen Vergangenheit als auch vieler gegenwärtiger Zeitläufte zeichnet ein absurdes Geschichtsbild, das »sich in meiner Arbeit weiter bestätigt hat. Wohl auch in meiner Einsicht, wie ich als Zeitgenosse Gegenwart erfahre« (WA X, 368). Grass begreift sich so als Aufklärer wider die Absurdität seiner Zeit.
Die Position, die es ihm erlaubt, in einer vernunftwidrigen Welt die Rolle des aufklärerischen Künstlers und Intellektuellen zu spielen, fand er bereits nach dem Krieg in Albert Camus’ Neudeutung des Mythos von Sisyphos, jenem berühmten existenzialistischen Versuch über das Absurde aus dem Jahr 1942. Grass erkannte sich Anfang der fünfziger Jahre wieder in der Figur des Sisyphos. Der griechischen Mythologie zufolge ist dieser von den Göttern dazu verurteilt, in einem unaufhörlichen und vergeblichen Kreislauf einen Stein bergauf zu wälzen, von dessen Gipfel der Fels nach jedem Versuch wieder zu Tal rollt. Sisyphos, wie Camus ihn interpretiert und auch Grass ihn begreift, ist der Held wider das Absurde. Er nimmt sein Schicksal an, indem er in einer fragwürdigen Welt unablässig den Stein wälzt und seiner Existenz auf diese Weise Sinn verleiht. Als Grass 1999 der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde, stimmte er in seiner Dankesrede eine selbstironische Hymne auf den mythischen Steinewälzer an:
Franz von Stuck: Sisyphus, 1920
In meiner Gottlosigkeit bleibt mir einzig übrig, das Knie vor jenem Heiligen zu beugen, der bislang immer hilfreich gewesen ist und die schwersten Brocken ins Rollen gebracht hat. Also flehe ich: Heiliger, von Camus’ Gnaden nobelierter Sisyphos, bitte, sorge dafür, dass der Stein oben nicht liegen bleibt, dass wir ihn weiterhin wälzen dürfen, auf dass wir wie du glücklich mit unserem Stein sein können und die erzählte Geschichte von der Mühsal unserer Existenz kein Ende findet (GA 12, 571).
Wie bei allen Aufklärern existiert auch bei Grass eine Schattenseite der Vernunft. Als er 2006 in seiner Autobiografie Beim Häuten der Zwiebel erstmals öffentlich über seine frühere Zugehörigkeit zur Waffen-SS berichtete, wurde offenkundig, dass ausgerechnet Grass, der andere Personen des öffentlichen Lebens wegen deren nationalsozialistisch belasteter Vergangenheit scharf kritisiert hatte, seine eigene Verstrickung in jene Eliteeinheit des Dritten Reichs jahrzehntelang verschwiegen hatte. Zudem haben gerade Kritiker in Deutschland immer wieder Anstoß genommen an seinem besserwisserischen Hang, den »moralischen Scharfrichter der Nation« (Kurbjuweit/Bönisch/Festenberg u. a. 2006, S. 47) oder »Oberlehrer der Nation« (Jürgs 2002, S. 228) hervorzukehren. Mit Blick auf sein Israel-Gedicht hat ihm der Lyriker Durs Grünbein »grobschlächtigen Moralismus« vorgeworfen: »Er ist ein Prediger mit dem Holzhammer« (Grünbein 2012). Den Fragwürdigkeiten der Vernunft widmete Grass schon in den achtziger Jahren, damals als Präsident der Berliner Akademie der Künste, eine ganze Veranstaltungsreihe unter dem Titel Vom Elend der Aufklärung. Eine Patentlösung kam dabei erwartungsgemäß nicht zum Vorschein – auch wenn Grass betonte, dass er sich um eine Form der Aufklärung bemühe, die jenseits der »pädagogischen Penetranz« und der »Tugendgebote« (GA 12, 122) angesiedelt ist.
Seit nunmehr über einem halben Jahrhundert hat Grass sich als Schriftsteller und Intellektueller auf das »Abenteuer der Aufklärung« (Zimmermann 2000) eingelassen. Deshalb ist auch weiterhin davon auszugehen, dass er zu gegebenem Anlass Unerhörtes zur Sprache bringen wird. Wahrscheinlich radikaler und provozierender als je zuvor – denn Grass hat sich im fortgeschrittenen Alter jene Empfehlung von Jacob Grimm zu eigen gemacht, der allen, die den größten Teil ihres Lebens bereits hinter sich haben, einst nahelegte:
je näher wir dem rande des grabes treten, desto ferner weichen von uns sollten scheu und bedenken, die wir früher hatten, die erkannte wahrheit, da wo es an uns kommt, auch kühn zu bekennen (zit. nach Grass 2010, S. 260).
II. Zeittafel
Postkartenansicht von Frauengasse und Marienkirche in Danzig, um 1900
1927
Günter Grass wird am 16. Oktober als Sohn von Helene und Wilhelm Grass in Danzig geboren. Seine Eltern betreiben ein Lebensmittelgeschäft im Vorort Langfuhr.
1930
Geburt der Schwester Waltraut
1933
Einschulung
1937
Gymnasium, Mitglied des Jungvolks und der Hitlerjugend (bis 1943)
1943
Luftwaffenhelfer (bis 1944)
1944
Reichsarbeitsdienst
Im September Einberufung zur Waffen-SS
1945
Im April Fronteinsatz und Verwundung südlich von Cottbus
Militärlazarett in Marienbad, wo Grass die Kapitulation erlebt
Amerikanische Kriegsgefangenschaft in Grafenwöhr nordöstlich von Nürnberg; ab Mitte Mai in Bad Aibling südlich von München
Führung durch das Konzentrationslager Dachau
1946
Im Januar Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft
Arbeit als Koppeljunge im Kali-Bergwerk in Giesen nördlich von Hildesheim
1947
Praktikum als Steinmetz und Steinbildhauer in Düsseldorf (bis 1948)
1948
Studium der Bildhauerei bei Josef Mages an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf (bis 1950)
1951
Grafikstudium bei Otto Pankok an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf (bis 1952)
Erste Reise nach Italien
1952
Erste Reise nach Frankreich
Erste Begegnung mit der Schweizer Ballettstudentin Anna Schwarz
1953
Übersiedlung nach Berlin
Bildhauerstudium bei Karl Hartung an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin
Augenzeuge des ostdeutschen Aufstandes vom 17. Juni
Zweite Italienreise
1954
Tod der Mutter
Reise nach Spanien
Heirat mit Anna Schwarz
1955
Erste Lesung von Gedichten vor der Gruppe 47
Dritter Preis beim Lyrikwettbewerb des Süddeutschen Rundfunks für das Gedicht Lilien aus Schlaf
Erste Veröffentlichungen: Lilien aus Schlaf und Meine grüne Wiese in der Zeitschrift Akzente
Erste Ausstellung von Zeichnungen und Plastiken in Stuttgart
1956
Erste Buchveröffentlichung, Die Vorzüge der Windhühner (Lyrik und Zeichnungen), im Luchterhand Verlag
Umzug von Berlin nach Paris
Begegnung mit Paul Celan
1957
Uraufführung von Hochwasser
Geburt der Zwillinge Franz und Raoul
1958
Preis der Gruppe 47 für eine Lesung aus dem Blechtrommel-Manuskript
Uraufführung von Onkel, Onkel
Erste Reise nach Polen nach dem Krieg; Reiseziele sind Danzig und Warschau
1959
Die Blechtrommel. Roman
Uraufführung von Noch zehn Minuten bis Buffalo, Beritten hin und zurück und Stoffreste; Sendung der Hörspielfassung von Zweiunddreißig Zähne
Veto des Bremer Senats gegen die Verleihung des Bremer Literaturpreises an Grass
Reise nach Polen
1960
Gleisdreieck (Gedichte und Zeichnungen)
Umzug von Paris nach Berlin
Reise nach Polen
1961
Katz und Maus. Eine Novelle
Uraufführung von Die bösen Köche
Erste Begegnung mit Willy Brandt
Beginn des politischen Engagements für die SPD
Geburt der Tochter Laura
1962
Prix du Meilleur livre étranger in Frankreich für Die Blechtrommel
Anzeige von Kurt Ziesel gegen Grass wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften (Katz und Maus)
1963
Hundejahre. Roman
Uraufführung von Mystisch – barbarisch – gelangweilt
Erste Spiegel-Titelgeschichte über Grass als Bestsellerautor
1964
Uraufführung von Goldmäulchen
Erste Reise in die Vereinigten Staaten
1965
POUM oder Die Vergangenheit fliegt mit (Theaterspiel)
Georg-Büchner-Preis
Gründung des Sozialdemokratischen Wahlkontors
Forts. 1965
Bundestagswahlkampf für die SPD
Reise in die Vereinigten Staaten
Geburt des Sohnes Bruno
1966
Uraufführung von Die Plebejer proben den Aufstand
Reisen in die Vereinigten Staaten, nach Mexiko, in die Tschechoslowakei und nach Ungarn
1967
Ausgefragt (Gedichte und Zeichnungen)
Premiere der Verfilmung von Katz und Maus
Erste Reise nach Israel
1968
Über das Selbstverständliche. Reden, Aufsätze, Offene Briefe, Kommentare
Briefe über die Grenze. Versuch eines Ost-West-Dialogs (mit Pavel Kohout)
Fontane-Preis
1969
örtlich betäubt. Roman
Uraufführung von Davor
Gründung der Sozialdemokratischen Wählerinitiative
Bundestagswahlkampf für die SPD
Spiegel-Titelgeschichte über Günter Grass als Wahlkämpfer
Reisen nach Rumänien, Jugoslawien, Ungarn und in die Tschechoslowakei
1970
Reise nach Polen mit Willy Brandt und Siegfried Lenz anlässlich der Unterzeichnung des Warschauer Vertrages
Titelgeschichte über Grass im amerikanischen Time Magazine
Reise in die Sowjetunion
1971
Reisen nach Tansania und Israel
1972
Aus dem Tagebuch einer Schnecke (Prosa)
Bundestagswahlkampf für die SPD
Reise nach Polen
Umzug mit Veronika Schröter nach Wewelsfleth, Schleswig-Holstein
Trennung von Anna Grass
1973
Mariazuehren (Gedichte und Grafiken mit Fotos von Maria Rama)
Reisen nach Israel und in die Vereinigten Staaten
1974
Liebe geprüft (Radierungen)
Der Bürger und seine Stimme. Reden. Aufsätze. Kommentare
Deutsch-deutsche Autorentreffen in Ostberlin (bis 1978)
Austritt aus der katholischen Kirche aus Protest gegen deren Ablehnung einer Reform des Abtreibungsparagrafen (§ 218)
Geburt der Tochter Helene (von Veronika Schröter)
1975
Erste Indienreise
1976
Mit Sophie in die Pilze gegangen (Gedichte und Lithografien)
Mitherausgeber von L’76. Demokratie und Sozialismus. Zeitschrift für Literatur und Politik (mit Carola Stern und Heinrich Böll)
Ehrendoktorwürde der Harvard University
Reise nach Frankreich
Erste Begegnung mit Ute Grunert
Trennung von Veronika Schröter
1977
Der Butt. Roman
1978
Denkzettel. Politische Reden und Aufsätze 1965–1977
Gründung der Alfred-Döblin-Stiftung
Reisen nach Japan, Indonesien, Thailand, Hongkong, Indien, Kenia
Scheidung von Anna Grass
Geburt der Tochter Nele (von Ingrid Krüger)
1979
Das Treffen in Telgte. Eine Erzählung
Premiere der Verfilmung der Blechtrommel
Spiegel-Titelgeschichte über die Verfilmung der Blechtrommel
Reisen nach Alaska, China, Singapur, Indonesien, die Philippinen, Ägypten
Heirat mit Ute Grunert
Tod des Vaters
1980
Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus (Prosa)
Forts. 1980
Oscar für Die Blechtrommel als bester fremdsprachiger Film
1981
Reise nach Polen
1982
Zeichnungen und Texte 1954–1977. Zeichnen und Schreiben I
Eintritt in die SPD als Zeichen der Solidarität nach dem Scheitern der sozialliberalen Koalition
Antonio-Feltrinelli-Preis für erzählende Prosa, der als der wichtigste italienische Kulturpreis gilt
Reisen nach Nicaragua und Italien
1983
Ach Butt, dein Märchen geht böse aus. Gedichte und Radierungen
Präsident der Berliner Akademie der Künste (1983–86)
1984
Widerstand lernen. Politische Gegenreden 1980–1983
Radierungen und Texte 1972–1982. Zeichnen und Schreiben II
1985
Schenkung des Hauses in Wewelsfleth an die Stadt Berlin als Arbeitsstätte für Alfred-Döblin-Preis-Stipendiaten
1986
Die Rättin (Roman)
In Kupfer, auf Stein. Radierungen und Lithographien 1972–1986
Umzug nach Behlendorf, Schleswig-Holstein
Halbjähriger Aufenthalt in Kalkutta
1987
Es war einmal ein Land. Lyrik und Perkussion (mit Günter Sommer)
Lesereisen in die DDR (bis 1989)
Kommentierte Werkausgabe in zehn Bänden
1988
Zunge zeigen (Prosa und Schlussgedicht mit Zeichnungen)
Reise in die Sowjetunion
1989
Wenn wir von Europa sprechen. Ein Dialog mit Françoise Giroux
Zum Beispiel Calcutta (Rede vor dem Club of Rome)
Austritt aus der Berliner Akademie der Künste aus Protest gegen die mangelnde Solidarität der Akademie für Salman Rushdie
1990
Schreiben nach Auschwitz (Frankfurter Poetik-Vorlesung)
Totes Holz. Ein Nachruf (Kohlezeichnungen und Texte)
1991
Vier Jahrzehnte. Ein Werkstattbericht
Gegen die verstreichende Zeit. Reden, Aufsätze und Gespräche 1989–1991
1992
Unkenrufe. Eine Erzählung
Austritt aus der SPD aus Protest gegen deren Zustimmung zur Einschränkung des Grundrechts auf Asyl
Gründung der Daniel-Chodowiecki-Stiftung
1993
Novemberland. 13 Sonette
Wechsel vom Luchterhand Verlag zum Steidl Verlag
Ehrendoktorwürde der Universität Gdańsk
Ehrenbürgerschaft der Stadt Gdańsk
1994
Angestiftet, Partei zu ergreifen. Politische Stellungnahmen
1995
Ein weites Feld. Roman
Gestern vor 50 Jahren. Ein deutsch-japanischer Briefwechsel (mit Kenzaburô Ôe)
Spiegel-Titelgeschichte anlässlich der Veröffentlichung von Ein weites Feld
1996
Der Schriftsteller als Zeitgenosse. Essays, Gedichte, Interviews
Sonning-Preis der Universität Kopenhagen, der als bedeutendster dänischer Preis für kulturelle Leistungen gilt
Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck
Verlegung des Sekretariats von Berlin nach Lübeck
1997
Fundsachen für Nichtleser (Aquarelle und Gedichte)
Ohne die Feder zu wechseln. Zeichnungen, Druckgraphiken, Aquarelle, Skulpturen
Gründung des Willy-Brandt-Kreises (mit Egon Bahr, Peter Brandt, Günter Gaus, Oskar Negt, Jens Reich, Friedrich Schorlemmer, Christa Wolf)
Gründung der Stiftung zugunsten des Romavolkes
Ausstrahlung des ARD-Fernsehfilms Die Rättin
1998
Wiedereintritt in die Berliner Akademie der Künste
1999
Mein Jahrhundert (Kurzgeschichten und Aquarelle)
Nobelpreis für Literatur
Prinz-von-Asturien-Preis für Literatur, der als eine Art Nobelpreis der spanischsprachigen Welt gilt
2000
Ohne Stimme. Reden zugunsten des Volkes der Roma und Sinti
Vom Abenteuer der Aufklärung. Werkstattgespräche (mit Harro Zimmermann)
Gründung der Wolfgang-Koeppen-Stiftung (mit Peter Rühmkorf)
2001
Die Zukunft der Erinnerung (mit Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Tomas Venclova)
Einrichtung des Medienarchivs Günter Grass – Stiftung Bremen
2002
Im Krebsgang. Eine Novelle
In einem reichen Land. Zeugnisse alltäglichen Leidens an der Gesellschaft (hg. mit Daniela Dahn und Johano Strasser)
Gebrannte Erde (Skulpturen)
Erste Reise in den Jemen
Eröffnung des Lübecker Günter-Grass-Hauses. Forum für Literatur und Bildende Kunst
Spiegel-Titelgeschichte anlässlich der Veröffentlichung von Im Krebsgang
2003
Letzte Tänze (Gedichte und Zeichnungen)
Günter Grass/Helen Wolff. Briefe 1959–1994
2004
Fünf Jahrzehnte. Ein Werkstattbericht
Lyrische Beute (Gedichte und Zeichnungen)
Der Schatten. Hans Christian Andersens Märchen – gesehen von Günter Grass
Reise in den Jemen
Gründung der Günter-Grass-Gesellschaft in Danzig
2005
Premiere des Spielfilms Unkenrufe – Zeit der Versöhnung
Erstes Lübecker Literaturtreffen
Reise nach Indien
2006
Beim Häuten der Zwiebel (Prosa)
Spiegel-Titelgeschichte über Grass’ Zugehörigkeit zur Waffen-SS
2007
Dummer August (Gedichte und Zeichnungen)
Steine wälzen. Essays und Reden 1997–2007
Göttinger Ausgabe in zwölf Bänden
2008
Die Box. Dunkelkammergeschichten
2009
Unterwegs von Deutschland nach Deutschland. Tagebuch 1990
Eröffnung der Günter-Grass-Galerie in Gdańsk
2010
Grimms Wörter. Eine Liebeserklärung (Prosa)
Gründung der August-Bebel-Stiftung
2012
Eintagsfliegen. Gelegentliche Gedichte
2013
Willy Brandt und Günter Grass. Der Briefwechsel
Günter Grass: Aquarell zum Gedicht »Mitten im Leben« in Fundsachen für Nichtleser, 1997
III. Leben und Werk
Geburtsanzeige, Danziger Neueste Nachrichten, 17.10.1927
Günter Grass kam am 16. Oktober 1927 in der Staatlichen Frauenklinik zu Danzig auf die Welt. Seine Mutter Helene Grass, geborene Knoff, stammte aus einer katholischen Familie und war ausgebildete Einzelhandelsverkäuferin. Sein Vater Wilhelm Grass, evangelischer Herkunft, war gelernter Bürokaufmann.
Im Jahr nach der Geburt des Sohnes zog die Familie in den Labesweg 13 im Danziger Vorort Langfuhr, wo die Eltern einen der Wohnung angegliederten Kolonialwarenladen betrieben. Die wirtschaftlichen Verhältnisse waren bescheiden, das Milieu kleinbürgerlich. Die Zweizimmerwohnung bot wenig Platz, es gab kein Bad, die Etagentoilette teilte man mit anderen Mietparteien. Da Grass und seine drei Jahre jüngere Schwester Waltraut keine Rückzugsmöglichkeit hatten, richtete er sich als Jugendlicher einen »Lieblingsleseplatz« (GA 10, 251) auf dem Dachboden des Mietshauses ein.
Wohnstätte der Familie Grass in Danzig bis Kriegsende, 2010
Günter Grass mit seiner Mutter Helene und Schwester Waltraut, um 1931
Grass’ Mutter gehörte als Kaschubin jener westslawischen Minderheit mit eigener Sprache und Tradition an, die im Hinterland von Danzig, in der Kaschubei, ansässig ist. Sie verstand sich weder als Polin noch als Deutsche, sondern legte Wert auf ihre kaschubische Herkunft. Ihren Sohn nannte sie ihren »kleinen Peer Gynt« (GA 10, 254) – nach jener Hauptfigur aus Henrik Ibsens gleichnamigem Stück, die gern Lügengeschichten auftischt. Helene Grass »liebte das Schöne, lauschte dem Volksempfängerradio Opern- und Operettenmelodien ab, hörte gerne meine vielversprechenden Geschichten, ging oft ins Stadttheater und nahm mich manchmal mit« (GA 12, 561). Eine »kunstsinnige Frau« (WA X, 437), die abends Klavier spielte und Mitglied in einem Bücherclub war. Die Ambitionen ihres Sohnes, der als 12-Jähriger verkündete, er wolle einmal Künstler werden, unterstützte sie bedingungslos. Als seine Mutter 1954 mit 57 Jahren an Krebs starb, war Grass 26. Jahrzehnte später widmete er ihr in Beim Häuten der Zwiebel (2006) einen Nachruf, der sich wie eine große Liebeserklärung liest (vgl. GA 10, 603–605). Im Alter von über 80 Jahren befragt, was das größte Unglück in seinem Leben gewesen sei, bekannte er:
Der Tod meiner Mutter. […] Ich weine immer noch. […] Ich kann nicht verwinden, dass es mir nicht mehr gelungen ist, ihr zu beweisen, dass sich die Hoffnungen, die sie in mich gesetzt hatte, bestätigten. […] Ich habe an die Stelle von Gott meine Mutter gesetzt. […] Auf meinem Grabstein wird stehen: ‚Hier liegt Günter Grass mit seinem Mutterkomplex, unbehandelt‘ (zit. nach Müller 2009).
Mit dem Vater verband den jugendlichen Grass »Dauerstreit« (GA 10, 508). Dem Wunschtraum seines Sohnes, einmal Künstler zu werden, begegnete Wilhelm Grass mit Verständnislosigkeit. Mit 15 Jahren, erinnert sich der Schriftsteller später, »wollte ich in Gedanken, Worten und Werken meinen Vater mit meinem Hitlerjugenddolch ermorden« (GA 5, 358). Er beschreibt seinen Vater als typischen Mitläufer des Dritten Reichs, der 1936 begeistert in die Partei eintrat. Jahre nach Kriegsende, als Grass sich mit seinen Büchern einen Namen gemacht hatte, wählte der Vater dem Sohn zuliebe SPD und behauptete, schon immer an ihn geglaubt zu haben. Zwar wich Grass’ jugendlicher »Hass auf den Vater« (GA 10, 274) mit der Zeit einem friedlichen Umgang, aber das Verhältnis blieb bis 1979, als Wilhelm Grass im Alter von 80 Jahren starb, distanziert.
Grass entstammt einer konfessionellen »Mischehe, wie man im Kirchengebrauch sagt. Wobei sich natürlich jeweils der stärkere Teil – und das ist der katholische Teil – durchzusetzen pflegte.« Er wurde in der Herz-Jesu-Kirche in Langfuhr getauft und war dort während seiner Jugend Messdiener. Den Katholizismus, von dessen sinnlichen Seiten Grass sich angezogen fühlte, empfand er keinesfalls als Last, zumal seine Mutter ihn auf »lässige Art und Weise« (WA X, 295) vorlebte. Mit dem Ende der Kindheit kam ihm allerdings der Glaube abhanden, »so dass dann ab dem 14. Lebensjahr an gläubiger Substanz so gut wie nichts mehr dagewesen ist« (WA X, 296).
Danzig
Jenes an der Ostsee gelegene Danzig, in dem Grass Kindheit und Jugend verbrachte, hatte seit dem Ersten Weltkrieg einen politischen Sonderstatus. Dem Versailler Vertrag zufolge bildete Danzig aufgrund seiner hervorgehobenen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage nicht länger einen Teil des Deutschen Reiches, sondern war als Freie Stadt Mitglied eines Freistaates, der ab 1920 unter der Verwaltung des Völkerbundes stand. Da die deutsche Bevölkerungsmehrheit – etwa 95 Prozent der Bürger sprachen Deutsch, rund 5 Prozent Polnisch bzw. Kaschubisch – den Sonderstatus ablehnte, gelang es den Nationalisten früh, in Grass’ Heimatstadt politisch die Oberhand zu gewinnen. Zielstrebig verfolgten die Danziger Nationalsozialisten dann ab 1933 die ‚Heimkehr ins Reich‘, die am 1. September 1939, als Deutschland zum Auftakt des Zweiten Weltkriegs Polen überfiel, vollzogen wurde.
Deutsches Reich (»Weimarer Republik«, »Drittes Reich«), 1919-1937
Als Grass später, ab Mitte der fünfziger Jahre beginnt, sich als Schriftsteller zu profilieren, entwickelt sich Danzig, genauer gesagt der Vorort Langfuhr, für ihn zum eigentlichen Zentrum seines literarischen »Universums«, das »zutiefst privat und doch von allgemeiner Gültigkeit ist« (Øhrgaard 2005, S. 13). Seine ersten beiden Romane Die Blechtrommel (1959) und Hundejahre (1963) sowie die Novelle Katz und Maus (1961) haben ihren geografischen und sozialen Mittelpunkt in Grass’ Heimatstadt und werden deshalb seit den siebziger Jahren weithin als Danziger Trilogie bezeichnet. Diese drei Prosawerke veranschaulichen, wie Grass erläutert hat,
[…] dass die Provinz der Geburtsort der Literatur ist. Dass eben dieser Vorort Langfuhr so groß oder so klein ist, dass alles, was auf der Welt geschieht, auch dort geschehen kann, von dort aus gesehen und begriffen und übers Knie gebrochen und erzählt werden kann (zit. nach Zimmermann 2000, S. 78f.)
Der »unwiederbringliche Verlust« seiner Heimatstadt am Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Deutschen aus Danzig vertrieben wurden, entwickelt sich Jahre später für Grass zur »anstiftenden Kraft« seiner Literatur:
Erzählend sollte die zerstörte, verlorene Stadt Danzig, nein, nicht zurückgewonnen, jedoch beschworen werden. Diese Schreibobsession hat mich angestachelt. Ich wollte, nicht frei von Trotz, mir und meinen Lesern ins Bild bringen, dass das Verlorene nicht spurlos im Vergessen versinken muss, vielmehr durch die Kunst der Literatur wieder Gestalt gewinnen kann (GA 12, 568f.).
1933 kommt Grass in die Grundschule, 1937 aufs Gymnasium, auf das angesehene Langfuhrer Conradinum. Seine schulische Karriere ist alles andere als gradlinig. Gute Noten erhält er lediglich in Deutsch, Geschichte und Kunst – Fächer, die ihm liegen. In der achten Klasse bleibt er sitzen. Weil er sich mit Lehrern anlegt, fliegt er während der Gymnasialzeit gleich von zwei Schulen – er sei »aufsässig und unverschämt frech« (GA 10, 248), heißt es in einem Bericht. Als Grass 1943 den Dienst als Luftwaffenhelfer antritt, ist die reguläre Schulzeit für ihn im Alter von 15 Jahren beendet. Einen Versuch, nach dem Krieg in Göttingen das Abitur nachzumachen, bricht er wieder ab.
Conradinum in Danzig, 2011
Doch Grass ist ein aufgeweckter Junge, der von früh an gern liest und sich außerhalb der Schule literarische Kenntnisse aneignet. Im Bücherschrank seiner Mutter – mit »kunterbunt gemischter Literatur« (GA 10, 247) – finden sich Werke von Dostojewski, Raabe, Schiller, Lagerlöf, Sudermann, Hamsun, Keller, Fallada, Storm, aber auch ein Band mit dem Titel Rasputin und die Frauen, der später in der Blechtrommel eine Rolle spielen wird. Grass liest Jüngers In Stahlgewittern, das den Krieg verherrlicht, und entdeckt in den Beständen eines Onkels Remarques Anti-Kriegsroman Im Westen nichts Neues, der im Dritten Reich auf dem Index stand. Auf dem Gymnasium macht ihn ein Lehrer mit Grimmelshausens Simplicissimus vertraut. Nie wieder, erinnert er sich später, »werde ich so lesen können, wie ich als Vierzehnjähriger gelesen habe: so absolut« (GA 5, 358). Jahre nach dem Krieg erhält er Zugang zu einem weiteren Familienbücherschrank im Haus seiner Schwiegereltern, wo er Werke kennenlernt, die seine künstlerische und intellektuelle Orientierung nachhaltig beeinflussen: James Joyce, Dos Passos’ Manhattan Transfer, Miłosz’ Verführtes Denken und Döblins Berlin Alexanderplatz. Von früh an sind Bücher für Grass »die fehlende Latte im Zaun, seine Schlupflöcher in andere Welten« (GA 10, 236).
James Joyce, um 1915
Dos Passos, vor 1970
Alfred Döblin, vor 1930
Der jugendliche Grass ist aber schon früh mehr als ein interessierter Leser und zeigt sich auch auf einem anderen Gebiet als der Literatur interessiert: Er zeichnet gern und besucht Abendkurse an der Danziger Technischen Hochschule. Auch ist da eine »geliebte Lehrerin« (GA 10, 482), Lilli Kröhnert, die den Jugendlichen heimlich mit ‚entarteter Kunst‘ bekannt macht und ihm damit die Augen öffnet für die Welt der Bilder jenseits der nationalsozialistischen Kunstdoktrin. Ebenso spielt das Schreiben eine Rolle. Als die Hitlerjugend-Zeitschrift Hilf mit! 1940 einen Erzählwettbewerb ausruft, beteiligt sich der 13-Jährige mit einem im 13. Jahrhundert angesiedelten Roman. Das Werk heißt Die Kaschuben, bleibt allerdings unvollendet, weil die Protagonisten allzu früh sterben. Später dann, während der Ausbildung als Panzerschütze 1944/45, schreibt der 17-Jährige »Tagebuchähnliches in ein Diarium« (GA 10, 326), das allerdings bei Kriegsende ebenso verloren geht wie sein unvollendeter Roman.
Titelansicht der NS-Schülerzeitung Hilf mit!, 1935
Auch wenn ihm der Bücherschrank seiner Mutter und Lilli Kröhnerts Kunstbände Einsichten in Gegenwelten zum Dritten Reich gewährten, war das Wertesystem des jugendlichen Grass doch primär vom nationalsozialistischen Geist seiner Zeit geprägt. Im Rückblick bezeichnet er sich als »Mitläufer« (GA 10, 228), der mit zehn Jahren freiwillig dem Jungvolk beitrat und im Alter von elf erlebte, wie am 9. November 1938 die Langfuhrer Synagoge von der SA verwüstet wurde. Wie damals üblich, kam er mit 14 zur Hitlerjugend: »Ich war ja als Hitlerjunge ein Jungnazi. Gläubig bis zum Schluss« (GA 10, 242). Bei der Bewertung seiner Jugend unterm Hakenkreuz lässt Grass im Rückblick jene nach 1945 virulente Legende nicht gelten, wonach das deutsche Volk von einer bösen Macht in die Irre geleitet worden sei: »Nein, wir haben uns, ich habe mich verführen lassen« (GA 10, 243).
Administrative Gliederung der NSdAP im Dritten Reich, Mai 1944
Vorbilder waren dem jugendlichen Grass die Idole seiner Zeit – mit Ritterkreuzen dekorierte Vorzeigesoldaten wie Kapitänleutnant Günther Prien oder Jagdflieger Adolf Galland, die von der nationalsozialistischen Propaganda glorifiziert wurden. In der Novelle Katz und Maus beschreibt Grass 1961 die unwiderstehliche Faszination, die auf Jugendliche seines Alters von den Kriegshelden jener Tage ausging. Grass war noch 15, als auch er den »fatalen Schritt« (GA 10, 271) vollzog und sich 1943 freiwillig zur U-Bootwaffe meldete. Da er wegen eines Aufnahmestopps nicht angenommen wurde, ging er im Frühjahr 1944 zunächst für drei Monate zum Reichsarbeitsdienst. Dort erlebte er zum ersten Mal mit, was es bedeutet, in einer Diktatur Nonkonformist zu sein. Einer seiner Kameraden, ein Zeuge Jehovas, weigerte sich kategorisch, eine Waffe anzufassen, und wurde deshalb aus dem Dienst entfernt und vermutlich ins Konzentrationslager gesteckt.
Krieg und Gefangenschaft
Grass war noch keine 17, als ihn der Einberufungsbefehl zur Waffen-SS erreichte. Worum genau es sich bei diesem militärischen Verband handelte, war ihm zu jenem Zeitpunkt offenbar nicht in vollem Umfang bewusst. »Schreck oder gar Entsetzen« verursachte die Einberufung jedenfalls nicht. Eher sah er die Waffen-SS als »Eliteeinheit«, von der, wegen ihrer multinationalen Zusammensetzung, »etwas Europäisches« (GA 10, 318) ausging. Bei einer Größe von 1,72 Meter galt er als ausgewachsen, die einzige körperliche Auffälligkeit war seine »angeborene Progenie« (GA 10, 248), die vorstehende Unterlippe, die er Ende der fünfziger Jahre optisch ausglich, indem er sich einen Schnauzbart stehen ließ. Als Grass im September 1944 aus Danzig aufbricht, um sich in der Division Jörg von Frundsberg zum Panzerschützen ausbilden zu lassen, kann er nicht ahnen, dass es ein Abschied für immer ist, der eine lang anhaltende Phase der »Wanderjahre« (GA 10, 424) einleitet.
Briefmarke zur Waffen-SS, 1943
Während seines ersten Fronteinsatzes in der Lausitz, Mitte April 1945 nördlich von Weißwasser, erlebt Grass den vielfachen Tod seiner Kameraden. Im sowjetischen Kugelhagel begreift er, was Todesangst bedeutet. Seither begleitet ihn das Gefühl, nur zufällig am Leben zu sein. Am 20. April 1945 gerät er zwischen Senftenberg und Spremberg erneut in einen sowjetischen Angriff, bei dem er am rechten Oberschenkel und an der linken Schulter verwundet wird, in der bis heute ein »bohnengroßer Granatsplitter« (GA 10, 410) steckt. Er selbst, schreibt Grass später, habe keinen einzigen Schuss abgegeben. Nach einem Lazarettaufenthalt in Marienbad kommt er zunächst in amerikanische Kriegsgefangenschaft bei Grafenwöhr, nordöstlich von Nürnberg. Ende Mai 1945 wird er von dort ins Lager Bad Aibling südöstlich von München verlegt, wo er unter freiem Himmel in einem Erdloch haust. Ein halbes Jahr später geht es in das in der Britischen Zone gelegene Munsterlager in der Lüneburger Heide, von wo aus er im Januar 1946 in die Freiheit entlassen wird. Zu diesem Zeitpunkt ist Grass 18 Jahre alt.
Während der Monate in Bad Aibling wurden er und andere Lagerinsassen durch das KZ Dachau geführt und mit Aufnahmen des Holocaust konfrontiert:
Schwarzweißfotos, Bilder aus den Konzentrationslagern Bergen-Belsen, Ravensbrück … Ich sah Leichenberge, die Öfen. Ich sah Hungernde, Verhungerte, zum Skelett abgemagerte Überlebende aus einer anderen Welt, unglaublich (GA 10, 403).
Was man ihnen zeigte, taten sie als »Propaganda« ab: »Niemals haben das Deutsche getan« (GA 10, 403). Erst als der ehemalige Reichsjugendführer Baldur von Schirach 1946 im Rahmen der Nürnberger Prozesse seine Kenntnis von der ‚Endlösung‘ zugab, begann Grass die Realität des Völkermordes an sich heranzulassen:
KZ-Arzt Fritz Klein in einem Massengrab in Bergen-Belsen, April 1945
Es verging Zeit, bis ich in Schüben begriff und mir zögerlich eingestand, dass ich unwissend oder, genauer, nicht wissen wollend Anteil an einem Verbrechen hatte, das mit den Jahren nicht kleiner wurde, das nicht verjähren will, an dem ich immer noch kranke (GA 10, 404).
Die Kenntnis von den Verbrechen ändert bis in die fünfziger Jahre nichts daran, dass Grass den während des Zweiten Weltkriegs geschehenen Ungeheuerlichkeiten mit Schweigen begegnet. »Frag nicht so viel« (GA 10, 493), weist ihn seine Mutter zurecht, als er in der Nachkriegszeit einmal nachhakt und wissen will, was seiner Schwester beim Einmarsch der Russen in Danzig wirklich angetan wurde. Wie gelernt hält Grass den Mund – einstweilen zumindest: »Aber auch mir kam nichts von dem über die Lippen, was rücklings angestaut auf Lauer lag: Meine unterlassenen Fragen …« (GA 10, 494)
»Ortlosigkeit«
Nach der Entlassung aus der Gefangenschaft Anfang 1946 setzt für Grass eine lange Phase der Neuorientierung ein. Die nationalsozialistischen Ideale, die ihm in seiner Jugend eingeimpft worden waren, hatten sich als größenwahnsinnig und verbrecherisch erwiesen. Was für eine Erfahrung, hat der Schriftsteller Salman Rushdie 1985 in einem Aufsatz über seinen Freund Grass bemerkt, ist es doch festzustellen, »that one’s entire picture of the world is false, and not only false, but based upon a monstrosity« (Rushdie 1985a, 183).
In Köln schlägt Grass sich zunächst als Schwarzhändler durch und arbeitet dann auf einem Bauernhof als Hilfskraft im Kreis Bergheim/Erft. Im Frühsommer 1946, mit 18 Jahren, erlebt Grass sein ‚erstes Mal‘, als er auf einer Hamsterfahrt in den Hunsrück Inge kennenlernt, eine Kriegerwitwe, mit der er den Hunger nach körperlicher Liebe stillt. Es bleibt bei einem Abenteuer, wie auch diverse weitere Affären in den kommenden Jahren zu nichts Dauerhaftem führen – bis er 1952 seiner späteren Ehefrau Anna Schwarz begegnet.
Einstweilen findet Grass eine weitere Anstellung in einem Kali-Bergwerk bei Giesen nördlich von Hildesheim. Dort, in über 900 Metern Tiefe, liegen die Anfänge seiner sozialdemokratischen Sozialisation. Während der damals häufigen Stromausfälle hört er den politischen Wortgefechten der Kumpel unter Tage zu. Die einseitigen Positionen der mehrheitlich entweder kommunistisch oder immer noch nationalsozialistisch gesinnten Arbeiter stoßen ihn ab, überzeugender findet er das »Einerseitsandererseits« (GA 10, 435) der sozialdemokratischen Bergleute. Im Rückblick auf jene unmittelbaren Nachkriegsjahre sieht Grass sich dennoch als jungen Mann »ohne festen Standpunkt« (GA 10, 434), der sich wenig um Tagespolitik kümmerte. Ohne bestimmen zu können, wofür er eigentlich war, legte er zunächst nur eine »prinzipielle Antihaltung« (GA 12, 243) an den Tag, die er später auf den Zusammenbruch seines nationalsozialistischen Wertesystems nach 1945 zurückgeführt hat:





























