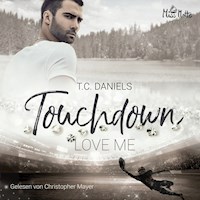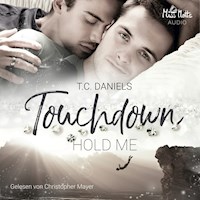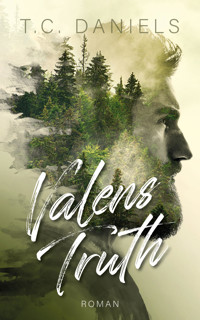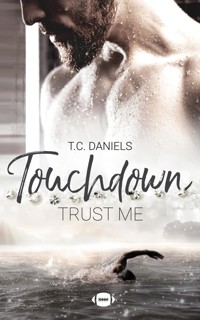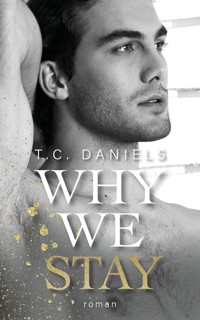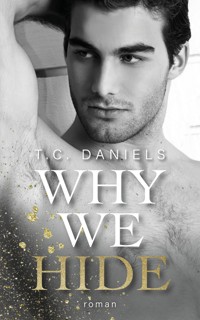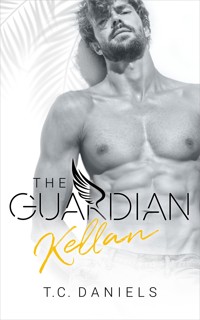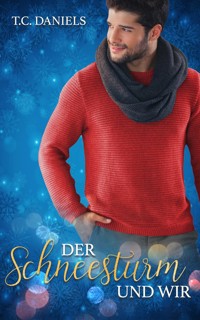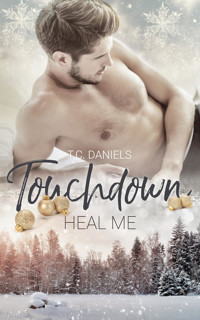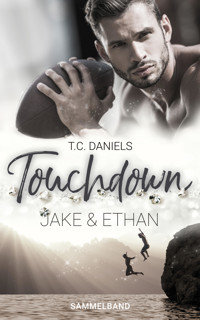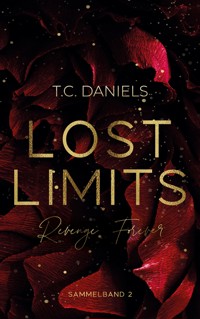
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sammelband 2 Gideon ist es nicht gelungen, Royal zu beschützen. In den Fängen erbarmungsloser Entführer kämpft dieser ums bittere Überleben, während Gideon dabei ist, alles zu verlieren, was er sich ein Leben lang aufgebaut hat. Nur die Unterstützung von Freunden und die ungebrochene Hoffnung, Royal doch noch retten zu können, lassen ihn weitermachen. Doch kann Gideon seine Vergangenheit endgültig hinter sich lassen? Wird Royal ihm jemals wieder vertrauen? Und haben Gideon und Royal eine Chance auf eine gemeinsame Zukunft, nachdem sie alles verloren haben, was jemals von Bedeutung war? In diesem Sammelband sind folgende Teile enthalten: Lost Limits - Revenge Lost Limits - Forever Es gibt keine Abweichungen im Inhalt zu den bereits erschienen Bänden. Bitte beachte, dass es sich hierbei um eine Dark Romance handelt. Zu Beginn des Buches erhältst du eine Triggerwarnung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Lost Limits
REVENGE FOREVER
SAMMELBAND 2
T.C. DANIELS
Inhalt
Triggerwarnung
Band 1
Lost Limits -Revenge
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Band 2
Lost Limits - Forever
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Epilog
Nachwort
1. Auflage
Copyright © 2023 T.C. Daniels
Covergestaltung: Katie Weber von www.kreationswunder.de
T.C. Daniels
c/o WirFinden.Es
Naß und Hellie GbR
Kirchgasse 19
65817 Eppstein
Newsletter
Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors. Personen und Handlungen sind frei erfunden, etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Menschen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Markennamen sowie Warenzeichen, die in diesem Buch verwendet werden, sind Eigentum der rechtmäßigen Besitzer.
Triggerwarnung
Lieber Leser, liebe Leserin,
die Teile 1-3 der Lost Limits - Reihe haben alle eine allgemeine Triggerwarnung enthalten. Lost Limits – Revenge könnte jedoch über die Grenzen einiger Leser hinausgehen und deshalb spreche ich eine explizite Triggerwarnung aus. Es könnte vorkommen, dass die Themen in diesem Buch triggernd auf dich wirken. Auch wenn du gewöhnlich nicht vor Büchern gewarnt werden musst, möchte ich dich darauf hinweisen, dass dieses Buch anders ist, als alles, was ich zuvor geschrieben habe. Die Schilderungen in diesem Buch könnten dich schockieren und deinen Lesegenuss schmälern, doch sie gehören zur Geschichte von Gideon und Royal und deshalb habe ich sie genau so beschrieben.
Solltest du dir im Moment also nicht sicher sein, ob du mit diesem Buch und seinen Inhalten zurechtkommst, verschiebe das Lesen auf einen späteren Zeitpunkt, denn deine Gesundheit geht vor.
Solltest du dieses Buch dennoch lesen wollen, wirst du mit folgenden Themen konfrontiert werden:
Gefangenschaft, Foltermethoden wie Waterboarding und Strom, Verstümmelung, körperliche und psychische Gewalt, körperlicher und psychischer Missbrauch.
Für Lost Limits – Forever gilt dann wieder eine allgemeine Triggerwarnung.
BandEins
Lost Limits -Revenge
Für River.
Weil sie dich nicht so sehen, wie ich es tue.
Eins
Gideon
Sie hatte blaue Haare. Die landesweit bekannte Traumaspezialistin, die die kindliche Psychologin seines Bruders Marshall ihm empfohlen hatte, hatte blaue Haare. Wenn er klug gewesen wäre, hätte Gideon nicht mal in Betracht gezogen, ihrem Rat zu vertrauen.
Sie hat viel Erfahrung mit Fällen wie Ihrem, hatte Dr. Andrews damals zu ihm gesagt, als er Marshall aus der Entzugsklinik mitgenommen hatte.
Wie viel Erfahrung konnte man denn bitte haben, wenn man bis vor zwei Tagen noch in den Kindergarten gegangen war? Wahrscheinlich hatten Dr. Warren und Dr. Andrews den gleichen besucht und dort ihr Arztdiplom erhalten. So musste es gewesen sein.
Dr. Augusta Warren ließ sich auf einem Sessel ihm gegenüber nieder. Sie trug ein ausgeleiertes, weißes T-Shirt auf dem die Rolling Stones abgebildet waren, und eine schwarze Leggins. Sie kaute auf einem Kaugummi, und schien ebenfalls eine Schwäche für Piercings zu haben. Wie ihr Partner in Crime, Dr. Andrews.
An ihrem linken Augenwinkel fanden sich zwei Glitzersteinchen. Gideon hatte nicht den blassesten Schimmer, wie sie dort hingekommen waren, und er wollte sich nicht mal vorstellen, wie es möglich war, dass sie nicht abfielen.
Hatte sie sich die Teile implantiert?
Himmel.
Ihr ganzes Auftreten war so weit weg von einer professionellen Psychotherapeutin, dass er am liebsten ganz schnell wieder abgehauen wäre. An einen Ort, an dem es Sinn machte, zu sein. In seinem Büro. Oder in Shelter Cove. Mit Royal.
Stattdessen war er hier. Bei seiner ersten psychotherapeutischen Sitzung. Auf einem Tischchen direkt neben seinem Sessel stand eine Groot-Figur, die anfing zu wackeln, wenn man sie anstupste. Er war sich noch nie so dermaßen fehl am Platz vorgekommen wie in diesem Moment.
»Sie können ihn anstoßen. Groot mag das«, sagte Dr. Warren lächelnd, die seinem Blick gefolgt war. Entgegen seiner Erwartungen hielt sie kein Klemmbrett in der Hand, auf dem sie sein gesamtes Auftreten und jedes einzelne Wort protokollieren würde. Stattdessen legte sie einen Recorder auf den Tisch zwischen ihnen. »Ich zeichne das Gespräch auf. Ist ein cooles Programm. Es überträgt mir alles Gesagte direkt in ein Computerdokument und ich muss es nur noch gegenlesen. Sehr praktisch.« Sie grinste.
Gideon nickte, und legte einen Fußknöchel über das Knie des anderen Beins. Er begann mit seinen Fingerspitzen auf dem Tischchen zu klopfen, bis er es bemerkte, dann hörte er auf, denn er wollte Dr. Warren nicht den Eindruck vermitteln, er sei nervös, obwohl er genau das war.
»Erste Frage, langweiligste Frage: Warum sind Sie hier?«
Für ihn war das überhaupt keine langweilige Frage. Der Grund seines Herkommens war so schwerwiegend, so traurig, so lebensverändernd. Wenn er die Hoffnung nicht verlieren wollte, dass Royal ihm irgendwann nochmal eine Chance gab, war sein Herkommen der einzige Weg.
»Weil ich einem Freund wehgetan habe.« Gideon räusperte sich.
»Wie heißt Ihr Freund?«
»Royal.« Gideon räusperte sich wieder. Himmel, warum war das nur so schwer? »Er heißt Royal Wright.«
»Netter Name.« Dr. Warren schmunzelte. Sie zog ihre Beine an und setzte sich in den Schneidersitz. »Können wir erst die Beziehung definieren, in der sie zu ihm stehen?«
Nein.
Er wollte überhaupt nichts definieren. Er wollte nur einmal in seinem Leben das Richtige tun, und Royal hatte ihm gesagt, dass er professionelle Hilfe brauchte, also hatte er sich professionelle Hilfe gesucht. Obwohl er sowohl die Professionalität, als auch die Hilfe in diesem Raum ernsthaft anzweifelte.
Gideon räusperte sich wieder. »Also, wir … ich bin … wir sind … Freunde?« Das letzte Wort wollte ihm kaum über die Lippen kommen. Selbst sein eigener Körper verschwor sich gegen ihn. Royal war doch so verdammt viel mehr als nur ein Freund. Er war der Mann, der alle Grenzen seines Lebens neu definiert hatte. Ihn als Freund zu bezeichnen, kam einer Beleidigung gleich. Aber vielleicht war die Definition ihrer Beziehung auch unwichtig. Royal könnte auch eine Clubbekanntschaft oder der Pizzabote sein. So oder so war Gideons Verhalten falsch und verwerflich gewesen, nur dass es eben nicht die Clubbekanntschaft getroffen hatte, sondern Royal, der so eine Behandlung am wenigsten verdiente.
»Okay. Wir müssen jetzt keine endgültige Definition formulieren. Halten wir fest, dass er eine Rolle in ihrem Leben spielt?«
»Spielte.«
»Sie sind keine Freunde mehr?«
Gideon atmete tief durch. Das Bedürfnis, den Groot anzuschubsen, wurde plötzlich übermächtig. Einfach etwas tun. Nur nicht reden. »Ich bin mir nicht sicher«, würgte er hervor.
Dr. Warren stand auf und schlenderte zu einer Karaffe mit Wasser, neben der einige elegante Kristallgläser standen. Bunte Plastikbecher mit Disney-Figuren darauf hätten besser zu ihr gepasst.
Sie schenkte zwei Gläser voll und kam zurück zu ihrer fröhlichen Teerunde. »Ich krieg hier drinnen auch immer einen trockenen Hals.« Sie reichte ihm eines der Gläser und setzte sich zurück auf den Stuhl.
»Was ist passiert?«
Gideon blinzelte. Das Gewicht in seiner Hand war angenehm kühl und schwer und erdete ihn etwas. Aber trinken würde er nicht können. Sein Hals war wie zugeschnürt.
»Ich habe ihn geschlagen.«
Er sah Dr. Warren an, wartete auf eine Erwiderung von ihrer Seite, vielleicht auch ein Urteil. Bisher hatte sie immer etwas gesagt oder gefragt, aber ausgerechnet in diesem Moment schwieg sie.
»Ich wollte es nicht«, setzte er also hinzu, um das unangenehme Schweigen zwischen ihnen zu brechen. Mit Royal war Schweigen nie so unangenehm. Nie.
»Haben Sie ihn versehentlich geschlagen?«
»Nein.«
»Dann haben Sie ihn bewusst geschlagen?« Dr. Warren legte den Kopf schief, dabei rutschten ihre langen blauen Haare zur Seite. Er entdeckte, dass auch ihre Ohren voller Ohrstecker und Piercings waren. Ein Sammelsurium metallischer Schmuckstücke, die vereinzelt glitzerten.
»Ich … ich weiß es nicht«, sagte Gideon, und fand, dass er dabei furchtbar kleinlaut klang. Als ob die Ärztin ihm die richtige Antwort nennen könnte. Innerlich verdrehte er die Augen. Im Nachhinein konnte er sich seine Reaktion nicht mehr erklären. Er wusste nur, dass er unter Schock gestanden hatte, nachdem Sterling ihn im Haus seines Vaters derart in die Enge getrieben hatte. In seinem Körper schwelte der Hass, und als Royal bei ihm gewesen war, da war es ihm vorgekommen, als könne nur er die Dämonen zum Schweigen bringen. Mit einem Blowjob oder einem Fick. Mit irgendeiner grenzüberschreitenden Scheiße, die ihn retten sollte. Doch am Ende war er zum grenzüberschreitenden Drecksack geworden.
Doch sogar in der Situation hatte Royal bewiesen, wie gut er ihn kannte. Natürlich wollte Gideon sich nicht ficken lassen. Nicht von einem Mann. Garantiert nicht. Aber allein schon, den Wunsch auszusprechen – und ihn erfüllt zu bekommen –, hätte ihm einen Teil seiner Kontrolle über sein Leben zurückgegeben. Weil dieses Mal er derjenige gewesen wäre, der danach verlangte. Das waren gute Aussichten gewesen, egal, wie er sich danach gefühlt hätte, es ging nur um diesen einen Moment.
»Was ist dann passiert? Nachdem Sie Royal attackiert haben?« Sie setzte das Wort in Anführungszeichen.
»Er hat gesagt, dass er keinen Kontakt mehr mit mir wünscht und ich Hilfe brauche.«
»Und deshalb sind Sie hergekommen?« Dr. Warren lächelte leicht.
»Ja.«
»Das ist großartig von Ihnen.«
»Da bin ich mir nicht so sicher.«
»Kann ich verstehen. Aber es sieht so aus, als würde Royal Ihnen etwas bedeuten. Sie kommen her, obwohl Sie sich sichtlich unwohl fühlen.«
Gideon schnaubte. Seinetwegen müsste sie jetzt nicht die volle Schlagkraft ihrer Beobachtungsgabe auspacken. Es würde reichen, wenn sie einfach registrieren würde, dass er sich unwohl fühlte. Es auszusprechen ließ ihn sich noch hilfloser fühlen.
»Bedeutet er Ihnen etwas?«, hakte Dr. Warren nach, weil er nichts gesagt hatte.
»Ja. Das tut er.« Ein bisschen Ehrlichkeit war okay.
»Gut. Damit können wir arbeiten. Können Sie mir sagen, wie der Angriff ausgesehen hat? Haben Sie ihn verbal angegriffen, hatten Sie einen Streit? Wurde einer von Ihnen handgreiflich?«
Gideon schluckte. Die heldenhaften Zeiten waren wohl vorbei. »Ich habe ihn geschlagen. Und ich war … nicht sehr freundlich.«
»Haben Sie so etwas schon mal getan? Einen Freund geschlagen?«
Er hatte keine Freunde.Die Frage war sinnlos.
»Nein.«
»Waren Sie wütend?«
»Ja. Sehr.«
»Auf Royal?«
»Auf mich.« Er war ein elender Sack.
»Wie hat Royal reagiert? Hat er zurückgeschlagen?«
Nein. Weil Royal so etwas nicht tun würde. Weil er der verdammt beste Mann war, dem er jemals begegnet war. »Er hat sich von mir getrennt und gesagt, dass er mich nie wieder sehen will.«
Dr. Warren lehnte sich vor. »Sie waren also ein Paar?«
Gideon spürte, wie er errötete. Gewöhnlich vermied er es, zu seinem Sexualleben Stellung zu beziehen. Er war weder geoutet, noch ein schwuler Mann. Er spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach. »Wir … nein. Wir haben uns nur eine Weile getroffen.«
»Und seit dem Streit hatten Sie keinen Kontakt mehr zu Royal?«
»Ich habe ihn am Tag darauf aufgesucht und ihn um Entschuldigung gebeten.«
»Hat es Ihnen wirklich leid getan?«
»Ja.«
»Und hat er ihre Entschuldigung angenommen?«
»Nein.«
»Was ist dann passiert?«
»Er ist nach Syrien gereist. Er arbeitet dort«, fügte Gideon hinzu. Dr. Warren lehnte sich in ihrem Sessel zurück und betrachtete Gideon. »Warum sind Sie hier?«
»Wie bitte?«
»Ich frage Sie, warum Sie hier sind. Sie haben alles richtig gemacht. Ich spreche dabei nicht von dem Streit. Ich heiße es auch nicht gut, dass Sie handgreiflich wurden. Aber Sie haben sich danach entschuldigt. Das ist mehr, als die meisten Menschen hinbekommen. Warum also sind Sie hier?«
Gideon schluckte wieder. Sein Mund war trocken und sein Hals kratzte. Das hier war noch viel schlimmer als alles andere. Andererseits hatte er sich geschworen, etwas zu verändern. Wenn er die Sache mit der Schlägerei, Aidan und seinem geheimnisvollen Partner geklärt hatte, wollte er eine ernsthafte Chance bei Royal haben. Keine Geheimnisse mehr. Keine Flucht. Keine Ausraster. Mehr Licht, weniger Dunkelheit.
Jetzt, hier, neben Groot, gegenüber der blauhaarigen Psychologin, hatte er das Verlangen, es irgendwie wiedergutzumachen. Irgendwie der Mann zu werden, den Royal verdient hatte. Zumindest Gideon wollte das. Ihm nahe sein, ihm zeigen, wie gern er ihn mochte.
In diesem Moment war er zu so ziemlich allem bereit, nur damit er Royal wieder zurückbekam. Es war knapp eine Woche her, seit er nach Syrien abgeflogen war, seither hatte Gideon kein Lebenszeichen von ihm erhalten, was ihn unruhig machte.
Nach den Geschehnissen der letzten Wochen und Sterlings Besuch hatte er das Gefühl, dass er irgendetwas verpasst hatte. Ein Puzzleteil war zu Boden gefallen, aber weil noch so viele andere auf dem Tisch lagen, wusste er nicht mal, um welches es sich handelte.
Sein Leben war zu einem unlösbaren Mosaik geworden, und welche Bruchstücke auch fehlten, Royal hatte es verdient, seinen Platz darin zu finden.
»Ich muss weitergehen«, sagte er dann entschlossen.
Zwei
Tag 7
Royal
Royal hob langsam den Kopf, sah in den Himmel und betrachtete den still herabrieselnden Schnee. Er hatte sein Leben lang in San Francisco gelebt und nie auch nur eine Schneeflocke gesehen. Hätte er gewusst, wie wunderschön und friedvoll sie waren, er wäre schon früher an einen Ort gefahren, wo er dieses Wunder hätte betrachten können.
Kleine Eiskristalle blieben für einen Moment auf seiner nackten Haut haften, glitzerten, ehe sie schmolzen und nur noch einen Wassertropfen hinterließen, der nicht annähernd so magisch war wie das filigrane Gebilde aus Kälte zuvor.
»Ich wollte dir schon immer den Schnee zeigen«, sagte Gideon. Er stand neben ihm, die Hände in den Taschen seines Mantels vergraben und hatte den Kopf gen Himmel gerichtet. Sein Atem wirbelte als weiße Wolke durch die Luft und verschwand in der Unendlichkeit.
»Ich mag es.«
Gideon richtete seinen Blick auf Royal und lächelte. »Ich auch.«
»Alter, der träumt von Schnee«, sagte eine Stimme direkt neben ihm, die gar nicht mehr nach Gideon klang. Auf einmal spürte er die Kälte als eisigen Schimmer auf seiner Haut.
Er fröstelte. So sehr, dass sich sein gesamter Körper verkrampfte.
»Vielleicht, weil es hier unten so verflucht kalt ist«, sagte eine andere Stimme und lachte.
Royal sah wieder zur Seite, erwartete, Gideon dort stehen zu sehen, mit seinem unvergleichlichen Lächeln. Er brauchte einen Moment, bis sich sein Blick scharfstellte, aber dann erblickte er eine grob verputzte Ziegelwand. Es bereitete ihm große Mühe, seinen Kopf zu drehen, daran schuld war unter anderem auch seine Hand, die mittels eines Kabelbinders an einem Gitter befestigt war.
»Hör auf zu träumen, Arschloch«, sagte eine Stimme neben ihm, die ihm irgendwie bekannt vorkam. Er wusste nur nicht woher. Er erblickte Beine, die in militärgrünen Hosen und Springerstiefeln steckten, traute sich aber nicht, den Blick zu heben, weil ihnen das strengstens untersagt worden war.
»Dein Essen«, sagte der Mann. Ein Tablett wurde neben ihm abgestellt, dann vernahm er schwere Schritte, die irgendwann verklangen.
Royal betrachtete den grüngrauen Inhalt der Suppenschüssel. Scheinbar brauchte der Mensch nicht sonderlich lang, um neue Gewohnheiten anzunehmen. Es hatte genau drei Tage und erste Schwindelanfälle lang gedauert, bis er verstanden hatte, dass er essen musste, solange er die Gelegenheit dazu hatte, denn sonst würde er über kurz oder lang verhungern. Deshalb setzte er sich langsam in eine aufrechte Position, ignorierte den Schmerz in seinem Rücken und Handgelenk und holte tief Luft.
Kalte Suppe. Wie die letzten Tage auch schon. Er schauderte leicht vor Ekel, griff aber gleichzeitig nach der Schüssel. Wenn er jetzt nicht aß, würde er die nächsten Stunden einen nagenden Hunger verspüren.
Sie bekamen eine Mahlzeit am Tag, zumindest wenn er die Dunkelheit und das Tageslicht richtig interpretierte, die durch das schmale Eckfenster in Deckennähe drangen.
Seine Geschmacksnerven zogen sich zusammen, trotzdem schaffte er es, die Mahlzeit einfach hinunterzuschlingen. Ohne Ekel, ohne Würgereiz.
»Royal!« Das Flüstern war so verdammt laut. Sie würden sie hören. Royal sah nervös durch die Gitter seiner Zelle. Er hatte direkte Sicht auf die Tür, durch die die Entführer immer kamen. Sie stand halboffen, weshalb er schon fast erwartete, dass einer ihrer Wärter sie gehört hatte.
Bisher hatte Royal zwei verschiedene Männer gesehen, die zu ihnen gekommen waren. Der Mann von heute, mit der Stimme, die ihm irgendwie bekannt vorkam, war zum ersten Mal zu ihnen gekommen. Vielleicht würde er sich erinnern, wer er war, wenn sein Körper und Geist nicht so angeschlagen wären. Aber im Moment blieb ihm nichts anderes übrig, als die brutalen und willkürlichen Misshandlungen über sich ergehen zu lassen, ohne groß nachzudenken. Royals schmerzender Körper war Zeugnis von vielen Fußtritten und Schlägen.
Er hatte nicht mal eine Scheiß-Ahnung, was diese Typen von ihm wollten und warum Marshall, Eli und er hierher verschleppt worden waren. Das alles kam ihm wie ein ziemlich gestörter Scherz vor, nur dass es keinen Grund gab, darüber zu lachen.
»Geht es dir gut?« Das war Marshall. Eindeutig. Royal seufzte innerlich auf. Um ihn hatte er sich die meisten Sorgen gemacht, denn bisher hatte er noch kein Wort gesagt.
»Ja«, flüsterte Royal und stellte seine Schüssel weg. »Alles okay. Wo ist Eli?«
»Ich bin hier«, schaltete sich Eli ein.
»Wir sind in der gleichen Zelle, sitzen einander gegenüber.«
Royal war zwar erleichtert, dass es den beiden offenbar gut ging, doch seine eigene Einsamkeit wurde in diesem Moment grenzenlos. Er würde jetzt sehr viel dafür geben, wenn er mit ihnen zusammen in dieser Zelle sitzen könnte.
Stattdessen war er allein und fror, weil sie ihm seine Klamotten weggenommen hatten, er war dreckig und bekam nur zweimal am Tag die Gelegenheit, auf einer verschmutzten Toilette sein Geschäft zu verrichten.
»Eli?«
»Ja?«
»Du hast gesagt, in Syrien wird es übel.«
»Tut mir leid, Mann«, war seine Antwort, die Royal ein kleines Lächeln abrang. Sie mussten gar nicht erst nach Syrien fliegen, um einen wahrgewordenen Albtraum zu erleben.
Royal vernahm Schritte und presste sich an die eiskalten Gitterstäbe. Er konnte nicht verbergen, dass er Angst hatte. Genaugenommen hatte er die Hosen voll. Er hatte keine Ahnung, was diese Leute von ihnen wollten, aber sie waren gewaltbereit, das war Grund genug, sich Sorgen zu machen. Fragen half allerdings nicht viel, das hatten sie gleich nach ihrer Entführung und einigen harten Schlägen mit einem Stock gelernt.
»Scheint ja wunderbar zu schmecken, so schnell, wie ihr das Zeug herunterschlingt.« Das war wieder der Kerl, dessen Stimme ihm so bekannt vorkam. Obwohl sie die Männer nicht ansehen durften, riskierte Royal einen Blick. Der Wärter trug eine Baseballkappe und eine Sonnenbrille, dennoch wusste Royal jetzt, woher er die Stimme kannte.
»Tobyn?«, fragte er fassungslos. Er sollte nicht so erstaunt sein, denn immerhin hatte Gideons Fahrer sie überhaupt erst in diese prekäre Lage gebracht. Trotzdem schockierte es ihn, dass er jetzt hier war und sich als einer ihrer Peiniger herausstellte.
Tobyn verzog den Mund. »Du weißt, dass du uns nicht ansehen sollst, oder?«
»Warum haben Sie das getan? Sie helfen denen?«
Tobyn lachte. »Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich schon darauf warte, dem vielbeschäftigten Arschloch-Boss Gideon McDermott seine eigene Scheiße zum Fressen zu geben.«
»Er hat Ihnen nie etwas getan!«
»Nein. Hat er nicht.«
»Warum machen Sie dann hier mit?«
Tobyn lachte wieder und zuckte mit den Schultern. »Sie zahlen besser.«
»Sie? Wer sind die?«
»Das wirst du noch früh genug herausfinden, Idiot. Und jetzt halt deine Klappe, bevor ich dir noch wehtun muss. Wir haben die Anweisung, nicht sanft mit euch umzugehen.«
»Wieviel Geld sie dir auch zahlen, Gideon wird dir mehr geben«, beschwor Royal Tobyn und riss an seiner Fessel. »Sie müssen uns nur hier rausbringen!«
»Das wird er«, warf Marshall ein. »Gideon interessiert sein Geld nicht.«
»Halt deinen verdammten Mund!«, rief Tobyn aus und dann holte er aus und schlug ihm seine Faust gegen die Schläfe. Royal sackte zur Seite und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder aufwachte, war er allein. Sein Kopf schmerzte, was sich seltsam tröstlich anfühlte. Und vertraut.
Er richtete sich sehr vorsichtig auf, weil der Schlag noch immer Schmerzsignale durch seinen Körper schickte und Übelkeit in ihm heraufbeschwor.
»Royal?«, fragte Marshall hinter ihm. »Alles okay?«
»Alles prima«, erwiderte Royal langsam. Vor seinen Augen zuckten ein paar gleißende Blitze, die ihm die Orientierung nahmen.
»Tobyn macht auch bei dieser Sache mit.« Marshalls Stimme klang fassungslos.
»Ja. Er scheint einer unserer Wärter zu sein«, sagte Royal bitter. Was würde Gideon dazu sagen? Würde er misstrauisch werden? Würden sie durch Tobyn eine Chance bekommen, diesem Albtraum zu entrinnen?
»Wenn ich ihn in die Finger bekomme, mach ich Hackfleisch aus ihm«, knurrte Marshall. »Er hat uns diesen Kerlen ausgeliefert.«
»Ja«, sagte Royal nur. Es kam ihm vor, als befände er sich in einem nicht enden wollenden Albtraum, was zwar klischeehaft klang, aber absolut der Wahrheit entsprach. Solche Dinge passierten nicht Menschen wie ihm. Oder Eli und Marshall. Es gab keinen Grund, sie zu entführen, sie nackt an Gitterstäbe zu fesseln und sie hier unten ausharren zu lassen. Absolut keinen.
Royal lehnte seinen Kopf zurück. Die Ausweglosigkeit und Hoffnungslosigkeit ihrer Lage machte ihm zu schaffen. Er wurde gerade müde, als ein Geräusch ihn aufhorchen ließ. Die letzten Tage hatten sie nach den Mahlzeiten keinen weiteren Besuch mehr gehabt, sondern nur noch still auf dem Boden sitzend verbracht. Schritte kamen näher, die anders klangen. Schwerer. Gemächlicher. In sich ruhend. Als hätten sie alle Zeit der Welt.
Eine Gänsehaut breitete sich auf seiner Haut aus, und wie eine La-Ola-Welle erreichte sie auch den letzten Winkel seines Körpers und ließ ihn erzittern. Sein Instinkt sagte ihm, dass sie das siebentägige Vorspiel nun hinter sich gebracht hatten.
»Ihr seht ja noch richtig frisch aus, Jungs. Hattet ihr schöne Weihnachten?« Die Stimme lachte tief und leise. Ihr Timbre ließ weitere Schauer über Royals Haut wandern. Er klang so selbstsicher, fast schon unbeschwert. Royal kam auch diese Stimme bekannt vor. Er hatte sie an jenem Tag gehört, an dem Tobyn sie nicht zum Flughafen, sondern zu diesen Männern gebracht hatte.
»Tut mir leid, dass ich so lange abwesend war, aber ich hatte noch ein paar Dinge zu erledigen. Ab jetzt stehe ich jedoch zu eurer vollen Verfügung.« Der Mann gluckste.
Royal schluckte. Er wandte seinen Kopf, obwohl er wusste, dass er es besser nicht tun sollte. Der Mann, der direkt vor dem Gitter seiner Zelle stand, war angsteinflößend. Seine Armyhosen mit einem grau-schwarzen Muster bedruckt und die breiten Schultern von einem Rollkragenpullover verhüllt. Seine nach hinten gekämmten Haare waren vom gleichen glänzenden Schwarz wie sein sorgfältig gestutzter Bart, der ihm einen gewissen Hauch von Eleganz verlieh.
»Wir haben einen Gewinner«, sagte er und schlug mit dem Schlüsselbund gegen das Zellengitter. »Ich wusste, dass einer von euch dumm genug sein wird, mich anzusehen.«
Das Gitter klirrte unheilvoll, als die Tür aufschwang und der Mann seine Zelle betrat. Es war genug Platz hier drin. Rein vom Augenmaß her schätzte Royal, dass er einen Raum von etwa drei mal vier Meter hatte, der ihm zur Verfügung stehen könnte, wenn er nicht festgebunden wäre.
Der Mann ließ die Zellentür offenstehen und kam auf ihn zu. Im nächsten Moment verspürte Royal einen scharfen Schmerz an seinem Handgelenk, dann fiel sein Arm zu Boden, ohne dass auch nur ein Muskel gezuckt hätte. Seine Schulter schmerzte aufgrund der plötzlichen Bewegung und der ungewohnten Durchblutung unendlich.
»Aufstehen«, sagte der Mann. Nicht mehr. Royal wartete auf einen Fußtritt oder Fausthieb, aber nichts geschah. Er wusste, dass es dumm wäre, den Befehl des Mannes zu ignorieren, weshalb er seinen schmerzenden, müden, gefrorenen Muskeln ein wenig Motivation zusandte. Er musste sich am Gitter abstützen, um langsam in den Stand zu kommen, dabei ließ er einen Blick in die direkt angrenzende Zelle schweifen. Er entdeckte Eli und Marshall. Beide waren nackt, wie er, mit jeweils einer Hand an einem Gitterstab festgebunden. Elis Gesicht konnte er von hier aus sehen. Die Hoffnungslosigkeit seines Blickes erschreckte ihn zutiefst.
Aus einem dummen, dummen, absolut lebensmüden Instinkt heraus mobilisierte er seine letzten Kräfte und warf sich mit seinem gesamten Körper gegen den Mann, der ihn um einen halben Kopf überragte. Der taumelte ein oder zwei Schritte nach hinten, dann fand er sein Gleichgewicht wieder. Wie Schraubstöcke legten er die Hände um Royals Oberarme. Es tat nicht weh, war einfach nur ein fester Griff, der ihn fixierte, und seinen Angriff mehr als jämmerlich wirken ließ.
»Ich werde das jetzt als ein unbeabsichtigtes Stolpern betrachten, denn wenn ich den Verdacht hätte, dass du die Absicht hattest, mich anzugreifen, dann müsste ich dich totprügeln, und dafür ist es eindeutig zu früh. Wir hatten noch nicht mal die Gelegenheit, uns kennenzulernen. Mitkommen.«
Royal biss die Zähne aufeinander. Er war wütend auf sich selbst, auf seinen schwachen Körper, darauf, dass er so gedankenlos gehandelt hatte, und auch auf die Gnade, die dieser Wichser ihm jetzt zuteilwerden ließ.
Royal wurde von dem Mann aus der Zelle geführt.
»Wo bringst du ihn hin, Arschloch!«, schrie Marshall von seinem Sitzplatz aus. Royal wandte den Kopf, aber mit seinem festen Griff brachte der Mann ihn dazu, wieder nach vorn zu sehen. »Klappe«, sagte er nur und schob Royal weiter. Sie gingen durch die Eisentür, durch die sie vor so unendlich langer Zeit hereingebracht worden waren, und gleich darauf einen dunklen Gang entlang. Irgendwann schob der Mann eine weitere Tür auf und schubste Royal hinein. Der Raum war in gleißend helles, fast schon weißes Licht getaucht, das ihn für einen Moment beinahe erblinden ließ. Er kniff die Augen zusammen und stolperte nach vorne.
»Hinsetzen«, sagte der Mann, und Royal wurde auf einen Stuhl gedrückt. Als sich seine Augen endlich an die Helligkeit gewöhnt hatten, stellte er fest, dass außer seinem Stuhl nur ein anderer mitten im Raum stand. Ansonsten schien er leer zu sein.
Er sah dabei zu, wie seine beiden Arme mit jeweils einem Kabelbinder an den Armlehnen des Stuhls fixiert wurden.
»Sitzt du auch bequem?«, hakte der Mann nach. Er klang, als würde er sich wirklich um sein Wohlergehen sorgen, aber das bezweifelte Royal ernsthaft.
»Wer sind Sie?«
Er lachte. »Tut mir leid, mir steht nicht der Sinn nach einer Plauderrunde. Aber du kannst mich gern Mr. Pain nennen, wenn du unbedingt einen Namen brauchst.«
»Das werde ich ganz sicher nicht«, murmelte Royal.
»Ist er bereit?«, fragte eine andere Stimme, die zu einem weiteren Mann gehörte. Wie viele Menschen gab es hier noch?
»Und wie er bereit ist.« Die dunklen Augen des unbekannten Mannes glitten über seinen Körper, huschten über jedes Fetzchen nackter Haut, ehe er lächelte. Es war nicht freundlich oder warm, sondern sehr, sehr kalt. Royal rutschte auf dem harten Stuhl umher und ließ sein Gegenüber nicht aus den Augen. Der dunkelhaarige Typ hatte sich ans andere Ende des Raumes zurückgezogen, wo er abwartend an der Wand lehnte, die Arme vor der Brust verschränkt, sie beobachtend.
»Du bist Gideons Fickfreund«, sagte der Mann direkt vor ihm. Seine Stimme besaß einen harten Unterton, seine Augen waren leblos.
»Wer sind Sie?«, fragte Royal.
»Das ist nicht wichtig.« Er wandte sich um. »Habt ihr inzwischen was von Gideon gehört?«
»Was wollen Sie von ihm?«, fragte Royal. Damit hatte er wieder die Aufmerksamkeit des Mannes. Der trat näher und betrachtete ihn, als wäre er eine sehr seltene, unerforschte Spezies. Dann lächelte er wieder. Ein grausamer Anblick. »Alles«, sagte er. »Wenn ich wählen könnte, würde ich alles nehmen.«
»Was meinen Sie damit?«
»Das wirst du noch früh genug erfahren.« Er kam näher und streckte seine Hand aus. Er wollte Royals Haare berühren, doch Royal drehte den Kopf weg soweit er konnte. Der Mann bekam seine Haare trotzdem zu fassen. Seine Finger gruben sich in sie und mit einem scharfen Ruck fixierte er Royals Kopf. »Hör auf, dich zu wehren«, flüsterte er. Sein Atem strich unangenehm über Royals Gesicht, seine Lippen berührten seine Haut. Nur ganz sachte, aber es reichte, um Abwehr aufsteigen zu lassen. Royal versuchte, sein Gesicht abzuwenden, aber es funktionierte nicht. Er wusste nicht warum, aber alles an diesem Mann stieß ihn ab.
Jetzt lachte er auch noch. »Das hat Gideon bestimmt sehr gemocht. Dass du dich wehrst. Ich mochte das auch immer. Er ist mir so verdammt ähnlich, obwohl ihm das nicht gefallen würde.« Seine Hand glitt tiefer und berührte ohne Vorwarnung seinen Schwanz, sodass Royal zusammenzuckte. Aufgrund der Fesselung konnte er sich kaum gegen den unangenehmen Griff wehren.
»Fahren Sie zur Hölle!«, stieß Royal hervor. Er schloss die Augen, als die Hand des Mannes langsam an seinem Schaft entlangfuhr. Mit Entsetzen spürte er, wie sich das Blut in seinem Geschlecht sammelte, ohne, dass er etwas dagegen tun konnte.
»Das magst du«, stellte der Mann mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck fest. »Dachte ich mir schon.« Er fuhr mit seinen Berührungen fort, bis Royals Schwanz aufrecht stand, dann ließ er ihn abrupt los. »Kümmern Sie sich um ihn. Gideon sollte so langsam in die Gänge kommen. Ein Schubs in die richtige Richtung ist vielleicht genau das, was er braucht.«
»Ich bin mir sicher, wenn es an der Zeit ist, wird alles so laufen, wie wir es uns vorstellen«, sagte der schwarzhaarige Mann mit einem Räuspern. Sein Blick lag unbewegt auf Royal.
Der andere trat vor, ganz nahe auf ihn zu. Beide Männer waren nun auf Augenhöhe und starrten sich an. »Er wird vorbereitet. Das hat nichts mit Gideon zu tun. Sondern damit, dass ich es so will.«
»Ich werde nicht …«
Der Arm des Mannes schoss vor und fixierte den Hals seines Gegenübers. Royal konnte, von seinem Platz aus, keine Furcht in seinen Augen erkennen. Eher so etwas wie stille Wut. Er hatte keine Ahnung, was sich gerade zwischen den beiden abspielte, aber es machte ihm Angst. Es konnte nicht gut sein, wenn seine beiden Entführer miteinander stritten. Oder vielleicht war es auch eine Chance. Wer wusste das schon?
»Ich habe Sie engagiert, weil man mir sagte, Sie wären gnadenlos. Also seien Sie das auch. Gnadenlos. Bekommen Sie das hin? Oder muss ich mich nach jemand anderem umsehen?«
Der Schwarzhaarige blickte an seinem Gegner vorbei und wieder zu Royal. Dann nickte er. »Natürlich werde ich den Job erledigen. Ich bin nur etwas erstaunt über ihre sehr klaren Vorstellungen. Normalerweise habe ich freie Hand in der Wahl meiner Methoden. Eine Liste habe ich noch nie erhalten.«
Für Royal hörte sich dieses ganze Gespräch so abstrus an, dass ihm der Kopf schwirrte. Was für Vorstellungen? Welche Methoden? Was für eine Liste?
Der Mann mit den kalten Augen ließ ihn los und trat einen Schritt zurück. »Wenn Sie so gut sind, wird das kein Problem für Sie darstellen. Sollten Sie allerdings jetzt schon Skrupel haben, wäre es wohl besser, diese zu äußern.«
Der Schwarzhaarige sagte kein Wort und der andere Mann sah nochmal zu Royal hin. »Kümmern Sie sich um seine Haare«, sagte er beim Hinausgehen. »Sie sind zu lang.«
Schweigen herrschte in dem Raum. Der Mann, der zurückgeblieben war, sagte kein Wort und Royal auch nicht. Er registrierte erleichtert, dass seine Erektion abgeklungen war, und hoffte gleichzeitig, dass sein Entführer ihn nicht darauf ansprechen würde.
»Du hast ihn gehört«, sagte er und stieß sich von der Wand ab und trat zu ihm.
»Sie müssen das nicht tun«, sagte Royal schnell. »Wenn es um Gideon geht, dann lassen Sie ihn mich anrufen. Er hat Geld. Er wird alles …«
Die Ohrfeige kam unerwartet und war härter als all die Faustschläge der letzten Tage. Schwindel rauschte durch seinen Körper, Übelkeit folgte und ließ ihn würgen.
»Solltest du auch nur einen Tropfen deiner Suppe ausspucken, werde ich dir sämtliche Zähne ausschlagen müssen. Ich hasse es, wenn Essen verschwendet wird.«
Royal keuchte schwerfällig, während sich die sorglos gesprochenen Worte in jeder seiner Zellen festsetzte. Er wartete, bis die Übelkeit verklungen war, dann stellte er sich wieder dem unbarmherzigen Blick des Mannes.
Er zuckte zusammen, als seine Hand plötzlich vorschoss und sich seine Finger in seinem wirren Haar vergruben. »Er hat recht. Dagegen müssen wir etwas unternehmen. Deine Haare sind das reinste Chaos. So geht das nicht. In meinem Haus herrscht keine Unordnung.« Er riss Royals Kopf nach hinten, sein Blick glitt langsam und äußerst sorgfältig über sein Gesicht. Es war, als würde er sich jede Furche, jeden Schmutzfleck, jede Schwellung, jede Blaufärbung genauestens einprägen.
Vorher, hatte Royal sich ihm verbunden gefühlt, vermutlich, weil er selbst auf eine Art zum Opfer geworden war. Doch diesen Eindruck revidierte er nun schnellstens. Dieser Mann war genauso wenig ein Opfer wie der andere. Sie beide waren Monster, direkt aus der Hölle zu ihm geschickt.
Tobyn betrat den Raum. Sein Gesichtsausdruck blieb vollkommen reglos, als er Royals Blick erwiderte. In seinen Händen hielt er ein Gerät, das Royal erst erkannte, als er direkt vor ihm stand. Schweigen breitete sich aus. Diese Art Schweigen, von dem man ahnte, dass gleich etwas Schlimmes geschehen würde.
»Fang an«, sagte der Schwarzhaarige mit leiser Stimme. Er setzte sich auf den Stuhl ihm gegenüber und musterte ihn. Royals Herz schlug heftig und schnell. Kalter Schweiß brach ihm aus, als plötzlich das monotone Sirren eines Rasierers zu hören war.
Sein Herz zuckte aufgeregt, sandte verzweifelte Stromstöße durch seine Muskelzellen, auf der Suche nach einem lebensfähigen Rhythmus. Der Apparat wurde an seiner Stirn angesetzt, und im nächsten Moment wurde ihm ein Streifen seines Haares abrasiert.
Royal wollte schreien, weinen, fluchen, bitten, ihm seine Haare zu lassen, einen Teil seiner Identität. Er hatte keine Probleme damit, nackt herumzulaufen, aber seine Haare … Der Mann vor ihm beobachtete ihn wie ein Adler, seine grauen Augen gruben sich bis in seine Seele. Einer seiner Mundwinkel zuckte.
Trotz seines inneren Schmerzes schwieg Royal, lauschte dem Stolpern seines Herzens, drängte Tränen zurück, dann schloss er die Augen.
Er würde jetzt viel dafür geben, den Schnee sehen zu können ...
Drei
Tag 9
Gideon
Gideon warf die Haustür zu, legte den Schlüsselbund achtlos in die dafür vorgesehene Schale und ging in die Küche. Noch bevor er sich ausgezogen hatte, betrachtete er schon wieder das Display seines Handys. Es kam ihm vor, als würde er nichts anderes tun. Zu seiner Enttäuschung hatte ihn in den Momenten zwischen Ankunft im Haus und Betreten der Küche kein Anruf erreicht. Welch Wunder. Auch keine Nachricht. Sein Handy war eine schweigende Verhöhnung. Du hast alles kaputtgemacht. Jetzt bist du allein. Das hast du davon.
Trotzdem versuchte er es weiter. Er würde nicht aufgeben, bis er Eli am Hörer hatte, der ihm sagte, dass es ihnen gut ging. Es war inzwischen nicht mehr, als eine routinierte Fingerbewegung, die Nummer zu wählen. Der Anruf baute sich auf und wurde im nächsten Moment unterbrochen. Bei Royal das Gleiche. Es frustrierte ihn. So sehr. Aber gleichzeitig besorgte es ihn weit weniger, als es bei Marshall der Fall war. Bei Eli und Royal gab es eine Erklärung, warum sie den Anruf nicht entgegennehmen konnten. Sie waren irgendwo in Syrien, wer wusste schon, ob ihre Handys dort funktionierten, ob eine Funkverbindung bestand oder sie Strom zur Verfügung hatten, um ihre Akkus zu laden.
Aber Marshall hatte er seit über einer Woche nicht ans Telefon gekriegt. Die nichtssagenden Nachrichten, die Marshall ihm hin und wieder schickte, beruhigten ihn überhaupt nicht, weil sie so gar nicht nach dem Marshall klangen, der er die letzten Wochen gewesen war.
Seine Sorge steigerte sich von Tag zu Tag, und heute hatte sie ihren Höhepunkt erreicht. Es gab nur eine Person, die vielleicht mehr wusste, als er, weil sie – wie Marshall – in New York lebte. Er wählte die eine Nummer, die er nie wieder hatte wählen wollen. Dieser Anruf wurde entgegengenommen. Natürlich.
»Hallo?«
»Hallo, Camille. Ich bin es. Gideon.«
Unangenehmes Schweigen hing in der Leitung. Er wusste jedoch absolut nicht, was er zu seiner Mutter hätte sagen sollen, nachdem sie sich jahrelang weder gehört, noch gesehen hatten. Es war schon ein Wunder, dass ihre Nummer noch stimmte, die er seit Jahren nicht mehr benutzt hatte.
»Gideon«, sagte sie leise, als hätte sie Angst, das Wort würde ihr im Mund zerspringen.
Gideon räusperte sich. »Ich rufe wegen Marshall an.«
»Oh, geht es ihm gut?«
Gideon lehnte sich an die Anrichte seiner Küche. Seine Haushälterin hatte ein paar frische Äpfel in die Obstschale gelegt, die er nicht essen würde. »Nun … das wollte ich eigentlich dich fragen.«
»Mich? Ich habe seit über einer Woche nichts von ihm gehört. Ist er nicht mehr in San Francisco? Ich dachte, er hätte spontan entschieden, Weihnachten mit Dakota und seinen neuen Freunden zu feiern. Mit dir.« Ihre Stimme versiegte.
»Er ist nicht in San Francisco«, sagte Gideon tonlos. Die Sorge wollte ihm die Luft abschnüren. »Bist du sicher, dass er nicht in New York ist?«
»Ich habe zweimal bei ihm geklingelt, aber er hat nicht geöffnet.«
»Hast du Nachrichten von ihm erhalten?«
»Ja. Er hat mir versichert, dass es ihm gut geht und er sich einen kleinen Urlaub gönnt.«
»Wo?«
»Das hat er nicht geschrieben.«
Gideon stieß einen Fluch aus und schlug auf die Granitplatte.
»Was ist denn los, Gideon? Irgendetwas stimmt doch nicht.«
»Das versuche ich gerade herauszufinden. Ich melde mich, wenn ich Genaueres weiß.« Gideon beendete das Gespräch, ohne auf die Erwiderung seiner Mutter zu warten. Nur weil Marshall nun wieder Kontakt zu ihrer Mutter pflegte, bedeutete das noch lange nicht, dass er dies ebenso handhaben musste.
Mit dem Handy in der Hand eilte er die Treppen nach oben und betrat die Garage, die direkt an sein Wohnhaus grenzte.
Da sein Fahrer aus unerklärlichen Gründen verschwunden war, war er seit einigen Tagen gezwungen, selbst zu fahren. Er besaß zwar eine ganze Reihe eigener Fahrzeuge, dennoch hatte er die Limousine immer vorgezogen, weil es einfach viel praktischer im Alltag war.
Er stieg in das nächststehende Auto ein, ein dunkelgrauer Porsche, fuhr rückwärts aus der Garage, wartete ungeduldig, bis das Tor zur Seite geglitten war und gab Gas.
Dank des übermäßigen Feierabendverkehrs benötigte er fast eine Stunde, bis er schließlich Royals Wohngegend erreichte. Er stellte seinen Wagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite ab, und hämmerte gleich darauf mit der Faust gegen die Tür.
»Himmel, was soll das denn?«, fragte Angela, als sie die Tür aufgerissen hatte. Sie starrte ihn fragend an, ihre Augen funkelten verärgert. »Sind Sie verrückt geworden?«
»Kann ich Dakota sprechen?«
»So? Auf gar keinen Fall. Gehen Sie weg.« Angela war im Begriff, die Tür wieder zu verschließen, aber Gideon stieß sie auf. Kein Funken Anstand steckte in diesem Moment mehr in ihm, nur sehr, sehr viele Fragen, als er sich an Angela vorbeidrängte und in die Küche eilte, in der jedoch nur Avery am Tisch saß. Sie trug ein niedliches Kleid und einen Haarreif, auf dem Lichter in verschiedenen Farben leuchteten.
»Hi, Gideon«, sagte sie und winkte ihm grinsend zu. »Santa Claus hat mir Stifte gebracht.« Stolz hielt sie einen roten Farbstift in die Höhe.
Gideon winkte zurück. »Das ist großartig, Prinzessin.« Er trat näher und warf einen Blick auf ihre Zeichnung. »Was ist das?«
»Ein Einhorn. Für Dakota.«
Gideon erkannte nur Gekritzel in verschiedenen Farben, aber wenn Avery der Meinung war, dass es sich dabei um ein Einhorn handelte, dann würde er ihr ganz sicher nicht widersprechen. »Wunderschön, Liebes. Weißt du, wo Dakota ist?«
»In ihrem Zimmer. Sie weint.«
»Raus!«, herrschte Angela ihn an und drängte ihn unsanft zur Seite. »Raus, sonst rufe ich die Polizei.«
»Ich muss nur einen Moment …«
»Sie haben genug getan. Sie haben Royal vertrieben, Sie haben Dakota unglücklich gemacht …«
»Was habe ich bitte getan, um Dakota unglücklich zu machen?«, rief er empört aus. Er wusste, dass durch sein Verhalten in den letzten Wochen, sein Karmakonto ziemlich ins Minus gerutscht war, und dass Royal wegen ihm weggegangen war, sah er definitiv auch so.
Nichtsdestotrotz … Er riss sich von Angela los und eilte mit großen Schritten die Treppe hoch. Am Geländer hingen noch Überreste von Weihnachtsdekoration, Tannenzweige und rote Schleifen. Er selbst feierte Weihnachten schon seit Jahren nicht mehr.
Oben sah er sich um, hörte Angelas Schritte, weil sie ihm folgte, und riss hektisch alle Türen auf, die er erreichen konnte.
Und dann stand plötzlich Dakota vor ihm. Die junge, hübsche Frau, das Energiebündel mit der losen Zunge. Gideon hatte noch nie in so endlos traurige Augen geblickt.
»Was ist passiert?«, fragte er perplex. Im nächsten Moment lag Dakota in seinen Armen, was sich ungewohnt und auch unbequem anfühlte, aber bei Weitem nicht so schlimm, wie vieles andere. Er spürte Dakotas Tränen, die durch den Stoff seines weißen Hemdes sickerten und seine Haut befeuchteten.
»Schhh«, sagte er leise und zog sie noch etwas fester an sich, weil er das Gefühl hatte, dass sie genau das jetzt brauchte. Seit wann dachte er bitte darüber nach?
»Ach. Auf einmal ist es okay, dass Sie berührt werden? Sie sind ein verdammter Freak«, hörte er Angela hinter sich murmeln und gab ihr insgeheim recht. Gideon lauschte den leisen Schluchzern von Dakota. So lange, bis sie irgendwann verklangen. Schließlich hob sie ihren Kopf und fuhr sich mit dem Handrücken über die Nase. Ihre Wangen waren gerötet, ihre dunkelbraunen Augen schwammen in einem Meer aus Tränen. Ihre Frisur war praktisch nicht existent und sie trug nicht mehr als eines von Royals T-Shirts und eine ausgeleierte Jogginghose.
»Besser?«, fragte er und wischte mit seinem Daumen eine einzelne Träne von ihrer Wange.
»Nicht wirklich«, murmelte sie und ging zurück in ihr Zimmer. Gideon folgte ihr und ignorierte dabei Angelas leises Zischen.
»Was ist passiert?«
»Marshall ist passiert«, sagte Dakota und setzte sich auf die Bettkante. Sie griff nach einem Kleenex und schnäuzte sich geräuschvoll. »Er hat Schluss gemacht, okay?«
Gideon setzte sich neben sie und starrte stirnrunzelnd auf den Teppich hinunter. »Warum?«
Dakota erwiderte nichts, stattdessen griff sie nach ihrem Handy, das neben ihrem Kopfkissen gelegen hatte. Sie betätigte den Touchscreen und reichte ihm gleich darauf das Gerät. Sie hatte den Chat mit Marshall geöffnet, und soweit Gideon das mit einem Blick erfassen konnte, hatten die beiden in den Wochen seit ihrem Kennenlernen einen wirklich obszön hohen Verbrauch an Herz-Smileys gehabt. Ihm wurde ganz warm, wenn er daran dachte, dass sein Bruder nach all den langen Jahren auf der Straße, im Drogensumpf, vielleicht wirklich so etwas wie Glück mit Dakota gefunden hatte. Es war, als wäre er ein völlig anderer Mensch geworden.
Nur die letzte Nachricht fälschte diesen Eindruck empfindlich ab.
Das mit uns wird nix. Aber war nett.
Mehr hatte er nicht geschrieben. Die Nachricht war letzte Woche am Donnerstag eingetroffen, das musste kurz nach seiner Abfahrt zum Flughafen gewesen sein. Gideon rekonstruierte den Tag, den er über Stunden und Tage zu Tode analysiert hatte. Das merkwürdige Gespräch mit Marshall, der Streit mit Owen, Sterlings Besuch, die Erleichterung, dass Royal, Marshall und Eli unversehrt am Flughafen angekommen waren.
Lauf. Lauf, und hol ihn zurück.
Dieser Satz hatte sich unauslöschlich in sein Gedächtnis eingebrannt, und wenn er sich dazu hinreißen ließ, dann verursachte ihm die Aufforderung sogar eine Gänsehaut, weil er nicht vergessen konnte, wie Sterling sie ausgesprochen hatte. Wie er dabei ausgesehen hatte. Wie ein Raubtier, dass sein Opfer im nächsten Moment zu Boden riss.
Es war ihm nicht gelungen, Royal zurückzuholen. Das hätte der nicht zugelassen. Außerdem … Wer sagte denn, dass es nicht besser war, wenn er außer Landes blieb, bis Gideon herausgefunden hatte, was Aidan plante? Und was hatte Sterling mit all dem zu tun?
»Hattet ihr Streit?«, fragte Gideon und gab Dakota ihr Handy zurück. Sie betupfte ihre Augen mit dem Kleenex und schüttelte den Kopf. »Nein. Es war alles okay. Wir wollten uns in der darauffolgenden Woche schon wiedersehen. Wir haben geplant, Weihnachten zusammen zu feiern. Ich … ich verstehe das alles nicht. Macht er das immer so?«
»Er hat die vergangenen Jahre auf der Straße gelebt, ich bezweifle, dass er in dieser Zeit eine Partnerschaft hatte. Ich habe also keine Ahnung.« Gideon griff nach seinem eigenen Handy und öffnete den Chat mit Marshall. Wortlos zeigte er Dakota den Bildschirm.
Lass mich in Ruhe. Brauche eine Pause.
»Das ist Marshalls letzte Nachricht an mich.« Gideon fluchte und steckte das Handy zurück in seine Hosentasche. Etwas stimmte nicht. Etwas mit Marshall stimmte ganz und gar nicht. Er hatte wirklich genug Probleme in seinem Leben, aber sein Bruder stand auf seiner Prioritätenliste noch immer ganz weit oben.
Gideon erhob sich und sah auf Dakota hinunter, die wie ein Häufchen Elend dahockte und ihn aus wässrigen Augen betrachtete.
»Zieh dich an. Wir beide werden Marshall einen Besuch abstatten.«
* * *
Gideon stieg zuerst aus dem Taxi und half dann Dakota. Nachdem sie ihr weniges Gepäck aus dem Kofferraum geholt hatten, fuhr der Taxifahrer davon, während Gideon an der Fassade des Hauses hinaufsah, in dem Marshall offenbar wohnte.
»Nett«, sagte er.
»Du warst noch nie hier?«
»Ich habe es bisher noch nicht geschafft«, korrigierte Gideon sie. Das klang sogar in seinen Ohren ziemlich scheiße.
Er nahm ihre beiden kleinen Reisetaschen, und gemeinsam gingen sie die Treppe zu dem Mehrfamilienhaus hinauf, in dem Marshall lebte. Gideon suchte nach Marshalls Namen auf einer der Klingeln, läutete, dann wartete er ab.
Schließlich räusperte sich Dakota. »Ich … also … Marshall hat mir einen Schlüssel gegeben«, sagte sie dann leise und errötete. Gideon bezweifelte, dass es an der Eiseskälte lag, die hier in New York herrschte und sich um mindestens fünfzehn Grad von den Temperaturen in San Francisco unterschied. Sie trugen zwar Mäntel, aber die waren nicht für einen Wintertag an der Ostküste gemacht.
»Du hast einen Schlüssel«, sagte Gideon tonlos. Er hatte keine Ahnung gehabt, dass es schon so ernst zwischen den beiden war. Er trat zur Seite und signalisierte ihr, dass sie aufschließen sollte. Anschließend führte sie ihn in den zweiten Stock des Gebäudes, in dem sich kein Lift befand.
Sie schloss die Tür zu Marshalls Wohnung auf und dann traten sie ein. Es war ein merkwürdiges Gefühl, zu wissen, dass er in der Wohnung seines Bruders stand, ohne, dass dieser es ihm zuvor erlaubt hatte. Es war schon merkwürdig genug, dass er überhaupt einen festen Wohnsitz besaß, nachdem er jahrelang auf der Straße gelebt hatte, obwohl er bei Weitem genug Vermögen hätte, um sich zehn Häuser kaufen zu können. Als stiller Teilhaber besaß Marshall knapp ein Drittel von McDermott Investments und war damit ein reicher Mann, ohne jemals in seinem Leben auch nur einen Finger krümmen zu müssen. Keine guten Voraussetzungen für einen Junkie. Es grenzte an ein Wunder, dass er nicht längst an einer Überdosis gestorben war.
»Marshall?«, rief Gideon. Nur bleierne Stille antwortete ihm.
Dakota hängte den Schlüssel an ein Brett mit mehreren Nägeln darin. Sie tat es so selbstverständlich, dass es Gideon ganz komisch wurde. Solche Rituale hatte er mit Royal nie gehabt. Er hatte ihm ja nicht mal seinen verdammten Hausschlüssel gegeben. Sie hatten einfach nicht genügend Zeit gehabt, um sich auf diese Art einander anzunähern. Außerdem – wenn er ganz ehrlich zu sich selbst war – er hätte vermutlich ein Problem mit der damit einhergehenden Nähe gehabt. Schlüssel austauschen, ungefragtes Betreten der Häuser, gemeinsame Rituale, Nähe.
Gideon folgte Dakota, die den Rundgang durch die Wohnung aufgenommen hatte und nach und nach die drei Zimmer absuchte.
Halb erwartete Gideon, Marshall in seinem eigenen Erbrochenen am Boden liegend vorzufinden, Spritzenbesteck um sich herum, eine noch nicht geschnupfte Line Kokain auf dem Tisch, aber nichts dergleichen fanden sie.
Die Räume wirkten, als wäre hier schon eine Weile niemand mehr gewesen.
»Er ist nicht hier«, sagte Dakota schließlich und sah Gideon fragend an. »Und jetzt?«
»Keine Ahnung«, brummte Gideon. Er hatte zwei Gitarren entdeckt, die an der Wand hingen. Langsam ging er darauf zu und betrachtete sie. Er legte die Finger an die Saiten und zupfte daran, sodass ein vertrauter Ton erklang, der ihn zurück in eine Zeit katapultierte, in der die Musik sein einziger Halt gewesen war. Eine Zeit, in der die Gitarre sein ständiger Begleiter gewesen war, in der auch Marshall seine Leidenschaft für das Gitarrenspiel entdeckt hatte.
Das unerwartete Läuten der Haustür ließ ihn aufschrecken. Er warf Dakota einen fragenden Blick zu, die zuckte nur mit den Schultern. Entschlossenen Schrittes ging Gideon zur Tür und stellte fest, dass es keine Gegensprechanlage gab, was er als sehr fahrlässig empfand.
Er drückte den Türsummer und öffnete derweil die Eingangstür. Leise Stimmen näherten sich, schließlich vernahm er Schritte, dann wirbelte ein etwa vierzehnjähriger Junge um die Ecke. Er strahlte, seine blonden Locken hatte er am Hinterkopf zu einem Zopf zusammengefasst. »Hey, Onkel Marsh-« Er verstummte, als er Gideon erblickte. Schweigend musterten sie sich, bis eine andere Person neben den Jungen trat. Jemand, den er seinen Lebtag nie mehr hatte sehen wollen.
»Hallo, Mutter«, sagte Gideon gefühllos, weil jegliche Emotion aus seinem Körper verschwunden war.
Vier
Gideon
Er wusste nicht, wie lange sie einander gegenübergestanden hatten, bis Dakota diesen unangenehmen Moment durchbrach. Sie zwängte sich an Gideon vorbei und fiel seiner Mutter in die Arme, was der seltsamste Anblick aller Zeiten war.
»Dakota!«, rief seine Mutter aus und zog sie an sich. »Was ist los?«
»Wir sollten das nicht hier besprechen«, sagte Gideon kühl. Er ignorierte den Jungen, der Marshall wie aus dem Gesicht geschnitten war. Das musste Miles sein. Sein Halbbruder.
Ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen, ging er zurück in Marshalls Wohnung. Dort wartete er ab, bis ihm die anderen drei folgten. Sie versammelten sich in der Küche, und Gideon wäre am liebsten geflohen.
»Was tust du hier, Gideon? Ich hatte keine Ahnung, dass du … Nach unserem Telefonat …«
»Ich wollte mich nur vergewissern, dass er wirklich nicht hier ist und irgendeine Dummheit angestellt hat«, unterbrach Gideon seine Mutter, die daraufhin verstummte. Der Junge neben ihr betrachtete ihn sehr aufmerksam, was ihn zunehmend irritierte.
»Ich habe noch ein paarmal versucht, ihn zu erreichen, aber er nimmt nicht ab.«
»Marshall hat Schluss gemacht«, erzählte Dakota. Sie schien sehr vertraut mit seiner Mutter zu sein, was ebenfalls komische Gefühle in ihm auslöste. Im großen Ganzen konnte man sagen, dass sein gesamter Körper im Moment ein Feuerwerk aus merkwürdigen Empfindungen war, die zu sortieren ihn eine Ewigkeit kosten würde.
»Aber warum? Ihr habt euch so gut verstanden.«
»Ich habe keine Ahnung.«
Gideon fluchte und schlug mit der Hand auf den Tresen, ehe er sein Handy hervorzog und die Nummer der einzigen Person wählte, die jetzt noch in der Lage war, ihm zu helfen. Sein Gesprächspartner nahm das Telefonat nach dem ersten Klingeln entgegen, und Gideon seufzte erleichtert auf.
»Owen. Irgendwas stimmt nicht.«
* * *
Nach seinem Telefonat mit Owen, der höchst professionell reagiert und sich nicht lange mit Schuldzuweisungen wegen ihrer kleinen Auseinandersetzung am Flughafen aufgehalten hatte, wandte Gideon sich wieder zu seiner Mutter, Dakota und dem Jungen um. Camille hatte damals, nachdem sie sich von seinem Vater getrennt hatte, nochmal ein vollkommen neues Leben begonnen. Weit weg von San Francisco und damit ihren Söhnen. Gideon fragte sich, ob es einen Mann zu dem Jungen gab. Und wie ging Marshall mit ihm um? Wie konnte Marshall das alles einfach so verzeihen?
»Wir fliegen zurück nach San Francisco. Wir fangen dort an, nach ihm zu suchen, wo wir ihn zuletzt gesehen haben.«
»Okay, ich bin dabei«, sagte Dakota sofort.
»Bitte haltet mich auf dem Laufenden, wenn ihr etwas herausfindet«, bat Camille und warf ihm einen flehenden Blick zu. Gideon blinzelte, denn mit dieser Antwort hatte er niemals gerechnet. »Du …?«
»Ich sorge mich genauso um ihn wie du.«
»So, wie du dich die letzten Jahre um ihn gesorgt hast, als er sich mehrmals am Tag einen Schuss gesetzt hat?«, hakte Gideon spöttisch nach.
»Gideon«, sagte Dakota leise. Sie legte ihre Hand auf seine, aber dieses Mal war es zu viel, und so entzog er sie ihr. Er betrachtete seine Mutter, die noch immer jugendlich schön wirkte. Ihre blonden Haare waren nicht mehr kraus und durcheinander, weil sie Naturlocken besaß, durch die er früher immer sehr gern mit seinen Händen gefahren war. Jetzt besaßen sie eine glatte Struktur und glänzten silberblond. Er hatte Camille McDermott, schon so viele Jahre nicht mehr gesehen, dass er nicht mit Bestimmtheit sagen konnte, ob es ihre natürliche Haarfarbe war. Er müsste dafür vermutlich alte Fotos ausgraben, was er ganz sicher nicht tun würde.
»Miles, geh bitte einen Moment nach draußen«, bat seine Mutter den Jungen. Der musterte Gideon noch einmal eingehend, dann ging er weg.
»Was ist hier los? Warum denkst du, dass etwas nicht stimmt?«
»Das würde mich auch interessieren«, warf Dakota ein.
Gideon seufzte und wandte sich ab. Er durchschritt Marshalls Küche, dabei glitt sein Blick über eine verschrumpelte Basilikumpflanze auf dem Fensterbrett. Er überlegte, was er den beiden Frauen erzählen durfte. Vielleicht war auch alles nur falscher Alarm, aber ein Gefühl in seinem Innern forderte ihn geradezu heraus, genauer hinzusehen.
Nach allem, was gewesen war, nach Sterlings Besuch, nach Owens Ermittlungsergebnissen, um die Gideon sich nicht mehr weiter gekümmert hatte … Es kam ihm vor, als hätte er einen Haufen offener Enden vor sich liegen, von denen er keine Ahnung hatte, wie er sie verknüpfen musste, damit sie ein vollständiges Bild abgaben. Aber er hatte das dringende Gefühl, dass er nicht einfach wegsehen durfte.
»Ich werde seit geraumer Zeit beschattet.« Er warf Dakota einen Blick zu. »Und Royal auch. Der Angriff auf ihn war nicht zufällig, sondern geplant.«
Dakota schnappte nach Luft. »Warum habt ihr nie etwas davon gesagt?«
»Royal wusste nichts davon«, sagte Gideon leise.
»Warum denn nicht? Denkst du nicht, es hätte ihn interessiert?« Sie starrte ihn einen Moment entgeistert an, dann schlug sie sich mit der Hand gegen die Stirn. »Deshalb hast du ihn überwachen lassen?«
Gideon verdrehte die Augen. »Meine Spione waren bei Weitem nicht so gut wie die der anderen.«
»Wer sind die anderen?