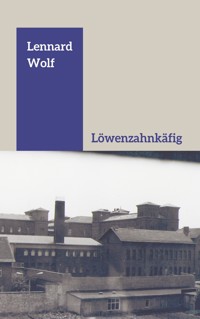
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
eine Jugend in der DDR ; Leben und Strafe im Sozialismus ; Erlebnisse des Autors im Gulag
Das E-Book Löwenzahnkäfig wird angeboten von BoD - Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Haft,Familie,Ministerium für Staatssicherheit,Jugenderinnerung,Deutschland (DDR)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Parteileitung hat die ganze Wahrheit, der Gebietsparteisekretär hat die halbe Wahrheit und der Bürger, tja der, der hat keine Wahrheit.
– chinesisches Sprichwort
Inhalt
Einzelhaft
Wintertag
Wintertag II
PM 12
UHA des MfS
Verhör
Kultur
Wintertag III
Der Fall
Unkraut im sozialistischen Rosengarten
Von Draußen
Rechtsvertreter
Justizgestrüpp
219er am Hals
Tag X
Drittes Leben
Auf Transport
Kästner-Piepe
Wolfszeit
Naumburger Land
Wieder die Stasi
Mewa III
Kalfaktor
Lebensmittelhandel
Ein Vollzugstag
Weihnachten
Zeitgenossen
Kehrtwende
Archaik
Unfall
Gefilzt
Bohème-Treffen
Abtransport
Grenzstation
Epilog
Anhang
Politische Paragraphen des DDR-Strafrechts
Fußnoten
Abbildungsverzeichnis
Bild 1 In der Laube im Harz
Bild 2 Russische Zarenfamilie
Bild 3 Halle – Neustadt 1980er
Bild 4 Passfoto für DDR-Volkspolizei
Bild 5 Staatsicherheit Halle
Bild 6 Stasi- Begehungsfoto
Bild 7 Staatsicherheit Halle2
Bild 8 Zwei Onkel 1947
Bild 9 Student in Leipzig 1961
Bild 10 Gefängnis Naumburg
Frontbild: ‚Roter Ochse‘ in Halle/S. 1984. Stasi-Untersuchungshaftanstalt und Frauengefängnis. Privatfoto
Rückseite: Gefängnis Naumburg 2019; Der Garten der Großmutter; Rettungsschwimmerclub
Prolog
„Wir haben kein Mitleid und wir fragen nicht nach eurem Mitleid. Wenn unsere Zeit kommt, werden wir uns nicht für den Terror entschuldigen“, schrieb Chefeditor Karl Marx 1849 in der letzten Ausgabe seiner Kölner Zeitung.1
„Uns ist alles erlaubt“, ergänzte sein Schüler Lenin später während des russischen Bürgerkrieges.2
Genauso handelten sie.
Sowjetrussland, die Geheimpolizei Tscheka und der Gulag waren eben gegründet, als im Juli 1918 der oberste Rat unter Jakow Swerdlow tagte. Wegen eines Attentats auf ‚Pressekommissar‘ Wolodarski wurde der „rote Massenterror gegen die Bourgeoisie und ihre Agenten“ beschlossen3. Als auch noch ein Doppelattentat auf Lenin und Tscheka-Chef Uritzki folgte, nahm der Staatsterror Fahrt auf. Zehntausende Bürger wurden unmittelbar umgebracht. Viele weitere folgten ihnen.
Lange Jahre währte das sozialistische Experiment. In jedem der zahlreichen Satellitenstaaten, wie etwa der DDR, gab es ein Gefängnissystem für Häretiker sowie eine politische Geheimpolizei nach dem Vorbild der Sowjetunion. Bis zum allgemeinen Zusammenbruch um 1990 starben weltweit etwa 80 Mio. Menschen.4
Ein Stück vom Leben im DDR-Sozialismus – jenem unerfüllten Traum von der Gleichheit und einem harmonischen Garten Eden auf Erden –, berichtet der ‚Schwimmer‘, wie ihn die Staatssicherheit in einem ‚Operativen Vorgang‘ nannte.
Das Buch gibt den Geist der Zeit wieder.
Januar 2025
Einzelhaft
Vom betonierten Hof führen ihn lange Kellergänge zu einem halboffenen, beinahe heimeligen, nur von einer Schreibtischlampe erhellten Raum. Offenbar ist dies die Kleiderstelle. Ein großes Ziegelgewölbe im Hintergrund jedenfalls sieht wie ein Theaterfundus aus. Unschlüssig bleibt Wolf stehen. Er wird zum Betreten eines historischen Holzpodests aufgefordert, das von einem niedrigen Gatter mit Türchen umgeben ist. Es wirkt lächerlich klein.
Der Uniformierte wirft einen kurzen Blick auf den Neuling.
„Taschen leeren!“, verlangt er.
Das ist nun einigermaßen unmöglich. Stumm hält Wolf die gefesselten Hände hin. Der andere lässt unwirsch die Acht aus Aluminium vom Transport aufschließen.5
Eine Ablage ist nicht vorhanden. Wolf deponiert also seine Habe auf dem handbreiten Geländer.
„Ausziehen!“
„Kann ich meine Sachen nicht anbehalten?“, fragt Wolf verblüfft. Immerhin ist er ja kein Verurteilter.
„Die werden hier nicht gewaschen. Nehmen Sie besser unsere.“
Das klingt nach einem längeren Aufenthalt. Aber auch sinnvoll. Wolf gibt nach.
„Kleidergröße?“
„Weiß ich nicht“, antwortet der Zwanzigjährige.
Der andere mustert ihn kurz. Mit abschätzig verzogenem Mund verschwindet er im Hinterraum.
„Alles!“, befiehlt der Mann mit der Goldrandbrille, als er wieder erscheint, und weist auf den Slip.
Wolf ziert sich etwas, beugt sich aber den Gepflogenheiten.
Die Märznacht ist kalt, eilig legt er das Überreichte an: graue Unterwäsche der praktischen Art aus Feinripp. Einen blauen Kunstfaser-Trainingsanzug. Dazu gibt es nagelneue Halbschuhe, Marke ‚Granit‘. Die Schnürsenkel sind zu entfernen.
Nichts Persönliches bleibt an ihm, auch kein Ring. Die Schachtel Streichhölzer schiebt er sich unbemerkt in die Hosentasche.
Über drei Etagen aufwärts geführt, vorbei an vielen breiten, grau gestrichenen, schweren Holztüren mit Spion, geht es durch eine davon, herein in eine Zwei-Mann-Zelle. Zwei hünenhafte Uniformierte mit Gummiknüppel am Gürtel, die wie zum Sprung bereit aussehen, füllen sie beinahe komplett aus. Man belehrt ihn zur Hausordnung. Die besagt etwa, dass man an die Wand zurückzutreten und Meldung zu machen hat, wenn die Zellentür geöffnet wird – das Gesicht stets zur Tür gewandt.
Als sie weggehen, fragt Wolf nach einem Anwalt. Antwort erhält er keine. Die Tür wird verriegelt.
Bald darauf kommen sie zurück, treten ein und legen ein Blatt mit lokaler Anwaltsliste auf den schmalen Tisch. Vogel in Berlin, der Abschiebeanwalt, steht nicht darauf.
„Nur die können Sie nehmen“, wird ihm gesagt.
Wenigstens ist A. gelistet, dem man das gleiche Geschäft nachsagt. Die anderen vier auf der erstaunlich kurzen Liste kennt Wolf nicht. Entscheiden muss er sich sofort.
‚Na, den Bock wollen wir ja nicht zum Gärtner machen‘, denkt er und unterstreicht A. Zu seiner Genugtuung wechseln die Uniformierten einen wissenden Blick.
‚Tja, ganz so unbeschlagen bin ich eben nicht, Leute‘, findet Wolf still, eine Spur besser gelaunt.
Die Stasi-Leute gehen.
Essen wird hereingegeben. Es ist ein beiger Plastikteller mit zwei Margarinesternen. Dazu je zwei Scheiben Mischbrot und Sülzwurst. Hier nennt man sie ‚Fensterwurst‘, erfährt er später, weil sie so dünn ist, dass man hindurchsehen kann. Weiter gibt es einen Plastikbecher mit Henkel, der kalten ‚Muckefuck‘, also Malzkaffee, enthält. Ungenießbares Zeug.
Wenigstens ist zum Runterspülen fließendes Wasser am Waschbecken vorhanden. Oder ist das präpariert? Jedenfalls schmeckt es normal.
Allein gelassen, verzehrt er alles.
Es ist die minimale Versorgung, die er noch aus dem Kinderferienlager kennt. Die es immer gab, wenn man zu spät kam und nichts anderes an Genussvollem mehr da war.
Zu seiner Überraschung ist es ein Uniformierter, der das Geschirr bringt und auch wieder abholt. Wohl um den Kontakt mit anderen Insassen zu vermeiden, machen die das hier. Zwei Riegel verschließen knallend die Holztür. Von innen ist sie vollständig mit grauem Blech beschlagen. Ein Schlüsselbund rotiert.
Erstmals sieht er sich um. Den Raum erhellt ein typischer ‚sibirischer Kronleuchter‘, bestehend aus einer einzelnen Glühbirne. Sie ist über der Tür in eine Mauernische eingelassenen, die mit klarem Plastik abgedeckt wurde. So ist sie unerreichbar. Wolf betrachtet die sinnige Konstruktion. Das Licht bricht sich im Kunststoff in feinen, irisierenden Kreisen. Er kneift die Augen zusammen, um den Eindruck zu verstärken. Es sieht nun aus wie nach einem langen Schwimmtraining im Chlorwasser. Die Welt ist danach immer eine Zeitlang wie in Regenbogenfarben getaucht. Für einen Moment erinnert er sich an die angenehme Mattigkeit nach dem Sport, wenn er wie in Trance nachhause lief.
Himmelweit entfernt ist das jetzt.
Ein Bettlaken gibt es nicht, dafür zwei dünne Wolldecken. Warm genug ist der Raum immerhin, wenn er die Lüftungsklappe nicht öffnet. Draußen ist ja noch Winter.
Auf den drei Seegraspolstern der Holzpritsche sind Flecken, über deren Herkunft Wolf lieber nicht sinnieren will.
‚Gott o Gott, wo bin ich hier gelandet‘, denkt er noch, wickelt sich fest in die Decken und schläft sofort ein.
„Gesicht frei!“, ruft irgendwann einer, der durch den Spion blickt.
‚Was will der? Ach ja, die Hausordnung‘, erinnert sich Wolf schlaftrunken und zieht sich die Decke vom Kopf. Eine miese Regel, denn hier gibt es wohl Dauerbeleuchtung. Traumlos vergeht die Nacht.
*
Kurzes, hartes Klopfen weckt ihn am Morgen. Wolf ist sofort hellwach und voller Tatendrang. Einen Augenblick lang muss er überlegen, wo er eigentlich ist. Es ist wohl schon etwas später, eine Uhr hat er ja nicht. Ach ja, da war das stundenlange Verhör gestern.
Es scheint angebracht zu sein, aufzustehen. Rasch angekleidet und gemäß Anstaltsordnung die Decken zusammengefaltet am Fußende der Pritsche platziert, wartet er.
Lange passiert nichts. Zu seiner Überraschung öffnet sich eine Metallklappe, die in der Tür eingelassen ist. Eine kleine, hellgelbe Plastikschüssel wird daraufgestellt.
Er zögert.
„Essen fassen!“ Auf den barschen Befehl hin greift er zu.
Es ist Kohlsuppe ohne sonstige Zutat.
„Will ich nicht“, sagt er später zu dem abholenden Uniformärmel und stellt sie auf die Luke.
„Hier wird aufgegessen. Oder wollen Sie das Essen verweigern?“
„Na gut“, sagt Wolf leise, eine Lösung parat. Er nimmt die Schüssel und appliziert den Inhalt direkt ins WC. Dem Ärmel genügt es, dass sie nun leer ist.
Weiterhin geschieht – nichts.
Wolf hat Zeit, über seine Situation zu grübeln. Diese Untersuchungshaftanstalt wird von der Staatsicherheit betrieben, die den Insassen ihre Allmacht sichtlich en Detail spüren lässt. Der Delinquent – Verdächtiger wäre zu viel gesagt, denn seine Anwesenheit beweist ja bereits seine Schuldigkeit – gibt mit der Kleidung auch seinen Namen ab. Er ist jetzt ‚46/1‘, benannt nach Zellennummer und Holzpritsche. Immerhin sind ein WC, ein Waschbecken, ein Handtuch sowie Tisch und Stuhl vorhanden. Allerdings kein Spiegel. Also ist er nur mehr ein Körper – in fremder Kleidung, namenlos und selbst sein Gesicht kann er nicht sehen. Hier soll man wohl fertiggemacht werden, was sonst. Staatsfeind, was sonst.
Gegen halb vier Uhr nachmittags wird Wolf einem Haftrichter vorgeführt, wie er auf dessen goldener Armbanduhr sehen kann. Der vitale, kleine Mann Anfang dreißig wirkt beschäftigt, eine Routinesache. Die Sekretärin neben ihm trägt ein hochgeschlossenes, enges rotes Top, das am Busenansatz dreieckig ausgeschnitten ist. Eindeutig West- oder ganz hochwertige ‚Exquisit‘-Ware. Hier lässt sich’s offenbar leben. Noch unterliegt Wolf der Illusion, dass sich die Sache jetzt aufklären ließe und er gehen könne. Ein paar öffentliche Losungen sind ja nun wirklich nicht die Welt. Doch weit gefehlt: Als Begründung für die angeordnete Untersuchungshaft steht auf dem Vordruck knapp ‚§§ 220‘. Ein kleines schwarzes Kästchen rahmt die folgenschweren Zeichen ein.
„Was heißt das?“, fragt er.
„Öffentliche Herabwürdigung“, wird ihm unwirsch erklärt, so als wüsste das jeder. Wolf hört zum ersten Mal davon.
„Und das rechtfertigt Untersuchungshaft?“, wirft er recht unpassend ins geschäftige Treiben ein.
„Wissen Sie überhaupt, was Anarchismus ist?“, blafft ihn der Jurist zornig an.
Das soll also die Antwort sein? Augenblicklich wird ihm klar, dass der Mann hier nur die Schreibkraft ist, die etwas erledigt, was andere festgelegt haben. Offenbar ist es zwecklos und Wolf spart sich jede weitere Bemerkung.
Zurück im Zellentrakt wird er sofort in eine Einzelzelle verlegt. Das geht schnell, denn bis auf die Wolldecken und das Handtuch ist nichts mitzunehmen. Besteck und Sanitärsachen befinden sich vor der Zelle in einem Regal.
‚Nun denn also, 44/1‘, stellt er nüchtern fest. Wobei die 1 ja sinnlos ist, denn eine weitere Pritsche passt gar nicht hinein. Also ist er einzig wegen Utz’ Anarchistenzeichen hier, nicht wegen der Losungen? Schön blöd. Wusste er’s doch, dass das Symbol Mist war.
Jetzt ist er Einzelhäftling. In einer Einrichtung, die ihn einfach geschluckt hat. Und bald dünkt ihn, dass sie ihn auch lebendig begräbt. Man kennt das ja aus dem Kinofilm ‚Papillon‘. Die Episode, als McQueen in einer Einzelzelle in Französisch-Guayana sitzt. Wo er Tausendfüßler isst und dann ziemlich abgerissen nach drei Jahren rauskommt. Das ist aber in der ungerechten Welt der bösen Kapitalisten gewesen, in Kolonial-Frankreich. Den Streifen hatte er in den ‚Goethe-Lichtspielen‘ auf dem Boulevard der Stadt gesehen.
Hier bei der Staatssicherheit gibt es jedenfalls keine Tausendfüßler, nicht mal Kakerlaken. Hier endet er bestimmt nicht so. Oder wie?
Wolf hat Muße, das merkwürdige Sein dieser Einzelzelle ausgiebig zu betrachten. Bald kennt er jedes Detail. Das Gebäude mit seinen dicken Ziegelmauern ist vorsozialistisch, wahrscheinlich aus der Kaiserzeit. Rechts neben der Zellentür steht ein mächtiger grauer Rippenheizkörper an der Wand. Die Seitenwände sind bis auf Brusthöhe mit derselben blaugrauen Ölfarbe gestrichen. Es ist denkbar eng. Den Arm ausgestreckt und die linke Hand flach auf eine Wand gelegt, reicht der Platz auf der anderen Seite nur bis zum Ellenbogen. Dafür ist die Zelle ganze sechs Schritte lang.
Das Fenster gegenüber ist eigentlich keines. Dort sind Glasbausteine eingemauert. Einmal von oben herab auf der Innenseite. Eine Handbreit dahinter erneut, diesmal von unten aufwärts. Die letzte Reihe Glasziegel hat man dabei jeweils weggelassen. So kann der Delinquent nicht hinaussehen, doch Frischluft ist gegeben. Gemein, aber wirkungsvoll. Gegen Kälte ist eine beige lackierte Holzklappe waagerecht dazwischengesetzt. Sie knarrt, als Wolf sie öffnet, und ist eingestaubt.
‚Hier war wohl lange keiner‘, denkt er seufzend. Sicher ist er ein Einzelfall.
Mehr als schummriges Tageslicht und den Schatten eines Gitters kann er hinter dem trüben Glas nicht erkennen. Hier endet alles Sichtbare.
Die Einzelzelle ist eine völlig stille Welt, nur gelegentlich von Geräuschen gestreift. Wer aus der lärmenden Stadt kommt, ist zunächst wie betäubt. Die Zeit tröpfelt langsam dahin; zäh, endlos. Ein unbändiges Verlangen nach Freiheit, Bewegung, Luft und Sonne – Dingen, die er ganz selbstverständlich immer hatte – erfasst Wolf. Und dennoch ist es nicht zu befriedigen. Der äußere Zwang ist jede Sekunde spürbar. Sentimentaler Schmerz packt ihn. Mit einem Streichholz kratzt er ein paar sehnsüchtige Verse in den Staub der Lüftungsklappe, wohl wissend um ihre ungelesene Vergänglichkeit. Was man glaubt, denkt, hofft, hat hier keine Bedeutung. Das Personal agiert einzig mit knappen Anweisungen. Existiert er überhaupt? Ist der Mensch mehr, oder doch nur die Vorstellungswelt im eigenen Kopf? Es ist, als sei nichts vorhanden außer Imagination. Bloß kein Selbstmitleid jetzt. Genau das ist ja das Ziel der Staatssicherheit, die ihn als Feind sieht. Die Absicht, den Verhafteten mürbe zu machen; ihn in Selbstzweifel über seine Überzeugungen zu stürzen. Was er ihnen nicht liefern wird.
Kleine Geräusche werden zu Sensationen.
Tauben gurren draußen auf einer Dachrinne. Was ihn zunächst erfreut, erscheint ihm bald wie der Totengesang für lebendig Begrabene.
Jemand in der Nachbarzelle klopft an die Wand. Wolf klopft zurück. Der andere wiederholt. Er auch. Sichtlich will der ihm etwas mitteilen, doch Wolf kennt die Sprache nicht, kommt zu seinem Bedauern auch nicht darauf. Er gibt auf.
„Frau Meister, die Küche!“, ruft draußen eine Frau.
Drei, vier Mal, in Abständen. Sie ist ihm schon ganz vertraut. Jeden Abend tut sie das, vermutlich gegen fünf oder sechs. Sicher ist es eine Gefangene. Wie alt mag sie sein? Dreißig, vierzig vielleicht?
„Fragen sind an den Vernehmer zu stellen“, schnarrt die Essenausgabe, als er einmal wissen will, wie lange das hier denn dauert. Dann schenkt er weiter schweigend aus.
Jeden Tag verlangt Wolf nun, zum Vernehmer gebracht zu werden. Doch der holt ihn nicht. Will ihn wohl weichkochen oder hat einen anderen Fall. Oder... wer weiß.
Am dritten Tag gibt man ihm ein Buch durch die Klappe. Auswahl gibt es keine. Es ist „Ole Bienkopp“ von Erwin Strittmatter, ein Schmarren über die Segnungen der Bauernkollektivierung. Immerhin erwähnt der Autor, dass die Kühe in den neuen Rinderoffenställen im Winter tot umfielen, wo nun ja eigentlich Luft und Licht zum Wohl der Tiere rein sollte. Und dass die offenen Stalltore jemand von der Partei mit Lederjacke befohlen hatte, ein Funktionär halt. Ansonsten sei aber alles bestens. Diese Dörfler lernten nun, was sozialistischer Fortschritt ist.
Wolf zwingt sich, jeden Tag nur fünfzig Seiten zu lesen. Das müsste reichen bis zur nächsten Buchausgabe in einer Woche.
Unter den Buchstaben des Textes sind Punkte und Striche mit Fingernagel eingedrückt, die er aber nicht deuten kann, die für ihn keinen Sinn ergeben. Ein Buch im Buch.
‚Na ja, was für Literatur mag das wohl schon sein‘, denkt Wolf und weiß doch, dass er nur der Fuchs in Äsops Fabel von den Trauben ist, der sie verschmäht, weil er sie nicht erreichen kann.
Das Wochenende ist ausgesprochen tragisch. Die Verwaltung ist auf Minimalbetrieb, gar nichts passiert im Ziegelgemäuer. Der Stasi-Apparat hat frei. Nur er selbst ist, unter Verkettung unliebsamer Umstände, in die Falle, soll heißen: die Zelle, geraten. Pech gehabt.
Immerhin bringt man ihn täglich zum Freigang in eine Hofbuchte, wortlos. Für eine geschätzte halbe Stunde sieht er zwischen hohen grauen Wänden den Himmel. Kann frei durchatmen. Oder geschieht das nur, um ihn auf grausame Weise an das zu erinnern, was er verloren hat? Das könnte denen so passen. Wolf beschließt, es als Vorteil zu sehen.
Oben am Gemäuer sieht er die gurrenden Tauben. Sie sitzen auf einer zerlöcherten Dachrinne, die, um sie zu vertreiben, offenbar mit Kleinkaliber beschossen worden ist. Was aber nicht gelang. Der Gedanke kommt ihm, dass sie frei sind, dass sie zur Saaleaue fliegen könnten, die ganz in der Nähe ist, einfach so. Doch will er darüber lieber nicht weiter nachdenken. Es ist zu schmerzlich.
Einmal schreit jemand unten im Gebäude, vielleicht im Keller. Glas splittert. Womit kriegt der nur die Glasbausteine kaputt? Wohl mit dem Stuhl. Er muss schon recht kräftig sein. Der arme Teufel ist wohl ausgerastet. Hastige Schritte im Gang, dann Stille.
Einmal führt man Wolf in den Keller. Auf einer uralten Holzstellage aus der Kaiserzeit hat er Platz zu nehmen. Eine Stativkamera fotografiert von vorn und im Profil. Dazu bedient der Uniformierte kurioserweise einen mechanischen Hebel, der den Sitz unter ihm dreht. Es geht eben nichts über altbewährte Technik. Eine hölzerne Plattenkamera mit qualmendem Blitz hätte ihn hier nicht verwundert.
In einer Ecke steht eine mannshohe Stellage unbekannter Funktion. Sie ist mit Stoff abgedeckt. Ist wohl ein Lagerraum, denkt Wolf.6
Würde er sich wegen Sehstörungen zum Optiker melden, käme sicher sein Ex-Chef vorbei. So könnte er sich draußen bemerkbar machen! Einmal im Monat, immer Mittwoch nachmittags, wenn das Ladengeschäft geschlossen ist, nimmt er hier Refraktionen vor.
Brillenreparaturen für die Insassen hatte Wolf öfters gemacht. Auf die Auftragstüten hatte der Chef nur römische Ziffern geschrieben, keine Namen. Alle waren aber unter derselben Anschrift, was Wolf verwundert hatte. Bis Kollegen ihm die Ursache verrieten. Nun firmierte er selbst unter dieser Adresse – Ironie des Schicksals.
Der Versuchung, sich vorführen zu lassen, widersteht er. Sie könnten sich ja doch nur schweigend mit Blicken verständigen. Sicher würde der alte Chef die Nachricht seiner Haft verbreiten, doch dessen mitleidige Miene ist das Letzte, was er jetzt braucht. Helfen kann der auch nicht. Außerdem, wie kam der überhaupt in diese Vertrauensstellung bei der Stasi? Womöglich ist er selbst ein Zuträger, eine von den ‚gesellschaftlichen Kräften‘.
Wintertag
Die Verhaftung fand an einem jener grau-gelben Wintertage statt, von denen man kaum erwartet, dass sie das ganze Leben ändern. Anfangs war er sogar noch ein wenig azurblau und sonnig gewesen. Wolf hatte wie gewöhnlich morgens ab sechs Uhr Rettungsschwimmerdienst.
Das Stadtbad gehört seltsamerweise zum ‚VEB Frisur und Kosmetik‘7 und nicht zum Betrieb Naherholung, wo der Vater arbeitet. Es ist ein Kuppelbau mit Türmchen und Bögen und dicken Mauern, beinahe wie eine Festung. Innen gibt es hübsche grüne Jugendstilkeramik, auf der Meeresgott Poseidon mit Dreizack und Blumenmustern posiert. Froher Bürgersinn hatte das einst erdacht. Leider ist hier stets eine wenig zuträgliche Dampfatmosphäre.
Am ovalen Beckenrand liest er oft, auch wenn das nicht gern gesehen wird. Kommt Frau Wurms, ein sportlich-langer, blonder, borstiger Besen, so reißt sie ihm meist das Buch aus der Hand. Frau Larnski, die Chefin, interessiert sich eher für den Text. Sie hat Kinder in seinem Alter. Bald ist sie dann mit ihm in ein Gespräch vertieft, bei dem sie ihr eigentliches Anliegen schon mal vergisst. Da sie das weiß, kommt sie wohl lieber nicht so oft vorbei, vermutet Wolf.
Schon beim Vater, im Freibad am Rande der Döhlauer Heide, arbeitete er in den Schulferien als Rettungsschwimmer. Der Vater leitet das ‚Objekt Heidebad‘. Und seit er sechs Jahre alt ist, schwimmt Lenni Wolf. Allerdings mit mäßigem Erfolg. 1:32 min ist seine jemals beste Wettkampfzeit. Das war auf hundert Meter Kraul bei den Stadtmeisterschaften. Sein Stil ist ganz gut, doch für die Sportschule, wie bei Sandkastenfreund Holger, reichte das nicht. Vorteilhafterweise, sagte er sich. Denn diese Leute haben immer grünlich schimmernde Haare vom Chlorwasser. Er beneidete ihn aber doch. Holger ist eigentlich dünn, aber wenn er mit den Armen krault, sieht es aus, als kreisten zwei Propeller durchs Wasser, so schnell ist er.
Auch aus einem anderen Grund sind ihm die Stadtmeisterschaften in unliebsamer Erinnerung. Das liegt an einem Wettkampf, bei dem er auf Bahn 8 startete – direkt unter der Zuschauertribüne. Anfangs lief es gut, doch nach der Wende riss ihm beim Rückenkraulen der Badehosengummi. Schwimmen oder die Hose festhalten war nun die Frage, und er entschied sich für Letzteres. Leute beugten sich grinsend über das Geländer. Einarmig rudernd kam er als Letzter ins Ziel. Zwar feixte niemand der Kameraden, schließlich hätte es jeden treffen können, doch für den Elfjährigen war die Schmach vollkommen gewesen.
Mit dem Sport ist er jedenfalls so verbunden, dass selbst die Staatsicherheit ihre Akte über ihn später „OV Schwimmer“8 nennen wird.
Utz, bei dem Wolf inzwischen in der Dachmansarde wohnte, ist wie er selbst voller Lebenshunger und Neugier. Sie testen Grenzen und philosophieren wild über die Welt, ihren Sinn und das Leben überhaupt. Was man als Neunzehnjähriger eben so macht. Jetzt liest Wolf nur noch das, was man die ‚ernste Literatur‘ nennt. Alles andere hielte einen doch nur auf. Mit beglücktem Stolz erwarb er zuletzt die zweibändige „Kritik der reinen Vernunft“ von Kant.
„Lebe so, dass die Maxime deines Willens jederzeit Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung sein kann“, schrieb der. Nicht übel.
Max Stirners Buch „Der Einzige und sein Eigentum“ wiederum, ein Hohelied auf den Egoismus, hat ihm Baader einmal auf der Straße gegeben. Ebenso wie Ossip Mandelstam.
„Der hat im Gulag gesessen“, sagte er verschwörerisch.
Das war vertrauensvoll, denn das Thema ist ein Tabu. Sachen weiß der!
Baader ist selbsternannter Poet. Er nennt sich so nach seinem Vorbild aus der Weimarer Republik, einem verrückten Berliner Dadaisten. „Ich bin, also ist Schönheit“, heißt dessen Buch. Matthias Holst, so sein richtiger Name, ist fünf Jahre älter, rappeldürr und recht beliebt. Zuletzt kam er braungebrannt und den Duft von Freiheit verströmend von einer Bulgarienreise zurück. Eine Frau, die seine Prosa schätzt, hatte ihm den Urlaub geschenkt, was doch erheblich seinen Ruhm mehrte. Baader betreibt Sprachakrobatik aus Satzfetzen, ziemlich kurios und stets bedeutungsschwanger. Den Job bei der Universitätsbibliothek hat ihm seine Mutter besorgt.
Dort findet Wolf auch vergessene Schreiber, wie Beumelburg, Lezius und Flex in einem alten Register abseits des Hauptarchivs. Viele der Karteikarten wirken wie aus einer anderen Zeit. Sie sind geschwungen mit Tusche geschrieben, beinahe gemalt, und schwer lesbar. Doch es gibt sie und selbst die Bücher dazu! Jemand musste all das über die Zeit gerettet haben. Wolf fühlt sich reich beschenkt. Wie viel Wissen kann man doch erwerben!
Manches ist hier im ‚Giftschrank‘ und nur im Lesesaal mit ‚wissenschaftlichem Nachweis‘ erhältlich, wie etwa O. Weininger. Weil er es unbedingt lesen will, fälscht er den Nachweiszettel. Es war aber schwülstiger Unsinn und die Sache nicht wert, denn gesperrt werden wollte Wolf hier nicht. Zwar hat er noch einen weiteren Ausweis, den der Karl-Marx-Universität Leipzig, doch dort gibt es nur Nachkriegsware, sozialistische Literatur. Die Stadt wurde im Krieg ausgebombt. Jedenfalls fand er zu seiner Enttäuschung nichts anderes.
Bis zum Ende der Schulzeit war es die Mutter gewesen, die Lenni an Feiertagen die neuesten Jugendbücher schenkte. Das waren sozialistische Belehrbücher wie „Das Mädchen von Ruda“ von Werner Heiduczek. Eines Tages wird man ihn zu den Müllkippen-Autoren zählen. Aus der Sowjetunion kam „Elli im Wunderland“, dazu Geschichten von sibirischen Tierkindern und, über den Deutschunterricht, „Timur und sein Trupp“. Eine Alphabetisierungskampagne lief gerade rund um die Welt, angetrieben von den sozialistischen Ländern. Man war stolz darauf, lesen zu können.
Der Vater hatte einiges aus dem Militärverlag. Darin war alles Jetzige gut, das Vorsozialistische hingegen böse.
War der Vater mit dem Tagwerk seiner Baustatik durch, hatte er in der Deutschen Bücherei immer in Westbüchern geschmökert, die es nur hier gab. Am liebsten las er von der Fremdenlegion, seinem Steckenpferd. Dann träumte er von Abenteuern in fernen Ländern und von Kämpfen unter Einsatz des Lebens – in Camerone oder in Dien Bien Phu, der Dschungelfestung. Manchmal nahm er Lenni in diese Bibliothek mit. Zwar war es langweilig, denn der Vater wurde ärgerlich, wenn man ihn störte, doch der große Lesesaal mit den schweren Eichentischen, dem gedämpften, grünlichen Licht und der so ernsthaften Stille imponierte ihm.
Zuhause bei den Eltern trug Lenni das dauernde Lesen den Spitznamen ‚zerstreuter Professor‘ ein, denn wurde er plötzlich etwas gefragt, musste er sich erst wieder in die Gegenwart zurückfinden. Der Bruder, der ein Jahr jünger ist, las ungern. Das Konzentrieren auf eine Sache strengte ihn an. Er ‚tobt lieber rum‘, wie die Mutter es nannte.
Zuhören konnte er aber. Gingen sie sonntags im Wald spazieren, lauschte auch er hingerissen dem Vater, der sich ein Forscherteam auf Reisen in der Saurierzeit ausgedacht hatte und die Geschichte öfters fortspann, um den langen Weg abzukürzen.
„Der Körper braucht Luft und Bewegung“, war seine stetige Predigt, wobei er rasch voranschritt. Da half kein Jammern über platte Füße.
*
Dieses, sein neues Leben, hatte eigentlich, wenig prosaisch, aus Langeweile begonnen. Er war vierzehn Jahre alt geworden und verbrachte wie jedes Jahr die Sommerferien bei der Großmutter im Harz. Diese bemerkenswerte Frau mit ihren fünf Vornamen, von denen er sich immer nur drei merken konnte – Helga, Hedwig, Aline –, lebte mit ihrem Mann in einem großen Bürgerhaus. Ihr Papa Karl hatte es einst erbaut. Zeitliche Zwänge, so wie bei Lenni in der Neustadt, kannte sie kaum. Beim Frühstück in der Gartenlaube plauderte sie gern von der alten Zeit, als ihr Papa noch das Fagott im Orchester des Herzogs spielte, oben im Schlosstheater. Meist schlief sie dabei ein, bloß um eine Stunde später, wieder wach geworden, weiterzuerzählen.
Die Großmutter hatte er sehr gern. Viele Anekdoten kannte sie: schöne und tragisch-romantische, traurige und lustige. Im Wald etwa, auf halbem Wege zum Jagdschloss, zeigte sie Lenni eine Holzbank. ‚FÜR FAULE‘ war dort eingraviert.
„Das heißt: Friede und Ruh’ Finden Auch Unglücklich Liebende Einmal“, erklärt sie.
„Da hat sich ein Liebespaar erschossen. Die Eltern wollten die Verbindung nicht, sie war nicht standesgemäß. Ist das nicht tragisch?“
Da war er plötzlich froh, im Sozialismus zu leben. In der neuen Zeit, wo alle gleich sind.
„Die Russen haben uns befreit. Von allen guten Dingen haben sie uns befreit“, war auch einer ihrer Sprüche, wenn wieder einmal etwas nicht zu bekommen war, in der Mangelwirtschaft.
„Und um hundert Jahre zurückgeworfen“, ergänzte sie, wenn sie sich einmal richtig ärgerte.
„Großmutter, wenn das einer hört!“, sagte Lenni dann erschrocken.
Die Russen sind sakrosankt, das sind die ‚Befreier‘. Sagt man nichts Positives, so hat man sie zumindest zu ignorieren. Einfach, als gäbe es sie gar nicht. Man sieht sie ja auch kaum. ‚Frage dich, wen du nicht kritisieren darfst, und du weißt, wer herrscht‘, soll ja Voltaire einmal gesagt haben. Die Großmutter findet er mutig.
Abb. 1 In der Laube im Harz
„Ich bin doch eine alte Frau. Was soll mir schon passieren?“, pflegt sie dann zu sagen.
Sie hatte sicher recht. Eines Tages im Sommer kam ein Brandschutzkomitee ins Haus. Es waren drei Männer mit dicken Aktentaschen, die sich überall umsahen. Kurz danach musste sie erklären, woher der antike Sekretär stammt, der im Wohnzimmer steht. Eigentlich kam er aus dem Anhaltiner Schloss, doch sie hatte ihn wirklich und wahrhaftig nach dem Krieg für 600 Mark gekauft und besaß eine Quittung. Da zogen die Herren verdrossen wieder ab. Wie sich viel später zeigte, waren die Leute von der Stasi gewesen. Sie durchsuchten Privathäuser nach Antiquitäten und filmten heimlich dabei. Konnte der Besitzer das Eigentum nicht nachweisen, wurden die Sachen beschlagnahmt und an einen Westpolitiker für Devisen verkauft.9 Der saß mit ihnen in der deutschdeutschen Verkehrskommission und sollte sich eigentlich nur um die paar Transitstraßen kümmern, die nach Westberlin gehen.
‚Es gibt doch hässliche Menschen, nicht wahr?‘, pflegte die Großmutter bei solchen Dingen zu sagen.
Womit sie aber den Charakter meinte und nie das Äußere. Es widersprach eben ihrem ästhetischen Empfinden. Dann wechselte sie gleich zu Schönerem. Wie etwa in jene Zeit, als Herr von Otterstedt sie die Landschaftsmalerei lehrte. Oder sie sprach über ihr Studium an der Kunstschule des Westens in Berlin-Charlottenburg. „Ich wollte so gern Bildhauerin werden, aber das war zu schwer für mich.“ Oder, oder...
In dieser alten Villa am Ostrand des Harzes, in der Dachmansarde, welche die Großmutter die ‚Schlafkoje‘ oder ‚das Kabinett‘ nannte, stand ein altes Bücherregal, das Lenni zunächst ärgerte, weil es Platz wegnahm. Da es nun aber einmal da war, beschloss er, es näher zu besehen. Es war ganz erstaunlich. Verstaubte Bücher standen hier hinter einem Vorhang, unberührt, so als harrten sie ihrer Erweckung. Die meisten waren aus Großmutters Kindheitswelt, die eine so gänzlich andere als die seine gewesen war. Da gab es „Brinker oder Die silbernen Schlittschuhe“, mit fein silbern ziseliertem Einband. Und dicke Bände der „Gartenlaube“, die ihre Eltern gelesen hatten. Auch „Leutnant Völkes Reise nach Afrika“, ein Privatdruck auf dickem Glanzpapier. Die Albumin-Fotos darin, die jedes Detail erkennen ließen, zeigten Großwildjäger mit Flinte über zahllosen erlegten Löwen und Antilopen. Der Offizier hatte es einst der Familie geschenkt. Solche Leute gab es doch sonst nur in Geschichtsbüchern! Seine Großmutter aber hatte sie gekannt! Die Texte zwangen Lenni dazu, Frakturschrift zu lernen, und das unscheinbare Regal wurde zum Tor in eine andere Welt.
Ein kleines Werk, ein ganz schmales mit verrosteten Klammern, berührte ihn. In vorwurfsvoller Trauer beschrieb es die Ermordung des russischen Zaren durch die Bolschewiken. Das war unerhört. Nach seinem sozialistischen Schulwissen galt der Adel als dekadent und der Zar wurde 1918 zu Recht erschossen. Hier aber war von der ganzen Familie die Rede, und es dauerte ihn unendlich, dass auch die Töchter, die doch in seinem Alter waren, umgebracht worden waren.
Was konnten diese Mädchen denn schon Übles getan haben? Außerdem sahen sie mit ihren langen Locken und ihren Spitzenkleidern schön aus. Solche Kleider trug einst auch die Großmutter auf ihren Kinderfotos. Damals, als ihr Vater den Ratsdienereid auf den Herzog von Anhalt geschworen hatte. „Helga hatte es gut. Wir hingegen waren immer viele“, sagte Eva, die Westberliner Tante, die als Kind in den Sommerferien oft im Kurort gewesen war. „Wenn sie ihren Mittagsschlaf hielt, mussten alle im Haus still sein.“
Eigentlich war Helga ja auch eine Prinzessin gewesen, dachte Lenni stolz. Schließlich war ihre Oma eine geborene ‚von der Heyden‘ gewesen. Sie starb jung und von wem ihr Sohn war, wusste niemand. Der Pfarrer erkannte das musische Talent und schickte Karl auf ein Konservatorium.
Abb. 2 Foto aus „Der Dornenweg des letzten Zaren“, Berlin 1931. Rechts nachträglich coloriert (Olga Shirnina).
Das gewichtigste von all den Büchern aber war Schopenhauers „Grundprobleme der Ethik“ gewesen. Weder wusste Lenni, was Ethik war, noch, dass es da Probleme gab. Viele griechische Zitate ohne Übersetzung fanden sich im Text eingestreut. Während die Sommersonne mild durch das kleine Fenster schien und die gekalkten Wände golden schimmern ließ, arbeitete er sich eisern durch, kaum die Hälfte verstehend. Das Altgriechisch aber, das blieb ihm trotzdem ein Rätsel. Er kannte niemanden, der die Sprache verstand.
Bildung, sagten alle immer wieder, sei wichtig und nützlich. Und so lernte er. Offenbar stimmte aber die Richtung nicht, die Bücher hier waren ja verboten. Oder zumindest als bürgerlich verachtet. Der Einzige, mit dem er das Interesse teilte, war Klassenkamerad Thomas, jedoch nur, weil der Antiquitäten schön fand und sammelte.
Dass es eigentlich die Systemfrage war, auf die er so unbedarft zusteuerte, zeigte sich bald.
Abb. 3 Halle – Neustadt. 2.Wohnkomplex am Zollrain 1988
Wintertag II
Am Verhaftungstag erschien um acht Uhr der ‚Schwimmverein 1905‘ im Stadtbad. In den Holzkabinen, die das Oval des türkisblauen Beckens umstanden, zogen sich die alten Damen gemächlich um.
„Ob sie wohl noch aus der Gründungszeit des Bades stammten?“, sinnierte Wolf, während er die Schwimmerinnen beaufsichtigte. Er rechnete die geschätzten Lebensalter zusammen. Siebenhundert Jahre waren es bestimmt. Ihr langsames Treiben im Wasser bereitete ihm stets Kopfzerbrechen und er grübelte, wie wohl diese oder jene gewichtige Dame im Notfall herauszuziehen wäre, falls das nötig sei, und ob ihm das überhaupt gelänge.
Nach einer Stunde war es glücklicherweise vorbei und das Schulschwimmen mit den Sportlehrern begann. Er hatte nun etwas frei und ging zur Post.
Draußen war es bitterkalt. Wie Winters immer, lag ein gelblicher Dunst über der Stadt. Es lag an den vielen Öfen, die mit Braunkohle geheizt wurden. Anders als in Neustadt hatten hier nur wenige Leute eine moderne Fernheizung. Kleine Häufchen schmutzigen Schnees säumten die Bürgersteige, zusehends schrumpfend, denn geschneit hatte es schon seit Wochen nicht mehr.
Auf der Post trifft er einen Bekannten seines Alters, den er wegen seiner Wichtigtuerei aber nicht sonderlich schätzt. Er redet immer laut und blickt dabei in die Runde, um zu sehen, ob ihm auch gelauscht würde. Sie wechseln ein paar Worte. Er sollte der Letzte sein, mit dem Wolf in diesem Land, in dem er sein ganzes Leben verbracht hatte, in Freiheit spricht.
Zurück im Bad schiebt Wolf noch zwei Stunden Dienst, was überwiegend Herumstreifen und Plaudern mit der Garderobenfrau Lilo bedeutet. Die ist etwa sechzig und noch recht fesch für ihr Alter. Bei den Gesprächen hat sie die Angewohnheit, dem jungen Kerl deftige Geschichten aus dem Alltag des Bades zu erzählen. Dabei sitzen sie im Aufenthaltsraum und rauchen. Oft spielt sie geziert mit dem Zipfel ihrer blauen Schürze, der auf dem Oberschenkel ihrer überschlagenen glatten, dünnen Beine liegt. Lilo war einst, so sagt man, im KZ gewesen, erhielt aber zu ihrem Ärger keine dieser hohen VVN-Renten, da sie nicht politisch, sondern als Prostituierte dort war.10 Dass Wolf immer recht bald zu lesen beginnt, irritiert Lilo jedes Mal. Dann greift sie zum Kreuzworträtsel in der ‚Freiheit‘, der örtlichen Tageszeitung der Staatspartei.
Sein aktuelles geliehenes Buch stammt von der Friedensbewegung und aus dem Westen. Bastian und Kelly heißen die pazifistischen, grünen Helden darin. Sie sind fortschrittlich und visionär, geradezu revolutionär. Allerdings auch kurios. Er hat das Buch abfotografiert. Die selbst entwickelten Filmrollen und ein paar andere Bücher deponierte er im leeren Spind neben seinem eigenen, damit die Sachen ihn nicht kompromittieren. Eine sinnvolle Maßnahme, wie sich bald zeigt, denn die Stasi wird sie nicht finden. Frau Larnski vielleicht, aber die hat sie ihnen wohl nicht ausgehändigt. Er sieht die Dinge nie wieder.
Gegen vierzehn Uhr, bald schon Feierabend, ruft ihn die Chefin per Haustelefon zu sich. Er trifft sie bereits in der Vorhalle, sie ist ihm entgegengelaufen. Es musste wohl wichtig sein.
„Auf Sie warten zwei Herren. Die sind heute Morgen schon mal dagewesen, aber ich habe sie weggeschickt“, erklärte sie, ihn verschwörerisch anblickend, so als hätte sie ihm einen Gefallen getan.
„Sonst hätten wir das Bad schließen müssen, habe ich denen erklärt.“
Ihr politischer Mut ist, wie bei den meisten, etwas gebremst und sozusagen privat, aber eine überzeugte Genossin ist sie nicht. Dann doch eher das Gegenteil. Zum Beispiel lässt sie, anders als allgemein üblich, ihren Weihnachtsbaum zuhause von der Decke baumeln, wie sie einmal erzählte. Das ist zwar nur seltsam, aber bereits gesellschaftlich auffällig.
„Ach so“, antwortete Wolf so beiläufig wie möglich, ist aber voller Adrenalin.
Es hätte ihm nichts genützt, wenn er von dem unliebsamen Besuch vorab gewusst hätte. Fliehen wollte er ja nicht.
‚Jetzt geht’s wohl los‘, denkt er nur.
Im Büro stehen ihm zwei dickliche Herren in schlechtsitzenden Anzügen gegenüber. So stellt er sich frühere, kapitalistische Staubsaugervertreter vor. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit im Bad schwitzen sie ziemlich.
„Komm’se mit“, wird er knapp aufgefordert. Seine Frage nach dem Warum wird mit der üblichen Floskel, ‚Zur Klärung eines Sachverhalts‘, beantwortet.
Draußen platziert man ihn im Fond eines Polizeiautos der Marke ‚Lada 1500‘ zwischen zwei Genossen. Es ist recht eng. Die Türen werden mit einem Klacken verriegelt. Der Laut ist unangenehm und seither packt Wolf immer eine gewisse Unruhe, wenn andere ihn irgendwo einriegeln.
Wolf ist verblüfft, dass keiner der Passanten Notiz von der Angelegenheit nimmt, doch wird ihm das noch öfters passieren. Na ja, warum sollten sie auch, so im Großstadtgetriebe. Die kurze Fahrt führt zur Volkspolizeiwache des Stadtbezirks. Es ist ein recht großer Laden. Die Umstände scheinen ihm etwas bedrohlich, so etwas hatte er noch nicht erlebt. Die Sache war wohl ernst. Aber hat er es letztlich nicht provoziert? Man führt ihn in einen kleinen, unbenutzten Konferenzraum, der mit zusammengeschobenen Bürotischen und sogar einem Rednerpult vollgestellt ist.
Die Anzugträger, die sich schon im Bad als Kripo vorstellten, beginnen umständlich danach zu fragen, wo er am Vorabend gewesen sei. Nach einigem Geplänkel, bei dem es ihm darum geht, herauszufinden, ob er überhaupt wegen ihrer Sache vom Vortag hierhergebracht worden war, entschließt er sich, einfach auszupacken. Das ist mit dem Freund abgesprochen, falls sie einen von beiden greifen würden.
„Sie suchen sicher den, der gestern Losungen angebracht hat“, sagt Wolf geradeheraus und sozusagen ins Blaue hinein. Was konnte wohl des Nächtens in der Stadt sonst losgewesen sein?
„Das war ich.“
Zu seiner Überraschung zeigt sich bei den vier Kripomännern keine Erleichterung über den schnellen Erfolg. Ein kurzes, bleiernes Schweigen breitet sich aus. Sie wissen wohl, was nun kommt. Es sind eben Männer aus dem Volk, trotz allem, mit Familien und Söhnen in seinem Alter.
„Wissen Sie, was Sie da sagen?“, fragt einer schließlich schwerfällig, so als müsse er sich dazu durchringen, und sieht ihn beinahe bedauernd an. Wolf ärgert das.
„Ja“, antwortet er trotzig bis frech, hat aber nicht wirklich eine Ahnung. Alle verlassen den Raum.
Er muss plötzlich an seine Klassenlehrerin denken. ‚Lenni neigt besonders in den Nachmittagsstunden zu unüberlegten Handlungen‘, hatte sie ihm einmal ins Hausaufgabenheft geschrieben. Die Mutter hatte gelacht und ihn ermahnt. Dass ‚Handlungen‘ immer überlegt sein müssten, ging ihm dann in der Pubertät wirklich auf den Zeiger.
Kaum eine Viertelstunde später treten plötzlich vier andere Herren auf. Statt der wollenen, groben Sakkos ihrer Vorgänger tragen sie glatte von deutlich besserer Qualität. Zudem sind sie jünger, sportlicher und sehen intelligenter aus als ihre Kripokollegen. Es ist die Staatssicherheit, was sonst.
Obwohl es etwas unangenehm ist, deren geballte Aufmerksamkeit zu haben, befriedigt es ihn doch.
‚Jetzt nehmen sie dich ernst‘, denkt er, ‚endlich.‘
Dass diese Leute allerdings keine Spaßvögel sind, lernt er bald.
Von der Stasi, der Staatssicherheit der DDR, kursieren wilde Gerüchte. Ihr Verwaltungsgebäude in der Neustadt, gespickt mit modernen Richtfunkantennen, hat noch nie jemand betreten, den Lenni kennt. Es heißt, es gäbe dort tiefe Polster, aus denen man von allein nicht wieder aufstehen kann. Und versteckte Kameras und Mikrofone sind sowieso überall. Als Kinder schauderte sie das einst. Dort, gegenüber der Eissporthalle, werden die Klassenfeinde ‚vorgeführt‘. Wen sie erfassen, der ist ein ‚Feind des Sozialismus‘. Er muss einer sein, denn die Stasi ist so gründlich wie sonst niemand, die irrt nicht. Sie ist sozusagen die verkörperte Effizienz.
Natürlich hat Wolf, wenn auch selten, bereits Stasi-Leute gesehen. Sie haben einen eigenen Sportplatz, den Besten der Stadt, wo er sie manchmal im Trainingsanzug Runden laufen sah. Beim Vorbeigehen blickte man besser nicht so genau hin, um nicht ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie musterten einen sonst scharf.
Auch ging Mona, eine Freundin aus dem Heidebad, mit einem ältlichen Stasimann öfters Eisessen. Er gab ihr jedes Mal 100 Mark, was richtig viel war. Die Aufmerksamkeit, die er ihr schenkte, reizte sie. Sie waren da sechzehn. Mona hat auch noch zwei jüngere Schwestern, die mehr oder weniger oft ins Heidebad kamen. Ihr Vater trägt beeindruckende goldene Litze auf seiner blauen Trapo-Uniform.11
Die Mädels arbeiteten manchmal nachts bei der Post. Sie bekamen dafür jeweils üppige 70 Mark. Was sie dort taten, verrieten sie nicht. Ein paar vermuteten, dass sie für die Stasi Westbriefe öffneten, die dann kopiert wurden.
Und dann war da noch Alex: Vor einem Jahr traf er den Ex-Schulkameraden zufällig an einer Neustädter Bushaltestelle. „Psst, soll ich dir mal was zeigen?“, sagte der wichtigtuerisch. Sich diskret umblickend, zog er einen schicken kleinen, mattschwarzen Plastikausweis hervor, klappte ihn auf und hielt ihn Wolf unter die Nase. Da waren seine Personendaten mit Foto und oben stand ‚Wachregiment des Ministeriums für Staatssicherheit ‚Feliks Dzierzynski‘‘. Dieser Mann war Chef der Tscheka gewesen, der Geheimpolizei in Sowjetrussland, und das große Vorbild der Stasi.
Wolf lauschte jetzt den dollen Geschichten aus Alex’ neuem Leben. Dass sie es sind, die in diesen kleinen Alu-Boxen mit kupferner Spiegelverglasung, die vor all den Berliner Botschaftsgebäuden stehen, Wache halten. Und dass er neben der Uniform zwei Zivilanzüge hat, um Streife zu laufen.
„Einmal hängt da nachts um eins ein Schwarzer oben an der Mauer12 und guckt rüber“, erzählte er in einem aufgeregten Schnellsprech, den er sich inzwischen zugelegt hatte und der wohl zum Umgangston gehört.
„Zweimal angerufen, keine Reaktion, Koppschuss, tot.“
Am meisten hätten sie Respekt vor Russen, die von der Armee weggelaufen sind, berichtete er und wurde direkt unruhig.
„Die könnten unter ihrer Wattejacke die Kalaschnikow dabeihaben. Alles schon passiert.“
Dann kam der Bus und sie trennten sich.
Über solche Dinge spricht man in der DDR nur im nahen Bekanntenkreis. Wer nachfragt, macht sich verdächtig. Bloße Neugier reicht bereits aus. Zudem reißt es den, der darüber redet, gleich mit rein. Und wer will das schon?
Warum erzählte er ihm das? Sicher hielt Alex ihn für harmlos. Als Schulkamerad und da ihr Zusammentreffen ja zufällig war. Jugendliche Prahlerei hatte ihn wohl auch geritten.
Das war nun beinahe alles, was Wolf über die Staatssicherheit wusste.
Ein Stasimann hatte mit Kuli seine Aussage festgehalten und ging sie nun nochmals durch. Draußen auf dem Flur der Kripo-Dienststelle setzte eine aufgeräumte Büroschlussstimmung ein. Sicher hätte Wolf im Schwimmbad jetzt auch die Feierabendlaune erfasst. Natürlich nur theoretisch.
„Wir sprechen jetzt woanders weiter“, sagte ein Stasimann.
Die Tasche wird Wolf abgenommen. Im Hof setzt man ihn in ein ziviles Auto, einen ‚Wartburg‘, und zu dritt fahren sie ein paar Häuserecken weiter. Es wird bereits dunkel.
„Sehn’ Se nach unten!“, wird Wolf barsch aufgefordert, als er die Gegend betrachtet. Für einen Moment denkt er daran, während der langsamen Fahrt einfach rauszuspringen.





























