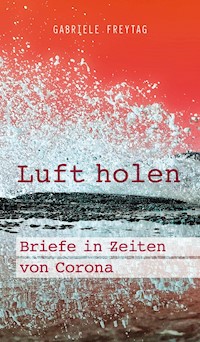
9,80 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Von Mitte März bis Ende Juni 2020 verschickte die Autorin 33 Rundbriefe an Freunde und Bekannte. Sie erzählt von Abenteuern vor der Haustür (mitten im Wald), Zweifeln und Lösungen und dem freiwilligen Rückzug mit ihrer Freundin. Ihr Blick richtet sich immer wieder nach Italien, wo Freundinnen mit dem dortigen Pandemiemanagement und dem harten Lock-Down eine schwere Zeit erleben. Ihre Informationen von dort sind spannend und gehen über das, was üblicherweise in Deutschland ankommt, hinaus. Wie auch in ihren vorherigen Publikationen, verbindet Dr. Gabriele Freytag Psychologie mit Politik. Ihre Erzählweise inspiriert zum Durchdringen eigener Positionen und ermöglicht den LeserInnen eine Vertiefung ihrer Erfahrung. Gerade jetzt, so Freytags Anliegen, lohnt sich ein Blick zurück auf die "Coronazeit", um für die Zukunft zu begreifen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Gabriele Freytag
Luft holen - Briefe in Zeiten von Corona
Gabriele Freytag
Luft holen
Briefe in Zeiten von Corona
© 2020 Dr. Gabriele Freytag
1. Auflage Juli 2020
Herausgeberin, Autorin, Fotos: Dr. Gabriele Freytag
[email protected] www.einwilderort.de
Umschlaggestaltung und Foto der Umschlagvorderseite, Satz und Gestaltung:
Niels Menke Design, Hamburg
Fotos der Autorin ©Rita Fevereiro, Lissabon
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN: 978-3-347-10107-4 (Paperback)
978-3-347-10109-8 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung,
Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
„Entgegen landläufiger Meinung sind es nicht große Ideen,
nicht die bedeutenden Ereignisse, die sich in Zeiten historischer
Umwälzungen am stärksten einprägen, vielmehr ist es
der ununterbrochene Strom kleiner Erfahrungen, Beobachtungen,
Turbulenzen, Ekstasen, kaum wahrnehmbarer Störungen,
die das banale, alltägliche Leben ausmachen.“
Aus: Im Herzen des Herzens eines anderen Landes
Etel Adnan
Was wir erlebten
konnten wir schwer dermaßen schnell und umfänglich begreifen.
Gegen das Verstummen und die Überwältigung
durch Nachrichten und Direktiven
wollte ich inmitten verstörender Gegenwart
mit Worten nahe bleiben – mir und anderen
weiter Verbundenheit ermöglichen, Stärkung, Verstehen
und den Horizont weit halten.
INHALT
Zeitschleife 16.3.2020
Noten vergessen 17.3.2020
Krisengespräche 18.3.2020
Versorgungsketten 19.3.2020
Italienische Verhältnisse 20.3.2020
Das Weinen in der Welt 21.3.2020
Mein Freund der Ärmel 23.3.2020
Schlamperei und Hungerwinter 24.3.2020
No escape room 25.3.2020
Mysterien am Fluss 27.3.2020
Seitlicher Meerblick 28.3.2020
Langer Atem 2.4.2020
In flagranti 3.4.2020
Kartoffeln satt 4.4.2020
Klub der Hässlichen 8.4.2020
Die Ducks 10.4.2020
Bergamo 20.4.2020
Krank im Senegal 22.4.2020
Und hopp 25.4.202
Alltag 29.4.2020
In Schach halten 2.5.2020
Feinstoffliche Freuden 5.5.2020
Smile or die 7.5.2020
Seufzerbrücke 9.5.2020
Halskratzen 11.5.2020
Die Hand reichen 15.5.2020
Ziehen sie das Ding aus 16.5.2020
Einige Gewissheiten 18.5.2020
Luft holen 23.5.2020
Die Geschichte von der toten Großmutter 25.5.2020
Tiger in der Taiga 31.5.2020
Weiter auf Sicht fahren 16.6.2020
Auf der Sorge 30.6.2020
Betreff: täglich Post?
Liebe Alle,
Vor vier Wochen war ich noch in Lissabon am Tejo, Ihr seht mich oben vor der berühmten Brücke. Die Reise kommt mir jetzt vor wie eine rare und exquisite Köstlichkeit.
Durch meine engen Verbindungen nach Italien fühle ich mich grade der Entwicklung hier ein Stück voraus. Was auch dazu geführt hat, dass Sigrid und ich seit einigen Tagen bereits im Rückzug leben, wir nennen es Retreat.
In unserer Lebenssituation – sie in Rente, ich mit viel Schreiben und einer Praxis im Haus mit nur wenigen Patientinnen – ist das gut machbar.
Mich überkommt ein starkes Bedürfnis über die äußere und innere Lage zu schreiben. Vielleicht auszutauschen? Sehe eine Gruppe vor mir, die häufig kurze oder längere Texte per Mail bekommt.
Ich hänge mal meine ersten beiden Coronabriefe an. Weitere verschicke ich dann nur nach Aufforderung.
Würde mich sehr freuen Dich zu den AbonnentInnen zu zählen – und Auskunft über Dein Befinden zu erhalten.
Ganz herzlich und mit allerbesten Wünschen aus dem Retreat Gabriele
ZEITSCHLEIFE16.3.2020
Heute hat es angefangen. Im Halbschlaf warte ich am Morgen das Rattern eines vorbeifahrenden Traktors zu hören oder die fürchterlichen Motorsägen aus dem Wald, wobei ich seit Tagen hoffe, für letztere wäre die Saison endlich vorbei. Als es dann ruhig bleibt bin ich verstört. Normalerweise ist mir Stille am liebsten – wenn andere sich nicht bemerkbar machen umso besser. Doch an diesem Montag soll die Woche unbedingt krachend losgehen, soll es möglichst geräuschvoll weiterlaufen und wir nicht feststecken, als würde von nun an das Wochenende täglich wiederkehren wie in einer Zeitschleife.
Man hatte es uns am Vorabend bei Anne Will noch einmal erklärt: Die große Hoffnung ist jetzt, durch einen partiellen Lock-Down die Kurve flach zu halten. Sigrid und ich waren erleichtert, dass wir in der Sendung nichts Neues erfuhren, uns also trotz physischer Isolation auf der Höhe der Zeit befanden. Im Gegensatz zu sonst blieben wir nach dem Tatort noch vor dem Bildschirm sitzen. Eine Teilnahme am sonntäglichen Talk-Show-Ritual schien uns geeignet, unsere aufgewühlten Gemüter zu beruhigen. Die Politiker (es waren nur Männer) kamen uns überraschend sympathisch vor. Bei der Intensivmedizinerin der Charité ging uns sofort das Herz auf: so engagiert und klug, ihr wollte man sich gerne anvertrauen. Wir suchten nach Zeichen. Alle Gäste wirkten müde auf uns, Gesichter und Augen machten einen traurigen Eindruck. Sie taten, das sah man doch, unter großer Belastung ihre Arbeit, versicherten wir uns. Der Finanzminister allerdings hustete oft und fasste sich noch öfter ins Gesicht. Man kam nicht umhin zu befürchten er könne demnächst erkranken.
Seit über fünfzehn Jahren genieße ich die Vorteile von zwei Wohnsitzen, zwei Häusern, zwei Freundeskreisen, zwei Landschaften und zwei Sprachen. In den letzten Wochen war mir, als trüge ich auch die Belastungen von zwei Ländern. Die Not Italiens geht mir nahe. Wenn ich auf twitter und facebook Fotos von unzureichend versorgten PatientInnen auf Krankenhausfluren, überfordertem medizinischen Personal und verzweifelten Angehörigen sehe hoffe ich immer noch, dass es so schlimm wie es wirkt nicht ist. In unserem auf Sicherheit und Risikoreduktion ausgerichteten westeuropäischen Denken sind solche Bilder nicht vorgesehen.
Seit einer Woche befinden sich die ItalienerInnen im Lock-Down. Die drastischen Ausgangsbeschränkungen wurden verordnet, weil man damit jetzt hofft, die rasante Ausbreitung des Virus und den Kollaps der Krankenhäuser noch eindämmen zu können. In Mails und am Telefon wähle ich sorgfältig meine Worte. Ich möchte meinen italienischen FreundInnen beistehen und ihren Schmerz teilen („Mi dispiace cosi tanto“). Ich möchte Hoffnung vermitteln, allerdings nicht zu platt („Wird schon“). Und auf keinen Fall will ich den Eindruck erwecken, dass in Deutschland alles besser bewältigt wird. Doch unweigerlich wird mir irgendwann die Frage gestellt „Und wie läuft es bei euch?“. Dann antworte ich schlingernd zwischen „Wir sind besorgt“ und „Noch ist nicht viel zu merken“ und fühle mich wie ein geretteter Passagier auf sicherem Grund, während andere Schiffbrüchige gegen die Wellen kämpfen. Auch sie werden, so beruhige ich mich, das rettende Ufer erreichen.
Sigrid und ich tauschen seit drei Tagen nur noch Viren untereinander aus. Gegen die Angst vor Ansteckung scheint uns das am besten. Sigrid war am Nachmittag noch ein letztes Mal auf dem Markt im Dorf gewesen. Die Menschen standen dicht wie immer in den Schlangen vor den Verkaufsständen. Am Morgen hatten wir noch eine Freundin zum Frühstück besucht. Das, so hatten wir beschlossen, waren unsere letzten Ausgänge. Ab jetzt würden wir die Biokiste aufstocken, unsere Vorräte aufbrauchen und Aktivitäten auf den Nahbereich beschränken.
Glücklicherweise leben wir in einem Naturschutzgebiet mitten im Wald mit dem See vor der Haustür und puzzeln beide gern alleine vor uns hin. Die ersten Knospen zeigen sich an den Bäumen, der Frühling, so versichern wir uns, wird den Gemütern helfen mit seiner verschwenderischen Fülle.
Auf dem beschaulichen Gut mit seinen ungefähr vierzig Bewohnerinnen sind die Bedingungen für Rückzug ideal. Wenn man sich zufällig trifft, was gar nicht selten geschieht, dann draußen auf dem Hof. Und da kann man sich nach wie vor sicher auf Distanz unterhalten. Mit Birgit, meiner Freundin und Nachbarin auf der Etage, war ich bereits dazu übergegangen, dass sie bei Gesprächen in ihrer Wohnungstür steht und ich drei Meter entfernt am Treppengeländer lehne.
In Birgits Schule war vor nicht einmal zwei Wochen der erste Corona-Fall im Landkreis bemerkt worden. Ein Kollege hatte das Virus auf nie geklärtem Wege mitgebracht und inzwischen andere Menschen in zweistelliger Zahl infiziert. Überraschenderweise war das Gymnasium nicht geschlossen worden. Das Gesundheitsamt erklärte, ein Infizierter begänne erst in den letzten beiden Tagen vor dem Ausbruch von Symptomen anstekkend zu werden. Da der Kollege die Symptome am Montag bemerkt hatte und am Freitagmorgen zum letzten Mal in der Schule gewesen war, konzentrierte man sich nur auf die Menschen, die er am Wochenende privat getroffen hatte. Sie alle wurden vom Gesundheitsamt kontaktiert, mussten in Quarantäne und werden bei Beschwerden getestet.
Weder Birgit noch ich noch sonst jemand, den wir kannten, hatten je von dieser Theorie gehört, auch im Netz fand man sie nicht. Doch alle Ansteckungen passierten wie vorausgesagt im Privatleben. Auf diesem Wege war auch M., eine enge Kollegin von Birgit, in Quarantäne geschickt worden. Wenn sie positiv getestet worden wäre, hätte Birgit zwei Wochen in ihrer Wohnung bleiben müssen. Ich versorge dich dann, beeilte ich mich zu sagen. Zwei Tage später fand ich einen Zettel vor der Tür „M. ist negativ“. Die Umsicht des Gesundheitsamtes wirkte beruhigend auf uns. Mir wurde klar, dass meine übliche Skepsis gegenüber dem schulmedizinisch orientierten Gesundheitswesen gerade Platz machte für Respekt und Vertrauen. Darüber war ich heilfroh. Alle mit denen ich sprach hatten den Eindruck, die Behörden reagierten prompt und behielten Infektionsketten gut im Blick. Allerdings wissen wir auch, dass die Dunkelziffer hoch ist und nur ein Bruchteil der Infizierten, nämlich die mit Symptomen, die sich zudem auch noch melden, getestet wird. Viele Menschen haben begonnen – meist mithilfe bunter Grafiken und Kurven – zu begreifen, was exponentielles Wachstum im Gegensatz zu linearem bedeutet.
Heute, zwei Wochen nach dem ersten Coronafall in unserer Nähe, sind bereits alle Schulen geschlossen, dazu Theater, Museen, Bibliotheken, Klubs und Grenzen. In Hamburg wurden auch private Zusammenkünfte von über 50 Menschen untersagt und von Treffen mit geringerer TeilnehmerInnenzahl wird abgeraten. Offensichtlich ist eine Verfolgung der Infektionsketten inzwischen nicht mehr ausreichend oder gar nicht mehr möglich. Social Distancing wurde zur besten Reaktion auf die Lage erklärt, flatten the curve ist jetzt unsere große Hoffnung.
NOTEN VERGESSEN17.3.2020
Heute morgen schien die Sonne und im See läuft nach dem langen Winter endlich wieder das Wasser ein. Ihr wisst ja, er wird wegen der Karpfen im Spätherbst immer abgelassen. Gleich beim Aufstehen stelle ich mich vor mein geöffnetes Schlafzimmerfenster, eingewickelt in eine Decke, atme tief durch und lasse einige Minuten die Schönheit von Himmel, Wasser und Wald auf mich wirken.
Ich wollte das schon lange machen. Jetzt habe ich das Gefühl, erstens genügend Zeit zu haben (die ich selbstverständlich vorher auch hatte) und zweitens alles was möglich ist tun zu müssen für meine psychische und physische Stärkung. Wer weiß, sage ich mir, wie lange die Puste reichen muss, lieber Vorräte anlegen.
Viele Leute antworten zur Zeit auf die Frage wie es ihnen geht mit „Noch gut“. Darin steckt wie auch in meinen morgendlichen Atemübungen der Gedanke, dass wir uns auf eine lange Zeit unter Einschränkungen und womöglich mit Krankheit einstellen müssen. Noch ist schwer vorstellbar, dass zwei Drittel der Bevölkerung infiziert sein werden – wie die Kanzlerin neulich verkündete. Noch glaube ich wie wahrscheinlich die meisten, dass es ganz so schlimm nicht werden wird. Doch auch wenn es weniger schlimm ausfällt, wäre das noch heftig genug.
Es ist seltsam. Man lebt in einer von der Ausbreitung des Virus noch relativ unberührten Gegenwart. Persönlich kenne ich niemanden, der oder die wissentlich infiziert ist, ich kenne aber Menschen, in deren Familie es Infizierte gibt – mit denen sie in den letzten Wochen glücklicherweise nicht in engem Kontakt standen. Von Toten im nahen oder weiteren Umfeld habe ich noch nichts gehört. Allerdings beschleicht mich eine Spur Angst, wenn ich an mein bereits mehrmals aufgeschobenes Telefonat mit Maria denke. Ich befürchte zu erfahren, dass in meiner zweiten Heimat Piobbico, einer Gemeinde mit zweitausend EinwohnerInnen in den Bergen der Provinz Pesaro/Urbino, seit Wochen rote Zone, inzwischen Menschen an der Infektion gestorben sind, möglicherweise Menschen die ich kenne. Von meinem Freund Claudio, der fünfzig Kilometer entfernt an der Küste wohnt, habe ich genau das bereits gehört: Zwei seiner Freunde haben den Aufenthalt auf der Intensivstation nicht überlebt, einer kämpft um sein Leben.
Wir in Deutschland erleben die Gegenwart, in der als fühlbare Veränderung das öffentliche Leben und die meisten privaten Treffen fehlen, mit dem Wissen, dass gerade etwas unvergleichlich Schlimmes auf uns zurollt. Es ist als nähere sich ein Zug, den man nicht mehr aufhalten kann, und wir stehen wie festgeklebt auf den Schienen.
Man könnte jetzt einwenden, gerne religiös/philosophisch unterfüttert, dass der Zug unseres Todes sich in jedem Moment des Lebens unaufhaltsam nähert. Im Moment mag ich die Rede vom höheren Sinn aber nicht hören; Pandemie als Schule des Lebens und Sterbens finde ich grade zynisch. Mir ist unwohl beim Versuch, die Coronakrise ideologisch aufzuwerten als Chance zur Läuterung. Wovon ich hingegen viel halte ist: das Beste aus der Situation zu machen, für sich und andere. Doch was ist das Beste? Viele Menschen bevorzugen die Verdrängung. Und für die allseitige Beliebtheit der Verdrängung lege ich als Psychotherapeutin meine Hand ins Feuer.
In der Bedrohung durch ein klitzekleines Virus sind wir aufgefordert, zumindest partiell nicht zu verdrängen, denn sonst würden wir die neuen lebensrettenden Regeln nicht einsehen. Wegen der Beliebtheit der Verdrängung wäre es auch keinen Tag früher möglich gewesen, die Theater zu schließen und Fußballspiele vor leeren Stadien abzuhalten. Die Menschen hätten es nicht akzeptiert. Geschickt fand ich, wie uns der Entscheidungsprozess über die Schulen überdeutlich als schwierig dargestellt wurde. Denn erst Schulschließung bedeutete – mehr noch als leere Stadien und Konzerthäuser –, dass es nun richtig ernst wurde.
Mit der Verdrängung ist es kompliziert. Ein gewisses Maß davon hilft beim guten Schlaf, um auch mal alle Fünfe grade sein zu lassen und für Momente leicht und locker zu werden. Erinnert Ihr Euch an die Augenblicke in den letzten Tagen und Wochen, in denen das Leben so schien wie immer? Die kleinen Auszeiten ohne das Gefühl der Bedrohung sind vermutlich gerade selten und kostbar. Bei mir ereignen sich Momente der Selbstvergessenheit wenn ich mich auf die Natur einlasse. Aber auch beim Essen und Trinken, an einem schön gedeckten Tisch mit etwas Feinem vor mir und in guter Gesellschaft fühle ich mich herrlich unbeschwert, gerne, Ihr kennt mich, mit einem guten Wein. Da fällt mir auf: Ich muss mit Sigrid vereinbaren, dass wir am Esstisch nicht über Corona sprechen.
Außerdem sehe ich gerade gerne Krimis. Es kommt mir vor, als würden sie mich entspannen, obwohl, einer tieferen psychologischen Sondierung hält dieser Effekt nicht stand, denn letztlich lenken sie nur ab. Zumindest bin ich eineinhalb Stunden von etwas ganz anderem gepackt und durchgeschüttelt. Mit Corona habe ich mir sofort den großen Fernsehfreifahrtschein ausgestellt. Normalerweise beschränke ich mich auf ein Mal die Woche, sonntags Tatort oder Polizeiruf reichte bisher.
Zu unserem Glück beschenkt uns die Natur großzügig – nicht nur morgens vor dem Schlafzimmerfenster. Wenn ich auf Vögel lausche, einen Baum umarme oder die sich gerade wieder intensivierenden Düfte erschnuppere geht’s mir prima. Aber auch da: Lieber nicht ständig mit Sigrid auf dem Spaziergang über die Coronalage reden oder alleine darüber nachdenken. Vielleicht am besten dosieren? Hinweg ja, Rückweg nein?
Sobald ich mit Kindern spiele konnte ich immer wunderbar abschalten. Doch mich mit den drei hier lebenden Kleinen zu treffen verbietet sich leider gerade. Physische Distanz bei unseren üblichen quirligen Unternehmungen wäre unmöglich. Sobald sich die Gelegenheit ergibt werde ich erklären, warum wir jetzt nicht näher zusammenkommen dürfen. Vielleicht begreifen sie ja, dass ich ihnen auch aus der Distanz nahe bin, das wäre schön – aber unwahrscheinlich.
Klavierspielen wollte ich wieder anfangen, gute Gelegenheit, steht schon ewig auf dem Zettel. Offensichtlich habe ich jedoch so lange pausiert, dass ich die Noten teilweise nicht mehr lesen konnte. Bei Satie sind sie aber auch besonders schwierig, tröste ich mich. Bisher hatte ich mich auch nach längerer Unterbrechung einfach auf den Hocker gesetzt und los gespielt, erst holprig, dann allmählich besser. Webrecherche hat geholfen. Die Noten sind mir wieder klar. Gespielt habe ich noch nicht. Fragt ruhig nach. Aber nicht so bald.
Lesen könnten wir jetzt alle ganz ausgiebig. Theoretisch. Gestern habe ich „Die Winterbienen“ recht zügig, man könnte sagen hektisch, quergelesen. Ein tolles Buch, ich schob meine Aufmerksamkeitsdefizite darauf, dass es für mich nicht ganz das richtige war, vielleicht zu sehr Männerbuch – habe es ja auch für einen Nachbarn zum Geburtstag gekauft. In der Regel lese ich das zu verschenkende Buch vorher ganz behutsam durch, man merkt es kaum. Sollte Ihr jemals von mir ein Buch bekommen – jetzt kennt Ihr mein Geheimnis. Meine Schwierigkeit, in Ruhe und Seite für Seite zu genießen hängt, so schwant mir, damit zusammen, dass ich momentan die innere Gelassenheit einfach nicht aufbringe. Trotzdem suche ich weiter nach dem richtigen Buch. Die genau passenden Lektüre zu finden ist ein heikles aber lohnendes Vorhaben, welches Wochen in Anspruch nehmen kann. Jetzt sollte es schneller gehen.
Vom Münchner Frauenbuchladen bekam ich eine Mail „Wir sind weiter für euch da“. Nun endlich werde ich nicht mehr beim Großversand, den man auch vorher keinesfalls unterstützen sollte, bestellen, sondern da wo es segensreich und nötig ist. Versprochen.
Gedanken, Gefühle und Impulse zu disziplinieren scheint mir jetzt mehr denn je zuträglich. Gestern Abend habe ich bewusst nicht „Hart aber fair“ gesehen – nur heute die Zusammenfassung gelesen. Es war mir zu viel, ich brauchte einen Abend, an dem ich früh zu Bett ging, Yoga praktizierte und meditierte, und vor allem benötigte ich erholsamen Schlaf. Zu letzterem, das weiß ich, trägt eine aufwühlende Sendung, auch wenn sie um halb elf zu Ende sein sollte, nicht bei. Und ja, es hat geklappt. Damit keine Missverständnisse aufkommen, ich glaube, ich habe die Sendung mit Frank Plaßberg noch nie in meinem Leben ganz gehört, nur jetzt mache ich das anders. Es liegt daran, dass ich verbunden bleiben möchte mit einer Art kollektivem Corona-Bewältigungsprozess, und dazu dienen mir auch Fernsehsendungen. Selbst den gefühlt zwanzigsten Mehrteiler über die Nachkriegszeit, mit wahlweise Anna Mühe, Iris Berben oder Maria Furtwängler in taillierten Blümchenkleidern, derben Schuhen und Flechtfrisuren – ich werde ihn mir anschauen, denn ich will dabei sein.
Zudem glaube ich, dass uns jetzt eine Menge über die Kriegsund Nachkriegszeit hochkommen wird, nicht nur bei denen, die es erlebt haben, sondern aus unserem gemeinsamen Unbewussten. Corona bedeutet zwar nicht Krieg und Kriegsmetaphern im „Kampf gegen das Virus“ finde ich fehl am Platze, doch wir leben in einem Ausnahmezustand, der Besorgnis hervorruft und drastische Verhaltensänderungen erfordert. Außerdem beeinträchtigt das Virus die ökonomische Sicherheit und Planbarkeit der Zukunft.
Auch wenn der Spruch, den ich auf Italienisch gelesen habe, stimmt „Von unseren Großvätern wurde gefordert, dass sie in den Krieg ziehen, wir hingegen sollen nur auf dem Sofa sitzen bleiben und Serien schauen“ beschreibt er nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite spielt es keine Rolle, wenn Corona verglichen mit dem zweiten Weltkrieg deutlich harmloser ausfällt. Psychologisch gesehen macht die Unterscheidung zwischen mehr oder weniger zerstörerisch, mehr oder weniger grausam und blutig, keinen Sinn. Ein Zustand, der kollektiv enorme Angst und Verunsicherung erzeugt, fordert die emotionale Stabilität nun mal heraus. Wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird, und wir wissen vor allem nicht, ob wir den Folgen dessen, was möglicherweise auf uns zukommen wird, gewachsen sein werden. Werden wir in der Lage sein durchzuhalten? Wer wird womöglich auf der Strecke bleiben? Und was können wir tun?
Liebe Elke, Judith, Claudia, Birgit, Gabi, Susanne, Ulrike, Kerstin, Ute, Uschi, Mari, Eva, Anette, Christine, Dagmar,
Petra und die drei Sigrids,
Freue mich sehr über die tolle Resonanz! Da kommt eine feine und gar nicht mal so kleine Gruppe von Adressatinnen zusammen! Die am weitesten entfernten leben in Galicien (Hallo Eva und Anette von Knulps-Reisen!), Südfrankreich, die Schweiz und natürlich die italienischen Marken sind vertreten, außerdem Berlin, Hamburg, Daudieck, Bonn, Stade, Hannover und die Pfalz. Der Osten fehlt noch mangels korrekter E-Mail-Adresse, wird sich aber hoffentlich demnächst dazu gesellen.
Über Rückmeldungen wie „Tut so gut die Texte zu lesen“ und „Bitte weiter schreiben, warte schon auf mehr“ hab ich mich doll gefreut. Schön wäre es, wenn eine Art Gemeinschaft durch die Rundbriefe ermöglicht würde.
In diesem Sinne take care und Danke Gabriele
KRISENGESPRÄCHE18.3.2020
Heute waren 18 Grad und Sonne angekündigt, ich freute mich auf einen herrlichen Frühlingstag. Gabi wollte aus Hamburg zu Besuch kommen und wir planten eine Wanderung, zum ersten Mal mit Anwendung der Abstandsregeln. Gabi war froh raus aus der Stadt zu fahren und nicht immer so viele Leute vor der Nase zu haben wie an Elbe und Alster. Allgemein, haben wir festgestellt, gehen die Menschen jetzt mehr spazieren. Über Gut Daudieck wälzen sich an schönen Tagen Massen von SpaziergängerInnen wie wir sie vorher nie gesehen haben.
Als Gabi aus dem Auto stieg zeigte sich der Himmel bedeckt und grau, der Wind wehte kühl. Wir beschlossen trotzdem gleich loszugehen. Die übliche Umarmung wurde aus der Ferne mittels geöffneter Arme angedeutet, der gemütliche Stop in meiner Wohnung fiel flach. Wir achteten immer schön auf einen Meter fünfzig zwischen uns, was eine gewisse Anspannung hervorrief, aber auch nicht sonderlich schwierig war. Statt Tee auf dem Sofa hatten wir den Rucksack mit der Thermoskanne dabei. Auf der gewohnten Bank am nächsten Fischteich war reichlich Platz an beiden Enden. Eine vorbei joggende Nachbarin kommentierte unsere Sitzordnung leicht ironisch mit: Na ihr macht das aber vorbildlich. Gegen Abend waren wir vier Stunden an der Luft gewesen und hatten mit den unterschiedlichsten Leuten geredet, immer auf Distanz, alle hatten sich bereits eingestellt, mitten in der Pampa.
Sogar die Kinder, die ich am späten Nachmittag auf dem Trampolin vorfand, rannten nicht wie sonst auf mich zu. „Coronavirus“ krähte der Vierjährige als ich gerade Luft holte für eine längere Erklärung. Danach hab ich die drei bestimmt zwanzig Minuten aus der Ferne beobachtet. Gelegentlich warfen sie einen kurzen Blick über die Schulter: Ihre Salti und kleinen Ringkämpfe, so redete ich mir ein, waren auch für mich. Ich versuchte, tapfer zu sein, ahnte jedoch bereits, dass der Kontakt mir schmerzlich fehlen würde.
Vor der großen Scheune stand T. und wollte grade in sein Auto einsteigen. „Na, alles paletti bei euch“ rief ich salopp und dachte dabei an seine Familie. Für einen Moment war mir entfallen, dass T. der Bürgermeister ist, ich sehe ihn immer nur privat, meist mit Bier in der Hand, beim Grillen oder Fußballschauen zur WM-Zeit. Mein Aussetzer dämmerte mir erst als er mich nicht unfreundlich, aber doch perplex anschaute „Meinst du den Krisenstab?“
Unsere Unterredung kreiste dann um den Tenor, dass die Krise doch gut bewältigt würde hierzulande. Wir wollten uns, so schien mir, rückversichern, dass kein Grund für allzu große Sorge bestehe, dass wir in einem guten Land leben. Die PolitikerInnen, so waren wir uns einig, machten das grade ganz anständig. T. warf ein, dass man in Berlin etwas früher hätte reagieren können mit den drastischen Maßnahmen, er kritisierte den hemmenden Föderalismus. Ich hielt kurz dagegen, die Bevölkerung hätte die Schließungen und Beschränkungen keinen Moment früher akzeptiert. Ohne Akzeptanz ginge Prävention nach hinten los. In Italien, so hatte ich auf social media gelesen, war bereits Anfang Februar die Gegend um Codogno, einem Zentrum von Infektionen, abgeriegelt worden, natürlich nur an den Hauptverkehrsstraßen. Die AnwohnerInnen seien dann die ganze Zeit auf Schleichwegen rein und raus gefahren.
Die Karten zur Eindämmung des Virus vorzeitig zu verspielen wäre ein fataler Fehler. Zumindest ein Ass im Ärmel haben wir ja noch, meinten wir, abermals in schöner Einigkeit: die Ausgangssperre. Außer mir glaubten alle, Birgit war noch dazu gekommen, dass eine strenge Ausgangssperre uns bald verordnet werden würde, nächste Woche lautete die Vermutung. Das mochte ich mir gar nicht vorstellen – auch wenn wir persönlich, wie wir augenzwinkernd versicherten, so weit draußen weiterhin Möglichkeiten finden würden, unbemerkt durch Wald und Wiesen zu stromern. Schon halb im Auseinandergehen wurde die Hoffnung laut, dass Angela Merkel heute Abend in ihrer Fernsehansprache die passenden Worte finden möge, um die Bevölkerung zu überzeugen. Nur wenn alle die Regeln befolgten könnte ein kompletter Lock-Down wie in Italien hier abgewendet werden. Meine Güte, dachte ich im Weggehen, so viel Staatstreue war selten, die Kanzlerin als große Heilsbringerin, hatte ich noch nie erlebt.
Mitten im Wald waren Gabi und ich auf ein Paar mit Hund gestoßen. Die beiden halten mich seit Jahren bei jedem zufälligen Aufeinandertreffen über die Fortschritte ihres nervösen Pinschers auf dem Laufenden. Inzwischen kenne ich auch die Fortschritte ihres Badezimmerausbaus und allmählich werden die Gespräche etwas zu ausufernd für meinen Geschmack, zumal es kaum zu schaffen ist, den Redestrom der Frau zu unterbrechen. Heute war das Thema völlig klar. Die Frau, wir haben uns nie einander vorgestellt, vertrat die These vom Meineid der Politiker am deutschen Volk. Gabi und ich schauten verständnislos. Die Politiker, erklärte sie streng, hätten geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuhalten und genau das würden sie jetzt nicht tun. Ich hielt sogleich dagegen, man würde die Bevölkerung sehr wohl schützen, das sei doch der Sinn der ganzen Regeln. Wie befürchtet wurde ich ohne Federlesen nieder geredet. Man hätte viel früher und strenger reagieren müssen, man habe die Lage verharmlost und Kritiker mundtot gemacht. Und man habe sowieso keine Ahnung da oben. Ich konterte mit der notwendigen Einsicht der Bevölkerung als Voraussetzung für die Akzeptanz von Maßnahmen. Als ich mit dem Beispiel aus Italien kam, wie tausende aus Mailand am Abend vor dem Lockdown die Flucht in den Süden angetreten hatten, war ich gespannt auf die Replik. Sie lautete wider Erwarten nicht, die Deutschen seien regelkonformer als die ItalienerInnen, sondern schlicht: Das Volk ist nun mal dumm. Hallo?! Das Volk dumm und die Regierung ja sowieso? Bei den beiden handelt es sich demnach um die einzigen Gescheiten? Das aufgebrachte Paar, schoss mir bei unserem eiligen Weitergehen durch den Kopf, hielt mich jetzt vermutlich nicht nur wie bisher für eine Katzenliebhaberin und Wanderlustige, sondern mindestens für eine wackere Sozialdemokratin. Ich hingegen hielt sie für unmögliche GesprächspartnerInnen. Beim nächsten Mal: nur noch der Hund. Im Höchstfall das Wetter.
Dass ich mich in letzter Zeit beruhigt fühle, wenn Heiko Maas versichert die Deutschen aus Marokko zurückzuholen, Angela Merkel Rücksicht durch physische Distanz anmahnt und Altmaier und Scholz die Bereitschaft sehr viel Schulden zu machen verkünden (um diesmal nicht „die Wirtschaft“, sondern „die kleinen Selbständigen“ zu unterstützen), kommt mir schon seltsam vor.
In der Schulzeit opponierte ich gegen die Schulleitung und natürlich gegen die Bildungspolitik von Stadt und Land (als einziges nicht kommunistisches Mitglied des Landesschülerrates). Später argumentierte ich gegen Professoren (Professorinnen gab es noch nicht am Fachbereich Psychologie der Universität Hamburg), die meisten Seminare und die Lehrpläne (als Mitglied des Frauenfachschaftsrates). Als Feministin kämpfte und kämpfe ich gegen das Patriarchat, gegen Diskriminierung, Doppelstandards und Männergewalt. Zusammen mit vielen anderen UmweltschützerInnen protestierten wir in Brokdorf und Gorleben gegen die Atompolitik. Und in jüngster Zeit haben wir freitags wieder angefangen mit dem Demonstrieren für eine bessere Zukunft. How do you dare, rufen wir: Wie könnt ihr nur die Zukunft vergeigen.
Meine Generation liebäugelt wahrhaftig nicht mit Regierungen. Wir hielten wacker dagegen und hatten oftmals prima Ideen zur Veränderung, von denen wir einige umsetzten. Ich gründete beispielsweise zusammen mit anderen Psychologinnen 1980 das Feministische Frauentherapiezentrum in Hamburg. Wir haben, das dürfen wir sagen, vieles erkämpft, von dem jetzt andere profitieren. Unseren Eltern haben wir als Orientierung meist wenig vertraut, sie im Gegenteil zur Rede gestellt wegen des Schweigens über Krieg und Faschismus – und uns frühzeitig abgeseilt. So standen wir bisweilen etwas alleine auf der Flur, aber immer entschlossen in kritischer Distanz.
Für die in den vierziger, fünfziger und sechziger Jahren in Westdeutschland Geborenen fühlt es sich wie etwas Besonderes an, ich möchte fast sagen Kostbares, den gewählten VolksvertreterInnen zu vertrauen. Nicht wenige der alten KämpferInnen scheinen gerade das Gefühl zu haben, in einem guten Land zu leben, in dem für sie gesorgt wird.
Ein Systemwandel, den wir zweifellos dringend brauchen, wird sich dennoch keineswegs von selber einstellen. Hinterher, nach Corona, werden wir uns jede einzelne Verbesserung bei Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit, Daseinsvorsorge, Bildungschancen und Gemeinwohlökonomie hart erkämpfen müssen. Wenn wir das nicht tun, wird die Chance verpuffen und die Krise des Systems bald vergessen sein als wäre sie nie dagewesen.





























