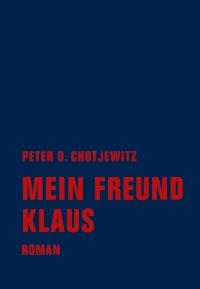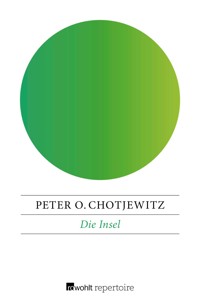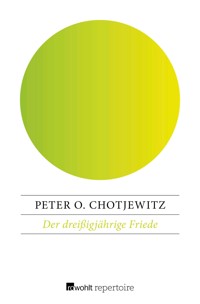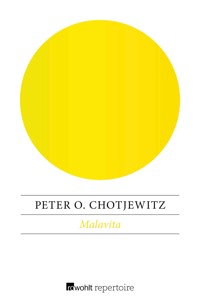
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was ist und wem nützt die Mafia? Peter O. Chotjewitz hat sich in Rom auf die Spuren dieses düsteren Kapitels italienischer Geschichte und Gegenwart gemacht. Er räumt mit dem herkömmlichen Mafia-Klischee als dem Syndikat der Entrechteten gründlich auf. Die Mafia, so zeigt sein provokativer Bericht auf, ist Produkt und Stütze der italienischen Oberschicht: in Konflikt mit dem Staat, wenn dieser seine Spielregeln durchsetzen will, aber einig mit Justiz, Polizei und Parteien, wenn es gilt, die bestehende Ordnung zu schützen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Peter O. Chotjewitz
Malavita
Mafia zwischen gestern und morgen
Ihr Verlagsname
Über Peter O. Chotjewitz
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Für Peter Kammerer, von dem die Anregung
zu diesem Buch stammt und dem ich zahlreiche
Hinweise verdanke.
1. Ein Buch schreiben über Mafia
Juli 1972. In Neapel streiken die Hafenarbeiter. Autos und Lastwagen werden von den Beschäftigten der Reederei «Tirrenia» verladen. Der Laderaum ist verpestet von Autoabgasen. Das Schiff ist kein Luxusdampfer. Pro Deck eine Dusche für jedes Geschlecht. Das warme Wasser schmeckt nach Leitung. Auch in den Aufenthaltsräumen ist es zu warm. Das Abendessen schmeckt wie aus einer deutschen Werkskantine. Im Fernsehen ein Boxkampf mit Bildstörungen.
An Bord vorwiegend Italiener. Es ist kein Vergnügen, mit der Autofähre von Neapel nach Palermo zu fahren. Man spart 800 Kilometer Autobahn und hat die Illusion, die zehnstündige Schiffsreise im Schlaf zurückzulegen. In der Ferne eine Zeitlang die regelmäßigen Ausbrüche des Stromboli.
An Schlaf ist nicht zu denken. Vor allem die Unterdecks dröhnen vom Lärm der Schiffsmaschinen. In den späten Nachtstunden wird es wärmer. Das schmale Leintuch klebt am Körper, die rauhe Pferdedecke kratzt, der Unbekannte im unteren Bett schnarcht. Hoffentlich habe ich auch geschnarcht.
An Deck ist es diesig und schwül. Es wird Tag. Die Luftfeuchtigkeit hat einen hohen Salzgehalt. Weinende Kinder, Berge schmutziger Wäsche in den engen Gängen, Kaffeegeruch, das Vestibül vollgestellt mit Koffern. Langsam kommt Land in Sicht.
Sizilien. 300 Sonnentage im Jahr. Mit 26000 Quadratkilometern fast so groß wie die Niederlande, größte und wichtigste Mittelmeerinsel, NATO-Stützpunkt. Neun Provinzen mit etwa 300 Gemeinden, knapp 4700000 Einwohner, ein Viertel davon in den 80 Gemeinden der Provinz von Palermo, Hauptstadt der autonomen Region. Die Bevölkerungsdichte schwankt zwischen sechs Einwohnern pro Quadratkilometer auf dem flachen Land und 3700 in Palermo. Lektüre: Danilo Dolci Umfrage in Palermo, Mitte der fünfziger Jahre, deutsch 1961 im Berliner Union Verlag. Herausfinden, was sich seither geändert hat.
Jetzt kommt auch die Stadt ins Blickfeld. Ab Termini Imerese im Osten von Palermo eine kilometerlange Neubausilhouette vor einer gleichmäßig hohen Bergkette, die den Flugverkehr zu einem Wagnis macht. Der Flugplatz liegt da, im Schatten der braungefleckten Berge, weil Grundstücksinteressen im Spiel waren. Die Mafia der Bau- und Grundstücksspekulation, die den sizilianischen Städtebau der fünfziger und sechziger Jahre zum einträglichen und blutigen Geschäft gemacht hat.
Ein Buch schreiben über Mafia. Ihre Entwicklung, Organisation, das soziale Gewebe, das sie hervorgebracht hat und noch heute nährt. Die Verbrechen der Mafia, die Waffen der Mafia. Wann die Mafia mordet. Die rituellen Formen ihrer Kriminalität. Die Ähnlichkeit zwischen Mafia-Mord und staatlicher Todesstrafe. Die Mafia als soziale Ordnungsmacht. Die Mafia als Verteidigerin und Nutznießerin des landwirtschaftlichen Großgrundbesitzes, als Alliierte norditalienischer Bourgeoisie und römischer Politiker. Die Politiker und Gewerkschaftler, die von Mafia umgebracht wurden. Die Strafprozesse gegen Mafia. Die Gesetze der Mafia. Die Geschäfte der Mafia. Mafia und Wahlen. Mafia in hohen Ämtern der sizilianischen und römischen Verwaltung, Mafia in den Parlamenten, die Mafia in der augenblicklichen Regierung. Der Generalstaatsanwalt, der angeblich in der Mafia war. Der Präsident einer Großbank, der nicht in der Mafia gewesen sein will.
Der Verteidigungsminister, der für die Mafia sehr nützlich war. Der Innenminister, der dem Banditen Giuliano und seinen mafiosen Hintermännern angeblich nicht den Auftrag erteilte, sizilianische Bauern haufenweise mit dem Maschinengewehr abzuknallen und die Bauernbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg zu zerschlagen. Der «König der Mafia», der sich nie die Ärmel runterkrempelte, nur selten eine Jacke trug und im «Albergo Sole» in Palermo eine ständige Suite hatte.
Auch ich wohne in «Albergo Sole». Mitten im Stadtzentrum, gegenüber dem Senatorenpalast, in unmittelbarer Nachbarschaft dreier übervölkerter Marktviertel, die fast nur von Arbeitslosen, Gelegenheitsarbeitern, ambulanten Händlern, Zigarettenschmugglern, Wahrsagern, Lumpenhändlern und kleinen Kriminellen bewohnt werden.
Es sind elende Quartiere mit unsagbar inhumanen Lebensbedingungen. Da hat sich nichts geändert seit Dolcis Umfrage. Und mitten hindurch geht der Corso Vittorio Emanuele, Gründerjahre, der direkt nach Montelepre führt, nur 30 Kilometer von Palermo aber tiefste Provinz, oben in den verkarsteten, baumlosen Bergen, mit schönem Blick auf den Golf von Castellamare und seine schmale Tiefebene.
Montelepre war die Geburtsstadt des Banditen Giuliano. «Dem Helden Siziliens» steht auf seinem Grabstein. Ausgedehnte Flächenbrände an den Hängen, die die Stadt einschließen, schicken hohe schwarze Rauchwolken in den unerhört blauen Himmel. Der Feuerschein wird von der Sonne verschluckt. In den Bergen ferne Kuh- und Ziegenglocken, Zurufe der Hirten, aber der Karst macht Menschen und Tiere unsichtbar.
5000 Einwohner waren 1961 in Montelepre registriert. In den Straßen fahren bunt und figurativ bemalte Karren auf zwei hohen Rädern, von einem geschmückten Maulesel gezogen, beladen mit Obst und Gemüse. Wenn man genügend Geld hat, wird die Unterentwicklung der sozialen Verhältnisse und Produktivkräfte zur Idylle. Die Wäsche auf den Leinen von Haus zu Haus, die Kinder, die auf den ungepflasterten Straßen spielen, die Frauen, die das Wasser vom Brunnen holen müssen, die Abwässerkanteln in den Straßen, die Leute, die vor den Haustüren sitzen, weil die Wohnungen düster, feucht, kalt und viel zu klein sind.
Noch heute gehen Doppelstreifen mit Maschinenpistolen Kontrolle. Wahrscheinlich hat man vergessen, sie abzuziehen. Es gibt keinen Banditismus mehr in Sizilien. Das Phänomen war stets von Mafia und sizilianischen Politikern in regionalen und römischen Gremien kontrolliert. Ein Instrument, um auf Rom Druck auszuüben. Giuliano hat seine Bedeutung überschätzt. Er starb, als er seine Aufgabe erfüllt hatte und hinderlich wurde. Am 4. Juni 1950. Die Inschrift auf seinem Grabstein haben nicht die sizilianischen Bauern, sondern Mafia und Großgrundbesitzer geschrieben.
Mit Verlauf und Absicht der Separatistenbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg müßte mein Buch beginnen. Eigentlich schon mit der Landung der Alliierten am 10. Juli 1943, die offensichtlich von amerikanischem Geheimdienst, Cosa Nostra und sizilianischer Mafia vorbereitet worden ist. Dann die Einsetzung von Mafia in Schlüsselstellungen der westsizilianischen Verwaltung durch die Amerikaner. Dann Mafia und Banditismus, Leben, Wirken und rätselvoller Tod Giulianos.
Die deutschsprachige Literatur über Mafia ist spärlich. Es gibt eine Menge Artikel und Rundfunksendungen, die großen Wert auf Leichen legen und dadurch verschleiern, daß die Produktion menschlicher Kadaver für die Mafia kein Geschäftszweig ist. Das Töten ist für Mafia so wenig typisch wie die Verhängung der Kapitalstrafe für die kapitalistische Gesellschaft.
Anfang der sechziger Jahre gab es im Spiegel eine Artikelserie, die als Buch 1965 unter dem Titel Die ehrenwerte Gesellschaft bei ECON in Düsseldorf erschien und für die Beurteilung der Separatistenbewegung und des Banditismus, also die Jahre 1945 bis 1950, einige Materialien bereitstellt, die allerdings, was nirgends vermerkt ist, vorwiegend aus Pantaleones Buch Mafia e Politica abgeschrieben sind. Auch ich kann nur abschreiben, aber ich gebe es zu. Die fünfziger Jahre beschreibt Lewis nur flüchtig. Über die sechziger Jahre schreibt er fast nichts, was um so bedauerlicher ist, als man in westdeutschen Bibliotheken zumeist nur dieses eine Buch findet. Der Hauptfehler von Lewis liegt in seinen romantischen Vorstellungen vom Wesen der Mafia, von der allmächtigen, straffen Organisation dieses angeblichen «Geheimbundes», seinen Initiationsriten und seinen historischen Ursprüngen.
2. Der Boß und die Cosca
Wichtige Arbeit hat in diesem Zusammenhang Henner Hess mit seinem Buch Mafia, Zentrale Herrschaft und lokale Gegenmacht, 1970 im Verlag Mohr, Tübingen, geleistet. Hier wird in erster Linie dargestellt, wie Mafia wirklich strukturiert ist und daß die Unheimlichkeit dieses Phänomens gerade in seiner Alltäglichkeit liegt. Der «harte Kern», der personell austauschbar ist, sind die «Bosse». Der Boß ist ein Mann, der zu mehreren Personen, die untereinander nicht entscheidend kommunizieren, Beziehungen unterschiedlicher Intensität unterhält. Diese Personen sind Familienangehörige, Patenkinder, Leute, bei denen der Boß Trauzeuge war oder die sich ganz einfach seinem «Schutz» unterstellen und infolgedessen Leistungen erbringen und erhalten, Beschäftigte im Betrieb des Boß, Freunde und Blutsbrüder, Leute aus dem gleichen Dorf, Helfershelfer, kleine Fische und alle, zu denen diese Personen Kontakte der genannten Art unterhalten etc.
Ein Boß scheint in der Regel etwa 20 Personen durch derartige Beziehungen eng um sich zu scharen. Die so gebildete Gruppe, die in Sizilien «Cosca» genannt wird, hat eine informelle Struktur, nimmt neue Mitglieder je nach Bedarf auf, gibt andere ohne große Formalitäten ab, scheint aber in Kampfzeiten «ehrenhaft» zusammenzuhalten und ihren Komponenten auch gewisse Beschränkungen und Verpflichtungen hinsichtlich geschäftlicher Selbständigkeit und Verteilung der Profite aufzuerlegen – je nach Art und Intensität des Verhältnisses von Mitglied und Boß.
Zuweilen kommt es zu einem Gruppenverband, einer Kette von mehreren Gruppen, wie in den vierziger und fünfziger Jahren in Corleone, wo mehrere dicke Bosse mit eigener Cosca wegen gemeinschaftlicher Interessen einen gemeinsamen Oberboß wählten, der die Aufgaben einer neutralen Gewalt hatte: Dr. Michele Navarra.
Auch eine gewisse Hierarchie ist feststellbar. Prestige scheint erblich zu sein, wer dagegen nicht aus einer alten Mafia-Familie stammt, muß sich hochdienen. Augenscheinlich ist, daß die Gruppenherrschaft auf bestimmte Geschäftsbereiche und geographische Zonen beschränkt ist. «Selfmademen», die frühzeitig nach Selbständigkeit und Aufbau einer eigenen Cosca streben, können sich nur durchsetzen, wenn ihr Anspruch durch befreundete Gruppen abgesichert ist. Die Gebrüder La Barbera in den frühen sechziger Jahren beispielsweise.
Die Lebensläufe einiger berühmter Bosse der letzten 20 Jahre beschreiben, zeigen, wie Abgrenzung und Kooperation erfolgen, unter welchen Umständen einzelne Gruppen einander bekämpfen.
Die vom Boß gebildete und geführte Cosca ist das Mittelstück einer Pyramide. Nach unten hin gehören zum Einflußbereich alle Personen, die die Herrschaft der Gruppe dulden und einen gewissen persönlichen oder familiären Nutzen daraus ziehen. Der Bauer, der ein Stück Pachtland erhält, der Arbeitslose, dem der Mafioso eine Stellung beschafft, der kleine Bauherr, der durch Vermittlung des Boß eine Baugenehmigung und Arbeitskräfte bekommt. Sie bilden die Klienten des Boß, seine sogenannte «Klientel», die einige hundert Personen umfassen kann. Die Spitze der Pyramide reicht hingegen bis in den undurchsichtigen Nebel der Amtsstuben, der Gerichte, der Parteiorganisationen, der Großbanken, Konzerne, der öffentlichen Dienstleistungsbetriebe, der Parlamente und Regierungen. Die hier sitzenden Advokaten, leitenden Angestellten, Beamten und Politiker, die zu mehreren Bossen Beziehungen unterhalten können, bilden die sogenannte «Partei» des Mafioso. Sie sind die «Freunde der Freunde».
Am Nachmittag fahre ich weiter nach Partìnico, wo Danilo Dolci wohnt. Die Literatur liegt mir schwer im Magen, aber es können auch die erbsengroßen Eisstücke sein, die jeder Barmann in den kalten Tee und Kaffee schüttet. Es gibt eine Sonne, die nichts mit Wohlbehagen zu tun hat. Ruhe sanft, Held von Sizilien. Seit Francesco Rosis Film Wer erschoß Salvatore Giuliano sehe ich dich immer in hellem Regenmantel vor mir.
Der Bericht der parlamentarischen Anti-Mafia-Kommission über Mafia und Banditismus, der am 10. Februar 1972 verabschiedet wurde, ist 775 Seiten lang. Die Spitze der Pyramide, die Mafia und Banditen einschloß, hieß Ende der vierziger Jahre Innenminister Scelba, der im Februar 1972 Präsident des Europarates war. Der Bericht enthält deshalb nur einen Teil der vorliegenden Erkenntnisse.
Weitere Veröffentlichungen der Anti-Mafia-Kommission: Bericht über die Tätigkeit der Kommission und den Stand der Entwicklung der Mafia am 31. März 1972, 1262 Seiten lang.
Die Vorfälle in Zusammenhang mit der Unauffindbarkeit des Boß Luciano Liggio vom 26. Februar 1970, 240 Seiten lang.
Bericht über das sizilianische Schulwesen vom 8. Juli 1971, 85 Seiten lang, beschreiben, was Mafia mit Schulwesen zu tun hat.
Bericht über die Mißstände in der Gemeindeverwaltung von Palermo, gleiches Datum, 111 Seiten lang.
Bericht über die Großmärkte vom 11. Mai 1971, 104 Seiten lang.
Die Lebensläufe zehn führender Bosse von 1971, in der Buchausgabe 450 Seiten lang. Daneben zahllose Bücher und Berichte, Ermittlungsergebnisse, Prozeßeröffnungsbeschlüsse, Prozeßakten, Anklagen und Urteile in italienischer Sprache aus mehreren Jahrzehnten. Wer ein Buch über Mafia schreiben will, steht zunächst einmal vor unübersehbarem Material. Seit 75 Jahren ist Mafia ein ständiger «Hit» auf dem italienischen Buchmarkt.
In Partinico befindet sich das «Studien-Zentrum» des Soziologen Danilo Dolci aus Triest. 1961 waren in der Stadt 26000 Personen registriert, Haupterwerbszweig war seit je die Landwirtschaft.
Die Häuser sind flach, vorwiegend einstöckig und bieten zumeist nur Raum für ein bis zwei Zimmer ohne Fenster, einen Abstellraum, eine kleine Küche, eventuell noch eine Schlafnische. Das Licht fällt durch die Haustür. Die Fassaden sind weiß oder leuchtend blau gestrichen, die Straßen kilometerlang, ungepflastert und ohne Schatten. Die Frauen sind schwarz gekleidet und tragen schwarze Kopftücher. Es gibt viele alte Leute, die mittleren Jahrgänge sind schwach besetzt. In zahlreichen Häusern ist Trauer, kleine Plakate an Fassaden und Plakatwänden verkünden den Trauerfall, seinen Jahrestag, eine Danksagung. Nur der lange Corso der Tausend, die Hauptstraße, hat Kleinstadtcharakter. Mit tausend Mann landete Garibaldi in Sizilien.
Dolci begann Mafia zu untersuchen, als er nach den Ursachen des sizilianischen Elends fragte, den Gründen für die Unterentwicklung der Produktivkräfte und das Fehlen, später die Entartung der gesellschaftlichen Dynamik. Er stieß auf Mafia, als er versuchte, die Pläne zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu realisieren, die das Studien-Zentrum zusammen mit der betroffenen Bevölkerung erarbeitet hatte.
Beschreibe die Verleumdungsprozesse der christdemokratischen Abgeordneten Mattarella und Volpe, denen Dolci und Franco Alasia 1965 öffentlich vorwarfen, führende Exponenten der Mafia zu sein. Die Klage endete nach einem Schnellverfahren damit, daß Dolci zu zwei Jahren Gefängnis, 3000 Mark Geldstrafe und 20000 Mark Prozeßkosten verurteilt wurde. Alasia bekam ein Jahr und sieben Monate Gefängnis.
Auch das gehört ins Buch: Die Unantastbarkeit des Mafioso, die Unmöglichkeit, ihn mit den Mitteln des sogenannten Rechtsstaates zu bekämpfen. Eines der typischen Merkmale und eine wesentliche Quelle der Macht der Mafia ist die Tatsache, daß man ihr fast nie etwas beweisen kann. Es gibt keine Korrespondenz und keine Mitgliederkartei der Mafia, niemand wird je ihre Statuten finden, weil es keine gibt. Ihre Initiationsriten und halbkultischen Versammlungen, von denen viele Autoren phantasieren, sind Hochzeitsfeierlichkeiten, Taufessen und gewöhnliche Zusammentreffen beim Mittagessen in gutbürgerlichen Speisegaststätten.
Es ist phantastisch, was manche Schriftsteller als Wesensmerkmale der Mafia ausgegeben haben. Den Gesichtsausdruck, die Körperhaltung, bestimmte Zeichen und Gesten, den gnadenlosen Blick, der jeden Eingeweihten erkennen läßt, daß ein Mafioso vor ihm steht und ihn erzittern läßt. In Wirklichkeit sind auch die Bestimmungsmerkmale des Mafioso viel realer. Unrealistisch zu meinen, irgend jemand im Gebiet von Villalba habe Don Calò Vizzini nicht gekannt, Giuseppe Genco Russo in Mussomeli, Michele Navarra und Luciano Liggio in Corleone, Don Vanni Sacco in Camporeale, ihre Macht und Partei nicht gekannt, die Skrupellosigkeit ihrer «kleinen Fische» im Umgang mit der Schrotflinte mit dem abgesägten Lauf, der sogenannten «Lupara», der traditionellen Mordwaffe der alten Agrarmafia.
3. Weitere Einübung
Meine nächste Station ist Alcamo, wie Castellamare noch im Einzugsbereich von Palermo. Der Abgeordnete, der in diesem Wahlkreis Partei des Mafioso ist, wird gewählt. Mattarella zum Beispiel. Die Stadt erinnert daran, wie es vor zehn Jahren in Südspanien aussah. Der vergebliche Versuch, einen zentral gelegenen Platz, auf dem ein paar Palmen wachsen, durch ausgetrocknete Blumenrabatten und staubige Sträucher zu verschönen. Der neue Springbrunnen, aus dem kein Wasser fließt. Die langen, schattenlosen, ungepflasterten Seitenstraßen mit den einstöckigen Katen. Die Plastikkörbe auf den Klosetts, in die man den Arschwisch wirft, weil Wasserspülung und Abfluß nicht funktionieren. Die Tankwagen zur Wasserversorgung.
Die Stadt liegt auf einem Bergrücken. Unten in etwa zehn Kilometer Entfernung das Meer. Drüben in 30 Kilometer Entfernung sieht man Montelepre liegen. Nach der anderen Seite hin: Castellamare, am Hang der Berge, die den Golf abschließen. Ob es eine Rolle gespielt hat, daß die Bosse der einzelnen Ortschaften sich praktisch auf den Teller spucken konnten? Auch Partìnico ist zu sehen. In den Bars Dr. Gottlieb-Flipper und Musikboxen von Wurlitzer, die die neuen Schlager aufs ehemalige Latifundium bringen.
1961 waren in Alcamo noch 43000 Einwohner registriert, in einer Umgebung, die, einschließlich Landwirtschaft, kaum nennenswerte Erwerbsmöglichkeiten bietet. Die örtliche Mafia gehört zur Familie der Rimi, die einigen der einflußreichen Palermitaner Bosse verbunden ist: Tommaso Buscetta, Rosario Mancino, Luciano Liggio, die Brüder und Vettern Greco, Badamalenti, Gerlando Alberti. Ihre Partei und Klientel reichen weit, Liggio und Coppola genießen auch in Rom Prestige und Protektion, wie die Flucht Liggios gezeigt hat. Die Mafia-Filialen in Mailand und Neapel wurden zeitweise von Alberti geleitet, der auch den Kollegen von der Generalstaatsanwaltschaft ermordet haben soll. Buscetta wurde im November 1972 am Rand einer brasilianischen Großstadt verhaftet, wo er mit seinem Clan eine Luxusvilla bewohnte. Alles Sizilianer aus einem Umkreis, dessen Durchmesser kaum länger ist als Westberlin von Norden nach Süden. Ein Sohn heißt Natale Rimi und ist etwa so alt wie ich. Er war bei der Stadtverwaltung von Alcamo beschäftigt und ist in mehrere populäre Kriminalfälle verwickelt.
Damit könnte der Sachbericht enden: Die Wiederbelebung der hitzigen Kriminalität in Palermo seit 1969. Das «Blutbad» im Büro eines Bauunternehmers der Mafia, der Mord an Generalstaatsanwalt Scaglione, der Überfall auf den Mafioso Ciuni in einer Klinik, das spurlose Verschwinden des Journalisten Mauro de Mauro, die erpresserische Entführung der Söhne zweier Bauunternehmer und Multimillionäre aus Tràpani und Palermo, die zur Fraktion einflußreicher Bosse gehören, und anderes mehr, wie die Einstellung von Natale Rimi bei der Regierung der soeben gegründeten Region Latium mit Sitz in Rom. Auch Mafia hat sich in letzter Zeit dezentralisiert und ist längst nicht mehr auf Sizilien beschränkt.
In Castellamare, dem Geburtsort von Mattarella, kaufe ich mir erst mal eine helle Leinenmütze. Der kleine Laden in einer Seitenstraße ist vollgestopft mit Badeausrüstungen, Plastiktieren, Textilien, Schuhen, Miederwaren, Gartengeräten, Seifenpulver. Es gibt zwei Arten Mützen. Der kleinere Typ werde von jungen Männern bevorzugt, behauptet der Verkäufer. Ich kaufe eine sehr breite, lappige Mütze, die angeblich von älteren Bauern bevorzugt wird und besser gegen die Sonne schützt.
Der Ort, in dem 1961 fast 17000 Einwohner gemeldet waren, würde in einem Buch über Mafia immer wieder genannt werden. Dolci hat vor Gericht zu beweisen versucht, daß außer dem Abgeordneten Mattarella auch einer der Bürgermeister von Castellamare, Giuseppe Munna, ein Boß der Mafia ist.
Unten am Meer ein kleiner Fischerhafen. Einige Arbeitslose sitzen herum, die wenigen Boote liegen kieloben, die alten Häuser am schmalen Strand bilden eine folkloristische Kulisse. Der Laden des Fischgroßhändlers liegt direkt am Ufer. Er kauft die Fische sofort auf.
Der gesamte sizilianische Fischhandel wird von Mafia beherrscht. Ihr gehört alles: die Netze, die Boote, der Handel, die Lastwagen, die Lagerhallen und weiterverarbeitenden Betriebe, die Stände auf den Großmärkten und oft auch noch der Einzelhandel. Es gibt einen eindringlichen Film von Visconti, Die Erde bebt, nach einer Erzählung von Verga, in der die sozialen und wirtschaftlichen Hintergründe des Phänomens der «Fischmafia» beschrieben werden. Hier sieht man, daß Mafia zumeist nur Tendenzen verlängert, die in der Gesellschaft bereits angelegt sind. Ein Kapitel über Mafia und Großmärkte.
Von den kargen Bergen oberhalb von Castellamare eröffnet sich der weite Blick auf die fruchtbare Ebene zwischen Tràpani und Marsala. Vor dem Meer leuchten die großen Flächen der Salinen. Von hier aus blickt man in zwei Zonen der Mafia.
Ich hätte Lust, Sizilien nur sinnlich wahrzunehmen. Auf den Landstraßen sieht man mehr Maulesel als Autos. Es gibt kaum Traktoren, Mäh- und Dreschmaschinen, fast nie einen Ackerwagen. Der Maulesel schleppt hochbepackt und unter seiner Last völlig versteckt die Ernte kilometerweit vom Stückchen Land des Kleinbauern ins Dorf. Eine Holzvorrichtung beidseits dient zur Befestigung der Lasten. Oftmals zwei oder mehr Maulesel hintereinander, alle hochbepackt, an einem langen Strick.
Es gibt auch eine Vorrichtung am Geschirr zur Befestigung der dünnen, spitzauslaufenden Wasserflaschen aus Ton. Auf dem Felde werden die langen Flaschen bis an den Hals in die Erde gegraben, um das Wasser kühl zu halten. Der Maulesel dient auch als Dreschmaschine. Ein kreisrundes Stück Land von etwa sieben Meter Durchmesser wird freigehackt, eingeebnet, mehrfach mit Wasser besprengt und festgetreten. Dann wird das Getreide ausgebreitet, ein Bauer steht mitten auf dem Platz und läßt das Muli stundenlang im Kreis laufen, ein anderer wirft mit einer Holzforke das Stroh auf die Seite, der Wind verweht die Spreu, und die Körner fallen zur Erde. Auch Bohnen werden so gedroschen. In Sizilien weht ständig ein Wind. Kilometerweit hört man die singenden, rhythmischen Rufe des Bauern, der die Mulis antreibt. Nebendran, auf den ausgedehnten Weizenfeldern eines großen Gutes, bringen zwei Mähdrescher in der gleichen Zeit eine hundertmal so große Ernte ein.
Es gibt viele solcher Gegensätze in Sizilien. Wenn das Zusammentreffen von Gegensätzen schön wäre, wäre Sizilien ein schönes Land. Die Pracht der Kirchen und Paläste von Palermo und das Elend der Strohhütten von Tudia. Die Schafherde neben dem dorischen Tempel der illyrischen Elymer von Segesta, die den Griechen nachbauten und auf der Längsseite eine Säule zuviel einfügten. Oben mit dem Blick auf den Golf von Castellamare an der Straße nach Tràpani das Amphitheater von Segesta, auf dem seit Jahrhunderten nicht als ein Naturschauspiel gegeben wird.
Der Chemiekonzern Montedison direkt neben dem hier kackbraunen Meer von Porto Empedocle, schon im Agrigentino. Die großen Ratten vor der blendend-weißen, pseudo-arabischen Fassade des luxuriösen «Hops-Hotel» im riesigen Fischerdorf Mazzara del Valle.
Tràpani und seine Provinz. Mafia hat sich im wesentlichen in den vier westsizilianischen Provinzen entwickelt: Tràpani im äußersten Westen, Agrigento im Südwesten, Palermo im Nordwesten, Caltanisetta im Zentrum der Insel. In diesen vier Provinzen ist nahezu jede Kleinstadt eine Hochburg der Mafia, jedes Dorf in ihrer Hand.
Charakteristika der Gegend: Die Leere des Landes und die Riesendörfer mit zwanzig-, dreißigtausend Einwohnern, die ein grobmaschiges, weites Netz über die Landschaft auswerfen. Zwanzig, dreißig Kilometer weit kein Haus, keine Siedlung, nur gelegentlich Feldhütten und die langen Tränken der artesischen Brunnen der Mafia. Die Wasser-Mafia beschreiben. Selten ein Baum. Auf den verkarsteten Berghängen und Almen kümmerliches braunes Gras, Strauchwerk und Krüppelholz. Überall die flatschigen, fleischigen großen Blätter der indischen Feigenbäume, hinter denen auf Bildern und in Moritaten der Mafioso mit der schußbereiten Lupara lauert.
Der Reisende sieht und spürt keine Mafia. Er ahnt sie, wenn der Portier behauptet, vor seinem Hotel werde niemand einen Diebstahl wagen, man könne alles im Auto lassen. Also doch ein Literatenthema? Die Beschreibung einer Wirklichkeit, die sich selbst nur teilweise ausdrückt, hinter der häufig eine zweite Realität lauert, Mafia? Die nur durch Abstraktion und Reflexion erkennbar gemacht wird? «Die Sizilianer der Mafia-Gebiete sehen keine Mafia», schreibt der Soziologe Ferrarotti.
4. Die Landwirtschaft
Wenn ich es recht übersehe, so gab es in Westsizilien bis in die fünfziger Jahre nur zwei Arten landwirtschaftlicher Betriebe, die wirtschaftlich eine Rolle spielten.
Die eine Betriebsform sind die sogenannten Gärten, die es auch heute noch gibt, an der ganzen Nordküste links und rechts von Palermo zum Beispiel oder in der berühmten Conca d’Oro, dem breiten Tal zwischen Palermo und Monreale.
Diese Gärten sind durchweg nur wenige Hektar groß, werden jedoch intensiv bewirtschaftet und bringen deshalb trotz ihrer geringen Größe ansehnlichen Gewinn. Sie sind das Land, wo die Zitronen blühn und zwei Formen von Mafia gedeihen: die Wasser-Mafia und die Mafia der Wächter und Caporali, die die Arbeitskräfte anwerben und vermitteln.
Den größten Teil der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche bildeten die Latifundien – riesige Weideländer und Äcker, die entweder brachlagen oder dem extensiven Anbau von Getreide und Hülsenfrüchten dienten und in einer Tradition standen, die bis zu den Römern verfolgt werden kann und von den Normannen nach Vertreibung der Araber erneuert wurde.
Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Rechtstitel mit feudalen Sonderrechten des Grundherren verbunden, aber es ist bezeichnend, daß die Bezeichnung «Feudo» bis heute erhalten blieb.
Kennzeichnend für diese Betriebsform war neben der immensen Ausdehnung der Latifundien und dem extensiven Anbau die Tatsache, daß zahlreiche Grundherren ihre Feudi nicht selber bewirtschafteten und oft fern von den Gütern in ihren Stadtpalästen, in Palermo oder auf dem Festland residierten, wo sie faul ihre Grundrente verzehrten und auch keine eigene Wirtschaftstätigkeit entfalteten.
Soweit die Latifundien bewirtschaftet wurden, waren sie dem Gabellotto übertragen. Die Bauern waren Unterpächter. Es wurden zumeist nur kleine Flächen von vier oder fünf Hektar in Unterpacht vergeben und die Pachtverträge liefen nur auf ein Jahr. Oft mußte der Bauer sich jedes Jahr ein neues Stück Land suchen.
Zu seiner Unterstützung hatte der Gabellotto eine Anzahl bewaffneter Feldhüter um sich, die sogenannten «Campieri», die eine Art Privatpolizei waren und die unteren Ränge der Mafia bildeten. Daneben gab es noch die Funktion des Caporale, die in der Auswahl und Überwachung der Tagelöhner bestand, die sich jeden Morgen vor Tagesanbruch auf den Plätzen versammelten und ihre Arbeitskraft feilhielten.
Die Macht auf den Latifundien und in den riesigen Dörfern wurde von diesen drei Funktionsträgern ausgeübt. Sie bildeten in Westsizilien die wichtigste Komponente der alten Agrar-Mafia, die nicht nur im Interesse der Grundherren, sondern auch im eigenen Interesse jeden Versuch, die Erstarrung der sizilianischen Wirtschaft und Gesellschaft durch eine neue Bodenordnung und eine produktivere landwirtschaftliche Produktionsweise zu lösen, boykottierten.
Erst die Agrarreform unter De Gasperi in den fünfziger Jahren führte zur Auflösung der meisten Latifundien. Es gibt in Sizilien heute 1306311 Kleinbauern, die im Durchschnitt 3,5 Hektar bewirtschaften, nicht leben und nicht sterben können und im übrigen dem Einfluß von Mafia weiterhin ausgesetzt sind, was ebenfalls darzustellen sein wird. Die Reform führte außerdem zu Gleichgewichtsstörungen, die in den beiden Dreschverfahren zum Ausdruck kommen.
Da nur Flächen über 300 Hektar umverteilt wurden, blieben die ertragreichen Weingüter und Zitrusplantagen in den fruchtbaren Ebenen in Küstennähe in der Hand ihrer Eigentümer. Da ferner mit der Reform mehrere aufwendige finanzielle Hilfsprogramme verbunden waren, die vorwiegend Leuten mit guten Beziehungen zu Hilfe kamen, führte die Reduktion des landwirtschaftlichen Eigentums auf 300 Hektar zur Entstehung zahlreicher, heute durchaus rentabler und intensiv bewirtschafteter Güter, denen durchweg die besseren Böden reserviert wurden, während die Kleinbauern die schlechteren Böden erhielten.
Ich sitze im «circolo dei nobili», dem «Club der Adligen» von Tràpani, wo auch Honoratioren Zutritt haben. Im Süden hat jede größere Stadt ihren Zirkel der Nobilität. Vor den großen Schaufenstern des Clubs geht halb Tràpani auf der Uferpromenade spazieren, dahinter das Meer mit den leeren Masten einiger Segelschiffe. Es ist Abenddämmerung. Die alten Herren im Lokal sehen aus wie Figuren aus einem Film von Visconti. Einige haben die Jacken abgelegt. Keine Frauen. Hier saßen einst die Erfinder der Mafia und spielten Zauberlehrling.
5. Kurze Geschichte
Es ist fast alles Tinnef, was über die Entstehung der Mafia geschrieben worden ist. Haltlose Spekulationen, tief in geschichtliches Dunkel gehüllt.
Daß die Spanier die Mafia nach Sizilien mitgebracht haben. Daß «M-A-F-I-A» die Anfangsbuchstaben des Wahlspruchs der sizilianischen Vesper im 13. Jahrhundert gewesen seien. Daß die von den Nomannen ins Landesinnere vertriebenen Araber, zumeist selbständige Kleinbauern, die Vorfahren der Mafiosi gewesen seien.
Daß man in dem ganz erdgebundenen, ja verwegenen Materialismus der Männer der «Ehrenwerten Gesellschaft» archaische Charakterzüge entdecke, die sogar noch aus dem Bronzezeitalter zu stammen scheinen (Lewis).
In allen diesen Spekulationen spukt das Mißverständnis, Mafia sei zeitweise eine Selbsthilfeorganisation der Bauern gegen ausländische oder italienische Fremdherrscher gewesen.
Brauchbarer sind auch hierzu die Erörterungen von Henner Hess, der darauf hinweist, daß man das Wort Mafia in verschiedenen italienischen Dialekten finden kann, daß sein arabischer Ursprung zwar wahrscheinlich sei, daß es aber in den verschiedenen Dialekten verschiedene Bedeutungen habe. Im Palermitaner Raum habe man noch 1880 von einem hübschen Mädchen gesagt, es habe «Mafia».
Hess begnügt sich damit, einige historische Phänomene der sizilianischen Sozialgeschichte, die strukturelle Ähnlichkeit mit Mafia haben, zu beschreiben: die ausführenden Organe der Inquisition im 15. Jahrhundert unter den Spaniern, die ebenfalls eine Familienstruktur hatten, die Handwerksinnungen des 17. und 18. Jahrhunderts, die Privatarmeen der Barone, die im 16. Jahrhundert als «Waffenkompanien» dem Staat unterstellt wurden, aber praktisch eine zivile Bürgerwehr blieben, auch die Feldhüter Gabellotti und Caporali. Daraus kann immerhin gefolgert werden, daß die Barone und andere Exponenten der herrschenden Klasse schon immer gewisse informelle Machtapparate zur Kontrolle und Ausbeutung der Kleinbauern und Landarbeiter eingesetzt haben. Das Bestehen einer mafiosen Gesellschaftsschicht vor dem 19. Jahrhundert kann daraus nicht hergeleitet werden. Da Mafia nach heutigen Begriffen eine vom Staat nicht formell sanktionierte Macht ist, konnte sie erst entstehen, als der bürokratische Staat anfing, seine eigenen Machtinstrumente zu präsentieren.
Die feudalen Rechte der Grundherren wurden 1812 abgeschafft. Die Handwerksinnungen, die noch 1820 ihre Sondergerichtsbarkeit erfolgreich verteidigt und während der Revolten gegen Ende des 18. Jahrhunderts bewaffnete Einheiten zur Aufrechterhaltung der städtischen Ordnung gestellt hatten, wurden 1822 verboten. Die Waffenkompanien dagegen wurden im Zuge der Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts lediglich neu geordnet. Erst 1892 wurde dieser halbprivate und stark zu eigener krimineller Tätigkeit neigende Ordnungssicherungsdienst abgeschafft.
Die Aufhebung der feudalen Sonderrechte war für die Barone eine Gefahr, zumal sie mit einer Bodenreform verbunden war, die die landlosen Bauern begünstigte. Sie berührte zwar nicht den Besitz der Barone. Aber wenn der Wind einmal weht, ist es schwer, ihn aufzuhalten. Die Großgrundbesitzer befanden sich zudem in einer Zwickmühle. Eine Ordnung, die sie mit dem Verlust von Sonderrechten bezahlen mußten, konnten sie nicht gutheißen. Der Zustand einer halbfeudalen Anarchie war auch geeignet, Bauern, Landarbeitern und Kleinbürgern der wenigen gesicherten Rechte zu berauben, die selbst der bourbonische Staat unter Umständen gewähren konnte, und dem Zugriff der Barone weiterhin auszuliefern. Andererseits brauchten die Barone und bürgerlichen Grundeigner Schutz gegen soziale und territoriale Ansprüche der landhungrigen Bauern und ausgepowerten Tagelöhner. Hier boten die Waffenkompanien sowie die Gabellotti und Campieri sich an.
Es scheint, daß nicht alle Gutsbesitzer die gesteigerte Bedeutung erkannten, die diesen Leuten nunmehr zukam und ihnen nicht sogleich jene soziale Stellung gewährten, die ihrer neuen Funktion entsprach: den Schutz des Latifundiums und der landwirtschaftlichen Geschäfte zu gewährleisten, den die staatliche Ordnungsmacht nicht übernehmen konnte, weil sie noch schwach war und nach dem Willen der Barone und ihrer Quislinge von der nun entstehenden Mafia auch schwach bleiben sollte. Es scheint jedenfalls Widersprüche zwischen dieser ersten Form von Mafia und den Großgrundbesitzern gegeben zu haben. Mehrere Autoren behaupten, daß Mafia damals Bauernaufstände angezettelt habe. Es sind Vorfälle, die es nur zwischen 1812 und der Errichtung der Diktatur Garibaldis 1860 gab, die jedoch das unsterbliche Gerücht genährt haben, Mafia sei zu Zeiten eine Organisation zum Schutz des Landvolks gewesen, obwohl diese Aufstände im Endeffekt nur die Notwendigkeit der Mafia als landwirtschaftlicher Ordnungsmacht bestätigen.
Richtig ist indessen, was Henner Hess im Titel seines Buches andeutet – Zentrale Herrschaft und lokale Gegenmacht –, daß nämlich in jener Zeit Mafia eine lokale Macht entfaltete, die eine effektive Tätigkeit des Staates als Ordnungsmacht bis heute verhindert hat, soweit sie nicht ihren Interessen diente.
Von einer lokalen Gegenmacht kann man jedoch nur bis zur Gründung des italienischen Einheitsstaates sprechen, wenngleich der Herrschaftsanspruch des Königreichs Neapel praktisch nur auf dem Papier bestand. Nach 1860 hingegen wurde Mafia von den römischen Regierungen selbst weniger als Gegner, denn als Partner betrachtet.
Ich weiß nicht, ob Garibaldi wirklich die Absicht hatte, die Bauern zu befreien. Wahrscheinlich war er lediglich durch seine militärische Schwäche gezwungen, sich nach der Landung in Marsala zunächst mit den sizilianischen Bauern zu verbünden, die ihn nur kurze Zeit als Befreier empfinden konnten. Sehr bald zeigte sich, welche Rolle der Süden im Konzept des piemontesischen Königshauses und der norditalienischen Bourgeoisie spielte. Der Norden war schon bei der Einigung höher entwickelt. Der Anschluß des Südens hatte vor allem den Sinn, die Entwicklung des Nordens weiter zu beschleunigen. Dazu war erforderlich, daß zwar die steuerlichen Mittel und Arbeitskräfte des Südens in den Norden gelangten, im übrigen aber keine Entwicklung der süditalienischen Produktivkräfte stattfand und die soziale Situation des Südens mit der Landwirtschaft als wichtigstem und zugleich in sich unterentwickelten Erwerbsfaktor unverändert blieb.
6. Die neue Klasse
Als natürlicher Verbündeter der norditalienischen Bourgeoisie und der Politiker in Rom bot sich hierfür in Sizilien das Vollzugsorgan der Großgrundbesitzer, die Mafia, an. Plötzlich reichte die Funktion der Mafia über Sizilien hinaus und wurde zu einem Instrument der italienischen Innenpolitik. In jener Zeit entsteht die Partei der Mafia, deren Bezeichnung sich ändert je nachdem, welche Partei die Regierung bildet oder maßgeblich an ihr beteiligt ist. Da das neue System gewisse formaldemokratische Regeln mit sich brachte, zum Beispiel Wahlen, erhält der Mafioso die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die Wähler den richtigen Kandidaten wählen. Es wäre zu zeigen, warum auch nach Einführung der geheimen Wahl, bis in die fünfziger Jahre, in Sizilien ein Teil der Bevölkerung nicht in der Lage war, frei zu wählen.
In den Jahrzehnten nach der italienischen Einigung wächst Mafia zur sizilianischen Mittelklasse heran, wie zum Beispiel der Mafioso in Tomasi di Lampedusas Roman Der Leopard. In der Literatur wird der Klassencharakter der Mafia gerne mit dem Hinweis abgelehnt, daß Mafia durch ihre Parteibeziehungen bis in die Politikerklasse, die Großbourgeoisie und den Adel hineinreicht, ihre Leute in sehr verschiedenen gesellschaftlichen Schichten hat und über ihre Klientel mehr oder weniger freiwillige Gefolgsleute unter den Kleinbauern, Hirten, Tagelöhnern, ländlichen und städtischen Kleinbürgern und sogar im Subproletariat besitzt, nicht zu vergessen das gemeine Verbrechertum.
Diese Meinung übersieht jedoch die Struktur der mafiosen Partei und Gruppe und ihrer Klientel, die ausschließlich an die Figur des Boß der Gruppe geknüpft sind, der zwar ausgewechselt werden kann, aber alle Fäden in der Hand hält. Dieser Boß ist seit hundert Jahren ein neues und eines der wichtigsten Elemente der bürgerlichen Mittelklasse.
Praktisch übernimmt Mafia ab 1860 die Garantie der sizilianischen Agrar- und Sozialordnung. Seither gilt der Satz: Mafia ist eine informelle Macht, die mit den Politikern der herrschenden Klassen auf allen Ebenen des Staates und den Organen der öffentlichen Gewalt eng verzahnt ist.
Gegenleistungen, die sie empfängt, sind hohes soziales Prestige und öffentliche und private Vergünstigungen aller Art für den Mafioso und seine Familie und Klientel. Unter den Bürgerlichen, die im 19. und 20. Jahrhundert ländlichen Grundbesitz erwarben, sind zahlreiche Mafioso. Lediglich von öffentlichen Ämtern bleibt Mafia bis 1943 ausgeschlossen.
Gestützt auf seine Macht beginnt der Mafioso bereits im vorigen Jahrhundert, den Spieß herumzudrehen und weniger einflußreiche Großgrundbesitzer unter Druck zu setzen. Er setzt seine Einnahmen aus dem Feudo selber fest und führt die Abgaben der Halbpächter nicht mehr ab und setzt sie herab, falls der Halbpächter ein Mafioso, Mitglied der Familie oder Klient ist. Als es nach dem Ersten Weltkrieg zu ersten Ansätzen einer Agrarreform zugunsten der aus dem Krieg heimkehrenden Bauern kommt, ist Mafia infolge ihrer Kontrolle über die Bauern in der Lage, daraus eine Reform zu eigenen Gunsten zu machen.
Zu beschreiben wäre, wie sich das abgespielt hat. Nur kurz behandelt zu werden brauchte die 20jährige Pause, die entstand, als 1922 der Faschismus die Aufgaben der Mafia übernahm und damit zugleich die Großgrundbesitzer von der Last ihrer unbequem gewordenen Sachwalter befreite.
Zu beschreiben wäre hingegen auch, wie Mafia nach dem Sturz des Faschismus wieder auflebte, schöner und stärker als je zuvor. Wie sie den langen Marsch durch die Institutionen des Staates antrat, in dem sie heute mit eigenen Leuten fest verankert ist. Wie sie die Agrarreform überlebte, obwohl sämtliche Eingeweihte die Aufhebung des Latifundiums mit dem Tod der Mafia gleichsetzten.
Wie sie in zahlreiche neue Geschäftszweige hineinwuchs und außerhalb Siziliens Brückenköpfe bildete.
Wie sie bekämpft wurde, sich bekämpfen ließ und aus ihren Niederlagen Siege machte. Wie sie erkennbar machte, daß ihre Abschaffung für Italien eine Revolution bedeuten würde.
Mit Don Calògero Vizzini aus Villalba müßte es anfangen. Und zum Schluß müßte man erkennen, was Mafia eigentlich ist.
7. Der gute Gott von Villalba I.
Villalba ist eine kleine Stadt fast im geographischen Mittelpunkt Siziliens, in der Provinz Caltanisetta, fünf Kilometer neben der Staatsstraße 121 von Enna nach Palermo. Der Ort besteht aus dreizehn kurzen Straßen, die parallel zueinander den Hügel hinauflaufen und von sechs Querstraßen im rechten Winkel geschnitten werden.
Am oberen Ende der Via Veneto gibt es einen Platz. Carlo Levi hat in seiner Erzählung Der Platz von Villalba beschrieben, wie hier alles zusammentraf, als sei der Platz eine Bühne: die Kirche, das Parteibüro der christdemokratischen Partei, die Filiale der Bank von Sizilien, die Kaserne der Carabinieri, das Haus Don Calògero Vizzinis und das Haus seines Gegenspielers Michele Pantaleone.
Ein seltsamer Gegensatz, aber auch er ist in Sizilien häufig: Gerade dort, wo die Herrschaft der Mafia am deutlichsten zum Ausdruck kommt, sind auch ihre Gegner am stärksten: Placido Rizzotto in Corleone, Danilo Dolci in Partinìco, Salvator Carnevale in Sciara, Lorenzo Barbera in Partanna, Pasquale Almerico in Camporeale und viele andere. Die meisten sind früh gestorben.
Bei Pantaleone ist der Kampf gegen Mafia Familientradition. 1848 erhoben sich die Bauern von Villalba, verbrannten die Akten des königlichen Amtsrichters und versuchten das Archiv des Notars zu stürmen, um die Pachtverträge des Feudo Miccichè zu verbrennen. Sie wurden von Giuseppe Pantaleone und anderen aufgeklärten Bürgern geführt. Ein anderer Pantaleone, Advokat, organisierte die Bauern in einem Schützenverein, der zur Bauernbewegung der «fasci» gehörte.
1878 wurde dieser Pantaleone gegen den Widerstand der Kirche und des Grundherren mit 194 von 200 Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Als drei Jahre darauf Neuwahlen anstanden, traf der Graf von Villalba und Baron von Miccichè bessere Vorkehrungen. Obwohl Erntezeit war, beauftragte er seine Mafia, die Bauern zehn Tage vor der Wahl in einem großen Gehöft einzusperren. Am Wahltag wurden sie von den bewaffneten Feldhütern der Mafia in Gruppen zu je acht Personen ins Wahllokal geführt.
Die Geschichte Villalbas und Don Calòs ist eng mit dem Feudo Miccichè verknüpft. Das Gut umfaßt 1900 Salmen, das sind etwas mehr als 20 Kilometer im Quadrat, und wird bereits im 12. Jahrhundert das erste Mal erwähnt. Der Ort wurde erst im 18. Jahrhundert gegründet. Ende des 19. Jahrhunderts hatte er knapp 5000 Einwohner, vornehmlich kleine Pachtbauern und Tagelöhner. 1962 waren es nur noch 3000.
Bei uns hätte man den jungen Calògero vermutlich für das schwarze Schaf der Familie gehalten. 1887 geboren, war er der dritte Sohn eines kleinen Pachtbauern. Die Mutter stammte aus einer anständigen Familie. Ein Bruder der Mutter genoß das Ansehen der Kurie von Caltanisetta und wurde rasch Bischof von Muro Lucano. Ein Neffe, Cousin Calògeros, wurde ebenfalls Bischof. Auch die beiden älteren Brüder Calògeros waren Priester, und nur der schlechte Ruf ihres kleinen Bruders verhinderte, daß sie Karriere machten.
Das «schwarze Schaf» besuchte nur ungerne die Schule, blieb sein Leben lang ein halber Analphabet und war ein ziemlicher Draufgänger. Der erste, der das zu spüren bekam, war der Stadtschreiber von Villalba. Sein Pech war, daß Calògero sich in die Tochter des Besitzers der kleinen Speiseeisfabrik von Villalba verliebte, auf die auch der Stadtschreiber ein Auge geworfen hatte. Der Stadtschreiber wurde von Calòs Freunden zusammengeschlagen, und das so heiß umworbene Mädchen ist heute noch Jungfrau.
Erst berufliche Erfolge verdankte Calògero seinen guten Beziehungen zu der Bande eines gewissen Gervasi, der Anfang des Jahrhunderts das Gebiet von Villalba unsicher machte. Da es in Villalba keine Mühlen gab, mußten die Bauern über Land fahren, wenn sie ihr Getreide mahlen wollten, und da nur der junge Calògero freies Geleit garantieren konnte, hatte er bald ein Geschäft, dessen Rezept die Mafia selber erfunden haben könnte: Man schafft eine Gefahr, um dann an der Überwindung der Gefahr zu verdienen.
Als Calò einige Jahre später zusammen mit der Bande des Briganten Vassalona verhaftet und angeklagt wurde, zeigte sich, daß er tatsächlich bereits den Respekt eines angehenden Mafioso genoß: Die Zeugen schwiegen vor Angst, und Calò wurde freigesprochen.
Er wandte sich nun, kaum über zwanzig, der traditionellen Erwerbstätigkeit der Agrar-Mafia auf dem Latifundium zu. Er wurde Gabellotto. Das war bis zur Agrarreform, in den fünfziger Jahren, ein lohnendes Geschäft. In Mafia und Politik beschreibt Pantaleone den auf dem Latifundium üblichen Pachtvertrag der sizilianischen Kleinbauern.
Im ersten Jahr bestellte der Pächter den Boden auf eigene Kosten, verstreute ca. 70 Zentner Stallmist pro Tumulus (etwa 14 Aar), säte Hülsenfrüchte und Saubohnen und durfte die Ernte behalten. Lieferte der Grundherr das Saatgut, so konnte dieser 32 % der Ernte für sich beanspruchen. Im zweiten Jahr baute der Bauer Getreide an, sofern der Boden es zuließ. Im Gebiet von Villalba gestatteten die stark tonhaltigen Böden fast nur den Anbau von Hülsenfrüchten, vor allem Linsen. Die Ernte stand Pächter und Grundbesitzer je zur Hälfte zu, daher der Name «mezzadria», Halbpacht.
Vor der Teilung durfte der Grundherr zahlreiche Abzüge vornehmen. Hatte er das Saatgut gestellt, so wurden die 32 % vorweg abgezogen. Da er im Vorjahr nichts bekommen hatte, erhielt er ferner ein Minimum von zwei Zentnern Getreide oder Hülsenfrüchten pro Hektar.
Den dritten und vierten Vorrang hatten die Einkommensteuer und die Kosten für die Ausbesserung der Straßen. Sodann erhielten der Gabellotto und seine Feldhüter für jede Salme Land (2,23 Hektar) 13,5 Kilo Getreide. Sieben Kilo entfielen auf die ewige Lampe des Herrenhauses, für die ebenfalls die Pachtbauern aufzukommen hatten. Weitere sieben Kilo erhielten die Kirche und die Mönche, und 3 ½ Kilo kostete das Festessen, das man am Tag der heiligen Lucia veranstaltete.
Berücksichtigt man, daß ein «Feudo» im Durchschnitt zwischen 500 und 1000 Bauern hatte, so gingen von der Hälfte der Ernte, die den Bauern zustand, allein für den Gabellotto und die Feldhüter sowie die ewige Lampe zwischen 600 und 1200 Zentner Getreide ab. Hinzu kamen noch die Steuern und Abgaben an die Gemeinde, während die Großgrundbesitzer häufig von den Gemeindeaufgaben befreit waren, weil sie für die Instandhaltung der Kirche, das Gehalt des Pfarrers und die Kerzen und das Öl zum Fest des Dorfheiligen aufzukommen hatten.
8. Die Geschäfte der Agrar-Mafia
Juristisch gesehen waren die Gabellotti Gutsverwalter, «gabello» heißt die «Steuerpacht». Sie pachteten vom Gutsherren das Recht, seine Einnahmen bei den zahlreichen kleinen Pachtbauern einzutreiben und, da es sich um Naturalabgaben handelte, zu versilbern, denn der Graf war an Geld interessiert, nicht an einem Speicher voll Linsen oder am Getreidehandel.
Zur Verwaltung des Feudo gehörte der Abschluß der Pachtverträge mit den Bauern. Die Eintreibung der Halbpacht und die Vollmacht des Grundherrn sicherte den Gabellotti und ihren Helfern eine erhebliche Macht über die armen Bauern.
Die Mitglieder der Mafia waren deshalb der dynamischste Teil des sizilianischen Mittelstandes und beschränkten sich nicht auf die unmittelbar mit dem Latifundium zusammenhängenden Geschäfte. Lag auf dem Gebiet eines Mafioso ein Steinbruch, so verkaufte er Steine und versuchte, das Geschäft durch staatliche Lieferaufträge noch lukraktiver zu machen. Hatte er einen Lastwagen, so bemühte er sich um private, möglichst aber öffentliche Transportaufträge, beim Straßenbau oder anderen Bauvorhaben. Da Mafia stets gute Freunde in den herrschenden Parteien und der öffentlichen Verwaltung hat, sind öffentliche Aufträge bis heute eine wichtige Pfründe der Mafia.
Einige Geschäfte sind in den letzten Jahren zurückgegangen, wie die Vermittlung von Arbeitskräften, die theoretisch nur noch von den Arbeitsämtern durchgeführt werden darf. In der Praxis gibt es die private Arbeitsvermittlung jedoch noch immer. Die Vermittlung von Dauerstellungen in der Wirtschaft und mehr noch in der staatlichen Verwaltung ist ein Privileg, an dem die Mafia neben anderen «pezzi da novanta», wie den Klerikern, den Politikern und den Beamten selber, mehr denn je beteiligt ist.
Ein gutes Geschäft war und ist der private Geldverleih zu Wucherzinsen und die Vermittlung von Krediten der öffentlichen Banken, zu denen die Mafia stets gute Beziehungen hat, wenn ihre Leute nicht sogar im Verwaltungsrat der Kreditinstitute sitzen.
Unvermindert aktuell ist auch die Aufgabe, die in den Mafia-Gebieten von jedem erhoben wird, der einem Geschäft nachgeht, das von Mafia kontrolliert wird. Sie ist eine Art Umsatzsteuer, die notfalls mit Drohungen und Gewalt durchgesetzt werden kann. Zahlreiche erpresserische Entführungen von Personen, die gegen ein Lösegeld wieder freigelassen werden, sind nur auf die schlechte Steuermoral der Betroffenen zurückzuführen.
Michele Pantaleone behauptet in seinem Buch Der Stein im Mund, daß «don» Vito Cascio Ferro, der Vorgänger von «don» Calò Vizzini, die Mafia-Steuer erfunden habe. Sie wird «u pizzu» genannt. Das Wort stammt aus dem eigentümlichen Jargon der Mafia und bedeutet nach Pantaleone «Schnabel». «Sich den Schnabel baden» ist eine Umschreibung für den Becher Wein, den man angeboten bekommt, wenn man jemandem eine kleine Hilfe geleistet hat.
Die Mafia verlangt freilich mehr als nur eine kleine Erfrischung, und jeder Steuerpflichtige würde ohne die «Hilfe» der Mafia erheblich besser leben. Die Mafia schafft selber die Gefahr, vor der sie Schutz bietet.
Dennoch erhebt sie seit mindestens 70 Jahren den «pizzu» mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der der Küster die Kollekte einsammelt. Der Bauer, der ein Stück Land pachten oder seine Ernte verkaufen will, der Müller, der Obst- und Gemüsehändler, der Eisbudenbesitzer, der kleine Gastwirt, der Bettler an der Ecke, der Arbeitslose, der eine Stellung sucht, der Dr. jur., der in den Staatsdienst treten will, der Transportunternehmer und der Bauunternehmer, die einen öffentlichen Auftrag haben wollen, der Besitzer eines Landhauses, der sich gegen Einbrüche versichern will, der Besitzer eines Obst- und Weingartens, der vor Felddieben Schutz sucht, sie alle zahlen der örtlich zuständigen Mafia «u pizzu».
Erweitert ein Boß auf irgendeine Weise seine Macht, heiraten seine Kinder oder hat er Namenstag, so ist ein Geschenk fällig. Da darf keiner ein Geschenk bringen, das nicht seinem Rang in der Cosca oder seiner gesellschaftlichen Stellung entspricht.
Die Geschenke sind heute noch üblich und dienen der Polizei dazu, den Rang der einzelnen Schenker zu beurteilen. In den Zeiten der Agrar-Mafia müssen diese rituellen Geschenke den Charakter morgenländischer Zeremonien gehabt haben. Den ganzen Tag über kamen die Leute von weit her, trugen ihre Geschenke auf, die der Boß je nachdem mit müder Geste beiseite zu stellen befahl oder liebevoll zur Kenntnis nahm, küßten dem Geburtstagskind die Hände («bacciamo le mani!»[*]), bekamen wohl auch ein Glas Wein und fühlten sich zu Recht ganz nebenbei aufmerksam beobachtet. Der Boß merkte sich seine Leute.
Einige Geschäfte sind so alt wie die Geschichten der Bibel. Der Viehdiebstahl zum Beispiel, der in den letzten zehn Jahren stark zurückgegangen sein soll und wie üblich zwei Aufgaben dient. Er gilt als Verwarnung des Viehbesitzers, wenn er es an Respekt fehlen läßt. Zum anderen wird das Vieh heimlich geschlachtet und auf den städtischen Märkten weiterverkauft. Es ist ein Geschäft, das die Bestechung von Beamten und die Unterbringung von Vertrauensleuten in den zuständigen Behörden erfordert; beim Schlachthof, im Veterinäramt, bei Polizei und Carabinieri etc.
Ein anderes, ebenfalls sehr altes Geschäft hat seine wirtschaftliche Bedeutung für die Mafia behalten. Es ist der pauschale Ankauf landwirtschaftlicher Produkte durch die Obst- und Gemüsegroßhändler der Mafia, der bereits Wochen vor der Ernte stattfindet. Für den Mafioso hat der Halmkauf den Vorteil, daß er langfristig disponieren und den Kaufpreis drücken kann, da die Bauern vor der Ernte kein Geld haben und man nie genau weiß, wie die Ernte werden wird.
Dennoch nimmt der Halmkauf den Bauern nur vorübergehend ihre ständigen Geldsorgen ab und mindert auch das Risiko der Ernte nur scheinbar. Denn der Kaufpreis ist so niedrig, daß er das Risiko einer schlechten Ernte schon mit einkalkuliert, und nach der Ernte würde der Bauer sehr viel mehr für seine Produkte bekommen. Der Halmkauf ist deshalb nur eine der vielen Scheinhilfen, die die Mafia den Bauern gewährt. Ganz deutlich wird das, wenn ein Bauer sich weigert, seine Ernte vorher zu verkaufen, da er in diesem Fall mit Racheakten rechnen muß.
Fast alle Geschäfte der Mafia werden von, kriminellen Handlungen begleitet, die ihren geschäftlichen Argumenten Nachdruck verleihen sollen, oder setzen als bekannt voraus, daß jeder Mafioso bedenkenlos Gewalt anwenden läßt, um ein geschäftliches Ziel zu erreichen. Davon sind die Brotgeber der Mafia, die Großgrundbesitzer, Politiker und Advokaten, Kaufleute und Bauunternehmer nicht ausgeschlossen.
Schon im vorigen Jahrhundert prellten Gabellotti ihre Großgrundbesitzer um Pacht und sonstige Naturalabgaben, entführten wohlhabende Bürger und Adelsherren, um Lösegelder zu erpressen, und erschlichen große Ländereien zu einem lächerlichen Preis, wenn die Grundherren verkaufen wollten oder mußten. Don Calò erwarb die 505 Hektar des in der Gemeinde Serradifalco gelegenen Feudo «Suora Marchese», indem er auf der Versteigerung des Latifundiums alle anderen Interessenten einschüchtern ließ und deshalb nur den Mindestpreis zahlen mußte.
Der Erwerb des nur 280 Hektar großen Feudo Graziano im Agrigentino durch Don Calòs Nachfolger, Giuseppe Genco Russo aus Mussomeli, in der Nachbarschaft von Villalba, und andere Mafiosi ist eine Geschichte für sich.
Die Eigentümer des Feudo, die Brüder Caramazza, die das Gut 1935 geerbt hatten, versuchten seit Kriegsende vergeblich, ihr Land zu verkaufen. Da die Pächter des Landes, die drei Brüder Rubino, gute Beziehungen zur Mafia hatten, warf der Feudo praktisch keinen Gewinn mehr ab. Der Verkauf erwies sich jedoch als schwierig, da die Rubino das Gut selber zu einem Freundschaftspreis erwerben wollten und alle potentiellen Käufer abschreckten.
Nachdem sie die Caramazza hinreichend zermürbt hatten, beauftragten sie den Mafia-Boß von Canicatti, Diego Di Gioia, mit den Verkaufsgesprächen. Di Gioia stellte sich den Caramazza selbst als Käufer vor und versuchte, die Lächerlichkeit seines Preisangebotes durch unmißverständliche Drohungen auszugleichen. Daraufhin beauftragten die Verkäufer den Kriminalkommissar Tandoj aus Agrigento, für ihren privaten Schutz zu sorgen, und baten den Kommandanten der Stadtpolizei von Casteltermini, Gerardi, die Verhandlungen mit Di Gioia zu führen.
Die beiden Polizisten waren nicht so dumm, sich der einflußreichen Mafia von Canicatti zu widersetzen. Sie kannten die Sitten, nicht zuletzt, weil sie selbst eng mit Mafia zusammenarbeiteten, und wandten sich deshalb an den Boß der Bosse, Genco Russo, der das Geschäft selber in die Hand nahm und von einem seiner Leute im Katasteramt von Agrigento gefälligkeitshalber feststellen ließ, daß das Feudo tatsächlich nicht mehr wert war, als Di Gioia angeboten hatte.
Damit waren die Caramazza allseits umzingelt und hatten keine andere Wahl, als das Feudo an Genco Russo und Di Gioia zu verkaufen, die den größten Teil sofort an die Brüder Rubino weiterverkauften, die damit ihr Ziel erreicht hatten. Sie verkauften das Land weiter, noch ehe der Kaufpreis bezahlt war. Ihr Gewinn war nach großstädtischen Begriffen mit etwa 50 % noch bescheiden.
Stadtpolizeichef Gerardi erhielt für seine Mitarbeit von Käufern und Verkäufern je 3000 Mark und kaufte sich dafür einen Alfa Romeo. Das Geschäft wurde bekannt, als Kriminalkommissar Tandoj bald darauf in Agrigento ermordet wurde. Aber das gehört in ein späteres Kapitel.
Wir werden im Laufe des Buches noch viele Geschäfte der Mafia in den Städten und auf dem flachen Land kennenlernen. Sie sind von zahlreichen Faktoren abhängig und waren es auch vor der Agrarreform. Jede Mafia versteht es vorzüglich, sich den Bedingungen der Zone, in der sie operiert, anzupassen. Dabei können wir jedoch für die Agrar-Mafia bis zur Bodenreform nur einen Faktor feststellen, der unabdingbar war. Ich meine das Latifundium, das die Mafia deshalb stets mit besonderer Sorgfalt verteidigt hat.
Diese Verteidigung bediente sich zweier Methoden. Die eine Methode war der bürokratische Weg. Die andere Methode war die Gewalt. Für die bürokratische Methode sind die Machenschaften der Mafia von Mussomeli ein gutes Beispiel. Sie wurde bis in die fünfziger Jahre in zahlreichen Gemeinden, u.a. auch in Villalba, wo Don Calò die Kooperative «Freiheit» gründete, angewandt.
9. Der Feudo Polizella
Die ersten Versuche, schlecht oder nicht bestellte Latifundien an die Bauern zu verteilen, erfolgten bereits nach dem Ersten Weltkrieg. Überall bildeten Bauern, die den Schlachtfeldern entkommen waren, Veteranenverbände und forderten Land. In Mussomeli stellte die Kooperative der Kriegsteilnehmer im Mai 1920 beim zuständigen nationalen Hilfswerk den Antrag, die im Bereich von Mussomeli gelegenen Latifundien Polizzello, Valle und Reina mit insgesamt 2800 Hektar Land zu enteignen. Eigentümer der Feudi waren die Fürsten Lanza Branciforti aus Trabia, die in der Folgezeit ihre Geschäfte unter einer Firma gleichen Namens betrieben.
Die Veteranen-Kooperative von Mussomeli stand von Anfang an unter starkem Druck der lokalen Mafia, die zwar nichts dagegen hatte, selber die Verfügungsgewalt über die Ländereien zu bekommen, jedoch aus purem Selbsterhaltungstrieb verhindern mußte, daß die Auflösung der Latifundien zur Schaffung kleiner und mittlerer bäuerlicher Betriebe führte. Es kam deshalb zu einem Kompromiß zwischen dem Fürsten und den Veteranen, der von der zuständigen Behörde auch akzeptiert wurde, da er nach außen hin wie eine Umverteilung der Latifundien aussah.
Statt der beanspruchten 2800 Hektar erhielten die Bauern von Mussomeli nur 850 Hektar des Feudo Polizzello, während der Rest des Feudo und die beiden anderen Latifundien anderweitig verpachtet wurden. Die Pächter dieser Ländereien waren weder Bauern noch Veteranen, sondern Advokaten und Geschäftsleute, Leute der Mafia, die das Land sofort zu den üblichen Wucherbedingungen an landlose Bauern weiterverpachteten. Aber auch die Veteranen erwarben kein Eigentum an ihren 850 Hektar Land. Ihr Land wurde der Veteranen-Kooperative lediglich verpachtet, und die Bedingungen verschlechterten sich mit jeder Erneuerung des Pachtvertrages.
Den Nutzen der «Umverteilung» hatten damit nur die Bosse der lokalen Mafia und ihre Klienten, Freunde und Verwandten. Präsident der Veteranen-Kooperative war Mafia-Boss Giuseppe Genco Russo, Beiräte waren die Mafiosi Giuseppe Sorce und sein Schwager Calogero Castiglione, der nach dem Zweiten Weltkrieg trotz mehrerer Vorstrafen Assessor[*] für die lokalen Behörden Siziliens wurde. Präsident des Veteranenvereins von Mussomeli, dem zahlreiche Bauern der «Kooperative» angehörten, war der mit Genco Russo in alter Feindschaft verbundene Mafia-Boß Vincenzo Messina.
Die günstigen Erfahrungen mit der Ausbeutung der Bauern durch Gründung einer Kooperative und die Tatsache, daß die Veteranen-Kooperative nur einen kleinen Teil der Latifundien erhalten hatte, veranlaßten Genco Russo, auch für die Viehzüchter von Mussomeli eine Kooperative zu gründen, die 1940 weitere 950 Hektar des Feudo Polizzello pachtete.
Sie war ebenfalls in der Hand der lokalen Mafia, nur daß die Funktionen anders verteilt waren. Hier war Sorce Präsident, während Genco Russo, Castiglione und der alte «don» Pasquale Canalella Beiräte waren.
Alle diese Herren waren sich durchaus nicht einig. Die Mafia von Mussomeli bestand zeitweise aus drei Fraktionen, die sich oftmals gegenseitig umzubringen versuchten. Aber die gemeinsamen geschäftlichen und politischen Interessen hielten sie doch immer wieder zusammen. Kraft ihrer Funktionen verfügten sie über insgesamt 1800 der von den Veteranen beanspruchten 2800 Hektar und verwalteten diese Ländereien wie üblich, indem sie den Bauern die undankbare Rolle von Halbpächtern, diesmal jedoch ihrer eigenen Kooperativen zuschoben.
Aber nicht nur die Pachtbedingungen, auch die Größe der Grundstücke, die die Veteranen-Kooperative ihren Genossen zubilligte, und die Arbeitsweise der Viehzucht-Kooperative verhinderten eine Besserstellung der Bauern. Die Veteranen-Kooperative vergab 250 Hektar an 11 Unterpächter, die dementsprechend einträgliche Betriebe führen konnten, während die restlichen 250 Unterpächter sich in die übrigen 600 Hektar teilen mußten.
Ihre Betriebe waren so klein, daß sie nur bei intensiver Bebauung mit hochwertigen landwirtschaftlichen Produkten ihr Auskommen gefunden hätten. Böden, die das gestatten, gibt es jedoch nur in den «Gärten» der fruchtbaren Küstengebiete und nicht im Gebiet der Latifundien.
Die Viehzucht-Kooperative bestand aus 51 Genossen, zu denen auch die Frauen und Kinder der Bosse gehörten, die die 950 Hektar der Kooperative an 200 Unterpächter weiterverpachtet hatten.
1950 sah es so aus, als ginge das Bauerndrama von Mussomeli endlich zu Ende. Durch ein Dekret des Präsidenten der Republik wurde die Enteignung der Latifundien angeordnet. Aber nun zeigte sich erst, was eine tüchtige Bürokratie alles vermag.
Die Firma Lanza Branciforti versuchte mit allen Mitteln der politischen Mafia, durch Eingaben und Prozesse die Maßnahme rückgängig zu machen oder zumindest die Enteignungsentschädigung in die Höhe zu treiben, und erreichte, daß die Akte tatsächlich mehrere Jahre auf irgendwelchen Schreibtischen herumlag. Hierzu trug die Tatsache bei, daß die Mafia von Mussomeli in die drei Fraktionen Genco Russo, Sorce und Messina gespalten war und sich erst einigen mußte, ehe die Bauern auf dem Wege der Landverteilung abermals zugunsten der Mafia geprellt werden konnten.
Mit dem Enteignungsdekret war eine Option verbunden. Sie verpflichtete das nationale Hilfswerk der Veteranen, innerhalb einer gewissen Frist der Firma Lanza vierzig Millionen zu zahlen, da sonst der Enteignungsanspruch erlosch. Hier erreichte die Mafia, daß dem Hilfswerk im richtigen Moment aus unerklärlichen Gründen das Geld ausging. Dadurch verschaffte sie sich einen Vorteil vor den Bauern. Denn nun führte Genco Russo zur Behebung des Geldmangels eine Sammlung unter den Bauern durch und stellte selbst aus den Mitteln der Bank von Mussomeli, deren Präsident er war, einen erheblichen Betrag bereit, auf Grund dessen er in Zukunft ein größeres Mitspracherecht verlangte.
Als Ende 1952 in Mussomeli eine erste vorläufige Landverteilung stattfand, wurde die Verteilungsverhandlung von den drei Bossen Genco Russo für die Viehzüchterkooperative, Giuseppe Sorce für die Veteranen-Kooperative und Vincenzo Messina für den Veteranenverein geleitet und führte dementsprechend zur Begünstigung der Klienten der drei Fraktionen.
Die Viehzüchterkooperative beharrte noch jahrelang auf dem Standpunkt, daß ihren 51 Genossen das Land nicht einzeln, sondern nur insgesamt übertragen werden dürfe. Die Veteranen-Kooperative verfocht die Ansicht, daß nur diejenigen Bauern Land erhalten dürften, die sich an Genco Russos Sammlung für die Zahlung der Option beteiligt hatten.
Erst als 1958 die sizilianische Behörde für die Agrarreform eingriff, konnte eine definitive Landverteilung vorgenommen werden, die jedoch unzureichend war, da die Größe der Flächen und die Qualität der Böden, die den Bauern zugewiesen wurden, sowie die Betriebsmittel der Kleinbauern zur Bildung lebensfähiger landwirtschaftlicher Betriebe nicht ausreichten.
10. Die Gesetze der Agrar-Mafia
Ein sizilianisches Sprichwort sagt: «Wenn drei Leute ein Geheimnis bewahren, sind zwei von ihnen tot.» Als Mafia im «Ucciardone», dem berüchtigten Stadtgefängnis von Palermo, den Adjutanten Giulianos mit Strychnin vergiftet hatte, las man auf den Gefängnismauern: «Wer nichts sieht, nichts hört und nicht redet, wird hundert Jahre alt.»
Die Gesetze der Blutrache und der Omertà sind wichtig. Noch wichtiger aber ist, daß der Wille eines Mafia-Bosses Gesetzeskraft hat. Wer sich seinem Willen nicht unterwirft, zeigt einen schwerwiegenden Mangel an Respekt und kann dafür bestraft werden.
Auf das «kann» kommt es an. Die Mafiosi der alten Schule vergewisserten sich, ob sie auch die Macht hatten, ihren Willen durchzusetzen, ehe sie ihn zum Gesetz erhoben, und richteten ihre Handlungen danach, ob sie opportun und nützlich waren.