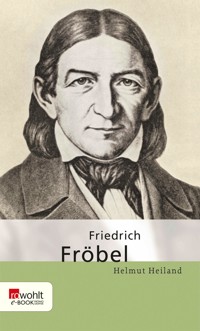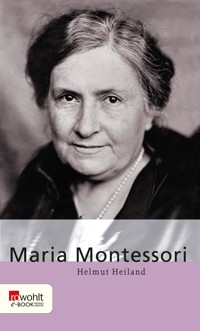
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Maria Montessori (1870–1952) hat mit ihrer Pädagogik der kindlichen Eigenaktivität eine einflussreiche internationale Bewegung ins Leben gerufen. Kindergärten und Schulen in aller Welt tragen ihre Gedanken weiter und setzen das von ihr entwickelte didaktische Material ein, mit dem Kinder selbsttätig lernen. Gerade in der modernen Gesellschaft mit ihren vielfachen Einengungen kindlicher Aktivität spielt die Pädagogik Montessoris als Alternative eine immer bedeutsamere Rolle. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Helmut Heiland
Maria Montessori
Über dieses Buch
Maria Montessori (1870–1952) hat mit ihrer Pädagogik der kindlichen Eigenaktivität eine einflussreiche internationale Bewegung ins Leben gerufen. Kindergärten und Schulen in aller Welt tragen ihre Gedanken weiter und setzen das von ihr entwickelte didaktische Material ein, mit dem Kinder selbsttätig lernen. Gerade in der modernen Gesellschaft mit ihren vielfachen Einengungen kindlicher Aktivität spielt die Pädagogik Montessoris als Alternative eine immer bedeutsamere Rolle.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Impressum
rowohlts monographien
begründet von Kurt Kusenberg
herausgegeben von Uwe Naumann
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2016
Copyright © 1991 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Für das E-Book wurde die Bibliographie aktualisiert, Stand: Mai 2016
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten
Umschlaggestaltung any.way, Hamburg
Umschlagfoto ullstein bild, Berlin (Maria Montessori, 1930)
Satz CPI books GmbH, Leck, Germany
ISBN 978-3-644-56531-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Kindheit und Jugend
Das Kind wird den Leidensweg Christi zu gehen haben. Der Beginn aber von alledem liegt in jenem ‹Ecce homo›. Hier steht ein Mensch, er trägt nicht Gott in sich, er ist wie entleert und ist bereits gedemütigt und gezeichnet worden von solchen Gewalten, die ihn hätten verteidigen können. Dann wurde er vor die Menge, vor die Autorität der Gesellschaft geschleppt.
Die Schule war für das Kind die Stätte größter Trostlosigkeit. Jene ungeheuren Gebäude scheinen für eine Menge von Erwachsenen errichtet. Alles ist hier auf den Erwachsenen zugeschnitten: die Fenster, die Türen, die langen Gänge, die kahlen, einförmigen Klassenzimmer … Die Familie ließ das Kind allein, verließ es an der Schwelle jenes Gebäudes … Und das Kind schien, weinend, hoffnungslos und von Furcht bedrückt, über jenem Tor Dantes Hölleninschrift zu lesen: ‹Durch mich gelangt man in die Stadt der Schmerzen›, in die Stadt, wo das verlorene Volk wohnt, das Volk, von dem die Gnade sich abgewandt hat.
Eine strenge, drohende Stimme forderte das Kind samt vielen unbekannten Gefährten auf, hereinzukommen, wobei man alle zusammen als böse Geschöpfe betrachtete, die Strafe verdient hatten: ‹Weh euch, ihr bösen Seelen …›
Da sitzt nun das Kind in seiner Bank, ständig gestrengen Blicken ausgesetzt, die zwei Füßchen und zwei Händchen dazu nötigen, ganz unbewegt zu bleiben, so, wie die Nägel den Leib Christi an die Starrheit des Kreuzes zwangen. Und wenn dann in jenes nach Wissen und Wahrheit dürstende Gemüt die Gedanken der Lehrerin entweder mit Gewalt oder auf irgendeinem anderen gutbefundenen Weg hineingepreßt sind, dann wird es sein, als blute dieses kleine, gedemütigte Haupt wie unter einer Dornenkrone.
Jenes Herz voll Liebe wird von der Verständnislosigkeit der Welt durchbohrt werden wie von einer Lanze, und bitter wird ihm vorkommen, was die Bildung ihm zum Stillen seines Durstes darreicht.
Schon steht das Grab bereit für die Seele des Kindes, die inmitten so vieler Unnatürlichkeit nicht zu leben vermag; und ist sie begraben, dann werden viele Wächter darauf sehen, daß sie nicht aufersteht.
Aber das Kind ersteht immer wieder und kehrt immer wieder, frisch und lächelnd, um unter den Menschen zu leben.[1]
Um zum Verständnis der Wünsche des Kindes zu gelangen, müssen wir es wissenschaftlich erforschen, denn seine Wünsche sind oft unbewußt. Sie sind der innere Schrei des Lebens, das sich nach geheimnisvollen Gesetzen zu entfalten wünscht. Wir wissen sehr wenig über die Art seiner Entfaltung. Gewiß wächst das Kind kraft einer göttlichen Einwirkung heran ähnlich der, die es vom Nichts zum Kinde werden ließ.
Unser Eingriff in diesen wunderbaren Vorgang istmittelbar: wir haben diesem Leben, das von selbst in die Welt kam, die zu seiner Entwicklung erforderlichenMittel zu bieten, und haben wir dies getan, so müssen wir achtungsvoll seine Entwicklung abwarten.[2]
Wir haben schon ein sehr interessantes Ergebnis erzielt, indem es uns gelang, neue Mittel zu bieten, vermöge deren die Kinder einen höheren Zustand der Ruhe und Güte erreichen können, und diese Mittel vermochten wir schon durch die Erfahrung zu erproben. Die ganze Grundlage unserer Erfolge beruht auf diesen Mitteln, die wir gefunden haben und die sich in zwei Rubriken bringen lassen:Organisation der Arbeit undFreiheit.
Eben die vollständige Organisation der Arbeit, welche die Möglichkeit der Selbstentwicklung gewährt und dem Tätigkeitsdrang Raum gibt, verschafft jedem Kinde eine wohltuende und beruhigendeBefriedigung. Und unter diesen Arbeitsverhältnissen führt die Freiheit zu einer Vervollkommnung der Fähigkeiten und zur Gewinnung einer schönen Disziplin, die selbst das Ergebnis jener im Kinde entwickelten neuen Eigenschaft, derRuhe ist. (1936)[3]
Diese Aussagen über das Wesen des Kindes und über Erziehung weisen zurück auf Maria Montessori selbst. Sie veranschaulichen unterschiedliche Seiten ihrer Persönlichkeit. Sie zeigen eine Orientierung an erfahrungswissenschaftlicher Forschung, aber auch die religiös-christliche Haltung Montessoris. Maria Montessori wurde als Ärztin durch die naturwissenschaftliche Schule medizinischer Ausbildung geprägt. Zugleich vertritt sie als Pädagogin eine Sicht vom Kind, die sie teilweise mit Bildern und Gleichnissen der Bibel beschreibt. In diesen Chiffren und Metaphern mit ihrer farbenkräftigen Anschaulichkeit schwingen Wehmut und Hoffnung mit: Wissenschaft vermag viel, sehr viel – so die Botschaft Montessoris –, aber sie vermag letztlich nicht das wahre Sein des Kindes zu erfassen. Sie vermag es auch nicht hervorzubringen. Wissenschaft und die von ihr erdachten und erprobten Mittel und Methoden der Erziehung vermögen das Kind, den heranwachsenden Menschen zwar eindeutig zu bestimmen und gehen doch dann gerade am wahren Wesen des Menschen vorbei. Das Kind als die Stelle, wo sich immer wieder der Mensch, das Wesen des Menschen in seiner Ursprünglichkeit manifestiert, wird nur dort sichtbar, wo Wissenschaft sich ihrer Grenzen bewusst wird, indem sie ihre Leistung innerhalb dieser Grenzen begreift. Das wahre Kind ist das durch Erziehung frei gewordene Kind.
Die Pädagogik Maria Montessoris hat zu allen Zeiten Kritik hervorgerufen. Aber vielfach waren Unverständnis und einseitige Kenntnis ihres Werks die Ursache dieser Kritik. Das Frühwerk scheint strengsten naturwissenschaftlich-empirischen Kriterien verhaftet zu sein. Die späteren Arbeiten tendieren scheinbar zum Spekulativen. Ihr Werk wirkt uneinheitlich. Die genauere Betrachtung korrigiert jedoch diesen Eindruck: Auch die frühen Werke beschreiben letztlich eine Erziehungspraxis, deren Ergebnisse nur begrenzt empirisch messbar, wohl aber erfahrbar sind. Und die späteren Schriften integrieren die frühen Ansätze in einer umfassenderen Schau des Kindes, ohne die empirischen Befunde und die Methoden und Mittel der Frühzeit aufzugeben. Man wird daher in der Geprägtheit Montessoris als naturwissenschaftlich ausgebildete Ärztin und als Mensch mit einer tiefen, aber nicht ausschließlich katholisch-christlichen Religiosität[4] die beiden Wurzeln ihrer Pädagogik sehen müssen.
Wer war diese Frau, die – noch im bürgerlichen 19. Jahrhundert geboren – doch alle Krisen, Zusammenbrüche und Katastrophen unseres Jahrhunderts, unserer Zeit, miterlebt, miterfahren, ja miterlitten hat? Wer ist diese Maria Montessori, die als einzige bedeutende Pädagogin ein Werk geschaffen hat, das man unbestreitbar als weltumspannend bezeichnen muss und das bis heute ungemindert diskutiert wird und in der Praxis von Kindergärten und Schulen seine Aktualität und Gültigkeit beweist? Lassen sich Bezüge zwischen Leben und Werk nachweisen? Ist ihr Werk, die Pädagogik Maria Montessoris, in ihrem Leben begründet?
Maria Montessori wird im Jahr der staatlichen Einigung Italiens, am 31. August 1870 in Chiaravalle in der Provinz Ancona geboren. Ihr Vater, Alessandro Montessori (1832–1915), ist Finanzbeamter, die Mutter, Remide Montessori, geb. Stoppani (1840–1912), stammt aus einer Gutsbesitzerfamilie und ist die Nichte des hervorragenden Naturwissenschaftlers Antonio Stoppani, der sich auch durch liberale Äußerungen zu Zeitfragen einen Namen gemacht hat. Während der Vater wohl eher der kleinbürgerlichen Schicht zuzuordnen ist – Marias Großvater väterlicherseits ist Angestellter in einer Tabakhandlung in Bologna gewesen[5] – und deutlich konservative Züge entwickelt, ist die Mutter hochgebildet und vertritt liberale Ansichten. Sie reagiert auf Zeitveränderungen aufgeschlossen. Diese unterschiedlichen Lebenseinstellungen werden sich bei der späteren Berufswahl Marias deutlich bemerkbar machen.
Alessandro hatte Arithmetik und Rhetorik studiert. Er wird 1850 Angestellter in der Finanzbürokratie des Vatikans und arbeitet dann als Inspektor in der Salz- und Tabakindustrie. 1859 wird er Inspektor in der Finanzverwaltung der Romagna, 1863 wird er zuständig für die Abgaben der Salz- und Tabakindustrie in der Finanzverwaltung der Romagna, die sich inzwischen dem Königreich Sardinien-Piemont angeschlossen hat. In dieser Funktion kontrolliert er 1865 in Chiaravalle die dortige Tabakindustrie und lernt Renilde kennen. Die Heirat findet 1866 statt. 1873 wird Alessandro nach Florenz versetzt, 1875 nach Rom, wo dann das Ehepaar Montessori bis zu seinem Tode leben wird.
Die Biographin Maria Montessoris, Rita Kramer, schildert das Ehepaar Montessori: «Sie waren ein anziehendes Paar: er mit lockigem, dunklem Haar und einem dunklen Schnauzbart, sie rundlich, wie es Mode war, rundäugig und mit sanften Zügen. Wenn sie in der Stadt spazierengingen, Alessandro in einem Straßenanzug, geschmückt mit einer baumelnden Uhrkette, und Renilde in wohlanständigem Schwarz, den Spitzenkragen mit einem kleinen goldenen Kreuz verziert und eine Rose in den auf dem Kopf hoch aufgetürmten Locken, erschienen sie wie ein Bild der Achtbarkeit und Prosperität.»[6] Kramer entwirft dieses etwas idyllisch anmutende Lebensbild nach den überlieferten Fotografien.
Die Kindheit Maria Montessoris ist nicht zuverlässig fassbar. Aussagen der Eltern und von Bekannten über die kleine Maria liegen nicht vor. Auch autobiographische Notizen Montessoris über diese Zeit existieren nicht. Aussagen zur Kindheit bieten die beiden Mitarbeiter Montessoris, Anna Maccheroni und Edward M. Standing.[7] Maccheroni lernte 1907, Standing 1921 Maria Montessori kennen. Wann die biographischen Aussagen Maccheronis und Standings festgehalten wurden, ist nicht bekannt, mit Sicherheit jedoch zu einer Zeit, als Montessori bereits weltbekannt war. Dass diese Aussagen autobiographische Qualität besitzen, also durchaus Maria Montessori zuzuschreiben sind, schließt ihren verklärenden Charakter nicht aus. Veröffentlicht werden sie Ende der vierziger, bzw. in den fünfziger Jahren. Kramer kennzeichnet diese Aussagen mit einer gewissen Berechtigung als «Legenden» und «anekdotisches Material».[8]
Standing bietet verschiedene Kindheitsszenen von unterschiedlicher Bedeutung.[9] Da wird zum einen die zur Selbstdisziplin erziehende Mutter Renilde sichtbar, die nach der Rückkehr von einer Ferienreise der hungrigen und quengelnden kleinen Maria ein vier Wochen altes Stück Brot mit den Worten gibt: «Also gut, wenn du nicht mehr warten kannst, dann iß das.» Die sozialen Pflegedienste Marias – sie muss für arme Familien stricken und ein behindertes Kind der Nachbarschaft bei Spaziergängen begleiten – zeigen nach Standing bereits Marias «Interesse für Menschen … denen es schlechter ging als ihr selbst».
Maria besaß zu dieser Zeit bereits «ein starkes Gefühl für persönliche Würde» und konnte andere Kinder durchaus verbal ‹herabsetzen›: So, wenn sie zu einem Mädchen sagt: Du! Du bist ja noch nicht einmal geboren! Eine Mischung von Beleidigung und persönlicher Profilierung verdeutlicht eine andere Bemerkung zu einer Mitschülerin: Erinnere mich bitte daran, dass ich beschlossen habe, nie mehr mit dir zu sprechen. Eine Variante dazu stellt ihr Verhalten einer Lehrerin gegenüber dar, die sich «abschätzig» über den «Ausdruck von Marias Augen beim Zuhören» geäußert hatte und die von Maria dann nicht mehr angesehen wurde.
Standing berichtet auch über die friedenstiftende Funktion der kleinen Maria. Als die Eltern sich stritten, soll Maria einen Stuhl zwischen beide geschoben, sich daraufgestellt und die Hände der Eltern ineinandergefügt haben. Kommentar Standings: «Frieden zu stiften – und allen Benachteiligten zu helfen – sollte ihr ganzes Leben lang ihr Hauptanliegen bleiben.» Am aufschlussreichsten aber dürfte eine Geschichte sein, die Anna Maccheroni berichtet: «Als die zehnjährige Maria eines Tages schwer krank war, habe sie zu ihrer besorgten Mutter gesagt: Mach dir keine Sorgen, Mutter, ich kann nicht sterben, ich hab’ noch zuviel zu tun.»[10]
Es gibt so gut wie keine autobiographischen Aussagen Marias zur Erfahrung der Dinge. Nahezu alle Berichte über ihre Kindheit beziehen sich auf den sozialen Bereich. (Marias Vorliebe, eine bestimmte Anzahl Fliesen beim Hausputz zu reinigen[11], dürfte für diesen Zusammenhang wohl kaum bedeutungsvoll sein.) Aber alle Berichte stimmen darin überein, dass Maria Montessori bereits als Kind sehr selbstbewusst, aber auch deutlich ichbezogen ist:
«Das Mädchen, das durch diese Geschichten hindurchschimmert, ist selbstsicher, willensstark, ein wenig selbstgefällig. Maria hat jenes Pflichtgefühl, das manchmal zur Intoleranz gegenüber anderen führt. Kurzum, sie war die geborene Sozialreformerin und gewiß eine auffallende Einzelgängerin dort und damals.»[12]
Sicherlich hat die Tatsache, dass Maria keine Geschwister besaß und so die völlige Zuwendung beider Eltern genoss, zur Entwicklung dieser Charakterzüge beigetragen. Jedenfalls ist die imponierende Lebensleistung Maria Montessoris, ihr umfangreiches schriftliches Werk mit über 800 Veröffentlichungen[13] und einer täglichen Arbeitszeit von acht Uhr früh bis ein Uhr nachts bis ins hohe Alter[14] nur aus der Verbindung einer überragenden Intelligenz und eines hohen Arbeitsethos im Dienst der Erziehung zu erklären.
Die überlieferten autobiographischen Zeugnisse enthalten kaum Aussagen über ihr Spielverhalten als Kind. Ob hier ein gewisses Defizit vorliegt, das ihr eigenes Arbeitsethos und die Dominanz der Arbeit in ihrer Pädagogik begründen könnte, muss offenbleiben.
Mit dem Umzug nach Rom verändert sich für die fünfjährige Maria vieles. Die Großstadt Rom fasziniert durch ihre anregende Atmosphäre, die Bildungsmöglichkeiten sind wesentlich besser als in der Provinz, wenngleich auch die römischen Grundschulen der damaligen Zeit einer Stock- und Paukdidaktik huldigen und die geistigen Kräfte nicht zu entwickeln vermögen. Die Klassen sind überfüllt, die Lehrer schlecht ausgebildet. Es überrascht nicht, dass sich Maria in diesem Milieu trotz ihrer hohen Intelligenz nicht auszeichnet. Im ersten Schuljahr wird sie wegen guten Betragens gelobt, im zweiten wegen guter Leistungen beim Anfertigen weiblicher Handarbeiten (Näh- und Strickarbeiten). Zunächst aber scheint sie in der Grundschule keinerlei Ehrgeiz zu haben. Standing berichtet in zwei Episoden darüber: «Einmal weinte eine ihrer kleinen Mitschülerinnen, weil sie nicht versetzt worden war. Ich konnte das gar nicht verstehen, berichtete Maria Montessori später, denn ich fand eine Klasse genau so gut wie die andere, und das habe ich ihr auch gesagt.»[15] Und eine weitere Erinnerung Montessoris aus der Feder Standings: Eine unserer Lehrerinnen war von der fixen Idee besessen, das Auswendiglernen von Lebensläufen berühmter Frauen müsse uns zur Nachahmung anspornen. Jede ihrer Erzählungen schloß mit der Mahnung: ‹Auch ihr solltet nach Ruhm streben! Möchtet ihr denn nicht berühmt werden?› – ‹O nein›, gab ich ihr eines Tages trocken zur Antwort, ‹ich will nicht berühmt werden. Ich habe viel zu viel Mitleid mit den Kindern der Zukunft, als daß ich die Liste noch um eine Biographie verlängern möchte.›[16]
Allmählich scheint Maria aber doch an ihrem leichten Lernen Freude gefunden zu haben und sucht gezielt den schulischen Erfolg. Sicherlich hat auch die Mutter eine wichtige Rolle bei dieser sich verstärkenden Einstellung gespielt. Denn Renilde Montessori sah in Marias zukünftigem Lebensweg Möglichkeiten, die sie selbst nicht verwirklichen konnte, und wollte auf jeden Fall für Maria eine hochqualifizierte Ausbildung und spätere Berufstätigkeit, nicht lediglich die obligat erscheinende Verheiratung.
Maria beginnt intensiv zu lesen und beschäftigt sich insbesondere mit Mathematik. Hier mögen auch Anregungen des Vaters wirksam gewesen sein. Kramer berichtet, dass Maria – wohl gegen Ende der Grundschulzeit, eher schon in der Sekundarschule – sogar bei einem Theaterbesuch das Mathematikbuch mitnimmt und es während der Vorstellung studiert.[17]
Nach der sechsjährigen Grundschulzeit tritt Maria mit dreizehn Jahren – also im Herbst 1883 – in die Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buonarotti ein.[18] Dies war eine naturwissenschaftlich-technische Sekundarschule mit dreijähriger Unterstufe, der sich ein weiterführender vierjähriger Kurs anschloss. Der Abschluss berechtigt zum Hochschulstudium. Die Entscheidung für die Scuola Tecnica ist für ein Mädchen damals ungewöhnlich gewesen. Sofern Mädchen überhaupt in die Sekundarschule gingen – und das waren nur wenige –, wurde das ginnasio bevorzugt, weil es gesellschaftlich brauchbare humanistische Allgemeinbildung vermittelte. Die naturwissenschaftlich-technische Sekundarschule, vergleichbar der deutschen Oberrealschule, aber war deutlicher ausbildungs- und berufsbezogen.
Maria spielt mit dem Gedanken, Ingenieur zu werden.[19] Die Eltern bevorzugen den Lehrerberuf als Ausbildungsziel. Doch die Mutter stellt sich auf die Seite Marias. Und es gelingt, nach ziemlich heftigen Auseinandersetzungen – in diesen Zusammenhang mag wohl auch die berichtete «Friedensszene» gehören –, den Vater zu überzeugen. Denn Alessandro Montessori sieht zunächst in dem Wunsch Marias eine Neuerung, die er mit seiner konservativen Weitsicht nicht zu vereinbaren vermag.
Die Unterrichtspraxis der Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buonarotti und des Regio Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, das Maria von 1886 bis 1890 besucht, ist lehrbuchorientiert.[20] Ein selbständiges Erkunden und Erforschen von fachlichen Zusammenhängen durch den Schüler mit Hilfe des Lehrers gibt es nicht. Möglicherweise haben sich hier erste Aspekte eines Konzepts selbstaktiven Lernens bei Maria Montessori herausgebildet. Denn Selbsttätigkeit, eigenes Tun ist ja zentrales Element ihrer Entwicklungspädagogik.
Der Fächerlehrplan ist modern: Dem dreijährigen Kurs mit Mathematik, Französisch, Buchhaltung, Geschichte, Erdkunde und einer Einführung in die Naturwissenschaften folgt der vierjährige Kurs mit modernen Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch), Mathematik, Physik und Chemie, dazu kommen noch «kommerzielle Fächer»[21]. Aus dem Lehrbuch wird vom Lehrer vorgetragen. Der Lehrbuchtext muss auswendig gelernt und im Gedächtnis behalten werden. Schulischer Unterricht ist präzise Reproduktion gespeicherten Wissens. Eine Überprüfung des Verständnisses der jeweiligen Thematik findet nicht statt und ist nicht wünschenswert.
Kramer sieht in der Tatsache, dass Maria Montessori dieses Drillsystem mit vorzüglichen Leistungen absolviert und trotzdem später in kreativer Weise eine neue und weltweit rezipierte Erziehungskonzeption zu schaffen vermag, zu Recht einen eindeutigen Beleg für die «Genialität» Maria Montessoris.[22] – Nach Abschluss des dreijährigen Kurses 1886 mit guten Leistungen in allen Fächern besucht Maria den weiterführenden vierjährigen Kurs im Regio Istituto Tecnico Leonardo da Vinci. Auch hier ist sie überaus erfolgreich. Insbesondere ihre Leistungen in Mathematik sind vorzüglich. – Gegen Ende der Institutszeit ändert Maria ihr Berufsziel. Nun will sie Ärztin werden und Medizin studieren. Diesem Einstellungswandel liegt nach der Darstellung Anna Maccheronis ein «mystisches Erlebnis» zugrunde[23], das Standing allerdings später, im Medizinstudium selbst ansiedelt.[24] Maccheroni berichtet: «Sie kann selbst nicht erklären, wie es zustande kam. Es geschah in einem einzigen Augenblick. Sie ging auf der Straße, als sie einer Frau mit einem Baby begegnete, das einen langen, schmalen, roten Papierstreifen in der Hand hielt. Ich habe Dr. Montessori mehrmals diese kleine Straßenszene beschreiben hören, ebenso den Entschluß, der ihr dabei in den Sinn kam. In solchen Momenten trat ein langer, tiefer Blick in ihre Augen, als suche sie nach Dingen, die weit über Worte hinausgingen. Dann pflegte sie zu sagen: ‹Warum?› und mit einer kleinen ausdrucksvollen Handbewegung anzudeuten, daß seltsame Dinge in uns geschehen, die uns zu einem Ziel führen, das wir nicht kennen.»[25] Die Szene bietet nichts Eindeutiges. Man könnte sie psychoanalytisch deuten. Man könnte sie als Vorwegnahme, als Antizipation der Entwicklungspädagogik Montessoris interpretieren. Eine solche Deutung würde dann aber nicht den Entschluss zum Medizinstudium erklären oder diesen doch deutlich zugunsten einer pädagogischen Grundentscheidung relativieren.
Wie dem auch immer sei: Alessandro Montessori sieht sich 1890 dem drängenden Wunsch seiner zwanzigjährigen Tochter konfrontiert, Medizin zu studieren und den Arztberuf ausüben zu wollen. Aber es gibt in Italien keine einzige Ärztin. Der Arztberuf ist absolute Domäne des Mannes.
Studium der Medizin
Das aufschlussreichste Zeugnis aus Maria Montessoris Studienzeit stellt der «Brief an Clara» aus dem Jahre 1896 dar, den Rita Kramer erschlossen hat. Dieser Brief zeigt aus der Rückblende, aber mit der Suggestivität direkten Erlebens, die persönlichen Probleme der jungen Medizinstudentin in der Anatomie, im Umgang mit dem Menschen als Leiche:
Die erste Vorlesung … fand im Anatomischen Institut statt. Ich kam eine Viertelstunde vor Beginn dort an, und man führte mich in einen Saal.
Es war dunkel und sie machten ein Fenster auf. Ich sah, daß der Saal sehr lang und durch einen Säulengang zweigeteilt war. Er hatte sechs Fenster. Das eine Fenster ließ nur wenig Ficht herein, und als ich mich im Halbdunkel umdrehte, erblickte ich ein ungeheuer großes stehendes Skelett. Ich sah es lange an und drehte mich dann um. In einem Schrank waren Gläser mit Eingeweiden und anderen inneren Organen in Spiritus. Das Skelett bedrückte mich. Ich ging durch den Bogen und befand mich in der anderen Hälfte des Raumes. Es war fast ganz dunkel dort. In einem Schrank sah ich eine Reihe von Schädeln … Ich wandte meine Augen ab und begann auf und ab zu gehen, abgestoßen von allem, was ich sah.
Während ich dort ging, dachte ich nicht, sondern ich fühlte: diese inneren Organe kamen mir vor wie Folterwerkzeuge, die jemandem schrecklichen Schmerz zugefügt hatten. Diese Schädel waren Romane unendlicher Leiden … Ich sagte mir: ‹Komm, mach, daß du hier rauskommst!› Da, auf der andern Seite schien sich das Skelett – das mir immer noch riesiger erschien – zu bewegen.
‹Mein Gott, was hab’ ich getan, um so leiden zu müssen? Warum bin ich hier allein inmitten all dieses Todes? Komm, nimm dich zusammen, das sind nur Gefühle; Empfindungen muß man überwinden … Dieses Skelett rührt sich nicht. Und was ist schließlich schon ein Skelett? Und wenn ich es einmal anfaßte?› Ein Schauer überlief mich. Ich hatte das Gefühl, mein Skelett würde vom übrigen getrennt, als würde ich so reduziert wie das, was da vor mir stand. ‹Verfluchte Verrücktheit›, murmelte ich und ging hinüber zum Fenster …
Während ich hinausschaute in die Sonne und ins Leben, bedrückte mich eine schwere Last. Das Skelett, diese Schädel und diese Organe; sie fesselten mich. Meine Gedanken hatten sich keinen Augenblick von ihnen getrennt.
Ich ging zurück mit einem Gefühl der Leere im Herzen, mit zitternden Knien, und das Blut strömte mir ins Herz … Ich lehnte mich an die Wand und konnte den Blick nicht von dem Lichtschein lösen. Ich wußte, daß ich alles liebte, was außerhalb dieses Raumes war. Ich hatte ein Gefühl äußerster Schwäche und dann der Angst, als stürbe mein Körper nach und nach. Ich lehnte mich an die Wand, war außer mir und litt Qualen.