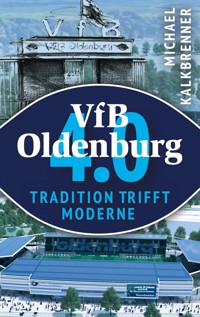Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Klug, kritisch, offen und warmherzig erzählt Michael Kalkbrenner in seinem autobiographischen Rückblick von seinem Leben mit dem Fußball, von seiner Zeit als Profisportler und Manager in seiner Heimatstadt Oldenburg, aber auch von seinen Stationen in Saarbrücken und Osnabrück. Es geht um Aufstiege, Abstiege, um Macht und Intrigen. Und doch feiert Michael Kalkbrenner seinen größten Sieg erst viel später. Er gewinnt den Wettkampf seines Lebens gegen eine heimtückische Krankheit. In einem eigenen Kapitel beschreibt er ausführlich die sehr belastende und gefährliche Therapie seiner Leukämie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
All den lieben Menschen in meinem Leben!
Inhalt
Prolog
»Fußball – ein wunderbares Spiel …« Kindheit und Jugend
Wie alles begann
Sechziger-Jahre-Familienidylle
Auf zu neuen Ufern
»Nur Fußball reicht mir nicht …« Spieler und Student
Studium an der roten UNI
VfB Oldenburg – Tradition pur
Mein Wechsel zum 1. FC Saarbrücken
VfL Osnabrück – erneut ein ruhmreicher Verein
Resümee einer schönen Zeit
»Eigentlich wollte ich aufhören …« Familie, Beruf, VfB Oldenburg
Vom Spieler zum Geschäftsführer
Andere Berufe und erneut der VfB
Berufliche und familiäre Achterbahnfahrt
Und immer wieder mein Verein
»Du kannst doch nicht aufgeben …« Der Wettkampf meines Lebens
Fit und trotzdem todkrank
Drei Schritte in ein neues Leben
Hürden auf dem Weg ins Ziel
Ausblick
Prolog
»Die Geschichte eines jeden Menschen kann uns weiterhelfen – entweder als Vorbild oder als Warnung.«
(Jim Rohn)
Aufgrund einer lebensbedrohlichen Leukämieerkrankung lag ich insgesamt über ein halbes Jahr im Krankenhaus und rang mit dem Tode. Ich hatte sowohl psychisch wie physisch sehr belastende Phasen meiner Therapie zu überstehen. Chemotherapien und Operationen wechselten sich ab. Hinzu kamen die vielen Nebenwirkungen der Behandlung meines Blutkrebses.
Während meiner Zeit im Krankenhaus erlebte ich viele emotionale Momente der Erinnerung durch Träume, während der Dämmerzustände nach Operationen, nach intensiven Medikationen sowie während der unzähligen Stunden, in denen ich über mein Leben nachdachte. Dabei mischten sich wundervolle Momente mit traurigen Erlebnissen – viele davon hatte ich fast vergessen oder sie zumindest lange nicht erinnert.
Meine Eltern und Geschwister, aber insbesondere meine Frau und meine Kinder durchlebten während meiner Krankenhausaufenthalte eine schwere Zeit. Die Unsicherheit des Behandlungserfolges sowie meine Einlassungen für den Fall meines Todes, machte allen sehr zu schaffen. Hinzu kam, dass ich auch äußerlich von schwerer Krankheit gezeichnet war.
Meine Chancen, die nächsten fünf Jahre zu überleben lagen bei fünfzig Prozent, wie mir die Ärzte versicherten – nicht die besten Voraussetzungen für ein sorgenfreies Leben. Darüber hinaus war ich mir im Klaren darüber, dass ich die nächsten Monate nicht an meinen Arbeitsplatz zurückkehren würde.
In dieser Situation entschloss ich mich, die Zeit zu nutzen, um die Erinnerungen an mein Leben in Form eines Buches zusammenzutragen. Zum einen, um zu resümieren, wie erfüllend mein Leben bisher war – in der Hoffnung, dass mich der Gedanke an den Tod nicht mehr ganz so belasten würde. Zum anderen, um dem Leser anhand meiner Kranken- und Lebensgeschichte im Sinne von Jim Rohn weiterzuhelfen, als Vorbild oder Warnung.
Meine Leukämieerkrankung und die erforderliche Therapie einschließlich meiner Krankenhausaufenthalte werde ich am Ende meines Buches detailliert beschreiben. Gerne möchte ich auf diesem Wege selber Betroffene oder andere Interessierte informieren und motivieren: Dass es sich lohnt, die mit der Erkrankung und ihrer Therapie verbundenen Herausforderungen anzunehmen, zeigt mein persönliches Beispiel. Ich selber habe die »Flinte beinahe ins Korn geworfen« und bin aufgrund meiner Genesung froh, mich der sehr belastenden und gefährlichen Behandlung meiner Erkrankung letztendlich doch gestellt zu haben.
Meine Lebensgeschichte habe ich soweit zusammengetragen, wie ich sie erinnere. Ich habe keine umfangreichen Recherchen angestellt, um jede Phase meines Lebens zu rekapitulieren, sodass mitunter auch Lücken in meinem Rückblick entstehen. Die Ausführungen zu den jeweiligen Lebensphasen spiegeln letztlich die Momente meines Lebens wider, die Spuren bei mir hinterlassen haben. Es waren viele sehr emotionale, atemberaubende Erlebnisse, die als Empfindungen von Glück zusammengefasst werden können. Ihnen stehen Momente gegenüber, auf die ich gerne verzichtet hätte. Sie prägen das Leben jedoch genauso, wie die Erfahrung von Glück: (Todes-)Angst, Perspektivlosigkeit, Traurigkeit, Enttäuschungen oder auch Wut.
In meiner Kindheit und später als Profi habe ich leidenschaftlich gerne Fußball gespielt und hierbei große Erfolge erzielt. Ich habe dabei sehr viele Abenteuer erleben dürfen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Manchmal bin ich selber überrascht davon, wie sehr mir einzelne Erlebnisse auch nach Jahrzehnten noch präsent sind. Auch meine Jahre als hauptberuflicher oder ehrenamtlicher Mitarbeiter beim VfB Oldenburg waren überaus erfolgreich. Bis heute ist mir der ruhmreiche Verein eine Herzensangelegenheit. Da sich der Fußball wie ein roter Faden durch mein Leben zieht, habe ich ihn in meinem autobiographischen Rückblick in den Mittelpunkt gerückt, wie es der Titel meines Buches bereits zum Ausdruck bringt.
Die Wahrheiten, die in diesem Buch das Tageslicht erblicken – sei es aus meinem Privatleben, meiner Zeit als Fußballprofi oder Manager in der zweiten Fußballbundesliga, aber auch aus meinem »normalen« Berufsleben, mögen den betroffenen Personen im Einzelfall nicht gefallen. Sie gehören aber zu meiner Vita – ich werde auf sie daher nicht verzichten. Andererseits entspricht der Blick auf die Menschen in diesem Buch meiner Erinnerung: Er ist sehr persönlich, subjektiv und nicht immer gerecht. In Fällen von lebenden und / oder leicht zu identifizierenden Personen, deren Urteil über das Geschriebene nicht eingeholt werden konnte, habe ich daher die Namen geändert, es sei denn, es handelt sich um Personen des öffentlichen Lebens.
»Fußball – ein wunderbares Spiel …« Kindheit und Jugend
Wann genau ich das erste Mal auf dem Sportplatz des Tus Ofen einem Fußballspiel zugeschaut habe, kann ich nicht sagen. Aber es war der Beginn einer Leidenschaft für ein Spiel, das mich mein Leben lang begleiten sollte.
Ich ging noch nicht zur Schule und muss ungefähr vier oder fünf Jahre alt gewesen sein. Ich war klein und schmächtig und meine dünnen Beinchen steckten sicherlich in kurzen, speckigen Lederhosen mit Latz, wie sie auch mein Bruder und so viele Jungen meines Alters damals trugen. Mein Bruder Frank ist ein Jahr jünger als ich und mit ihm an meiner Seite besuchte ich so oft wir durften die Heimspiele der Herrenmannschaft unseres Heimatvereins. Der Sportplatz lag nur wenige 100 Meter vor unserer Haustür, besaß keine Umzäunung und war damit frei zugängig. Wir gesellten uns häufig unter die wenigen, aber lautstark schimpfenden oder jubelnden Zuschauer, die direkt am Spielfeld standen. Frank und ich waren geradezu fasziniert von dem, was die Spieler dort auf dem Platz trieben: das Spiel zweier Mannschaften gegeneinander, der Kampf Mann gegen Mann, das Spiel miteinander – die Ballstafetten, Torschüsse, fliegende Torhüter, Torjubel oder auch lautstarke Auseinandersetzungen gegnerischer Spieler und Zuschauer, die ihre Freude oder ihren Unmut zum Ausdruck brachten und dabei häufig ihren Regenschirm in den Himmel reckten.
Angetan hatten es uns erst recht die Begegnungen mit den älteren Jungen während ihrer Meisterschaftsspiele, die wir regelmäßig besuchten. Schon bald hatten wir unseren eigenen Fußball dabei, da wir den Älteren mit größter Begeisterung nacheiferten. Schauten wir den Jungen beim Training zu, durften wir uns auch schon einmal in das Tor stellen, auf das die älteren Burschen schossen. Wenn wir dann in der kalten Jahreszeit den nassen und schweren Ball, der damals noch aus echtem Leder mit dicken Nähten gefertigt wurde, mit voller Wucht ins Gesicht bekamen, gingen wir auch schon mal k.o. Das hielt uns jedoch nicht davon ab, weiterzuspielen, im Gegenteil, sahen wir doch, dass dieser Sport etwas für »echte Kerle« war.
Seit jenem Tag, als wir das runde Leder von unseren Eltern geschenkt bekamen, sollte der Ball ein ständiger Begleiter unserer Kindheit und Jugend werden. Jeden Tag wurde gedribbelt, unendlich gegen die Garagentore gepasst, in die Luft geschossen und wieder kontrolliert. Wir liebten es, den Ball zu jonglieren und dabei immer erfolgreicher zu werden. Wir waren von dieser Art des Spielens unglaublich angetan und konnten nicht genug davon bekommen.
Wie alles begann
Elf Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges wurde ich in Oldenburg geboren. Im Kalender stand der 1. Juli 1956. Da dieser Tag auf einen Sonntag fiel, kommt er in den üblichen Jahreschroniken nicht so häufig vor.
Mein Geburtsjahr hatte es jedoch vielfältig in sich: Mit dem Einrücken von etwa 1.500 Freiwilligen beginnt der Aufbau der Bundeswehr als westdeutsche Nachkriegs-Streitmacht. Die Wehrpflicht wird eingeführt und auf zwölf Monate festgelegt. Gleichzeitig wird der zivile Ersatzdienst für Kriegsdienstverweigerer eingerichtet. Sowjetische Panzereinheiten marschieren in die ungarische Hauptstadt Budapest ein, schlagen den Volksaufstand nieder und beenden damit den Versuch Ungarns, sich aus dem Ostblock zu lösen und demokratische Reformen einzuleiten. Ein Arbeiteraufstand in der polnischen Stadt Posen wird durch Armeeeinheiten blutig niedergeschlagen. Israelische Streitkräfte greifen Ägypten an und besetzen mit Unterstützung britisch-französischer Luftunterstützung in kürzester Zeit die gesamte Sinai-Halbinsel. Sie reagieren damit auf die ägyptische Verstaatlichung des Suezkanals, der bisher in französischem und britischem Besitz war. Der junge Senator John F. Kennedy hält eine bedeutende Rede: »Vietnam ist der Eckpfeiler der freien Welt in Südostasien, der Schlussstein im Bogen, der Stopfen im Deich. Er ist unser Kind, wir dürfen es nicht verlassen, und wir können seine Bedürfnisse nicht ignorieren.« Mit diesen Worten fasste Kennedy zusammen, was die Machtelite in Washington dachte, mit dieser Rede zeichnete sich ab, dass John F. Kennedy als späterer Präsident der USA eine bedeutende Rolle bei der Eskalation des fürchterlichen Vietnamkriegs spielen sollte. In der Bundesrepublik Deutschland wird die Kommunistische Partei Deutschland (KPD) als verfassungsfeindliche Partei eingestuft und verboten.
Der Bundestag beschließt die Einführung einer zentralen Verkehrssünderdatei in Flensburg. In Siersdorf am Niederrhein treffen die ersten fünfzig Gastarbeiter aus Italien ein. Das englische Kernkraftwerk Calder Hall wird als erste kommerziell genutzte Anlage von Königin Elizabeth II feierlich eröffnet. Der Fußballtraditionsverein Borussia Dortmund wird zum ersten Mal Deutscher Meister. Die Olympischen Sommerspiele finden in Melbourne, Australien statt. In Monaco heiratet Fürst Rainer III. die US-amerikanische Schauspielerin Grace Kelly. Das Musical »My Fair Lady« wird – wie auch der Film »Moby Dick« – in den USA uraufgeführt. Die Hüftbewegungen des einundzwanzigjährigen Elvis Presley zu seinem Song »Hound Dog« während einer beliebten TV-Show in Amerika führen zu einem Medienaufruhr und machen den Rock`n Roller weltberühmt. In der Schweiz findet der erste »Grand Prix de la Chanson« statt. Das Drama von Carl Zuckmayers »Der Hauptmann von Köpenick« mit Heinz Rühmann in der Titelrolle wird uraufgeführt und der Film »Die Halbstarken« mit Horst Buchholz und Karin Baal feiert Premiere.
Als ich das Licht der Welt erblickte, war meine Schwester Gabriela bereits drei Jahre alt. Ein Jahr nach mir wurde mein Bruder Frank geboren. Da meine Mutter am 3. Januar 1933 auf die Welt kam, war sie mit vierundzwanzig Jahren bereits Mutter von drei kleinen Kindern. Sie selber war die Älteste von drei Geschwistern.
Meine Großeltern sind beide 1911 geboren und haben kurz vor der Geburt meiner Mutter geheiratet. Opa Horst war gelernter Bademeister, hatte sich aber zum Einkaufsleiter eines Unternehmens für Sicherheitstechnik emporgearbeitet. Oma Else war Novizin, als sie meinen Opa kennenlernte. Sie hatte keinen Beruf erlernt. Mein Großvater kam aus Berlin und hatte Oma Else in ihrem Geburtsort Schweidnitz kennengelernt, wo er berufstätig war. Schweidnitz war eine Kreisstadt in Schlesien, das bis Ende des zweiten Weltkriegs zum Deutschen Reich zählte. Dort wurde auch meine Mutter geboren. Die Familie zog nach Berlin, wo 1939 Gitta, die jüngere Schwester meiner Mutter, geboren wurde. Ihr jüngerer Bruder Heider erblickte 1943 das Licht der Welt in Eger, einer kleinen Stadt in der Tschechoslowakei. Hierher war die Familie nach der Besetzung des Landes durch die deutsche Wehrmacht gezogen, da Opa Horst dort eine attraktive Beschäftigung in einem Flugzeugwerk gefunden hatte.
Mein Opa war Mitglied der NSDAP und Familienoberhaupt vom Typ »Patriarch«, der die Familie ernährte. Oma Else übernahm die klassische Rolle als Hausfrau, die sich um die Kinder kümmerte. Der Familie fehlte es an nichts, die Kinder wuchsen gut behütet auf. Es wurden die traditionellen Werte gelebt, die häufig mit »kleinbürgerlich« beschrieben werden. Meine Mutter besuchte die Volksschule und erlebte eine Kindheit, wie viele Kinder ihres Alters.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde die »Hitlerjugend« als einzig staatlich anerkannter Jugendverband ausgebaut. Er sollte den gesamten Lebensbereich der jungen Deutschen erfassen. Es ging dabei um die körperliche und ideologische Schulung. Sie umfasste rassistische und sozialdarwinistische Indoktrination und gemeinsame Wanderungen und Übungen im Freien. Neben Elternhaus und Schule nahm dieser Jugendverband entscheidenden Anteil an der Erziehung der jungen Menschen. Mit der Einführung der »Jugenddienstpflicht« im März 1939 wurden alle Kinder ab einem Alter von zehn Jahren zur Mitgliedschaft verpflichtet. Meine Mutter trat 1943 dem »Jungmädelbund« bei, dem weiblichen Zweig der Hitlerjugend der Zehn- bis Vierzehnjährigen.
Als zum Ende des zweiten Weltkrieges amerikanische Luftstreitkräfte auch Eger bombardierten, suchten die Menschen Schutz in ihren Kellern. Nach den Angriffen wurde meine Mutter als eines von vielen »Bombenkindern« auf den Dachboden geschickt, um zu schauen, ob Blindgänger das Dach durchschlagen hatten. Opa Horst war an die Front beordert worden und geriet später in Gefangenschaft. Davon erzählte meine Mutter uns Kindern, wie auch von der Vertreibung aus Eger, als die »alliierten Streitkräfte" die Tschechoslowakei einnahmen. Oma Else machte sich mit ihren drei Kindern auf die Flucht nach Dresden, ohne zu wissen, wo ihre Reise letztlich enden sollte.
Meine Mutter erzählte, dass sie als Zwölfjährige mit Großmutter und den jüngeren Geschwistern im Alter von sechs und zwei Jahren versuchte, mit dem Zug aufzubrechen. Sie hatten von ihrem Hab und Gut nur so viel retten können, wie in einen Kinderwagen passte, in dem bereits der Jüngste der Familie lag. Kaum waren sie auf dem Bahnhof in Eger angekommen, wurde meine Großmutter verhaftet. Die Kinder blieben alleine auf dem Bahnsteig zurück. Oma Else kehrte erst am nächsten Tag zurück. Ohne zu wissen, wo ihre Mutter geblieben war und wann sie zurückkäme, musste sich meine Mutter um ihre jüngeren Geschwister kümmern und sie beruhigen – eine Mammutaufgabe, vor allem über Nacht.
Die Flucht der Familie gelang und Oma Else fand mit ihren Kindern eine Bleibe in einer Flüchtlingsunterkunft in dem kleinen Ort Münchenbernsdorf in Thüringen. Dort erfuhren sie von der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945. Meine Mutter besuchte die Münchenbernsdorfer Volksschule, bis der Familie eine Dachgeschosswohnung in Oldenburg zugewiesen wurde. Im Sommer 1947 zog die Familie mit ihren Habseligkeiten in den Norden.
Oldenburg war damals eine Stadt mit etwa 117.000 Einwohnern. Die Zerstörungen der Bausubstanz durch Kampfhandlungen im zweiten Weltkrieg betrugen etwa nur ein Prozent, auch weil sich die Truppen der Nationalsozialisten aus Oldenburg in Richtung Wilhelmshaven zurückgezogen hatten, als die kanadischen und britischen Kampfeinheiten vor den Toren der Stadt standen. Somit konnte Oldenburg kampflos übergeben werden. Die Kanadier zogen ihre Truppen zügig ab, die Briten richteten eine Militärregierung ein und begannen mit der Umsetzung ihrer Besatzungspolitik. Zunächst beschäftigten sich die Briten jedoch mit der Wohnsituation in Oldenburg. Aufgrund der Truppenstärke der Alliierten, aber vor allem wegen der vielen Flüchtlinge und Vertriebenen aus den ehemals deutschen Ostgebieten, kam es zur drastischen Wohnungsnot in Oldenburg. Die Militärregierung sorgte dafür, dass Menschen in unterbelegte Privatwohnungen untergebracht wurden, in Schulen, Turnhallen, aber auch in den Kasernen, über die Oldenburg als ehemalige Garnisonsstadt verfügte. Für die Unterbringung der eigenen Offiziere beschlagnahmten die Briten einige Wohnungen und Häuser in der Stadt.
Da Oma Else keinen Beruf erlernt hatte, übernahm sie Hilfstätigkeiten in den Abendstunden, um ihre Kinder ernähren zu können. Gleichzeitig musste sie sich den Übergriffen ihres Vermieters erwehren, der ein Auge auf seine hübsche Mieterin geworfen hatte. Meine Mutter musste häufiger die Polizei rufen, wenn der Aufdringling wieder einmal betrunken an die Eingangstür hämmerte und Einlass verlangte. Ohnehin übernahm meine Mutter in diesen schweren Zeiten Verantwortung im Haushalt und kümmerte sich um die jüngeren Geschwister, wenn ihre Mutter nicht zuhause war. Die Situation änderte sich erst, als Opa Horst 1948 zur Familie zurückkehrte. Zuvor war er schwer verletzt aus der Gefangenschaft gekommen und von seiner Großmutter in Duisburg gepflegt und aufgepäppelt worden.
Meine Mutter besuchte die Volksschule in Oldenburg, die sie nach dem neunten Schuljahr mit gutem Abschluss verließ. Anschließend machte sie eine Ausbildung zur Stenotypistin bei einem Rechtsanwalt, die sie 1951 abschloss.
Mein Vater wurde 1931 in Berlin geboren. Er war 26 Jahre alt, als mein Bruder als drittes Kind zur Welt kam. Seine Eltern sind im letzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts ebenfalls in Berlin geboren. Opa Otto hatte den Beruf des Elektromonteurs gelernt, Oma Gertrud den der Verkäuferin. Als jüngster Spross der Familie wuchs mein Vater mit seinen Schwestern Charlotte und Gerda auf, die wesentlich älter waren als er.
Opa Otto starb 1936 mit nur 44 Jahren, als mein Vater fünf Jahre alt war. Er war bis zu seinem Tod bei der Marine in Kiel beschäftigt. Mein Großvater war 27 Jahre alt, als er sich im November 1918 am Kieler Matrosenaufstand (auch Kieler Matrosen- und Arbeiteraufstand) beteiligte, der die sogenannte »Novemberrevolution« auslöste, die zum Sturz der Monarchie und zur Ausrufung der Republik in Deutschland führte. Nach seinem Tod erhielt Opa Otto posthum »im Namen des Führers und Reichskanzlers das Ehrenkreuz für Kriegsteilnehmer zur Erinnerung an den Weltkrieg 1914/1918« verliehen.
Oma Gertrud lernte bald ihren neuen Lebensgefährten kennen. Bereits im August 1937 erblickte ihre Tochter Regina das Licht der Welt und mein Vater besaß ab sofort eine Halbschwester. Nach der Hochzeit zwei Jahre später wollte der neue Mann an Omas Seite meinen Vater adoptieren. Dagegen setzte er sich erfolgreich zur Wehr, wie er noch heute behauptet.
Mein Vater wuchs mit seinen Schwestern wohlbehütet in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Weißensee auf. Die Familie lebte in bescheidenen Familienverhältnissen mit klassischer Aufgabenteilung. Bis zum Tod von Opa Otto kam die Familie finanziell über die Runden, danach musste der Groschen öfters »umgedreht« werden und Oma Gertrud übernahm diverse Jobs, beispielsweise als Straßenbahnschaffnerin. Sie war eine dominante und durchsetzungsstarke Person. Später unterstützte sie ihr zweiter Ehemann finanziell, bis auch er im zweiten Weltkrieg an die Front beordert wurde.
Aufgrund der ersten Luftangriffe der britischen »Royal Air Force« auf Berlin seit August 1940, wurden auf Anordnung des »Führers« – mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten – Kinder aus Berlin und Hamburg, später auch aus anderen »luftgefährdeten Gebieten«, in sichere Landstriche »evakuiert«. Meinen Vater verschlug es im Alter von zehn Jahren nach Österreich, wo die deutsche Wehrmacht seit 1938 das Kommando übernommen hatte. Er verbrachte dort in dem kleinen Ort Liebenau ganze zwei Jahre auf einem Bauernhof.
Er hatte sehr fürsorgliche Gasteltern und vertrug sich bestens mit den beiden Söhnen, die etwa im gleichen Alter waren. Wie uns mein Vater erzählte, fühlte er sich dort sehr gut aufgehoben – wie in einer Ersatzfamilie. Trotzdem vermisste er seine Mutter, die ihn in den beiden Jahren nur zweimal besuchen konnte. Wie sehr ihm die Zeit in Liebenau »unter die Haut« gegangen war, erkennen wir noch heute, wenn unser Vater im Alter von 90 Jahren unter Tränen davon erzählt. Nach seiner Pensionierung war es ihm ein großes Bedürfnis, die Kinder seiner Gastfamilie in Liebenau noch einmal zu besuchen, um mit ihnen nach Jahrzehnten ein Wiedersehen zu feiern.
Während seiner Zeit in Österreich trat mein Vater 1941 pflichtgemäß der Hitlerjugend bei. Er schloss sich dem »Deutschen Jungvolk« an, dem sich jeder zehnjährige für mehrere Jahre zu verpflichten hatte. Seine Mitglieder nannten sich »Jungvolkjungen«, die Jüngsten wurden im lockeren Sprachgebrauch als »Pimpfe« bezeichnet. Bis zum Ende des zweiten Weltkriegs erlebte mein Vater fast vier volle Jahre in der Hitlerjugend, je zur Hälfte in Liebenau und Berlin. Wie er uns Kindern erzählte, war er gerne dort. Er nutzte das attraktive Freizeitangebot und war stolz auf seine Uniform mit Dienstgradabzeichen. Ihn interessierte das Sportangebot und er war begeistert von den Zeltlagern, die einmal im Monat stattfanden. Auf den Tagesplänen standen dort unter anderem: Exerzieren, Schießübungen, Fahnenappelle und Geländemärsche. Noch mehr reizte die meisten Jungen jedoch, dass beim Jungvolk das »Führerschaftsprinzip« galt: Jugend sollte durch Jugend geführt werden, dieses Prinzip galt zumindest für die unteren Führungsgrade. Ein Zeitzeuge beschrieb die Wirkmechanismen aus eigenem Erleben als Pimpf folgendermaßen:
»Zwölfjährige Hordenführer brüllten zehnjährige Pimpfe zusammen und jagten sie kreuz und quer über Schulhöfe, Wiesen und Sturzäcker. Die kleinste Aufsässigkeit, die harmlosesten Mängel an der Uniform, die geringste Verspätung wurden sogleich mit Strafexerzieren geahndet – ohnmächtige Unterführer ließen ihre Wut an uns aus. Aber die Schikane hatte Methode: Uns wurde von Kindesbeinen an Härte und blinder Gehorsam eingedrillt […]. Wie haben wir das nur vier Jahre ertragen? Warum haben wir unsere Tränen verschluckt, unsere Schmerzen verbissen? Warum nie den Eltern und Lehrern geklagt, was uns da Schlimmes widerfuhr? Ich kann es mir nur so erklären: Wir alle waren vom Ehrgeiz gepackt, wollten durch vorbildliche Disziplin, durch Härte im Nehmen, durch zackiges Auftreten den Unterführern imponieren. Denn wer tüchtig war, wurde befördert, durfte sich mit Schnüren und Litzen schmücken, durfte selber kommandieren, und sei es auch nur für die fünf Minuten, in denen der ‚Führer’ hinter den Büschen verschwunden war.« (Arno Klönne: »Jugend im Dritten Reich. Die Hitlerjugend und ihre Gegner.«)
Mein Vater wurde in den Jahren beim Jungvolk zweimal befördert und hatte ausreichend Zeit zu lernen, wie Untergebene befehligt und geführt werden.
Der Drill von Befehl und Gehorsam und von körperlicher Fitness sollte die jungen Menschen auf den Kriegseinsatz vorbereiten. Darüber hinaus wurden die Jugendlichen im Sinne des nationalsozialistischen Erziehungsideals ideologisch verblendet. Die Titel der Schulungshefte, die in den »Heimnachmittagen und -abenden« Gegenstand des Unterrichts waren, sprechen für sich: »Die Reinhaltung des Blutes«, »Brandstifter Jude« oder »Kampf dem Weltfeind Bolschewismus«.
Mein Vater hat nie bestritten, den »Führer« verehrt und den Juden als Feind gesehen zu haben. So hat er damals auch nichts Verwerfliches daran entdecken können, dass Geschäfte von Juden durch Farbschmierereien gekennzeichnet oder ihre Inhaber verprügelt wurden. Darüber hinaus gehende Gewaltverbrechen hat er weder selber gesehen, noch davon gehört, wie er uns Kindern glaubhaft versicherte. Über viele Jahre hatte mein Vater die nationalsozialistische »Gehirnwäsche«, die er als Kind erhielt, nicht wirklich überwinden können. Erst viel später, als auch in unserem Hause der Fernseher Einzug gehalten hatte und er die »Bilder des Schreckens« der nationalsozialistischen Herrschaft in all ihren fürchterlichen Facetten ansehen »musste«, erkannte er unter Tränen, welch menschenverachtenden Kriegsverbrecher er in seiner Kindheit aufgesessen war.
Kurz vor Kriegsende brachte mein Vater als knapp Vierzehnjähriger seine Mutter vor den Bombenangriffen der alliierten Streitkräfte in Sicherheit (wie er heute noch formuliert), die jetzt auch für Berlin-Weißensee erwartet wurden. Er begleitete sie im Zug von Berlin nach Oldenburg, wo inzwischen seine älteste Schwester wohnte, dort lebte zur Sicherheit bereits seine Halbschwester Regina. Sie seien dabei mit dem Zug durch zerbombte Städte gefahren. In Oldenburg angekommen, wunderten sie sich, dass die Stadt durch den Krieg fast keinen Schaden genommen hatte.
Oma Gertrud lebte ab sofort bei ihrer Tochter in der Schillerstraße und auch mein Vater blieb dort für die nächsten Wochen. Er unterstützte als »Jungvolkjunge« die Truppen der Deutschen Wehrmacht in Oldenburg als »Melder«, die ihr Quartier im Luftschutzbunker im »Eversten Holz« bezogen hatten, einem Stadtwald in Oldenburg. Als mein Vater kurz vor der Kapitulation Oldenburgs den Bunker aufsuchte, fand er ihn verlassen. Er begab sich daraufhin in die City der Stadt und musste zu seinem Entsetzen feststellen, dass dort deutsche Soldaten an den Laternenmasten aufgehängt wurden – durch Befehl ihrer Vorgesetzten von den eigenen Kameraden, wie er später erfuhr – sie hatten sich in Anbetracht des verlorenen Krieges dem Feind nicht mehr entgegenstellen wollen. Dieser Anblick hat bei meinem Vater tiefe Spuren hinterlassen.
Nach der Kapitulation Deutschlands kehrte mein Vater nach Berlin in sein Elternhaus zurück, wo seine jüngere Schwester immer noch wohnte. Sie hatte inzwischen geheiratet. Mein Vater begann eine Lehre, die er Ende 1948 abschloss. Anschließend zog es ihn erneut nach Oldenburg. Dort lebte er bei seiner Mutter in der Bremer Heerstraße, wohin sie inzwischen mit ihrer Tochter Regina umgezogen war. Auch ihr zweiter Ehemann wohnte dort, nachdem er aus dem Krieg zurückgekehrt war. Zwei Zimmer standen der Familie zur Verfügung, die Toilette befand sich auf dem Hof. Mein Vater arbeitete zunächst in seinem erlernten Beruf als KFZ-Mechaniker, bis er seinen Job wegen Betriebsaufgabe im August 1949 verlor.
Ende 1949 lernte mein Vater meine Mutter kennen. Sie begegneten sich erstmals in dem von Opa Horst in Oldenburg gegründeten »Verein der Berliner und Brandenburger«, einer Begegnungsstätte für Menschen aus diesem Raum, die es nach Oldenburg verschlagen hatte. Die Räumlichkeiten des Vereins lagen am Julius-Mosen-Platz. Meine Eltern verliebten sich und wurden ein Paar. Opa Horst passte das gar nicht, da er sich als Schwiegersohn einen Mann »aus gutem Hause« vorgestellt hatte. Hinzu kam, dass mein Vater mit großem Erfolg dem Boxsport im VfB Oldenburg von 1897 e.V. frönte und damit dem Vorbild seines Vaters gefolgt war, der einst bei der Marine in Kiel geboxt hatte. Für Opa Horst war der Boxsport etwas für »Dumpfbacken«. Verheimlichen konnte mein Vater seine Boxkämpfe jedoch nicht, da ihm häufig die Schlagzeilen im Sportteil der Oldenburger Nordwest-Zeitung (NWZ) gehörten, wenn er wieder einmal vor über 2.000 Zuschauern im Stadion des VfB Oldenburg im Stadtteil Donnerschwee einen Sieg erkämpft hatte, in dem Stadion, in dem ich später selber große Erfolge als Fußballer feiern sollte. Nachdem sämtliche Ermahnungen meines Opas an seine Tochter nicht fruchteten, die Beziehung zu meinem Vater zu beenden, schickte er sie nach Bonn, wo sie ihrem Beruf nachgehen sollte. Aber dieser Versuch, meine Eltern auseinanderzubringen, brachte nicht den gewünschten Erfolg, meine Eltern trafen sich so oft es ging heimlich. An den Wochenenden war meine Mutter in Oldenburg bei meinem Vater.
In der Zeit von Oktober 1949 bis März 1952 war mein Vater als Lagerist beschäftigt, bis er wegen »Arbeitsmangel« abermals seinen Job verlor. Ab Mai 1952 heuerte er deshalb als Kraftfahrer an und durchquerte fortan täglich den Nordwesten. Er lieferte Waren aus und kassierte direkt den Kaufpreis.
Dann kam der Tag, an dem mein Großvater einlenkte und er seiner Tochter den Segen nicht nur für eine Partnerschaft, sondern gleich für die Ehe gab. Es war der Tag, als er erfuhr, dass meine Mutter schwanger war: Ein uneheliches Kind – das ging gar nicht. Meine Eltern heirateten im April 1953 und bezogen eine Zwei-Zimmer-Wohnung im gleichen Haus, in dem nach wie vor Oma Gertrud und Regina wohnten. Von ihrem Ehemann hatte sich meine Großmutter zwischenzeitlich getrennt. Ein halbes Jahr später, am 30.09.1953 kam meine Schwester Gabriela zur Welt, die später immer nur Gabi gerufen wurde. Bereits drei Jahre später sollte es noch enger werden in der kleinen Wohnung: Am 1. Juli 1956 erblickte ich das Licht der Welt.
Sechziger-Jahre-Familienidylle
Kurz nach meiner Geburt kündigte mein Vater seinen Arbeitsvertrag als Kraftfahrer zum Ende des Monats Juli 1956, da er sich erfolgreich um einen Platz unter den ersten 1500 freiwilligen Bewerbern für den Aufbau der Bundeswehr beworben hatte. Kurz darauf wurde mein Vater Soldat. Zunächst verschlug es ihn nach Hemer in Nordrhein-Westfalen zum Heer. Es gelang ihm aber, sich zur Luftwaffe versetzen zu lassen. Schließlich beabsichtige er, später einmal in Oldenburg auf dem Fliegerhorst seinen Dienst zu verrichten – noch war der Flugplatz von den Briten besetzt.
Zu Ausbildungszwecken wurde mein Vater zur Truppenschule der Luftwaffe nach Hamburg geschickt. Nachdem die Briten im Oktober 1957 den Fliegerhorst an die Bundeswehr übergeben hatten, ging der Wunsch meines Vaters in Erfüllung und er wurde noch im gleichen Monat dorthin versetzt, das war schon wieder ein Grund zum Feiern. Denn bereits wenige Wochen zuvor war am 14. Juli 1957 mein Bruder Frank geboren worden. Da die Wohnung meiner Eltern nun endgültig zu klein wurde, fügte es sich, dass mein Vater in einer Siedlung, unmittelbar am Fliegerhorst gelegen, eine Reihenhauswohnung zugewiesen bekam. Welch eine Erlösung! Es handelte sich um nach englischem Vorbild gebaute Reihenhäuser aus rotem Klinker, die speziell für britische Soldaten und ihre Familien erstellt und zunächst ausschließlich von ihnen bewohnt worden waren. Als später die britischen Truppen nach und nach abzogen, wohnten in der Siedlung erst sowohl britische als auch deutsche Familien in bester Nachbarschaft – später ausschließlich deutsche Bundeswehrangehörige. Trotzdem haben wir über viele Jahre weiterhin von der »Englischen Siedlung« gesprochen, wenn wir erklären wollten, wo wir wohnten.
Die Siedlung lag abgelegen am Fliegerhorst, umgeben von Wald und Wiesen und landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der nächste Ort war einen Kilometer entfernt und heißt Ofen. Er besaß eine Volksschule und liegt seinerseits etwa sieben Kilometer vor den Toren der Oldenburger Innenstadt. Motorisiert konnte die Siedlung nur über die einzige ausgebaute Straße erreicht werden. Dort, wo sie in der Siedlung mündete, gab es nur die eine Haltestelle, an der die Busse hielten, wendeten, um den gleichen Weg zurück zu nehmen. In unmittelbarer Nähe des Wendeplatzes lag der Sportplatz des TuS Ofen und auch eine große Garagenanlage mit einem großzügig gepflasterten Vorplatz, der uns Kindern als Bolzplatz dienen sollte.
Bei unserem neuen Zuhause handelte es sich um ein Reihenendhaus mit vier Zimmern, Küche und Bad. Meine Schwester erhielt ihr eigenes Zimmer und wir Brüder teilten uns eines. Geheizt wurde in den ersten Jahren mit einem Kohleofen. Später bauten die Eigentümer eine Gasheizung ein. Zur Wohnung gehörte ein großer Garten mit Apfel- und Kirschbäumen. Für die Familie war das neue Heim geradezu ein Geschenk und wir konnten uns glücklich schätzen, dass unser Vater als Berufssoldat mit einem ordentlichen Einkommen dafür sorgte, dass die Familie materiell abgesichert war.
Auch unsere Mutter trug zum Familieneinkommen bei. Sie arbeitete als Sekretärin beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Oldenburg. Morgens brachte sie uns Kinder mit dem Fahrrad in den Kindergarten. Ich fand dabei meinen Platz auf dem Gepäckträger, mein Bruder saß in der Sitzschüssel hinter dem Lenker und meine Schwester versuchte mit ihrem Kinderfahrrad schrittzuhalten. Anschließend fuhr unsere Mutter nach Oldenburg, erledigte ihren Job und holte uns am Nachmittag wieder ab. Daheim angekommen, erledigte sie den Haushalt und kümmerte sich um ihre hungrige Familie. Unsere Mutter konservierte Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten durch das »Einmachen« und zauberte manche Mahlzeit, dass wir uns die Finger danach leckten.
Sie war eine starke Persönlichkeit, die wusste, was sie wollte und sie besaß das Durchsetzungsvermögen, die Dinge so zu regeln, wie sie es für richtig hielt. Dafür benötigte sie nicht das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau aus dem Jahr 1958, das dafür sorgte, dass der Mann zumindest nicht mehr in allen Eheangelegenheiten das letzte Wort hatte und die Ehefrau nicht mehr um Erlaubnis fragen musste, ob sie arbeiten gehen durfte. Allerdings durfte eine Frau bis zum Jahr 1977 nach dem Gesetz in Westdeutschland nur dann berufstätig sein, wenn das »mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar« war. Aufgaben im Haushalt und in der Kindeserziehung waren nach dem Gesetz also klar geregelt. Ich wäre gerne dabei gewesen, wenn mein Vater versucht hätte, meine Mutter ausschließlich auf diese Aufgaben zu verpflichten.
Aus den frühen Jahren meiner Kindheit erinnere ich mich an manches Weihnachtsfest. Alle hatten sich herausgeputzt. Unsere Mutter servierte die Gans oder die Pute, die den ganzen Vormittag im Ofen mit viel Hingabe gebraten wurde. Der Blick in den Ofen hatte uns zuvor bereits das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Gleichzeitig lag uns der Geruch von feinen Plätzchen in der Nase, die bereits am Tag vor dem Fest gebacken wurden.
Nach dem Essen mussten wir immer warten, bis das Christkind sein Werk getan hatte. Dann erklang ein heller Glockenton und wir durften das Wohnzimmer betreten. Es erwartete uns ein wunderschön geschmückter Tannenbaum. Unter dem Baum lagen die Geschenke. Jedes Kind fand sein edel gekleidetes Päckchen. Wir haben uns über dieses eine Geschenk jedes Mal unglaublich gefreut. Weihnachtslieder wurden gesungen und wir verbrachten gemeinsam einen schönen Abend.
Ich erinnere mich noch ganz genau, dass Fleisch und erst recht Geflügel für uns etwas ganz Besonderes waren: Grillten unsere Eltern Hähnchen, da sie die Nachbarn zum Essen erwarteten, saßen wir Kinder auf der Treppe hintereinander, wie auf einer Hühnerleiter und warteten, bis die Küchentür aufging und uns Kindern ein Teller mit drei Hähnchenflügel gereicht wurde. Was waren das für besondere Leckereien!
Unsere Eltern gehörten um 1960 zu den ersten in der »Englischen Siedlung«, die einen Fernseher besaßen. Er lieferte Schwarz-Weiß-Bilder und kannte nur das Programm der ARD, 1963 kam das ZDF hinzu. Da viele Familien damals noch keinen Fernseher besaßen, hatten wir häufiger Besuch aus der Nachbarschaft. Wir Kinder sahen jeden Abend das Sandmännchen, danach ging es zu Bett. Als wir älter waren, verliebten wir uns in Nachmittagsserien wie »Lassy«, »Fury« und »Rin Tin Tin« - sämtlich Abenteuerfilme mit Tieren. Besonders gerne schauten wir auch die Westernserien »Bonanza« und »Am Fuß der blauen Berge«. Und wie konnte es anders sein, bastelten wir uns Pfeil und Bogen sowie Gewehre und spielten Cowboy und Indianer.
Überhaupt verbrachten wir sehr viel Zeit an der frischen Luft im eigenen Garten oder wir durchforsteten die umliegenden Wäldchen. Auch der große Spielplatz in direkter Nachbarschaft hatte es uns angetan. Dort gab es ein hohes Klettergerüst und ein großes, kniehohes Planschbecken sowie zwei sehr große Sandkästen. Da unser Vater bis zu seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr geboxt hatte, wollten wir es ihm gleichtun. Wir zogen unsere Boxhandschuhe an, die wir uns hatten schenken lassen und nutzten einen Sandkasten als Ring. Da ich ein Jahr älter war, hatte mein Bruder fast immer das Nachsehen. Ich pflegte ihn nach dem Kampf immer fürsorglich – wie es die »Großen« taten – mit einem kalten Lappen auf der Stirn. Wir versuchten uns jedoch nicht nur selber als Boxer, sondern saßen mit unserem Vater so manches Mal vor dem Fernseher, wenn ein Kampf des wahrscheinlich besten Schwergewichtsboxers aller Zeiten, Cassius Clay alias Muhammad Ali, im Fernsehen gezeigt wurde.
Gerne erinnere ich mich auch an die Winter, die damals noch welche waren. Der Schnee lag hoch und wir bauten mit unseren Eltern wirklich große Schneemänner. Da unsere Mutter einen Firmenwagen besaß, einen weißen Ford Taunus 12 m TS, nutzten wir die Gelegenheit, einen Schlitten an die hintere Stoßstange zu binden, um uns von unseren Eltern unter großem Gejohle durch die Siedlung ziehen zu lassen, das wäre heute undenkbar.
Der Samstag war der Große Aufräum- und Putztag im Hause Kalkbrenner. Nicht nur, dass unsere Mutter durch das Haus wirbelte und unser Vater im Garten zauberte. Es war auch der Tag für die intensive Körperpflege. Einmal in der Woche wurde gebadet, eine Dusche gab es nicht. Als wir Kinder noch sehr klein waren, wurden wir gemeinsam oder nacheinander im Wäscheboiler gebadet. Später durften wir Kinder uns im Badewasser der Eltern vergnügen.
An Sonntagen hat die Familie gemeinsam Mittag gegessen und anschließend regelmäßig Karten gespielt oder bei Brettspielen um den Sieg gestritten. Später ging es dann häufig zum Spaziergang in die Umgebung oder wir fuhren nach Oldenburg, um durch den Schlossgarten zu schlendern. Für die Ausflüge putzte sich die Familie heraus: Alle zogen ihre Sonntagsausgehkleidung an. So war es auch, wenn die Familie in die Kirche ging, für Weihnachten und Ostern war das eine Selbstverständlichkeit. Auf Fotos von damals erkennt man noch heute die perfekte Sechziger-Jahre-Familienidylle.
Manchmal fuhr die Familie nach Oldenburg zum Einkaufen, das war für uns Dorfkinder die große Welt. Die City, die damals noch keine Fußgängerzone besaß, beeindruckte uns Kinder besonders: große Kaufhäuser, viele alte Gebäude, ein großer Marktplatz mit einer mächtigen Kirche, schmale Straßen, durch die sich große Busse quälten und viele Menschen, die durch Geschäfte wuselten, die auch für uns Kinder ein großes Angebot bereithielten. Die City besaß schon damals ihren ganz besonderen Charme und übte eine große Anziehungskraft auf uns Kinder aus.
Wenn wir in die Stadt fuhren, war auch der Einkauf auf dem Wochenmarkt obligatorisch. Eines Tages konnten wir unsere Eltern überreden, für jedes Kind ein kleines gelbes Küken zu kaufen, die dort angeboten wurden. Die Küken bekamen einen Namen und wurden mit viel Liebe großgezogen. Eines Tages besuchten uns wieder einmal Opa Horst und Oma Else, die inzwischen in Duisburg lebten. Sie brachten uns Kindern auch dieses Mal tolle Geschenke mit. Womit wir allerdings nicht gerechnet hatten, war, dass anlässlich des Besuchs unserer Großeltern Huhn auf dem Speiseplan stand. Obwohl wir unter Tränen heftig protestierten, legte Opa Horst die Hühner nacheinander über den Holzklotz und schlug ihnen den Kopf ab. Anschließend wurden sie für den Grill präpariert. Wir Kinder haben keinen Bissen runtergekriegt.
Im Februar 1962, kurz vor meiner Einschulung, wurden meine Geschwister und ich »Opfer« der Kinderlandverschickung. Wir gehörten zu den Millionen Kindern, die damals aufgrund eines staatlichen Gesundheitsprogramms von gigantischem Ausmaß von einer Erholungskur profitieren sollten. Für drei Wochen wurden wir zusammen mit vielen anderen Kindern im Kinderlandheim Schillig untergebracht, ein Heim direkt am Deich zur Nordsee gelegen. Unsere Eltern glaubten, uns damit etwas Gutes zu tun.
Wir erlebten dort allerdings das, was in über 800 Landheimen in Deutschland die meisten Kinder erlebten: Einen Erziehungsstil der Betreuer, der oft geprägt war von Gefühlskälte und extremen Formen der Abwertung und Demoralisierung. Am wenigsten belastend waren noch die Folgen, wenn jemand seine Mahlzeit nicht vollständig verzehrte, und es gab viele Dinge, die wir absolut nicht mochten: Derjenige musste solange sitzen bleiben, bis der Teller leer war, egal, wie lange es dauerte. Zum Glück hatten wir Brüder unsere ältere Schwester dabei, die in einem unbeobachteten Moment häufig unsere Reste vom Teller nahm und sogleich verschlang. Überhaupt war unsere Schwester in unserer Kindheit diejenige, die sich immer schützend vor ihre Brüder stellte und sie auch immer wieder rausboxte, wenn sie Unfug getrieben hatten – sofern sie denn konnte.
Kinder, die sich nass gemacht hatten, mussten zur Strafe den ganzen Tag in derselben Kleidung herumlaufen. Hatten sie nicht gespurt, wurden sie zur Strafe isoliert und alleine in Zimmer gesperrt. Es herrschte ein strenger Befehlston und auch die geringsten Unkorrektheiten wurden geahndet. Hatten die Kinder Heimweh oder weinten bitterlich, so gab es keinen Trost.
Einzig die Spaziergänge auf dem Deich oder am Strand führten zur Aufhellung unserer Stimmung, auch wenn es zu dieser Jahreszeit bitterkalt war. Der Wind nahm von Tag zu Tag zu, bis er so stark war, dass die älteren Kinder die Jüngeren während der Spaziergänge auf dem Deich unterhaken mussten, damit sie von den Windböen nicht umgepustet wurden. Als sich abzeichnete, dass es zur Sturmflut kommen sollte, schickte uns die Heimleitung in Bussen auf den Heimweg. Was die große Sturmflut mit Wasserhöchstständen vom 16. auf den 17. Februar 1962 nach Deichbrüchen für verheerende Schäden durch gewaltige Überschwemmungen vor allem in Hamburg anrichtete, konnten wir in den Fernsehnachrichten verfolgen. Wir hatten Glück, dass wir rechtzeitig nach Hause geschickt worden waren.
Ostern 1962 begann ein neuer Lebensabschnitt für mich, ich wurde wenige Wochen vor meinem sechsten Geburtstag eingeschult. Meine Schwester besuchte die Volksschule in Ofen bereits seit zwei Jahren. Ich erinnere mich noch genau, wie ein ziemlich alter Lehrer uns Kinder in der ersten Klasse schon mal mit dem Rohrstock malträtierte, wenn wir nicht spurten. Überhaupt gehörte die körperliche Züchtigung nicht nur in der Schule zum legitimen Mittel der Erziehung. Als ich etwa das fünfte Schuljahr erreicht hatte, ohrfeigte ein dafür bekannter Lehrer einen zarten Schüler dermaßen, dass dieser schwer zu Boden ging. Erst der dadurch ausgelöste Aufruhr einer großen Elternschar sorgte dafür, dass ab sofort die körperliche Bestrafung der Schüler an unserer Schule ein Ende hatte.
Daheim gehörte diese Art der Bestrafung jedoch weiterhin zum Repertoire der Erziehung unserer Eltern. Da gab es schon mal die eine oder andere schallende Ohrfeige, wenn wir wieder einmal ungezogen waren. Sollte der Unfug, den wir getrieben hatten, auf mehr Ärger gestoßen sein, drohte unsere Mutter gelegentlich: »Lasst bloß euren Vater nach Hause kommen.« Dann konnte es passieren, dass wir übers Knie gelegt und mit einer Tracht Prügel ins Bett geschickt wurden. Es verwundert daher nicht, dass mein Bruder und ich eines Tages, nachdem wir wieder einmal etwas angestellt hatten, unsere sieben Sachen packten und ausbüxten, um unserer Bestrafung zu entgehen. Wir begaben uns auf eine alte Müllhalde hinter der Siedlung und suchten uns einen sehr großen Karton, in dem wir übernachten wollten. Es war kalt und als es dunkel wurde, wollte ich meinem Bruder eine Trillerpfeife von einem alten Tannenbaum pflücken, der dort im Müll lag. Als ich Zugriff, versank ich fast bis zur Hüfte im Morast und rief um Hilfe. Mein Bruder »rettete« mich, wobei er selber bis zu den Knien versank. Nass, wie wir beide waren, kauerten wir zunächst in unserem Karton, bis wir uns entschlossen, doch besser den Heimweg anzutreten. Daheim angekommen, hatte noch nicht einmal jemand gemerkt, dass wir weg waren. Ärger bekamen wir nun doppelt: Für den Blödsinn, den wir verzapft hatten und dafür, dass wir aussahen wie kleine Schweine und auch so rochen.
Trotz der heute überholten Erziehungsmethoden sind wir behütet aufgewachsen. Außerdem hatten wir gerade in jungen Jahren ein sehr emotionales Verhältnis zu unseren Eltern. Als Kinder beschlich uns nie das Gefühl, dass uns ernsthaft etwas fehlte, auch wenn wir nicht in großem Wohlstand lebten. Unsere Eltern vermittelten uns die Werte, die sie selber lebten und die in den fünfziger und sechziger Jahren charakteristisch waren für die Lebensführung der meisten Menschen in dieser Zeit: das Ideal der Selbstdisziplin und Pflichterfüllung, das Leitbild der sozialen Anpassung sowie die Emotionsskepsis – wie es die Experten ausdrücken.
Das Ideal der Selbstdisziplin drückte sich bei uns zu Hause aus in der Forderung nach Fleiß, Ordnung, Sauberkeit, Pünktlichkeit, usw. Jeder hatte seine Pflichten, nicht nur im Haushalt. Es herrschte ein überwiegend autoritärer Erziehungsstil; die Kinder hatten zu gehorchen, Widerspruch wurde selten geduldet, Erklärungen gab es nur wenig.
Unsere Eltern legten Wert auf ein angepasstes Verhalten, dass sie selber vorlebten. »Was sollen die Nachbarn denken«, war ein Satz, den wir häufig hörten und der zum Ausdruck brachte, dass ein sozial abweichendes Verhalten unerwünscht war. Im Gegenteil wurde soziale Normalität geradezu demonstriert, man war anständig, benahm sich und war höflich. Hinzu kam, dass unsere Eltern uns vermittelten, dass Gefühle wie Angst, Trauer oder Wut möglichst kontrolliert und Freude oder Lust nicht übermäßig zelebriert werden, wie sie es selber gelernt hatten. Die Berufstätigkeit - die Arbeit - wurde als etwas gesehen, »was getan werden muss« und materielle Sicherheit bringt. Das Lebensglück konnte beschrieben werden mit: Familie, Haus, Auto, Urlaub. Diesen Lebenssinn hatten auch wir Kinder mit der Zeit verinnerlicht.
Der Erziehungsstil damals führte häufig zu einem distanzierten Eltern-Kind-Verhältnis, wie auch in unserer Familie. Waren unsere Eltern – wie viele andere Kriegskinder auch – aufgrund ihrer Erziehung und Kriegserlebnisse emotional bereits schwerer zu erreichen, kratzte die Prügelstrafe weiter am emotionalen Verhältnis zwischen uns Kindern und unseren Eltern, je älter wir wurden. Der unbedingte Gehorsam, der uns abgefordert wurde, vergrößerte die emotionale Distanz im Laufe der Jahre zusätzlich. Im Zuge des späteren Generationenkonflikts erschöpfte sich die emotionale Nähe zu unseren Eltern fast vollständig. Erst viele Jahre später kamen wir unseren Eltern wieder näher.
*
Wann immer es die Zeit erlaubte, jagten mein Bruder und ich mit unendlicher Begeisterung dem Ball hinterher, überall, wo sich die Gelegenheit bot: im Garten, auf dem Spielplatz, auf den gepflasterten Garagenplätzen, insbesondere jedoch auf dem Sportplatz des TuS Ofen, sobald sich die Gelegenheit dafür bot. Unsere tägliche »Bolzerei« führte dazu, dass der Ball immer häufiger das tat, was wir von ihm wollten, das blieb auch den Trainern der jüngsten Jugendmannschaft im TuS Ofen nicht verborgen. Eines Tages besuchte uns ein »Offizieller« des Vereins und sorgte dafür, dass unsere Eltern uns beim TuS Ofen anmeldeten. Ab sofort durften wir am Training der Jugendmannschaften teilnehmen. Da wir noch keine zehn Jahre alt waren, nahmen wir noch nicht an Meisterschaftsspielen teil, die wurden erstmals in der »D-Jugend«, der Gruppe der Zehn- bis Zwölfjährigen ausgetragen. Aus diesem Grunde engagierte sich unser Vater im Tus Ofen und übernahm das Training und die Betreuung von uns »Bambinis«. Nachdem wir eingeschult worden waren, schlossen sich einige Klassenkameraden unserer Gruppe an. Wir hatten unglaublich viel Spaß beim Training, alle waren immer mit großem Eifer bei der Sache.
Es dauerte nicht lange, engagierte sich auch unsere Mutter als Übungsleiterin einer Mädchengruppe im TuS Ofen. Sie kümmerte sich um das Kinderturnen. Wie wir Jungs nahm auch unsere Schwester immer häufiger an Sportfesten oder anderen Sportveranstaltungen des Vereins teil. Schon bald war die gesamte Familie auf sämtlichen Sportveranstaltungen in der Region zu finden. Waren es Einladungen anderer Vereine zu Sportfesten, Leichtathletik- oder Laufveranstaltungen – immer waren die Kalkbrenners dabei und mit der Zeit auch ausgesprochen erfolgreich. Unsere Schwester spielte später beim »Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg« (TvdH) Handball und wir Jungen konzentrierten uns immer stärker auf den Fußball.
Als ich gerade zehn Jahre alt geworden war, begann im Juli 1966 die Fußballweltmeisterschaft in England. Es war die erste Weltmeisterschaft, an die ich mich erinnern kann. Mit der ganzen Familie verfolgten wir insbesondere die spannenden Spiele der deutschen Mannschaft. Sie schaffte es bis in das Endspiel im legendären Wembley-Stadion. Ich weiß noch heute ganz genau, wo ich damals in unserem Wohnzimmer auf einem Sitzkissen mehr rumgesprungen war, als ich gesessen hatte, um mit meinen Idolen um Kapitän Uwe Seeler mitzufiebern. Im Stadion waren fast 100.000 Zuschauer. Es herrschte eine atemberaubende Atmosphäre, die mich elektrisierte. Es war ein packendes Spiel, das fast verloren schien, bis Verteidiger Wolfgang Weber in der 90. Minute der regulären Spielzeit noch gerade den Ausgleich zum 2:2 erzielte, was die deutsche Nationalmannschaft in die Verlängerung rettete. Leider verlor unsere Mannschaft am Ende 4:2. Dass umstrittene »Tor des Jahrhunderts« durch den englischen Spieler Geoff Hurst, das die Niederlage der deutschen Mannschaft einleitete, werde ich nie vergessen, auch nicht meine Entrüstung darüber. Die Enttäuschung über das verlorene Endspiel war groß.
Mit dem begeisternden Fußball meiner Helden vor Augen und einer Atmosphäre, die mir unter die Haut gegangen war, durfte ich kurze Zeit später endlich in meine erste Spielzeit um eine Meisterschaft gehen. Auch mein Bruder war dabei, obwohl er noch nicht zehn Jahre alt war. Die Vorfreude wurde noch befeuert, da uns Opa Horst unsere ersten nagelneuen Fußballschuhe schenkte – auch noch die mit den drei Streifen, die unsere großen Vorbilder trugen.
Unsere Mannschaft setzte sich überwiegend aus Klassenkameraden unserer Schule zusammen. Im Tor stand mein bester Freund Ralf Middendorf, mit dem ich auch sonst viel unternahm. In der Abwehr standen mit Hermann Hafermann und Jürgen Proske zwei hochgewachsene, kräftige Kerle, die vor dem Tor nichts anbrennen ließen und den Ball mit einem Hieb weit in die Hälfte des Gegners befördern konnten. Davor teilten sich Gerold und Raimund Schröder häufig die Spielzeiten, die den gleichen Nachnamen trugen, aber nicht verwandt waren. Im Sturm spielten entweder der hoch aufgewachsene Jürgen Ashauer, der manche »Bude« machte oder mein Bruder, der Haken schlagen konnte wie ein Kaninchen und als wuseliger Stürmer seine Gegner schon mal schwindelig spielte. Zum Kader zählten auch Peter Zuber als zweiter Torwart sowie Hartmut Denker und Ralf Schmidt. Ich selber war überall auf dem Platz zu finden und als Spielführer der Kopf der Mannschaft. Als schneller und technisch beschlagener Spieler schoss ich Tore am Fließband. Von meinen Mitspielern erhielt ich den Spitznamen »Kalki«, so werde ich im Freundeskreis heute noch gerufen. Mein Vater war unser Trainer und brachte uns nicht nur den Umgang mit dem Ball näher, sondern auch das Verhalten als Mannschaft auf dem Platz. Außerdem vermittelte er uns Werte wie Teamgeist, Fairness und Respekt, aber auch Disziplin und Pünktlichkeit. Gleich in den ersten beiden Spielzeiten konnten wir die Saison jeweils als Tabellenerster abschließen und die Meisterschaft erringen. Wir haben während dieser Zeit für Furore gesorgt, da wir als kleiner Dorfverein die großen Vereine, wie den VfB und VfL Oldenburg deutlich schlagen konnten. An diese Zeit erinnern wir uns nur allzu gerne, auch an die vielen Turniere, an denen wir regelmäßig teilnahmen.
Ich liebte dieses Spiel mit dem runden Leder, es war herrlich und aufregend. Ich liebte es, in einer Mannschaft mit gleichen Trikots zu spielen, zusammenzuhalten und um den Sieg zu ringen. Sobald es auf ein Spiel zuging, beschlich mich jedoch auch ein weniger wohliges Gefühl, von dem ich nicht recht wusste, wie ich es einsortieren sollte. Es war widersprüchlich und sorgte bei mir für eine Anspannung, die kurz vor dem Anpfiff ganz erheblich sein konnte. Einerseits gab es die Chance, einen Sieg zu erringen und die damit verbundenen Glücksgefühle und die Anerkennung des Erfolges zu genießen, andererseits begleitete mich die Angst, individuell oder als Team zu versagen, zumindest nicht erfolgreich zu sein. Dieses Gefühl sollte mich während meiner gesamten Karriere begleiten.
Aufgrund unserer Erfolge waren wir immer wieder ein gern gesehener Gast auf fremden Sportplätzen. Aber auch der TuS Ofen richtete Turniere aus. Ich erinnere mich, wie die Plätze dafür hergerichtet wurden. Häufig hat mein Vater die Spielflächen abschließend noch einmal mit dem Handrasenmäher präpariert. An den Turniertagen hat unsere Mutter aufgrund der verkürzten Spielzeiten aus dem auf dem Sportplatz geparkten PKW heraus die »Zeit genommen« und mit einem Hupton die parallel angepfiffenen Spiele für beendet erklärt.
Unser Vater war inzwischen Fußballobmann der Jugend im Verein und unsere Mutter hat geholfen, wo sie konnte, beispielsweise hat sie die Trikots der Mannschaft gewaschen. Unsere Eltern hatten zu Mannschaftsabenden mit den Eltern eingeladen, der Dank ging dabei insbesondere an die Eltern, die uns als Mannschaft unterstützten, vor allem mit der »Fahrerei« zu den Auswärtsspielen.
Als der langjährige Fußballobmann der Herren im TuS Ofen Heino Brüggemann heiratete, der die Jugendarbeit meines Vaters immer sehr unterstützt hatte, sollten wir als Mannschaft dem Brautpaar nach der kirchlichen Trauung »Spalier stehen«. Die beiden Mannschaften des jüngeren Jahrgangs wurden in ihren Trikots herausgeputzt und in Reih und Glied aufgestellt, um das getraute Paar am Kirchausgang zu empfangen. Als Spielführer war es meine Aufgabe, einen in den Vereinsfarben gebundenen Blumenstrauß zu überreichen und unseren Glückwunsch in Versen vorzutragen, die meine Mutter gereimt hatte. Dieses Gedicht kann ich heute noch spontan vortragen:
»Wir sind die Jüngsten des TuS Ofen und haben uns gedacht, dass unser Glückwunsch heute, euch besonders Freude macht. Die Frühlingsboten hier, in den Farben rot und bleu, sind nicht nur Farben des TuS Ofen, sondern Symbol für lieb und treu. Nun Schluss der vielen Worte mit Glück und Segen immer da, wir sind echte Sportler und legen alles in ein kräftiges hipp hipp hurra, hipp hipp hurra, hipp hipp hurra (die Mannschaften im Chor).«
Aufgrund meiner Leistungen im Verein wurde ich zunächst in die Auswahlmannschaft des Fußballkreises und später in die des Fußballbezirkes berufen. Ein besonderes Erlebnis sollte für mich ein Treffen sämtlicher Bezirksauswahlmannschaften Niedersachsens in der Sportschule des Fußballverbandes in Barsinghausen werden. Da sich damals dort auch die deutsche Nationalmannschaft hin und wieder traf, erwartete ich ehrfürchtig den Hauch vom »großen Fußball«.
Sämtliche Mannschaften spielten über mehrere Tage im Turniermodus gegeneinander. Die anwesenden Trainer des niedersächsischen Fußballverbandes wählten währenddessen die Spieler aus, die zukünftig in der »Niedersachsenauswahl« spielen durften. Bei der großen Abschlussfeier wurde ich als einer der besten Spieler des Turniers ausgezeichnet. Trotzdem war ich sehr enttäuscht, da ich aufgrund meiner fehlenden Athletik den erträumten Sprung in die nächsthöhere Auswahlmannschaft verpasst hatte. Ich tröstete mich damit, zumindest in den Betten übernachtet zu haben, in denen auch schon meine Idole gelegen hatten.
*
Im Januar 1967 verstarb Oma Gertrud. Obwohl ich bereits zehn Jahre alt war, kann ich mich daran kaum noch erinnern. Sie hat uns auch nicht so oft besucht, da meine Mutter und ihre Schwiegermutter nicht das beste Verhältnis hatten. Wenn heute in meinem Umfeld jemand ständig wehleidig über eine Krise in unserem Lande klagt, verweise ich gerne auf Oma Gertrud: Sie hatte den ersten und zweiten Weltkrieg erlebt, die Hyperinflation um 1920 und die Weltwirtschaftskrise zum Ende der 1920er Jahre.
Als ich im April des Jahres erfuhr, dass die Kirchengemeinde Nachwuchs für ihren Posaunenchor suchte, meldete ich mich neugierig an. Ich lernte Noten lesen und erhielt in der Gruppe der Anfänger Trompetenunterricht. Die Übungsräume befanden sich im Gemeindehaus, direkt neben der Kirche gelegen. Hätte ich gewusst, wie lange es dauert, bis ein Schüler die ersten Melodien spielen kann, hätte ich gar nicht erst angefangen. Blechblasinstrumente sind echt schwer zu spielen! Einmal in der Woche ging es zum Unterricht und daheim hatte ich die Hausaufgaben zu erledigen.
Es folgte die Zeit, in der auch wir Anfänger regelmäßig unseren Teil zur musikalischen Gestaltung der Gottesdienste beitragen durften. Dann trafen wir uns immer auf dem Orgelboden unserer Kirche, um die Gemeinde bei den Chorälen zu begleiten. Außerdem spielten wir festliche Kirchenmusiken. Ich habe viele Gottesdienste auf dem Orgelboden verbracht, immer Ostern und Weihnachten und an anderen wichtigen kirchlichen Feiertagen. Nie habe ich einer Predigt vollständig folgen können, obwohl ich es mir wiederholt fest vorgenommen hatte.
Mit dem Posaunenchor waren wir auch in der Gemeinde unterwegs: diamantene Hochzeiten, neunzigjährige Geburtstage, vor Altenheimen und Krankenhäusern sowie zu den Geburtstagen der Chormitglieder.
Wir hatten richtig Spaß bei dem, was wir machten. Nachhaltig in Erinnerung sind mir dabei die emotionalen Momente geblieben, wenn wir gerade die hochbetagten Jubilare mit unserem kurzen Konzert überraschten. Der musikalische Auftritt eines Chores mit so vielen jungen Mitgliedern hat die alten Menschen häufig zu Tränen gerührt. Als mein Großvater von meinem Engagement erfuhr, schenkte er mir eine nagelneue Trompete, sie war ab sofort mein ganzer Stolz.
Ich war etwa zwölf Jahre alt, als ich anfing, regelmäßig die Jungschar der evangelischen Kirchengemeinde zu besuchen, wie es für die Kinder des Ortes üblich war. Im Gemeindehaus trafen sich die Kinder der nahen Umgebung, um unter Anleitung von Erwachsenen einen Einblick in biblische Geschichten zu erhalten. Damit wurden wir Kinder bereits auf den Unterricht vorbereitet, der einer Konfirmation vorauszugehen hatte. Es gab aber auch ein umfangreiches Freizeitangebot: Geländespiele, Lagerfeuer, Singen, Sport etc. Höhepunkte waren immer die Freizeiten, Übernachtungsaktionen, Sommerzeltlager oder Sportturniere. Da sich Jungen und Mädchen in der Regel in getrennten Gruppen trafen, waren die Kinderdiskos im Gemeindehaus der ideale Treffpunkt zwischen beiden Geschlechtern. Dieses Angebot wurde begeistert angenommen. Schon damals putzten sich alle für das große Schaulaufen mächtig heraus.
Unser Vater arbeitete auf dem eingezäunten und gesicherten Fliegerhorst. Für Unbefugte war der Zugang streng verboten. Als Kinder eines Soldaten besaßen wir jedoch Ausweise, die uns erlaubten, den Fliegerhorst zu betreten. Die Sicherheitszonen waren allerdings auch für uns tabu. Wir nutzten unsere Freiheiten, um unseren Vater zu besuchen, sofern es seine Dienstzeiten zuließ. Viel öfters nutzten wir unsere Ausweise jedoch für den kostenlosen Besuch des Freibades auf dem Bundeswehrgelände, dass von den jungen Wehrpflichtigen nach Feierabend stark frequentiert wurde. Bis dahin gehörte das Freibad uns Kindern. Kamen die jungen Männer, war es uns ein Vergnügen, ihren Kunststücken und auch ihre Albernheiten vom Dreimeterbrett zu bestaunen.
An den Wochenenden waren die Kantinen der Kasernen nicht geöffnet. Die Freizeiträume mit Automaten und einem Kickerspiel waren jedoch zugängig. Diese Räume wurden gerade an Sonntagen zu unserem Revier. Wir spielten stundenlang Tischfußball, indem wir die Tore mit Bierdeckeln abdichteten und die Bälle dadurch nicht verloren gingen. Wir besorgten uns auch schon mal die eine oder andere Schachtel Zigaretten, bevorzugt »Reval ohne«, die auch Opa Horst rauchte, indem wir heimlich Mutters Stielkamm ausliehen, um dem Zigarettenautomaten die eine oder andere Schachtel kostenlos zu entlocken. Da unsere Mutter rauchte, aber auch der Westernheld, der Kommissar, der Bundeskanzler und alle anderen Vorbilder, wollten wir hier nicht nachstehen: bei unserer »Pafferei« fühlten wir uns wie die Großen.
Es folgten die Jahre, in denen wir als Familie in den Urlaub fahren konnten. Unsere Eltern hatten in der Lotterie 500 DM gewonnen. Sie kauften davon ein großes Familienzelt und mieteten uns auf einem Campingplatz in Harlesiel an der Nordsee ein. Unser Vater befreite unseren »Oles«, wie wir unseren PKW liebevoll nach den Buchstaben des Nummernschildes getauft hatten, von der Rücksitzbank und ersetzte sie durch mehrere Lagen Konserven. Sie sollten dafür sorgen, dass unsere Mutter die Familie satt bekam, ohne vor Ort teuer einkaufen zu müssen. Auf den Konserven wurde eine Wolldecke befestigt und fertig war die Sitzgelegenheit für uns Kinder, Sicherheitsgurte gab es noch nicht. Zum Glück sind wir bei Tageslicht Richtung Küste gefahren, da der Wagen hinten so in die Knie gegangen war, dass das Scheinwerferlicht in den Himmel gezeigt hätte. Freunde unserer Eltern begleiteten uns nach Harlesiel mit ihrem PKW, da wir mit einem Wagen das Zelt und alle notwendigen Klamotten nicht mitbekommen hätten.
Während die Erwachsenen noch das Zelt aufbauten, waren wir Kinder bereits am Strand, um uns auszutoben. Wir genossen über drei Wochen einen herrlichen Urlaub bei durchgehend bestem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen. Mein Bruder und ich hatten am Strand täglich den Ball am Fuß und unsere ältere Schwester turtelte mit den Jungen am Strand, die sie auf dem Campingplatz kennengelernt hatte. Unser Vater wurde zum »Strandkönig« gewählt und durfte dafür dem Wahlvolk eine Runde spendieren.
Als Familie unternahmen wir Spaziergänge in den Ort Carolinensiel und stöberten in den kleinen Lädchen. Natürlich waren wir wieder herausgeputzt – weiß war hier die herausragende Farbe. Wir Kinder haben intensiv das kleine Meerwasser-Freibad des Campingplatzes genutzt. Ich brachte mir selber den Salto vom Dreimeterbrett bei und zusammen mit meinem Bruder gab ich alles in den Schwimmwettkämpfen, die von den Bademeistern durchgeführt wurden. Dieser Urlaub sollte nicht zuletzt wegen des herrlichen Wetters der Schönste von drei Sommerurlauben sein, die wir in Folge auf dem Campingplatz in Harlesiel verbrachten.