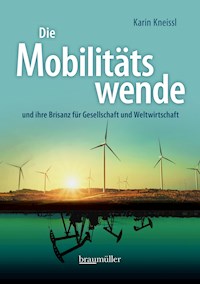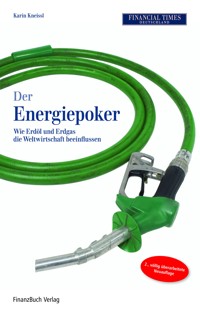18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Amman, Beirut, Jerusalem - Karin Kneissls Leben zeigt viele Stationen. In ihrem Buch spricht sie von ihrer ganz persönlichen Verbindung zum Nahen Osten und warum es sie immer wieder in die Krisengebiete verschlagen hat. Kann man sich in einen unlösbaren Konflikt verlieben? Karin Kneissl hat ihr halbes Leben im und mit dem Nahen Osten verbracht. Zwischen dem Wunsch zu verstehen und zu helfen; zwischen Todesangst, Frustration und dem Fatalismus einerseits und der tiefen Liebe zu einer Region und den Menschen andererseits. Sie studierte in Jerusalem, organisierte Menschenrechtsdebatten in Beirut, führte Interviews im Irak und erlebte den Arabischen Frühling am Tahrir-Platz mit. Als Journalistin, Diplomatin und Lehrende erlebte sie nahöstliche Königspaläste und österreichische Ministerien, deutsche Redaktionen und amerikanische Universitäten, nationale Botschaften und globale Energiekonzerne, backstage und ungeschminkt. Diese skurrilen, absurden, traumatischen und berührenden Erfahrungen teilt sie nun in diesem Band. Und wir kommen mit ihr zur Überzeugung, dass die Welt Menschen mit Rückgrat braucht, die nach ihrer eigenen Überzeugung handeln und sich nicht zu Söldnern anderer Interessen machen lassen - in den Krisengebieten der Welt ebenso wie im politischen Alltag hierzulande.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Osmanisches Reich um 1900
Karin Kneissl
MEIN
NAHER
OSTEN
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage 2014
© 2014 by Braumüller GmbH
Servitengasse 5, A-1090 Wien
www.braumueller.at
Bildnachweis: Archiv Karin Kneissl außer: © Bundesheer / Unger (Umschlagfoto 2); ORF ZiB (Umschlagfoto 3); Johann Heinrich Callenberg: Colloquia arabica viginti sex. Halle, 1717. Halle, Franckesche Stiftungen: AFSt/H Q 64 (Kapitel „Arabisch und die Sprachlosen“, Lehrbuch für Arabisch); Presseabteilung OPEC („Emotionale Energiepolitik“, Gespräch mit dem OPEC-Generalsekretär) Landkarten: Wikimedia Commons (Vorsatz); Braumüller Verlag („Die turbulente Geschichte des Orients“); Martin Zechner nach NordNordWest/Wikipedia, CC-BY-SA-3.0-DE: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode (Nachsatz)
ISBN der Printausgabe: 978-3-99100-112-6
ISBN E-Book: 978-3-99100-113-3
Für Vera, die zu früh starb.
Für Franz, der sich stets der Tiere annimmt,
wenn ich unterwegs bin.
Für Nathalie, die mir in Beirut
mehr als eine Freundin aus Kindertagen ist.
Für Abdallah, der im Sinne von Voltaire
seinen Garten in Amchit pflegt.
Und für meine Feinde, die mich vieles lehrten ...
Inhalt
AM ANFANG WAR DER ORIENT
Ex oriente lux
Eine Kindheit in Amman und eine kurze Geschichte Jordaniens
Schwarzer September – Bürgerkrieg in Jordanien
Wie der politische Islam das Land veränderte
Sommer 1982: Krieg im Libanon
Umweg über Jerusalem
ARABISCH UND DIE SPRACHLOSEN
Ohne Bildung wäre ich nichts
Die Sprache als Schlüssel
Vom Nutzen der Rechtslehre
Rückkehr nach Jerusalem
Georgetown und die zahlenden arabischen Kunden
DAS NAHÖSTLICHE FIASKO DER DIPLOMATIE
Der Nimbus Diplomatie und die harte Realität
Zwischen Damaskus und Intrigen
Am Ballhausplatz im Sommer 1990
Mit dem Schiff nach Byblos
Mission Wiedereröffnung der Botschaft
Als erster Rock im Kabinett des Außenministers
VON FREIGEISTERN UND SÖLDNERN
Frei schaffend
Als Journalistin zwischen dem Balkan und dem Orient
Was ist eine Recherche wert
Die vielen innerislamischen Glaubenskriege
Die Seele nicht verkaufen
Der Mut der Journalisten von Algerien bis in den Iran
Von der Haus- und Hofberichterstattung zum Weblog
Die vielen Experten der Ferndiagnose und die Zerstörung des Iraks
Geistige Söldner und Privatarmeen
Als Lehrende zwischen Orient und Okzident
Von Ethnopsychiatern und der Inflation interreligiöser Dialoge
EMOTIONALE ENERGIEPOLITIK
Es ist nicht „unser“ Öl
Warum der Nahe Osten noch nicht zu vergessen ist
Das hochpolitische Erdölgeschäft
Die verzerrten Bilder der OPEC
Faszination Energie
Der Erste Weltkrieg ist noch nicht zu Ende
Von Persien zum Iran
Zwischen Turkmenistan und dem Iran
Gemeinsam reich werden
Epilog: Zurück ins Dorf und unterwegs in den Nahen Osten
Die turbulente Geschichte des Orients
Erklärung zur Karte im Nachsatz
Danksagung
AM ANFANG WAR DER
ORIENT
Ex oriente lux
Der Nahe Osten ist das Thema meines Lebens, dank ihm wurde ich zu der, die ich bin. Wie es dazu kam, ist eine Geschichte mit Höhen und Tiefen, von der ich manches, aber nicht alles erzählen will. Einen Anfang nahm dieses Leben für den Nahen Osten im Sommer 1982, als der Libanon heftig brannte, einen anderen 1969 in Jordanien, wo ich einen kurzen Teil meiner Kindheit verbrachte. Die Lebenspfade der letzten bald fünfzig Jahre führten immer wieder in den Orient. Meine Lektionen aus diesen teils abenteuerlich schönen, teils bedrückenden Erfahrungen nahm ich mit in den Westen. So erwarb ich eine homöopathische Dosis Fatalismus und lernte bei jeder Reise aufs Neue, wie sich das Leben auch in widrigen Zeiten meistern lässt.
Dauerhaft könnte ich mir ein Leben im Nahen Osten nicht vorstellen, obwohl mich anfänglich die arabischen Großfamilien in ihren Bann gezogen hatten. Der Orient ist aber mit all seiner Intensität und Tragik ein Stück von mir. Wann immer ich mich abwenden wollte, holte er mich ein und ich blieb ihm verbunden. So versuche ich zu erklären, warum die Situation ist, wie sie ist, verworren und oft voller Überraschungen, und wir uns den Umbrüchen in dieser Weltecke nicht entziehen können. Denn der Nahe Osten ist Europa sehr nahe, dafür sorgen die Menschen und die Geografie.
Zu einem Zeitpunkt, an dem man sich „normalerweise“ für Jungs und Ausgehen interessieren sollte, verliebte ich mich gleichsam in einen unlösbaren Konflikt. Es war im Sommer 1982, als ich in Frankreich als Kindermädchen einige Wochen an der französischen Atlantikküste verbrachte und abends mit dem Wörterbuch in der Hand die Nachrichten aus dem Kriegsgeschehen im Libanon gebannt verfolgte. Ich wollte unbedingt verstehen, wer hier gegen wen und warum kämpfte, und begann alles, was mir in die Hände fiel, zu lesen und niederzuschreiben. Es war damals nicht absehbar, dass daraus ein Engagement für das weitere Leben werden würde. Aufmerksame Lehrer nützten meine jugendliche Expertise und schickten mich für Gastreferate quer durch das Schulgebäude. In Vorbereitung auf die Matura hatte ich als Autodidakt die ersten Grundlagen rund um den Konflikt erworben. Binnen Kurzem verbanden Mitschüler mit meinem Namen den Libanon und wunderten sich nicht mehr über Post des libanesischen Präsidenten Amin Gemayel, die ich freudig in die Schule mitbrachte. Sieben Jahre später lernte ich ihn schließlich in seinem Pariser Exil kennen, es entstand eine ganz besondere Freundschaft, die bis heute währt. Später würde ich Briefe an Hafez al-Assad, Ayatollah Khomeini und Menachem Begin schreiben, um die Freilassung politischer Häftlinge aus den Gefängnissen Syriens, des Irans und Israels einzufordern. So verfasste ich mit wachsender Routine offizielle Korrespondenzen, versehen mit bunten österreichischen Briefmarken, die ich aus eigener Tasche bezahlte. Organisatorisch erwarb ich mir Sporen mit Unterschriftensammeln und Demonstrationen gegen den Krieg im Libanon und diversen politischen Engagements. Dazwischen pflegte ich in einem Hospiz in Jerusalem jüdische Patienten kurz vor ihrem Abschied aus dem Leben, auch wenn ich lieber in einem Kindergarten mit arabischen Kleinkindern gespielt hätte. Die Arbeitssuche in Jerusalem ließ mich 1984 am Ende der menschlichen Existenz landen. Über Tod und Sterben, vor allem über das lange Warten bis zum Endlich-sterben-Können, lernte ich einiges zwischen der täglichen Betreuung der Patienten, zaghaften oder ergiebigen Gesprächen am Totenbett, Nachtdiensten in einem alten Gemäuer gegenüber der noch viel älteren Stadtmauer von Jerusalem, wo die Panzer im Dunkel der Nacht nach Norden in den Libanon zum Töten rollten, und letztlich dem Waschen der vom Krebs schon lange zuvor ausgemergelten Leichen, die wir in den Kühlraum des Krankenhauses brachten. Dieser Tod der Alten und Kranken war immer Erlösung.
Ganz anders sollte es sich mit den kleinen Krebspatienten aus Libyen verhalten, die ich im Wiener Allgemeinen Krankenhaus rund zwei Jahre betreuen half. Ihr Leiden ließ mich rebellieren. Indem wir Arabisch sprachen, half ich beim Übersetzen und wollte mich nützlich machen. Die Gelassenheit und der Humor, die diese kleinen tapferen Wesen mit den von Infusionen geschundenen Venen ausstrahlten, haben sich tief in die Erinnerung eingegraben. Später erlebte ich ein anderes abruptes und junges Sterben im Beirut der Bürgerkriegstage, als Checkpoints rivalisierender Gruppen die Viertel zerrissen, kleine Distanzen Nervenproben waren, Autobomben das Leben zum Spießrutenlauf machten und junge Milizionäre vollgepumpt mit Drogen aus Langeweile auf alles schossen, was sich bewegte. All dieses Morden unter Berufung auf einen barmherzigen Gott zieht sich wie eine dicke Blutspur durch die Geschichte der Menschheit. Was mir die Generation der Großeltern, die als Kinder den Großen Krieg und dann als Erwachsene das Massensterben des Zweiten Weltkriegs überlebten, vom Tod erzählt hatten, erlebte ich da und dort in der unendlichen Geschichte des Nahostkonflikts.
Ich war 22 Jahre alt, als ich 1987 mit den Recherchen für meine völkerrechtliche Dissertation zu den Grenzen im Nahen Osten an der Hebräischen Universität von Jerusalem begann, und hatte bereits mein ganzes Leben, all mein Sehnen und Streben auf die Nahostfrage ausgerichtet. Es sollte mir einige Jahre später zu viel werden, denn ich meinte in jugendlichem Überschwang mit all dem karitativen und politischen Engagement den Nahen Osten retten zu müssen und scheiterte entsprechend. Doch ich konnte aus meiner Entschlossenheit nicht mehr heraus. So erinnere ich mich gut an einen Moment in der Bibliothek der Orient-Gesellschaft in Wien, wo ich zwischen juristischer Fakultät und Orientalistik einen Abendkurs in Arabisch absolvierte. Zufällig stieß ich auf das Buch „Die sieben Säulen der Weisheit“ von Thomas E. Lawrence und las im Vorwort: „Mache niemals die Sache einer anderen Nation zu Deiner eigenen.“ Zwar begriff ich sofort, was jene schillernde Figur des „Lawrence von Arabien“ damit gemeint hatte, er war royalistischer als der König für die Anliegen eines anderen Volkes aufgetreten. Irgendwie steuerten all mein Denken und Streben nur mehr in Richtung Libanon, wo ich glaubte, unbedingt einen Beitrag zum Frieden leisten zu müssen. Doch sah ich mich mit dem Zynismus, der Brutalität und vor allem der Dummheit der eitlen Warlords in politischen Ämtern konfrontiert, die auch dreißig Jahre später noch das Sagen haben. Es dauerte, bis ich wieder einen inneren Kompass fand und nicht mehr das tiefe Unbehagen hatte, mich zu verirren. Dabei wollte ich unbedingt die Wahrheit über das Gemetzel im Namen von nationaler Sicherheit und religiösem Eifer ergründen. Dass ich hierbei nicht fündig wurde, erklärt sich von selbst.
Etwas für die Menschen und den Frieden im Nahen Osten zu tun, war letztlich auch der Hauptgrund, warum ich beschloss, in den diplomatischen Dienst der Republik Österreich einzutreten, wo ich als junge Referentin in der Nahostabteilung den surrealen Sommer 1990 rund um die damaligen Vorbereitungen des Krieges gegen den Irak erlebte. Auf einen Außeneinsatz in den Nahen Osten wurde ich aber nicht entsandt. Viele Jahre später begann ich als Journalistin über die neuen Kriege der alten Konflikte zu schreiben. Danach erstellte ich Lehrveranstaltungen zur Geschichte des arabisch-israelischen Dilemmas, um verschüttetes Wissen freizulegen. Ich wollte mich über den Unterricht vom Tagesjournalismus freischaufeln, den ich einige Jahre für mehrere deutsche Zeitungen intensiv betrieben hatte, der aber nicht meine Berufung war. Doch bei allem Gefallen an der Lehre sah ich meine Zukunft nicht vorrangig in einer universitären Funktion. Vielmehr lockte mich stets die Möglichkeit, zwischen den Welten zu wandern, im Räumlichen, aber noch viel mehr im Kopf.
Von der Fragenden wurde ich schließlich zur Interviewten, die im Österreichischen Rundfunk (ORF) die jeweils aktuellen Entwicklungen kommentierte, in vielen Debatten rund um den Irakkrieg von 2003 Position bezog, gegen den unseligen „War on Terror“ aufbegehrte und sich mit kritischer Stimme so manche Hetze gegen die eigene Person einhandelte. Letztlich begann ich mich in die energiepolitischen Fragen einzuarbeiten. In der Bibliothek der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) in Wien und in der Beobachtung vieler Konferenzen der Erdölproduzenten sowie zahlreicher Recherchen zwischen Algerien, dem Iran und Zentralasien erarbeitete ich mir eine neue Expertise, in die ich ein historisches Schlaglicht und vor allen Dingen menschliche Erfahrung einzubringen suchte.
In all diesen Phasen meines Lebens im und für den Nahen Osten spielten viele bemerkenswerte Menschen eine Rolle. Frauen und Männer unterschiedlicher Herkunft und Lebensanschauung, die mich einiges lehrten. Zum einen waren es arabische Familien in Jerusalem, die mir mit menschlicher Wärme und Großzügigkeit begegneten, die ich von zu Hause nicht kannte. Zum anderen lernte ich beim Beobachten unbekannter Helden im kriegserschütterten Beirut der späten 1980er-Jahren eines: Es kommt nicht darauf an, irgendwie zu überleben, sondern in Anmut und Würde. So wurde vor allem der Libanon zu meiner Lebensschule, der ich vieles verdanke. Ich erlebte, wozu der Mensch im Guten wie im Schlechten fähig ist. Und mein politisches Beobachterauge schärfte sich an den Tauschgeschäften korrupter Milizchefs zwischen Beirut und Damaskus ebenso wie beim akribischen Studium kurzsichtiger Großmachtpolitik für meine Doktorarbeit in den Archiven der israelischen Regierung und der Library of Congress in Washington. Seit dem Krieg des römischen Konsuls Julius Cäsar in Gallien scheint vieles unverrückt: teilen und herrschen, Geiseln nehmen, Militärposten errichten, zerstören und wieder aufbauen. So manche im Libanon gewonnene Beobachtung half mir Jahre später, den Wahnsinn der Balkankriege zu begreifen. Bloß waren die Dramen in Bosnien oft noch um ein Vielfaches brutaler als jene des Libanons, wo alles stets ein wenig sanfter erscheint und ein ungeschriebener Ehrenkodex den Respekt vor dem Leben ermöglicht, anders als ich es in den Balkankriegen erlebte. Bei allem Hadern mit so manchem Schicksalsschlag, aus der Leidenschaft für den Libanon zog ich immer wieder eine tiefe Zuversicht.
Eine Kindheit in Amman und eine kurze Geschichte Jordaniens
Im Frühjahr 1969 beschloss mein Vater ein Angebot des jordanischen Königs Hussein anzunehmen, als Pilot Seiner Majestät zu dienen und am Ausbau der nationalen jordanischen Airline mitzuarbeiten. Er war mit 24 der jüngste Kapitän bei der ebenso noch jungen AUA, stolzes Staatseigentum des gerade seit 14 Jahren erst wieder souveränen Staates Österreich. Parteipolitik dominierte aber bereits damals alle Personalentscheidungen. Ihm war diese Günstlingswirtschaft zuwider und lieber zog er in ein kleines arabisches Land, um in einer neuen Fluglinie alsbald zum Kapitän und Ausbildner aufzusteigen. Diese Fluggesellschaft hieß Alia, der Name leitete sich von der dritten Ehefrau von König Hussein ab, die bei einem Hubschrauberabsturz tödlich verunglücken sollte.
Im Herbst 1969 übersiedelte unsere Familie neben einigen anderen Piloten aus Europa mitsamt Anhang in ein Dorf namens Amman, wo die schwarzen Beduinenzelte die Skyline bildeten. Die jordanische Hauptstadt war vor knapp fünfzig Jahren kaum mehr als eine verstaubte Siedlung entlang der alten Nomadenrouten, auch wenn sie unter dem Namen Philadelphia im Römischen Reich einst bessere Zeiten erlebt hatte. Unser Haus war eines der wenigen aus Stein und befand sich auf einer der Erhebungen, die heute von Hochhäusern übersät sind. Als weitere Steinhäuser ließen sich die Gebäude am Flughafen, die Paläste der Königsfamilie, die Häuser des kleinen einheimischen Mittelstands sowie der Ausländer und einige wenige Hotels nennen – wie das Intercontinental, das Hotel der Fluglinien. Hier stiegen Piloten und Stewardessen ab, genossen die damals noch tagelangen Stopover zwischen den Flügen und präsentierten ihre meist schönen Körper am Pool. Die Luftfahrt jener Zeit hatte einen ganz besonderen Nimbus, denn Fliegen war seltener Luxus. Von Charterflügen war noch keine Rede. Wer an Bord ging, war zuvor beim Friseur gewesen und elegant gekleidet. Für ein Flugticket musste man oft ein ganzes Monatsgehalt zahlen. Demzufolge war der Flugbetrieb noch recht beschaulich, da die Zahl der abgefertigten Flüge, vor allem in Amman, gering war.
Gerhard Kneissl als Kapitän in einer DC-8 der Fluglinie Atlantis 1972
Die Mehrheit der Behausungen von Amman machten jene großen flachen Zelte aus, die in den kargen Tälern um die Hügel standen, umgeben von Ziegen- und Schafherden, dazwischen die Hirten und ihre Frauen- und Kinderscharen. Zu ihnen gingen wir, um Laban, das köstlichste Joghurt, knuspriges Fladenbrot und auch Eier zu holen, Geflügel hielten die Sesshafteren unter unseren unmittelbaren Nachbarn. Ihr ungebundenes Leben als Hüter der Tiere, die Zufriedenheit und Freiheit ausstrahlten, faszinierte mich damals sehr. Die Nächte waren sternenklar. Und gegen Morgen war das Gekreische der Esel und Ziegen sowie der jagenden Hunde und gejagten Katzen rund um das Haus laut und pünktlich. Diese durch und durch freien Menschen hatten mit der Umgestaltung der Landkarte nach dem Ersten Weltkrieg, im Zuge derer anstelle des weitläufigen, aber bankrotten Osmanischen Reiches nun arabische Nationalstaaten mit linearen Grenzen entstanden waren, ihre Wanderungen einschränken müssen. In Jordanien fanden viele von ihnen eine neue Lebensgrundlage, da sie unter anderem in der Armee Arbeit erhielten. Die berittene Beduinenpolizei patrouilliert bis heute auf jenen Wanderstrecken, auf denen die arabischen Stämme gegen Norden gezogen waren, um die verhassten türkischen Besatzer zu vertreiben. Insbesondere in Ägypten standen sie meist von der Warte der jeweiligen Machthaber aus unter Generalverdacht von Schmuggel bis Terrorismus, doch in Jordanien genossen sie dank der schützenden Hand der Haschemiten einen besseren Status.
Die Beduinen waren und sind im Militär das Rückgrat dieses Kunststaates Jordanien, den die Briten im Jahre 1923 aus dem eben erst von ihnen geschaffenen Mandatsgebiet Palästina herausgelöst hatten. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs war das Osmanische Reich zerfallen. Die Siegermächte Großbritannien und Frankreich teilten die Region neu unter sich auf. Dafür schufen sie Mandatsgebiete, die bis heute die Grundlage der hier bestehenden Nationalstaaten bilden. Vor dem Wort „Kolonie“ schreckten die Herren in London und Paris dann doch zurück, man entschied sich für „Mandat“. Gemeint war ein Land, das noch nicht fähig war, in die Unabhängigkeit entlassen zu werden, das man aber darauf vorbereiten wollte. Jordanien trug zunächst den Namen Transjordanien, also jenseits des Flusses Jordan, und sollte ein Trostpflaster für einen Beduinenfürsten namens Abdallah aus einem der ältesten Stämme Arabiens sein. Die Haschemiten waren zuvor seit dem 10. Jahrhundert die Herrscher des Hedschas, der südlichen arabischen Halbinsel gewesen, die Wächter der heiligen Stätten des Islams, Mekka und Medina, und sie rühmen sich eines Stammbaums, der auf den Propheten Mohammed zurückgeht. Für die Briten waren sie in die Reiterschlacht gegen die Osmanen gezogen, versprochen wurde ihnen ein Vereinigtes Arabisches Königreich mit Damaskus als Hauptstadt. Besagter Lawrence, ein britischer Offizier, Archäologe und Teilzeitspion, schmiedete die Allianz, die 1919 in den umstrittenen Pariser Vorortverträgen endete. Prinz Hussein und sein Freund Lawrence erschienen bei diesen Verhandlungen wie Exoten in der traditionellen Tracht der Beduinen und mussten sich in Geduld üben, während relativ junge Sachbearbeiter der britischen und französischen Diplomatie die Dossiers debattierten. Die mit der Orientfrage ante 1914 erfahrenen Beamten waren für die innereuropäische Nachkriegsordnung abgezogen worden. Doch die Grenzen für diese neuen arabischen Nationalstaaten wurden nicht in Sèvres bei Paris vereinbart. Die detaillierte Aufteilung der Region sollte ein Jahr später in San Remo, dem Kurort der Belle Epoque an der italienischen Riviera, erfolgen. Zu diesem Zwecke waren in erster Linie die Vertreter großer Erdölfirmen angereist, die neben der Übernahme der deutschen Konzessionen die Trasse jener Pipeline besprachen, die Erdöl aus dem nördlichen Mesopotamien ans Mittelmeer transportieren sollte. Mosul-Haifa hieß die Pipeline, die zur Referenz der nachfolgenden Grenzziehungen wurde. So entstanden also die neuen Staaten Irak und Syrien als Ergebnis eines Pipeline-Abkommens. Und wenn die Anekdote stimmt, so wurden die Linien hierfür auf dem Tischtuch im Hotel Londra gezeichnet. Das Mandatsgebiet Palästina wurde dann 1923 geteilt, als ein gewisser Winston Churchill, Staatssekretär im Kolonialministerium, die Gebiete östlich des Jordans Abdallah, einem der Söhne des Verbündeten Husseins, gab. Ein anderer Sohn Husseins wurde im neu geschaffenen Irak als König eingesetzt. Die Dynastie der Haschemiten hatte in diesem Land jedoch nur eine kurze Geschichte. 1958 wurde König Faisal II gestürzt und öffentlich hingerichtet. In der Folge wurde die gesamte Königsfamilie ermordet. Die Bilder der geschändeten Leichen erschütterten nicht nur die arabische Öffentlichkeit. Tabus waren gebrochen, und Regierungen wechselten mit viel Gewalt, um dann noch gewalttätiger vermeintliche innere Feinde niederzuschlagen. Der Irak sollte ebenso wie Syrien durch eine Serie von Militärputschen gehen, bis Mitte der 1970er-Jahre unter der repressiven Regierung von Saddam Hussein eine relative Ruhephase begann, die mit dessen Sturz 2003 wieder von einem blutigen Konflikt abgelöst wurde.
In Syrien war es nicht unähnlich, auch hier leitete erst die Machtergreifung des Luftwaffenoffiziers Hafez al-Assad 1970 eine Phase der Stabilität um den Preis brutaler Unterdrückung der Bevölkerung ein. Syrien wurde vom Spielball der Mächte zum eigenständigen Spieler, der im Konflikt mit Israel und vor allem im Nachbarland Libanon voller Machtfülle auftrat. Jordanien hingegen sollte sich im Windschatten seiner mächtigen Nachbarn trotz aller inneren Umwälzungen durch den Zustrom palästinensischer Flüchtlinge relativ ruhig entwickeln. Die Palästinenser kamen zunächst 1948 bei der Gründung Israels, wobei die Mehrheit noch kein nationales palästinensisches Nationalgefühl hatte, und dann in noch viel größerem Umfang 1967 infolge des Sechstagekriegs und der israelischen Besetzung des Westjordanlands und von dem ebenso von Jordanien zuvor okkupierten Ostjerusalem. Diesmal waren die Palästinenser nicht mehr die königstreuen Untertanen, sondern entwickelten ihren eigenen revolutionären politischen Kurs, der in Jordanien und später im Libanon für Unruhe sorgte. Die Folge des starken Zustroms von Flüchtlingen war, dass die Palästinenser bald mehr als sechzig Prozent der jordanischen Bevölkerung ausmachten. Sie wurden von der politischen und militärischen Führung stets argwöhnisch als eine Fünfte Kolonne beäugt, die der Staatssicherheit noch gefährlich werden würde. Neben den Bewohnern der palästinensischen Flüchtlingslager, die, wie das größte seiner Art Baqa’a, seit bald fünfzig Jahren bestehen, baute ein erfolgreicher palästinensischer Mittelstand Jordanien mit auf, doch als Bürger zweiter Klasse fühlen sich noch heutzutage viele unter ihnen. Irgendwie arrangierte man sich letztlich mit der Monarchie, denn auf den alten Haudegen Jasser Arafat, den Untergrundkämpfer und Vorsitzenden der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), setzten vor allem die Linken und Jungen in den 1980er-Jahren, bevor die PLO dank Friedensvertrag mit Israel 1993 international salonfähig wurde.
Das Königshaus gründet aber seine Hausmacht zum einen auf die Beduinenstämme, deren Loyalität sich aus alter Feudaltreue und Zuwendungen des Königs ergab. Zum anderen sind wesentliche Posten im Militär mit den aus dem Kaukasus zugewanderten Tscherkessen besetzt. Nicht wenig hochrangige Offiziere sind blond und blauäugig, da ihre Vorfahren auf der Flucht vor russischen Pogromen Mitte des 19. Jahrhunderts in diese Provinzen des Osmanischen Reiches gekommen waren. Die Haschemiten, selbstbewusste alte Aristokraten und weltoffen, waren ihrerseits 1924 von den Emporkömmlingen der Wüste, dem Stamm der Sauds, von der Arabischen Halbinsel vertrieben worden. Die Sauds hatten ihre Hausmacht im Verein mit der Ende des 18. Jahrhunderts entstandenen konservativen Strömung der Wahhabiten aufgebaut, sie brauchten die religiösen Fanatiker, um den rivalisierenden Stämmen ein einigendes Band umzuhängen. Die Wahhabiten wurden mit ihrer verengten Weltsicht bis heute so einflussreich, da die Sauds ihnen Macht und vor allem viel Geld gaben, während der Rest der Welt bei so mancher Machenschaft wegsah. Denn zuerst sollten die Briten, später die US-Regierungen auf eine ölige Verbindung mit den Sauds setzen. Man ließ die Extremisten gewähren, als sie karitative Einrichtungen mit all der damit verbundenen ideologischen Gehirnwäsche für einen radikalen Islam von Westafrika bis Südasien errichteten. Der Westen hatte bis zum überraschenden Fall der Berliner Mauer 1989 bloß das Ziel, den Kommunismus einzudämmen, der politische Islam saudischer Machart war hierbei ein willkommenes Mittel. Die Auswirkungen des Exports wahhabitischer Vorstellungen erleben folgende Weltregionen seit bald zwanzig Jahren. Denn religiöser Fanatismus bewegt die Menschen von Nigeria bis Pakistan und entflammt täglich neu in den vielen Stellvertreter- und Bürgerkriegen zwischen Libanon, Syrien und dem Irak. Saudi-Arabien ist übrigens neben Liechtenstein der einzige Staat, der nach einer Familie benannt ist. Jene, die in den Saudis Usurpatoren und nicht die legitimen Herrscher auf der Halbinsel sehen, sprechen lieber vom Hedschas als von Saudi-Arabien.
Wären die Haschemiten an der Macht geblieben, hätte sich wahrscheinlich ein solch gewaltbereiter politischer Islam, wie er heute die muslimische Welt in ihrer Gesamtheit erschüttert, nicht herausgebildet. Die Haschemiten erhoben lange offiziell den Anspruch auf die Rolle der Scherifen, der Wächter der heiligen Stätten von Mekka und Medina, dem höchsten offiziellen Amt, den heute die Sauds innehalten. Die vertriebenen Haschemiten waren aber stets auch pragmatisch genug, um ihre Ambitionen nicht allzu hoch zu schrauben. Vielmehr positionierten sie sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als verlässliche Partner zwischen Ost und West. König Hussein, der 1952 seinem kränklichen Vater Talal mit nur 16 Jahren auf den Thron folgte, verwandelte sich über die Jahrzehnte immer mehr zum Wüstenfuchs, der eine Mischung aus Bauernschläue und ausgeprägtem Gespür für internationale Beziehungen vereinte. Von seinem Großvater Abdallah hatte Hussein den politischen Instinkt geerbt, der ihn ungewöhnliche politische Spagate machen ließ. Denn Amman galt, ebenso wie Kairo unter den Langzeitherrschern Anwar as-Sadat und Hosni Mubarak, als engster arabischer Verbündeter der USA. Zugleich verstand der kleine König, seine Körperhöhe maß nur 160 cm, mit den Intimfeinden Washingtons gemeinsame Sache zu machen, wenn es seine ganz persönliche Staatsräson erforderte. Dies war zum Beispiel im Sommer 1990 der Fall, als der Irak in Kuwait einmarschierte und das kleine Golfemirat, das einst von Basra aus verwaltet worden war, zur 19. Provinz des Iraks erklärte. Die gesamte arabische Welt zog in jenem Sommer geschlossen in eine Allianz unter der Führung der USA, um im UN-Sicherheitsrat gegen den Irak vorzugehen. Bloß König Hussein reiste nach Bagdad, um demonstrativ seine Solidarität mit jenem Mann zu bekunden, der den Golfmonarchien den Kampf ansagte. Gemeinsam ballerten die beiden Männer am Balkon des Präsidentenpalastes mit Jagdgewehren in die Luft und zeigten auf geradezu archaische Weise ihre Waffenbrüderschaft. Husseins Beweggründe lagen zum einen in seiner alten Verachtung für all die Emporkömmlinge der reichen Ölstaaten, zum anderen in seinem Feingefühl für die Stimmung im Volk. Die „arabische Straße“, wie es etwas abschätzig heißt, wenn von den Millionen im Volk die Rede ist, stand nämlich auf Seite von Saddam Hussein, der den USA die Stirn bot. Besonders populär war der Schnauzbart von Bagdad unter den Palästinensern. Ihre Landsleute, die zu dem Zeitpunkt in großer Zahl in den Golfstaaten arbeiteten, bezahlten für diese Sympathie einen hohen Preis. Gleichsam über Nacht wurden sie aus Saudi-Arabien und anderen Staaten der arabischen Halbinsel hinausgeworfen. Rechtlos wie alle Ausländer, die dort arbeiten, mussten sie Hab und Gut zurücklassen und wurden von den nervösen Herrschern kollektiv bestraft.
König Hussein präsentierte sich einmal mehr als schlauer Akrobat, der ebenso großzügige finanzielle Zuwendungen der USA an Land zog, um sein rohstoffarmes und bevölkerungsreiches Land wirtschaftlich am Leben zu halten, wie er auch in der US-kritischen Öffentlichkeit hohes Ansehen genoss. Hussein soll rund vierzig Attentate auf seine Person überlebt haben, widersetzte sich mit harter militärischer Entschlossenheit einem Aufstand der PLO im September 1970, ließ so manches Komplott zerschlagen, führte Dutzende Nahostfriedensgespräche und schloss mit Israel 1994 einen offiziellen Friedensvertrag, der aber letztlich wenig veränderte, denn mit den Israelis pflegte er meist gut umzugehen, jedoch musste er sich im Februar 1999 dem Krebs geschlagen geben. Noch auf dem Totenbett ließ er eine mittlere Palastrevolte schlichten und das Testament umschreiben, denn anstelle seines Bruders Hassan, dem ewigen Kronprinzen, sollte sein Sohn Abdallah aus zweiter Ehe mit einer Britin die Nachfolge antreten. Hintergrund für diese relativ überraschende Verfügung war die Furcht von Ehefrau Nummer vier, Königin Noor, dass sie und ihre Kinder aus dem Palast und der Nachfolge gedrängt würden, wenn Hassan und dessen ehrgeizige Ehefrau einzögen. Was wie eine kuriose orientalische Seifenoper klingt, krempelte ein wenig die Nahostpolitik um. In Washington war man letztlich auch mit dieser Wendung zufrieden, da man Hassan eine zu starke Nähe zu den Muslimbrüdern nachsagte. So kam Abdallah plötzlich auf den Thron und hatte von Anbeginn mit dem übermächtigen Schatten seines Vaters zu kämpfen. Anfänglich versuchte er noch berühmte Aktionen des Verstorbenen nachzuahmen, wie als Taxifahrer inkognito am Steuer unterwegs zu sein und ähnlich der Märchenfigur des volksnahen Herrschers von Bagdad, Kalif Storch, Sorgen und Klagen aus dem Volk zu erfahren. Doch was bei Hussein authentisch wirkte, schien bei Abdallah von Souffleuren eingeflüstert. Seine Unsicherheit gründet aber auch auf der Tatsache, dass er mütterlicherseits halber Engländer ist. Sein Arabisch mit starkem englischem Akzent sorgt seit jeher für viel Spott. Wesentlicher Trumpf war einige Jahre lang seine palästinensische Ehefrau Rania, die perfekt anmutende, moderne arabische Frau, die den Umgang mit westlichen Medien elegant beherrscht und, falls nötig, ihr Gegenüber professionell bezirzt. Doch ihre Einkaufstouren im Ausland und unklare Immobiliengeschäfte für die eigene Familie im Land sorgen für wachsenden Unmut. Das Königspaar ist nicht so populär, wie man es von außen gerne vermeint. Abdallah ertränkt und verspielt zudem so manchen Kummer bei nicht islamischen Vergnügungen, was wiederum sein Ansehen in der frommen Bevölkerung sinken lässt. War Vater Hussein ein Lebemann in Zeiten, als die arabische Welt noch mehr von nationalistischen Themen als von einer erstarkten Religiosität bestimmt war, so muss der Sohn mehr achtgeben. Den Instinkt seines Vaters hat er jedenfalls nicht geerbt, denn dieser wusste sich in widrigen Umständen mit viel Souveränität durchzusetzen und irgendwie schienen Freund und Feind immer wieder seinem Charme zu erliegen. Dabei war der kleine König nichts anderes als ein orientalischer Despot, der sich hübsche Stewardessen bei Bedarf ebenso zuführen ließ, wie er Klartext mit dem israelischen Geheimdienst Mossad redete und ein Gegengift für einen von den Israelis vergifteten Hamas-Politiker binnen Stunden erhielt. Hussein war der arabische Gentleman, den man in den Wiener Salons freudig begrüßte, wenn er auf Zwischenstopp zwischen Skiurlaub am Arlberg und Besuch seiner Residenz in Wien-Döbling auch einige Nahostgespräche führte. Mit dem Tod seines Freundes Bruno Kreisky im Sommer 1990 wurden seine Visiten in Wien immer seltener, denn mit welchem österreichischen Politiker hätte er sich danach noch über den Nahen Osten austauschen sollen?
Schwarzer September – Bürgerkrieg in Jordanien
Es war also diese schillernde Persönlichkeit Hussein, für die mein Vater einige Jahre arbeitete. Was die beiden Männer verband, war eine tiefe Leidenschaft für die Fliegerei. Hussein setzte sich gerne selbst ins Cockpit und übernahm den Steuerknüppel. Auf ausländische Piloten in seiner unmittelbaren Nähe vertraute der Hobbyflieger wenig, dafür hatte er zu viele Anschläge knapp überlebt. Am meisten geprägt hatte ihn wohl 1951 das tödliche Attentat auf seinen Großvater Abdallah bei einem Besuch der al-Aqsa-Moschee. Hussein war damals 16 Jahre alt, der Attentäter ein palästinensischer Nationalist, der den König des Verrats an den Arabern bezichtigte. Die Legende berichtet, dass der junge Hussein den Anschlag nur deshalb überlebte, weil die Kugel an jenem Orden abprallte, mit dem ihn kurz zuvor sein Großvater dekoriert hatte. Die Gesprächskanäle und vielen Geheimtreffen zwischen den Haschemiten und Zionisten noch vor der Gründung des jüdischen Staates waren auch in der Bevölkerung hinlänglich bekannt. Doch dieses Thema war stets brisant. Ich erinnere mich meiner Dissertationsrecherchen in der Bibliothek der Universität von Amman, wo ich bloß unter Aufsicht und nach Einholung mehrerer Genehmigungen bestimmte Bücher zum Thema lesen durfte. Diese Zensur bewirkte im November 1988 in mir einen mittleren Zornesausbruch im Dekanat der Universität, wo ich wütend in klassischem Arabisch den Verwaltungsbeamten zurief, dass man auf der Hebräischen Universität von Jerusalem viel leichter Bücher lesen konnte als hier im Haschemitischen Königreich Jordanien! Starre Blicke schlugen mir entgegen. Wohl hatte ich Glück, dass niemand so recht wusste, wie auf meine Vorwürfe zu reagieren wäre. Von da an bemühte ich mich nicht mehr um Sondergenehmigungen für Bücher, sondern las eben das Wenige, das vorhanden und erlaubt war.
Diese Erfahrungen sollte ich knapp 18 Jahre nach meinem ersten Aufenthalt als Kind in Amman machen. Der König war immer noch an der Macht, saß fester als je zuvor im Sattel, vor den Abendnachrichten lächelte der Monarch als Knospe aufblühender Blumen in vielen Varianten vom Bildschirm. Sein Konterfei beherrschte das gesamte öffentliche Leben, wie es bei anderen Langzeitherrschern von Marokko bis zum Golf der Fall war und auch nach allen revolutionären Umbrüchen noch ist. Die Jordanier waren immer recht erstaunt, wenn ich ihnen mitteilte, dass ich bereits vor dem Bürgerkrieg des Schwarzen September 1970 im Land gewesen war. Irgendwie konnten sie sich das mit meinem damaligen Lebensalter nicht ganz ausrechnen. Jedenfalls erfuhr ich als Studentin etwas, das ich als Kind noch nicht begreifen konnte, und dank einer entspannten politischen Situation in Osterreich als Heranwachsende nicht durchleben musste: die dauernde Angst vor Geheimdiensten, Willkür, Putschversuchen, Intrigen mit tödlichem Ausgang. Diese Stimmung beherrschte das Land ebenso wie die Nachbarstaaten.
König Hussein hatte dieses Dilemma zu einem sehr frühen Zeitpunkt in seinem Leben erfasst. Oberste Priorität hatten Machterhaltung und Machtentfaltung. Und die Schaffung einer eigenen Airline war ihm hierfür ein Herzensanliegen. Flagge und Fluglinie sind offensichtliche Symbole von Souveränität, auf die jeder junge Staat pocht. Alia sollte später unter dem Namen „Royal Jordanian“ auch zu einer renommierten Airline mit einem weiten Streckennetz aufsteigen, wie überhaupt die einstigen großen europäischen und US-amerikanischen Namen in Service und Verbindungen immer mehr abstiegen und im internationalen Vergleich hinter die Fluglinien der arabischen Welt und der Asiaten abrutschten. Dass dahinter mehr Prestigedenken der Machthaber und großzügige Subventionen als unternehmerisches Wirtschaften stehen, ist klar.
Als wir Ende der 1960er-Jahre in Jordanien ankamen, waren die Fliegerei und Piloten sehr begehrt, jedenfalls am Hofe des jovialen kleinen Königs, der sich bei seinen eigenen Flugeskapaden auch von den politischen Wirren erholte, denn über den Wolken sieht die Welt einfach anders aus. Zudem war er ein leidenschaftlicher Funker, der binnen weniger Jahre den gesamten Königshof für den Amateurfunk begeisterte. Er sah darin ein Symbol technischen Fortschritts und die Versorgungssicherung. Hussein war fest entschlossen, aus dem kleinen Rumpfstaat mit Zugang zum Meer, wo nutzbares Land ebenso fehlt wie Trinkwasserreservoirs, einen soliden Nationalstaat zu machen. Für die Herausbildung einer nationalen Identität eignete sich die alte Felsenstadt Petra, die der Schweizer Orientreisende Jean Louis Burckhardt 1812 dank eines hilfreichen Hirten wiederentdeckt hatte. Indem man sich auf die einstige Hochkultur der Nabatäer, des orientalischen Händlervolks der Antike, berief, die ihre bemerkenswerten Tempel und Häuser vor über zweitausend Jahren in die Felsenwände geschlagen hatten, baute man sich eine zivilisatorische Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die touristische Erschließung sollte aber erst Jahrzehnte später erfolgen, denn um 1970 herum verschlug es nur wenige Reisende in das provinzielle Jordanien. Damals war Kabul viel populärer und leichter zu bereisen. Afghanistan und der Iran waren beliebte Reiseziele meiner Elterngeneration. Der Favorit hieß aber Beirut, wo zwischen schicken Hotels und ausgelassenen Clubs stets levantinisches Dolce Vita herrschte. Vielmehr als ein subventionierter Tourismus in die Wüste eignete sich also der Aufbau einer nationalen Fluglinie zur Stärkung der nationalen Zusammengehörigkeit.
Im Sommer 1970 schien ebendieser Zusammenhalt auf die Probe gestellt. Ein Verband palästinensischer Gruppen, der in Jordanien Zuflucht gefunden hatte, unternahm einen Umsturzversuch. Weil er im September 1970 begann, trägt er bis heute den arabischen Namen „Ayul al-Aswad“, Schwarzer September. Es war Bürgerkrieg oder vielmehr ein Aufstand der Palästinenser gegen die jordanische Staatsmacht, der ein Jahr dauerte und eine bis heute unbekannte Zahl an Opfern forderte. Jordanien diente als Rampe und Rückzugsgebiet palästinensischer Fedayin, Guerilleros beziehungsweise, in der israelischen Diktion, Terroristen, wobei vertriebene Palästinenser anfänglich versuchten, zurückgelassenes Hab und Gut noch nachzuholen, später ging es vor allem um Zerstörung israelischer Infrastruktur. Mit zunehmender Eskalation infolge weitreichender Vergeltungsakte der Israelis und der gewaltigen jordanischen Verluste im Sechstagekrieg vom Juni 1967 wurde Jordanien immer mehr zum Schauplatz des arabisch-israelischen Konflikts. Während der arabische Nationalist in Kairo, Staatspräsident Gamal Abdel Nasser, seinerseits die arabische Agenda dominierte und im Juni 1967 in der Niederlage des Sechstagekriegs scheiterte, hatte der Monarch Hussein in den nationalistischen Bewegungen wie dem Nasserismus stets eine kommunistische Machtübernahme gewittert. Die von linken Ideen aller Art bewegten Palästinenser wurden zusehends zu einer regierungskritischen Bevölkerung, die nicht mehr auf die verkrusteten arabischen Machtapparate, sondern auf ihre eigene Kraft zwecks Rückeroberung der verlorenen Heimat setzte. Mit der Entstehung der PLO 1965 und dem Vorsitz von Jassir Arafat entwickelte sich der Konflikt von einer israelisch-arabischen zu einer israelisch-palästinensischen Konfrontation. Internationale Bekanntheit erreichte die PLO ab 1972 mit Flugzeugentführungen, die sie als Mittel zum Zweck für die „Sache der Palästinenser“ verstanden.
Partner wurden diverse Terrorgruppen in Deutschland (z. B. RAF), die Finanzierung kam einmal aus Libyen, dann wieder aus Moskau oder Ost-Berlin. Neue Abhängigkeiten waren rasch da. Dominierten bis in die Mitte der 1980er-Jahre noch nationalistische Dogmen sowie ein buntes Gemisch aus linken Ideen und einem Internationalismus die Anliegen der Palästinenser, begann angesichts all der Niederlagen gegen Israel und vor dem Hintergrund tiefer Veränderungen in der muslimischen Welt, wie die Revolution im Iran 1979, der politische Islam die Palästinenser zu begeistern. Die Muslimbrüder in Ägypten hatten mit der Hamas bereits eine politische Filiale im Gazastreifen geschaffen, die anfänglich auch mit israelischem Wohlwollen wirkte. Es war den Besatzungsbehörden angenehmer, wenn die jungen Palästinenser in die Koranschulen als in politische Salons des Untergrunds gingen. Symbole wie die schwarzen Flaggen des Islams waren ihnen damals sympathischer als die säkularen Kampfslogans der PLO. Doch die Aufstände vom September 1970 gegen den unmittelbaren Nachkommen des Propheten Mohammed wurden ausschließlich im Namen einer neuen revolutionären palästinensischen Sache ausgefochten.
Wie lange das, aus meiner kindlichen Sicht, relativ gemütliche Familienleben in dem Steinhaus zwischen den Beduinenzelten tatsächlich andauerte, verschwimmt in der Erinnerung. Aber irgendwie habe ich gute Erinnerungen an jene Zeit, die in mir vielleicht so etwas wie eine erste Saat für die spätere Liebe zu den Menschen und zum Orient legten. Denn die nahöstlichen Gefilde waren in gewissen Gerüchen und Erzählungen immer zugegen. Jedenfalls nahm das Kapitel Jordanien ein abruptes Ende, als mein Vater eines Tages sehr früh vom Flughafen nach Hause kam und sagte: „Wir haben Krieg.“ Als Fünfjährige konnte ich damals mit dem Wort Krieg gar nichts anfangen, erinnere mich aber an sehr blasse Gesichter der Erwachsenen rundum. Der ansonsten redselige Koch, der mit mir in der Küche zum Klang der zerkratzten Platten tanzte, wurde immer stummer und kam bald gar nicht mehr. Das Leben wurde schwieriger, als die Wassertanks auf dem Dach beschossen waren, der Strom ausfiel und auch wir Ausländer zum Ziel der Kämpfe wurden. An einem Abend wurde unser Auto, ein Kombi, bei der Heimfahrt von einer Gruppe vermummter Kämpfer an einem Checkpoint gestoppt. Der Anführer wedelte mit seinem Maschinengewehr in der Luft umher und bat uns höflich aber sehr bestimmt auszusteigen. Wir absolvierten den restlichen Weg zu Fuß, das Auto war kurzerhand konfisziert worden. Relativ bald stand fest, dass meine Mutter, die kleine Schwester und ich das Land verlassen würden. Die Reise aus Amman heraus in Richtung Libanon dauerte eine halbe Ewigkeit, Wagen und Passagiere wurden an vielen Kontrollposten von oben bis unten durchsucht, aber irgendwann landeten wir dann wieder auf einem europäischen Flughafen. Im Gegensatz zu den Menschen, die mit ihrer Flucht ihr Land und alles Hab und Gut verloren, waren wir unendlich privilegiert. Denn wir kehrten in eine Wohnung nach Wien heim, ließen nur Spielsachen, Kleider und Schallplatten, die wir ohnehin schon Hunderte Male gehört hatten, zurück. Mein Vater würde noch einige Monate weiter im Dienste Seiner Majestät stehen und Mitglieder der königlichen Familie ein- und ausfliegen, um dann auch Jordanien zu verlassen, wo er binnen Kurzem Status und Wohlstand erworben hatte, was in Europa in dem Umfang nicht so rasch möglich gewesen wäre.