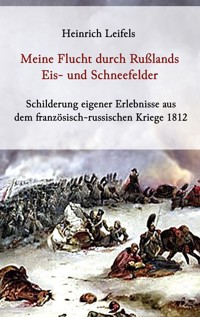
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch findet sich der packende Bericht des westfälischen Sergeanten Heinrich Leifels, der mit der großen Armee Napoleons im Jahre 1812 Teilnehmer am schicksalsträchtigen Feldzug gegen Rußland war, der mit der vollständigen Vernichtung des Invasionsheeres endete.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt.
Vorwort.
Erster Teil.
Bruchstücke aus dem französisch-russischen Feldzuge im Jahre 1812.
1. Die Rekrutenzeit und der Abmarsch zum Kriegsschauplatz.
2. Der Beginn des Krieges.
3. Erlebnisse auf der Relaisstation.
4. Der Rückzug beginnt.
5. Von Smolensk bis an die Beresina.
6. Der Übergang über die Beresina.
7. Von der Beresina bis nach Wilna.
8. Furchtbare Ereignisse am Njemen, bei Wilna und Kowno.
9. In deutschen Quartieren.
10. Scheintot in der Leichenkammer.
11. Des Dramas letzter Akt.
12. Ein Lob durch König Hieronymus.
Zweiter Teil.
Leben und Wirken des Erzählers.
Sein Lebenslauf.
Dritter Teil.
Kurze Übersicht über den russisch-französischen Krieg im Jahre 1812.
Vorwort.
EINER der merkwürdigsten Kriegszüge aller Zeiten war bekanntlich der kühne Zug Napoleons I. nach Rußland im Jahre 1812. Der korsische Eroberer, der sich zu Beginn dieses Feldzuges auf dem Gipfel seiner Macht befand, führte damals mitten durch Deutschlands Gaue hindurch nach Rußlands unwirtlichen Steppen ein so gewaltiges Heer, wie man es seit den ältesten Zeiten nicht mehr beisammen gesehen hatte. In seinem Heere, der sogenannten „großen Armee“, waren fast alle Völker Europas vertreten; der Wille des Mannes, der Mitteleuropa beherrschte, zwang die von ihm abhängigen Nationen, ihm Hilfstruppen zu stellen, und ganz besonders waren es die von dem „Sohne des Glückes“ in blutigen Kämpfen unterworfenen germanischen Volksstämme, die starke Kontingente zu der großen Armee stellen mußten. Aber von den 600,000 Mann, die den sieggewohnten Adlern und Fahnen des Cäsars des 19. Jahrhunderts nach Rußland folgten, kamen kaum 20,000 Mann in elendem Zustande über den Njemen zurück, und von diesen kläglichen Trümmern der großen Armee ging noch der größte Teil infolge der ausgestandenen Entbehrungen und Strapazen alsbald an Krankheiten zugrunde.
Über den Sohn des korsischen Advokaten, über Napoleon Bonaparte, der sich im Jahre 1804 als Napoleon I. durch sein unvergleichliches Kriegsgenie zum Kaiser der Franzosen und in den folgenden acht Jahren zum Beherrscher des größten Teiles des europäischen Festlandes emporgeschwungen hatte, war auf Rußlands Schnee- und Eisfeldern ein furchtbares Strafgericht hereingebrochen. Ein frühzeitig begonnener strenger Winter vollendete das Zerstörungswerk, das die erschlaffende Hitze des Sommers und die monatelangen Entbehrungen vorbereitet hatten - und in wenigen Wochen war die mächtigste Armee der Welt fast vernichtet.
Einer der wenigen, die alle Schrecken dieses an furchtbaren Ereignissen so reichen Krieges mitgemacht hatten, und sich von den ausgestandenen Entbehrungen und Strapazen allmählich erholten, war der Verfasser dieses Buches, Heinrich Leifels, damals Sergeant in französischen Diensten, später preußischer Wachtmeister in Borken i. W. Der Lebenslauf dieses Mannes ist ebenso eigenartig als interessant und zugleich eine treffende Illustration zu den damaligen Zeitverhältnissen, durch welche die streitbaren jungen Männer fast aller Nationen von der Kriegsfurie bald hierhin, bald dorthin geworfen wurden, bis die meisten von ihnen auf irgendeinem Schlachtfelde oder im Lazarett vom Tode ereilt wurden.
Wie alle alten Soldaten, so erzählte auch Leifels in späteren Jahren im trauten Familien- und Freundeskreise gern von seinen Kriegstaten. Ganz besonders aber waren es die erschütternden Erlebnisse im französisch-russischen Kriege vom Jahre 1812, die er ungemein fesselnd zu schildern verstand, und die sich seine Bekannten immer wieder von ihm erzählen ließen. Auf ihre Veranlassung hat er damals diese Erlebnisse niedergeschrieben und mit anderen für ihn wertvollen Schriftstücken sorgfältig verwahrt. Er beabsichtigte, diese Erinnerungsblätter aus schwerer Zeit drucken zu lassen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist aber nicht mehr zur Vollendung seines Planes gekommen.
Die alten vergilbten Blätter blieben nun im Besitz der Familie - an direkten Nachkommen leben zurzeit noch ein Sohn und eine Tochter, - welche den schriftlichen Nachlaß des tapferen Kriegers sorgfältig, gleichsam wie einen Familienschatz, bewahrten.
Auf mehrfache Anregungen hin entschloß sich der Unterzeichnete, das vorhandene Material zu sichten und jetzt noch, fast ein Jahrhundert nach den geschilderten Erlebnissen, im Druck erscheinen zu lassen. Im 1. Teile erzählt der Verfasser Selbsterlebtes, das um so erschütternder wirkt, als die einfache, schmucklose Sprache offenbar nur die reine Wahrheit enthält. Auch manche bisher unbekannte oder doch nur wenig bekannte Episode aus der Geschichte des Unterganges der großen Armee ist in diesen Blättern verzeichnet. Der 2. Teil des Büchleins enthält einige nähere Angaben über die Person des Erzählers, die wohl manchem Leser willkommen sein dürften, während der 3. Teil eine kurze informierende historische Übersicht über den Verlauf des Krieges enthält.
Ich übergebe das Büchlein mit dem Wunsche der Öffentlichkeit, daß nie wieder für unser Vaterland so schwere Zeiten hereinbrechen mögen wie damals, wo die streitbaren Söhne deutscher Mütter unter dem Joche der Fremdherrschaft Kriegsdienste tun mußten und nutzlos auf den Schlachtfeldern geopfert wurden. Wie aber einerseits der Glücksstern Napoleons auf Rußlands Eisfeldern erblich, so brach anderseits gerade dort für Deutschland das Morgenrot einer neuen Zukunft an, und an der Befreiung unseres Vaterlandes von der Fremdherrschaft hat auch mein im Jahre 1854 verstorbener Vater, der Erzähler dieser Geschichten aus dem französisch-russischen Kriege, tatkräftig mitgewirkt. Möge seinen ergreifenden Schilderungen, die klar erkennen lassen, wie tief er das Unglück seines Vaterlandes mitempfand, eine freundliche Aufnahme in weiten Kreisen beschieden sein.
Borken i. W., im November 1906. Heinrich Leifels.
Erster Teil.Bruchstücke aus dem französisch-russischen Feldzuge im Jahre 1812.
Von
Heinrich Leifels.1
1.
Die Rekrutenzeit und der Abmarsch
zum Kriegsschauplatz.
IM Jahre 1810, den 10. Juni, trat ich als Kantonist aufgrund einer unglücklichen Nummer, in das 8. westfälische Linien-Infanterie-Regiment ein, denn alle Bemühungen, als Kavallerist zu dienen, waren vergebens.
Dieses Regiment garnisonierte damals in Hildesheim. Der König Hieronymus, der jüngste Bruder Napoleons, residierte in Hessen-Kassel. Die Aushebung geschah in Hofgeismar. Der General, der die Rekrutierung leitete, hieß v. Hammerstein.
Nach einigen trüben Wochen wurde ich Unteroffizier.
Um diese Zeit war ein sehr reges Leben und Treiben in diesem Regiment, so daß es für Rekruten fast nicht zum aushalten war.
Der Bataillonskommandeur v. Meybaum bemerkte eines Tages meine gänzliche Erschlaffung, und ich gestand sie ihm ein. Dieser verständige Herr aber antwortete, daß er sich und sein Bataillon absichtlich abzuhärten trachte, indem wir bald in einen Krieg kommen würden, wo große Anstrengungen erfordert würden; überhaupt müsse der Soldat nicht allein dahin wirken, daß das Ganze gelinge, sondern auch für sich selbst glänzend zurückkehren, und dann würden wir uns seiner dankbar erinnern.
Ich faßte frischen Mut und übte mich nach seiner Anleitung häufig im Wachen, - das Fasten kam von selbst. Mit Eifer bemühte ich mich, den dienstlichen Anforderungen gerecht zu werden - und diese waren, wie schon erwähnt, wahrlich nicht gering. Bis 12 Uhr nachts war Dienst. Um 5 Uhr morgens wurde zum Exerzieren angetreten und bis 11 Uhr exerziert; von 12 Uhr mittags bis 1 Uhr exerzierten die Offiziere und Unteroffiziere. Von 2 bis 3 Uhr wurde der innere Dienst betrieben, um 3 Uhr wurde angetreten und bis 8 Uhr exerziert; von 9 Uhr abends bis 11½ oder 12 Uhr war theoretischer Unterricht, der stets vom Bataillonskommandeur selbst geleitet wurde.
Es wurde kein Sonn- und Feiertag geachtet, nur wurde dem Dienste ein anderer Name gegeben. Überhaupt war in diesem ganzen Regiment die Maxime angenommen, daß Essen, Trinken und Schlafen ganz Nebensachen seien, die man sich abgewöhnen könne.
Doch nur ein Kapitän namens Zwirnemann schien strenge der Meinung der höheren Vorgesetzten beizupflichten. Die übrigen Offiziere hörte man öfter murren. Auch meldeten sie sich häufig krank.
Nach mehreren Hin- und Hermärschen marschierte das Regiment im März 1811 nach Danzig und wurde dort zum Ausbau der Festungswerke herangezogen.
An einem Sonntagnachmittag im Juni entstand zwischen den 30,000 Mann Besatzungstruppen eine Schlägerei. Zwischen den Polen und Sachsen gärte es schon lange. Diese im geheimen genährte Feindschaft, kam nun plötzlich in heftiger Weise offen zum Ausbruch und artete fast in einen förmlichen Krieg aus. Die unmittelbare Veranlassung hier zu war folgende: Eine polnische Patrouille, welche abgesandt war, für Ruhe zu sorgen, wurde vermutlich von den Sachsen in eine Schlägerei verwickelt und kam verstümmelt in die Kaserne zurück; dies reizte die Polen so, daß sie fast in ganzen Regimentern, mit Knütteln, Kochstangen, Rudern usw. bewaffnet, aus den Kasernen rückten, auf einer Fähre über die Mottlau setzten, wie ein Lavastrom sich durch die Straßen wälzten und alles, was ihnen in den Weg kam, niederschlugen.
Neugierig blieb ich stehen, und da wir damals weiße Röcke wie die Sachsen trugen, mochte ich wohl für einen solchen angesehen sein, was für mich recht unangenehm werden sollte, denn ein Schlag raubte mir alsbald den Tschako; ein zweiter Schlag brach mir den linken Oberarm. Ich rettete mich, während die Bürger die Türen und Läden verriegelten, durch schnellen Lauf zum Arzte. Der Arzt hatte aber kein Verbandszeug, und so mußte ich mit dem zerbrochenen Arm den Ausgang der Schlacht abwarten.
Die zwei Regimenter Polen drangen vom östlichen Ende der Stadt bis zum Hagelsberge vor, wendeten da links in einen anderen Teil der Stadt, alles, was ihnen in den Weg kam, niederschlagend, und wurden von den bei Bürgern einquartierten Truppen mit Dachziegeln und Holz geworfen, wodurch viele verwundet wurden.
Gleich zu Anfang des Ausmarsches der Polen war die Runde dieses Aufruhrs in die bayerischen und württembergischen Kasernen gedrungen. Diese Rheinbündler setzten sich sogleich in Marsch und zogen den Polen entgegen. Am westlichen Ende der Stadt trafen beide Teile zusammen, keiner wollte weichen. Endlich siegten die Deutschen. Die Polen mußten den nämlichen Weg, den sie gekommen waren, wieder zurück. Beim Auszuge der Deutschen hatte sich ein bayerischer Unteroffizier mit etwa 20 Mann auf dem nächsten Wege nach der Fähre begeben, das Seil abgehauen und die Fähre vom Ufer gestoßen. Die Polen, von hinten gedrängt, stürzten fast alle ins Wasser und viele ertranken, nur diejenigen, die schwimmen konnten, wurden gerettet.
Inzwischen waren alle Offiziere auf den Schauplatz gekommen, wo viele von ihnen verwundet wurden. Es gelang ihnen jedoch nicht so bald, des Aufruhrs Herr zu werden. Schließlich trennte nur das Wasser die Wütenden.
Es wurde Nacht. Jetzt erst wurde ich zum Lazarett Schwartzmenschen gebracht und verbunden. Nach und nach wurden 700 Mann Verwundete in diesem Gebäude aufgenommen. Ich kam zwischen zwei Polen, Federowsky und Bernadowsky, zu liegen; beide starben an ihren Wunden. In anderen Hospitälern sollen noch mehr Verwundete aufgenommen sein. Der größte Teil der Verwundeten waren Polen. Am folgenden Morgen wurden einige Haupträdelsführer erschossen.
Im März 1812 marschierte das Regiment nach Marienburg, wo ungefähr acht Tage lang auf dem Schlosse die Distribution empfangen wurde. Von da wurden wir auf die Insel Neutiw, zwischen Danzig und Pillau, befördert, wo wir in Zelten, welche anderen Truppen (Preußen) gehörten, ungefähr 14 Tage den größten Hunger und Durst litten. Hier konnten wir merkwürdige Beobachtungen machen. So wurde z. B. häufig bei starkem Winde Bernstein ausgeworfen, öfter bis ins Zelt; er wurde zum Räuchern (größere Stücke als Licht) benutzt, einige auch verkauft.
Bei einer Überfahrt, um Lebensmittel aus Pillau zu holen, entstand ein Orkan, eine Barke wurde auf eine Untiefe geworfen, alle Insassen kamen aber mit der Angst davon.
Von hier marschierte das Regiment nach Königsberg, wo wir einschließlich mehrerer Hin- und Hermärsche ungefähr sechs Wochen blieben. Hier mußte jeder französische Soldat - also auch wir - sechs Pfund Mehl, sechs Pfund Reis, einen Beutel mit Salz, drei Paar neue Schuhe, ein Paar halbe Sohlen, Schuhnägel usw. aufnehmen und die Einwohner ihre Kriegsfuhren auf acht Tage verproviantieren.
2.
Der Beginn des Krieges.
NACHDEM unsere Verproviantierung in vorstehend angegebener Weise erfolgt war, ging der Marsch von Königsberg aus auf Kowno. Hier drängte sich eine gewaltige Truppenmasse zusammen und passierte den Njemenfluß.
In Eilmärschen wurde Wilna erreicht; von da gingʼs nach Witebsk und nach Smolensk. Hier hatten wir am 17. August unter Napoleons Oberbefehl eine harte, aber siegreiche Schlacht zu bestehen. Unser Regiment stand jetzt mit den Polen unter dem Befehl des Generals Poniatowski.
Mehrere Stunden standen wir vor einer Redoute unbeweglich im Kugelregen, fast den ganzen Tag vor Schanzen. Im Anfange schon zeigte man mir ein Loch durch meinen Tschako und machte mich auf andere im gerollten Mantel aufmerksam, von deren Vorhandensein ich mich später überzeugte.
Die Nacht machte wohl der blutigen Schlacht ein Ende, - aber nicht dem Elende. Da, wo man gerade stand, wurde von den brennbaren Trümmern, die man auf dem Schlachtfelde fand, Feuer angemacht. Wir waren ohne Wasser und ohne Lebensmittel; man plünderte deshalb die Tornister der Gefallenen, um Lebensmittel zu finden, denn alles andere hatte schon jetzt keinen Wert mehr. Aber bald stellten sich noch andere Übel ein. Eine Menge Leute, die gestern noch gesund waren, kamen von irgendeinem Kommando, wenn auch nur vom Herbeiholen der Biwaksbedürfnisse, zurück und zeigten abgeschossene Zeigefinger vor! Diese Selbstverstümmelung kam so häufig vor, daß der Befehl gegeben wurde, daß allen, denen der Zeigefinger abgeschossen sei, die Faust abgenommen werden solle, welches auch an mehreren sogleich geschah.
Die Offiziere und Unteroffiziere waren so entkräftet, daß fast gar kein Kommando mehr gegeben wurde. Korporalschaftsweise teilten sich die Leute von selbst ohne weiteres in die unvermeidliche Lagerarbeit, und kaum war der Ort des Lagers bezeichnet, so sah man die Metzger mit ihren Gewehren, Beilen und Stricken die Richtung zum Walde nehmen und diejenigen Leute, die Lebensmittel, Holz. Futter usw. holen sollten, zu den Dörfern gehen, von wo sie dann erst in der Nacht zurückkamen und unser Los entschieden, - ob wir hungern oder essen sollten.





























