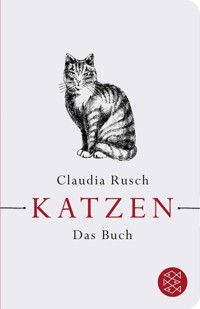9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was passiert, wenn man in dem festen Glauben aufwächst, Kakerlaken seien Stasi-Spitzel? Und wie fühlt man sich, wenn man als Kind mit einem »Schwerter-zu-Pflugscharen«-Aufnäher in die Schule gehen muss? Claudia Rusch, die im Umfeld der DDR-Bürgerrechtsbewegung aufwuchs, erzählt in ihren Erinnerungsgeschichten pointiert und mit Herz und Humor, wie sie unter kaum glücklich zu nennenden Umständen eine glückliche Kindheit verlebte, auch wenn die bitteren Erfahrungen nicht ausblieben: Der Großvater starb in Stasi-Untersuchungshaft, die Familie lebte unter andauernder Beschattung, eine enge Freundin der Mutter entpuppte sich als IM »Buche«. Doch was übrigbleibt, sind überwiegend schöne Erinnerungen an eine fast normale Kindheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Claudia Rusch
Meine freie deutsche Jugend
Mit einer Nachbemerkung von Wolfgang Hilbig
Über dieses Buch
Was passiert, wenn man in dem festen Glauben aufwächst, Kakerlaken seien Stasi-Spitzel? Und wie fühlt man sich, wenn man als Kind mit einem »Schwerter-zu-Pflugscharen«-Aufnäher in die Schule gehen muss?
Claudia Rusch, die im Umfeld der DDR-Bürgerrechtsbewegung aufwuchs, erzählt in ihren Erinnerungsgeschichten pointiert und mit Herz und Humor, wie sie unter kaum glücklich zu nennenden Umständen eine glückliche Kindheit verlebte, auch wenn die bitteren Erfahrungen nicht ausblieben: Der Großvater starb in Stasi-Untersuchungshaft, die Familie lebte unter andauernder Beschattung, eine enge Freundin der Mutter entpuppte sich als IM »Buche«. Doch was übrigbleibt, sind überwiegend schöne Erinnerungen an eine fast normale Kindheit.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2003 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr.114, D-60596 Frankfurt
Covergestaltung: Nicole Lange, Darmstadt
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491260-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Die Schwedenfähre
Die Stasi hinter der Küchenspüle
Die Hauptabteilung VIII im Märchenwald
Honeckers kandierter Apfel
Die Meissner Porzellantasse
Peggy und der Schatten von Ernst Thälmann
Gleiche unter Gleichungen
Die Jugendweihe
Prager Frühling
Die Direktorin
Die Feinschmecker vom Prenzlauer Berg
Die Strickjacke
Mauer mit Banane
Der Stempel
Ein Zimmer voller Raider
Die neue Wohnung
Die Rede
FKK am Mittelmeer
Der Verdacht
Der Bücherschatz
Die Musik meines Vaters
Der Freispruch
Darauf einen Becherovka
Fremdes Leid trägt sich leicht
Der Stadtplanfluch
Claudia Ruschs »Meine freie feutsche Jugend«
Für meine Familie und natürlich für Antonia
Die Schwedenfähre
Ich bin an der Ostsee groß geworden. Wie meine Mutter, mein Großvater, dessen Eltern genau wie ihre, deren Eltern wieder und so weiter. Seit 500 Jahren waren meine Vorfahren Kapitäne und Kapitänsfrauen. Eine ganze Dynastie mit einem alten Familiennamen und einem festen Heimatort, wie sich das gehört: die Bradherings aus Wustrow auf dem Fischland. Meine Mutter kann von Glück sagen, dass sie ein Mädchen geworden ist. Einen Stammhalter hätten meine Großeltern allen Ernstes Sylvester getauft. Sylvester Bradhering vom Fischland. Das klingt wie ein Menüvorschlag.
Mein leiblicher Vater war nicht der Traum meiner Mutter, doch er passte ganz gut ins Familienkonzept. Nur ein Marineoffizier zwar, noch dazu ein sächsischer, aber ein Kapitän.
Er war an der nordwestlichsten Spitze Rügens stationiert. Links von uns war Hiddensee und irgendwo hinter dem Meer lag das Königreich Schweden. Ich wusste damals nichts von Karl Gustav und Silvia Sommerlath, aber Schweden war für mich ein Märchenland. Ein verwunschener Platz. Ein Ort, an den wir nicht durften, wo die Männer groß und stark wie Bären waren, die Frauen aussahen wie Agneta von ABBA und alle mit bunten Bändern um Maibäume tanzten. So stellte ich mir das vor. Ein fröhliches Land, voller blonder Menschen.
Von Saßnitz an der Ostseite der Insel fuhr zweimal täglich ein Schiff nach Trelleborg. Die Schwedenfähre. Man sah sie immer auf dem Meer hin- und herfahren, ganz langsam, beharrlich am Horizont entlang, scheinbar parallel zum Ufer. Und jeden Sommer saß meine Mutter mit mir am Strand und schaute auf das weiße Schiff in der Ferne.
Eine meiner frühesten Erinnerungen beschwört genau dieses Bild. Wir sind allein am menschenleeren Strand von Bakenberg, hinter uns die Steilküste mit Uferschwalben. Ich trage eine von diesen weißen Kindermützen, sitze auf dem Schoß meiner nackten Mutter und mache Winke-Winke zu dem großen Schiff. Meine Mutter küsst mich und flüstert mir ins Ohr, ich verspreche dir, eines Tages werden wir mit dieser Fähre fahren, du und ich, auf die andere Seite der Ostsee. Ganz sicher.
Die Jahre vergingen, meine Eltern trennten sich, wir zogen nach Berlin. Aber jedes Mal, wenn wir die Schwedenfähre wiedersahen, hielt meine Mutter ihre Hand über die Augen, schaute hinaus auf das Meer und seufzte leise. Eines Tages fahren wir mit dieser Fähre.
Wir fuhren aber nicht.
Später phantasierte ich oft, wo man sich im Malmö-Express, der nach Trelleborg mitfuhr, verstecken konnte oder wie man sonst noch unbemerkt nach Schweden kam. Es schien mir vollkommen abwegig, dass das nicht möglich sein sollte. Es gab doch keinen Stacheldraht oder patrouillierende Soldaten wie in Berlin. Das hier war das Meer. Irgendwie musste es doch machbar sein, an das andere Ende zu gelangen …
Ich wusste damals nicht, wie viele Menschen bei Fluchtversuchen über die Ostsee umgekommen waren, dass skandinavische Fischer über Jahre hinweg immer wieder Leichen in ihren Netzen fanden und dass mein geliebtes Meer von der DDR zur mörderischen Falle umfunktioniert wurde. Ich bin nicht sicher, ob ich je wieder in der See gebadet hätte, wäre es mir bewusst gewesen.
Meine Großmutter lebte in Stralsund. Wie meine Mutter hatte auch sie ihren Kapitän und das Fischland verlassen. Sooft sie konnte, fuhr sie nach Hiddensee: EVP 2,50 M bis Neuendorf, 3,00 M bis Vitte und 3,50 M bis Kloster. Natürlich kannte meine Großmutter alle Damen im Fahrscheinschalterhäuschen am Stralsunder Hafen und natürlich hatten die wieder gute Verbindungen zu den Fahrscheinschalterdamen in Saßnitz. Und so kam es, dass meine Oma, eine Flasche Ost-Cognac in der Tasche, am Morgen des 10. November 1989 an den Stralsunder Hafen ging und die Damen um einen Gefallen bat. Sie wollte Fahrkarten für das Schiff von Saßnitz nach Trelleborg, Hin- und Rückfahrt am 24. Dezember 1989. Es war ihr Weihnachtsgeschenk. Einmal mit der Schwedenfähre fahren. Auf die andere Seite der Ostsee.
Die Fähre hatte an diesem Weihnachtstag fast eine Stunde Verspätung, und es gab keine Zeit mehr für einen Aufenthalt in Trelleborg. Wir gingen trotzdem von Bord. 10 Minuten Schweden. Ein hässlicher anonymer Hafen, Industrieanlagen, alles grau vom Regen – aber Schweden. Endlich. Wir hatten es geschafft.
Mehr vom Land sah ich erst fünf Jahre später. Ich hatte ein Jahr in Italien studiert und mich mit lauter Skandinaviern angefreundet. Sie hatten Bologna alle schon Anfang April verlassen, weil es ihnen zu heiß wurde in der Po-Ebene. Ich hielt tapfer bis Mai durch, meine Freundin Charlotte blieb sogar bis Ende Juni. Einige unserer schwedischen Kommilitonen luden uns dann für August nach Gotland ein. Schweden gefiel mir sehr. Die Menschen waren nett, die Häuser wunderschön und alle hätten im IKEA-Katalog auftreten können. Überall gab es Lachs und Wodka. Ein polares Paradies.
Wir fuhren mit dem Malmö-Express erst nach Saßnitz, checkten dann auf dem Schiff ein und setzten über nach Schweden. Alles verlief normal. Den Malmö-Express hatte ich immer nehmen müssen, um meine Großmutter zu besuchen. Das hatte einen einfachen Grund. Seit ich 6 Jahre alt war, fuhr ich meistens allein von Berlin hoch zu Oma. Da der Malmö-Express nur dreimal hielt, bevor er in Stralsund ankam, reduzierte sich die Eventualität enorm, dass ich den Bahnhof verwechselte, Irre zustiegen oder ich aus dem Abteil fiel. Also saß ich jahraus, jahrein immer wieder in diesem einen selben Zug. Ich fand es aufregend, weil ich wusste, dass er in Saßnitz auf die Schwedenfähre verladen wurde und dann von Trelleborg einfach weiterfuhr. Außerdem hatte mein Zug einen richtigen Namen: MALMÖ-EXPRESS. Das klang nach großer weiter Welt. – Ich musste immer am Rügendammbahnhof in Stralsund aussteigen. Zurückbleiben, die Türen schließen und Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges.
Dieses Mal blieb ich mit Charlotte sitzen und fuhr bis Malmö durch. Ich konnte eine gewisse Befriedigung nicht leugnen. Es hatte etwas von Ätsch – ich fahre doch damit!
Als ich dann 1996 zum dritten Mal die Schwedenfähre nahm, holte mich meine Kindheit ein. Ich wollte zur Sommersonnenwende nach Nordschweden. Es war der 19. Juni, und sowohl mein Ausweis als auch der Europa-Pass liefen an diesem Tag ab. Ich hatte das erst unmittelbar vor dem Aufbruch entdeckt. Keine Zeit für deutsche Behörden mehr, also blieb mir nichts anderes übrig, als zu pokern. Der Malmö-Express kam gegen zwei Uhr nachts am Hafen von Saßnitz an. Entweder ich hatte Glück und es kam niemand mehr, oder ich stellte mich schlafend und würde vielleicht so übersehen. Zur Not konnte ich noch auf kleines Mädchen machen. Kulleraugen, Zuckerschnute, verwirrt stottern. Zieht immer. Auch Zöllner haben ein Herz.
Ganz sicher war ich aber nicht, ob das funktionieren würde, denn immerhin ist ein ungültiges Personaldokument kein fehlender Parkschein. Dachte ich.
Wir kamen in Saßnitz an, der Zug wurde zuckelnd in den Schiffsbauch verfrachtet, und die Grenzer ließen sich Zeit. Schließlich kam doch noch jemand, erwischte mich wach und verlangte meinen Ausweis. Ich zeigte ihn vor und versuchte geschickt mit dem Daumen das Datum zu verdecken. Keine Chance. Der Zöllner brauchte genau eine Zehntelsekunde, um mit sicherem Blick das Problem zu erfassen.
»Ihr Ausweis ist vor zwei Stunden abgelaufen, junge Frau.«
Okay, Augen auf und durch: »Heißt das, ich darf nicht nach Schweden?«
Ohne zu antworten, bat er mich ihm zu folgen. Ich sah mich schon in Handschellen, verhaftet wegen Irreführung der Behörden oder illegalen Einreiseversuchs …
Und dann geschah es. Er führte mich ins Nachbarabteil, zog eine Sofortbildkamera aus einem Schubfach und fragte mich, ob ich zehn Mark passend hätte. Dann machte er ein Foto von mir und stellte mir einen neuen Ausweis aus.
Einfach so.
Ich fasste es nicht. Meine ganze Kindheit über war diese Grenze, weit mehr als die Berliner Mauer, mein persönlicher Eiserner Vorhang gewesen. Unüberwindlich. Eisig. Ein tiefer, dunkler Wassergraben. Eine Wand aus tosenden Wellen. Ein Ort, an dem ich jeden Tag sah, wo meine Welt zu Ende war. Und jetzt hatte ich nicht mal einen gültigen Ausweis und durfte passieren. Zwei Minuten, und das Tor nach Schweden öffnet sich. Ich war so baff, dass ich die ganze Unschulds-Nummer vergaß und mich stockend bedankte.
Als das Schiff den Hafen verließ, ging ich an Deck. Ich sah auf Saßnitz und mir kamen die Tränen.
Das war keine Rührung, das war Wut. So banal war das also. Alltäglich, nichts sagend. Einfach nur die Grenze nach Schweden. Bitte treten Sie durch, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie einfach weiter.
Ich konnte nicht weitergehen. Mir lief der Rotz aus der Nase, und ich dachte an die Ohnmacht, die dieses weiße Schiff in mir immer wieder ausgelöst hatte. An das Gefühl, ausgeschlossen von der Welt, im Osten inhaftiert und vergessen zu sein.
In diesem Moment begriff ich, dass ich mit der Schwedenfähre meinen Frieden machen musste. Ich stand nicht mehr hilflos am Strand der Ostsee, sie bestimmten nicht mehr mein Leben, und niemand würde jemals wieder ungerechtfertigt solche Macht über mich besitzen. Es ging nicht um Schweden oder um diese Fähre; es ging um die Freiheit am Horizont. In der Nacht des 20. Juni 1996 um zwei Uhr morgens war ich dort angekommen.
Ich stand an der Reling und sah die Lichter von Saßnitz in der Nacht verschwinden.
Die Stasi hinter der Küchenspüle
Nach der Trennung meiner Eltern zogen wir von der Ostsee ins Berliner Umland, zu Katja und Robert Havemann, den engsten Freunden meiner Mutter. Sie waren der eigentliche Scheidungsgrund. Jedenfalls glaubte das mein leiblicher Vater, der als Marine-Offizier bei der NVA diente. Meine Mutter zeigte ihm einen Vogel, nahm ein paar Regale und mein Spielzeug mit. Alles andere ließ sie ihm.
So kamen wir am 21. September 1976, meinem fünften Geburtstag, nach Grünheide in der Mark.
Zwei Monate später wurde Wolf Biermann ausgebürgert, über Robert Havemann wurde ein Hausarrest verhängt und mein Leben änderte sich.
Plötzlich war überall die Stasi, Männer in Uniformen oder in Zivil. Sie saßen in Ladas vor dem Haus, beobachteten uns, folgten uns, durften aber nicht mit uns reden. Manchmal versteckten sie sich wie Hasen hinter Bäumen.
Ich begriff nicht, warum Robert andauernd im Fernsehen zu sehen war und jetzt nicht mehr aus dem Haus durfte, warum Polizei die Straße verbarrikadierte und meine Mutter mich nicht mehr zu Katja ließ. Aber ich gewöhnte mich schnell daran. Ich weiß noch, dass ich die Präsenz der Stasi damals nicht wirklich bedrohlich fand. Für mich waren die ewig wartenden Männer beruhigend. Sie passten auf mich auf. Ganz im Sinne der Stasi-Ballade: Leibwächter.
Im Hause Havemann sprach man nicht von Stasi, sondern von Kakerlaken, wenn die Posten vor dem Haus oder in den Autos gemeint waren.
Und weil das so war, wurde ich groß, ohne zu ahnen, was Kakerlaken wirklich sind. Natürlich wusste ich, dass es Küchenschaben gibt, aber ich hatte keinen Schimmer, dass man sie Kakerlaken nennt. Irgendwie war das an mir komplett vorbeigegangen. Ich dachte, Kakerlaken sei der gängige Begriff für das Fußvolk der Stasi. Ich dachte, die heißen so. Klingt ja auch ein bisschen russisch …
Später zogen wir nach Berlin, ich bekam einen neuen Vater, der mir viel besser gefiel als der alte, und mit der Großstadt kehrte eine gewisse Normalität in mein Leben ein.
Ich war ungefähr 16, als ich einen Bekannten besuchte, der gerade in ein Studentenwohnheim am Ostbahnhof gezogen war. Ich fand das sehr schick und erwachsen. Hey, ein Studentenwohnheim, cool.
Sein Zimmer lag in einem der oberen Stockwerke des Hochhauses und hatte einen hervorragendem Blick über Ostberlin. Es gab eine sehr kleine schlauchartige Küche und ein großes Zimmer mit zwei Doppelstockbetten. Ich war begeistert. So also sah das Leben nach der Schule aus. Vierbettzimmer mit Küchenzeile. Super.
Ich ahnte schon, dass mein eigenes Leben nicht so sein würde, aber ich dachte nicht gerne daran. Außerdem gab ich die Hoffnung nicht auf. Vielleicht würde aus mir mit der Zeit ja doch noch ein anständiger DDR-Bürger. Eben Abitur, Studentenwohnheim, Schrankwand. So wie hier.
Ich lobte sein Zimmer. Ja, antwortete er, es sei toll, nur die vielen Kakerlaken würden stören.
Wie – die vielen Kakerlaken? Ich fiel aus allen Wolken. »Hier im Studentenwohnheim?« Ich war ehrlich erstaunt. Ich wusste natürlich, dass die Stasi auch hier war, mir war allerdings nicht bewusst, dass sie sich so offen in den Gängen des Wohnheims bewegte.
»Ja, natürlich, alles voll. Auch hier im Zimmer.«
»Was?« Meine Stimme wurde merklich schriller. Ich sah niemanden außer uns im Raum. »Wo denn?«
Jetzt schaute er mich irritiert an: »Wo? Na, hinter der Küchenspüle!«
Ich fing vor Verwirrung fast an zu quietschen: »Hinter der Küchenspüle? Du hast Kakerlaken hinter der Küchenspüle? Um Gottes willen, wie viele denn?«
Er sah mich an, als ob ich einen Dachschaden hätte: »Was ist denn das für eine Frage. Keine Ahnung, 200 vielleicht …«
Es war vorbei mit meiner Fassung. Außer mir, kreischte ich los: »Du hast 200 Kakerlaken hinter der Küchenspüle?!?« Und ich sah es schlagartig vor mir: die Miniküche, in die nicht mal ein Tisch passte, die Spüle gegenüber der Zimmertür, in Höhe der Armaturen ein riesiges Loch im Gemäuer, dahinter ein Raum, in dem 200 Männer standen, eng aneinander gedrängt, wie in einem überfüllten Bus, und alle schauten unbeweglich durch das Loch über dem Wasserhahn … Noch während dieses Bild in meinem Kopf aufblitzte, wurde mir klar, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Nie im Leben war so ein vermufftes Studentenwohnheim so wichtig, dass sich zwei Hundertschaften Stasimänner dafür in einen winzigen Raum hinter einer Küchenwand pferchen ließen. Nicht mal für Frieden und Sozialismus. Ich war hier die Verrückte.
»Was sind Kakerlaken?«, fragte ich betont unschuldig meinen Bekannten.
Jetzt war er es, der fast die Beherrschung verlor: »Küchenschaben. Was ist eigentlich los mit dir?«
»Nichts. – Wirklich schönes Zimmer. Wie viel Miete kostet so was?«
Damit war das Thema für mich beendet. Er muss gedacht haben, ich hatte einen kurzen Anfall von Wahnsinn. Ich habe ihn in diesem Glauben gelassen.
Die Hauptabteilung VIII im Märchenwald
Meine Großmutter besuchte uns regelmäßig in Grünheide. Sie nahm von Stralsund den D-Zug bis zum Ostbahnhof, stieg dann in die S-Bahn und fuhr bis Erkner durch. Dort stellte sie sich an die zugige Haltestelle und wartete auf den Landbus. Zwei Dörfer weiter war sie am Ziel. Der Bus hielt am Rand der Waldsiedlung, in der wir lebten.
Sie war nur einseitig bebaut. Alle Häuser reihten sich wie aufgefädelt aneinander. Gegenüber standen dichte Kiefern. Nach 200 Metern machte der Weg einen Knick. Dort wohnten wir. In einem Gesindehaus mit Strohdach am Ufer eines winzigen Sees. Er gehörte zu einem noch winzigeren Schloss, welches gleich nebenan hinter einem großen Tor lag und von einem richtigen Park umgeben war. Unsere Straße war nie befestigt worden. Als würden noch des Grafen Rosse hier tänzeln, nur märkischer Sand. Der Weg war durch Wind und Regen so verwaschen, dass er für moderne Fortbewegungsmittel eigentlich immer unbenutzbar blieb. Fahrrad fahren war lebensgefährlich, Autos tuckerten sicherheitshalber in Schrittgeschwindigkeit. Genau richtig für Katzen und kleine Kinder.
Jedenfalls solange die Sonne schien. Nachts wurde die Siedlung zum Gespensterwald. Überall waren unheimliche Geräusche. Es gab Wildschweine, Eulen und bestimmt Wölfe. Ganz zu schweigen von dem meterlangen Krokodil in unserem Kleiderschrank. Ich hatte Panikattacken, wenn ich im Dunkeln allein blieb.
Deswegen verstand meine Mutter auch nicht, was mich dazu brachte, eines Winterabends hartnäckig darauf zu bestehen, meine Großmutter ganz allein vom Bus abzuholen.