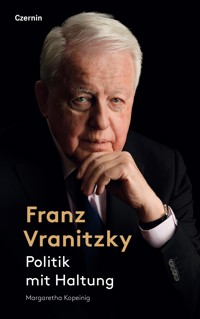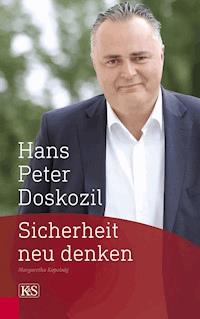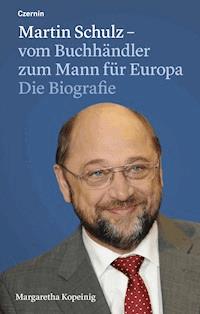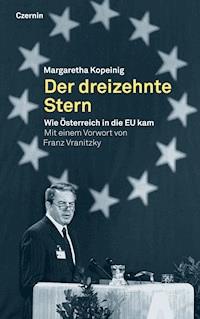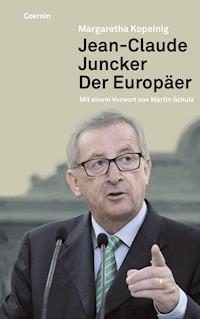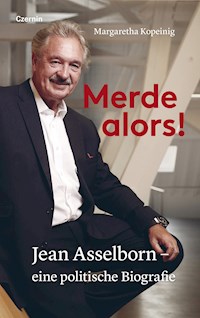
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der luxemburgische Sozialdemokrat Jean Asselborn ist der dienstälteste Außenminister der Europäischen Union. Durch seine klare und humanistische Haltung, seine pointierte Sprache und seinen Sinn für Humor ist er nicht nur unter Kollegen und Medienvertretern äußerst beliebt. Doch wie kommt er zu seinem positiven Image und wie agiert er angesichts all der Höhen und Tiefen der EU? Die Biografie zeichnet ein lebendiges Bild von Asselborn und seiner politischen Karriere: von den Anfängen als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Steinfort über den Parteivorsitz der luxemburgischen Sozialdemokratie bis hin zum Minister für auswärtige Angelegenheiten. Die renommierte Journalistin Margaretha Kopeinig stellt den charismatischen und engagierten Politiker lebhaft dar und zeigt, wie notwendig klare Positionen und konsequente Haltungen in turbulenten Zeiten sind. "Jean Asselborn ist eine Stimme für Frieden, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit – sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene." Ban Ki-moon, aus dem Vorwort
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Margaretha Kopeinig
MERDE ALORS!
JEAN ASSELBORN – EINE POLITISCHE BIOGRAFIE
Mit einem Vorwort von Ban Ki-moon
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur
Kopeinig, Margaretha: Merde alors! Jean Asselborn – eine politische Biografie/Margaretha Kopeinig
Wien: Czernin Verlag 2020
ISBN: 978-3-7076-0711-6
© 2020 Czernin Verlags GmbH, Wien
Coverfoto: Luxemburger Wort, Guy Wolff
Autorinnenfoto: Jeff Mangione
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
Lektorat: Karin Raschhofer-Hauer
ISBN Print: 978-3-7076-0711-6
ISBN E-Book: 978-3-7076-0712-3
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
INHALT
Vorwort des ehemaligen UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon
Einleitung
1.Umringt von Europas Historie. Jean Asselborns Arbeitsplatz
2.Was Disziplin und Ehrgeiz bewirken. Vom Arbeiter zum dienstältesten Außenminister der EU
3.Beginn einer langen politischen Karriere 1982. Jean Asselborn wird Bürgermeister seiner Geburtsstadt Steinfort
4.Aller Anfang ist schwer. Übernahme des Außenministeriums 2004
5.Schwierige Jahre ab 2015: Flüchtlingskrise, Brexit und internationale Herausforderungen
6.Die Angst im Jahr 2020, dass sich die Flüchtlingskrise von 2015 wiederholt
7.Das Coronavirus als Stresstest für die EU. Nationalismus gegen Gemeinschaft
8.»Merde alors!« Jean Asselborn platzt der Kragen beim informellen EU-Treffen in Wien
9.Theater gegen rechts: »Alles kann passieren!«
10.Politik und Radsport: Eine unteilbare Leidenschaft
11.Was Jean Asselborn wichtig ist
12.Wie geht es weiter? Ist die EU ein weltpolitischer Akteur?
13.Heinz Fischer im Interview über die Politik Jean Asselborns
14.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über Jean Asselborn
Chronologischer Lebenslauf
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Danksagung
Über die Autorin
VORWORT
Jean Asselborn ist seit Juli 2004 luxemburgischer Außenminister. Meines Wissens ist er heute der am längsten amtierende Außenminister der Europäischen Union – und selbst weltweit wird es nicht mehr viele Außenminister geben, die länger im Amt sind als er. Ich war von Januar 2004 bis November 2006 Außenminister der Republik Korea, wir haben also einige Zeit in der gleichen Funktion für unsere jeweiligen Länder gedient.
Ich erinnere mich an ein Treffen mit Außenminister Asselborn, als Luxemburg in der ersten Hälfte des Jahres 2005 die Präsidentschaft der Europäischen Union innehatte. Er war ein leidenschaftlicher europäischer Bürger und ein Weltbürger, und beides ist er heute noch. Während meiner Kampagne für den Posten des UN-Generalsekretärs war er so freundlich, mich vielen europäischen Außenministern vorzustellen. Für seine starke Unterstützung bin ich ihm immer noch dankbar.
In meiner Zeit als Generalsekretär der Vereinten Nationen in den Jahren 2007 bis 2016 hatte ich ebenfalls gute Beziehungen zum luxemburgischen Außenminister – persönlich und auch telefonisch. 2012 war Luxemburg Kandidat für einen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für die Jahre 2013 und 2014. Jean Asselborn startete eine weltweite, intensive Kampagne dafür. Am Ende hat sie sich als erfolgreich erwiesen: Luxemburg war zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen zum Mitglied des Sicherheitsrates gewählt worden. Das war gut für Luxemburg und für die Vereinten Nationen. Am Ende dieser zwei Jahre teilte mir Asselborn mit, dass er während der gesamten Periode an 17 Sitzungen des Sicherheitsrates teilgenommen hatte. Die Stimme Luxemburgs war immer eine Stimme für Frieden, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit – sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.
Seit Dezember 2013 ist Jean Asselborn neben seiner Funktion als Außenminister auch Minister für Migration und Asyl. Soweit ich informiert bin, war und ist er in diesem Bereich sehr engagiert, und seine Arbeit gewann seit Beginn der Migrationskrise im Jahr 2015 noch mehr an Bedeutung. Gleichzeitig wurde diese Arbeit aber auch immer schwieriger.
Kürzlich hat er den »Globalen Pakt der Vereinten Nationen für sichere, geordnete und reguläre Migration« (GCM), der 2018 von der Generalversammlung verabschiedet wurde, nachdrücklich unterstützt. Ich schätze es sehr, dass er die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung fördert. Natürlich freue ich mich, dass er auch die Arbeit des Ban-Ki-moon-Zentrums für Weltbürger in Wien unterstützt.
Jean Asselborn, der im April 2019 seinen 70. Geburtstag feierte, ist meines Wissens ein enger Freund des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und des ehemaligen österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer (2004–2016). Beide kommen in diesem Buch zu Wort.
Ich begrüße diese Publikation, weil sie viele Informationen über die europäische und internationale Politik enthält. Das Buch vermittelt auch Einblicke in eine Person, die viel zur Entwicklung der europäischen Zusammenarbeit, zur Entwicklung der Vereinten Nationen und zum Erfolg der Ziele für nachhaltige Entwicklung beigetragen hat.
Seoul, Dezember 2019
Ban Ki-moon
EINLEITUNG
Dieses Buch erzählt von Jean Asselborn, dem dienstältesten Außenminister der Europäischen Union seit 2004. Doch Amtsjahre allein machen die Bedeutung des luxemburgischen Sozialdemokraten nicht aus. Es sind das wohl sein Ansehen, seine zentrale Rolle im Kreis der 27 EU-Außenminister, seine klare Haltung zu verschiedenen politischen Themen, zu aktuellen Fragen und nicht zuletzt sein Sinn für Humor. Das macht ihn beliebt, nicht nur unter Kollegen in Europa und außerhalb, sondern auch unter zahlreichen Medienvertretern. In seinem Heimatland Luxemburg liegt er seit Jahren bei Umfragen zu Kompetenz, Sympathie und Bekanntheit mit rund 85 Prozent Zustimmung unangefochten auf Platz eins.1 Je älter Jean Asselborn wird, je länger er in der Politik ist, desto überzeugender scheint er auf Menschen zu wirken.
Viele fragen sich: Was macht nun dieses Image aus? Das vorliegende Buch versucht Antworten zu geben. Vollständig wird das nie gelingen. Jean Asselborn hat viele Facetten und Eigenschaften.
Freund und Feind bestätigen seine pointierte Sprache, seine Offenheit und seine Bereitschaft, unangenehme Dinge beim Namen zu nennen. Er ist ein mitreißender Charismatiker. Wer eine Podiumsdiskussion besucht, bei der Asselborn auf der Bühne sitzt, kann sicher sein, dass er sich nicht langweilen wird. Wer seine Statements vor EU-Ministerräten hört, wird kurz und knapp informiert und weiß über die Konfliktlinien und die Stimmungslage der EU-Außenminister Bescheid. Der Luxemburger argumentiert schnell, manchmal auch konfrontativ. Er kennt sich in der Europapolitik aus und spart sperrige Begriffe aus.
Was Jean Asselborn in der Öffentlichkeit so sympathisch und bei seinen Gesprächspartnern so beliebt macht, ist seine Liebe zu den Menschen. Er engagiert sich seit jeher für jene Gruppen, die keine Lobby haben. Er setzt sich für Flüchtlinge, Arme, sozial Schwache und Benachteiligte sowie Opfer autoritärer Regime ein. So sagt er in einem unserer Gespräche, dass sein »größter Erfolg« als Außenminister die Befreiung eines Vaters von vier Kindern aus dem Kerker war. Der Mann, tunesischer Nationalität, lebte mit seiner Familie in Luxemburg und wurde bei einem Besuch in seiner Heimat festgenommen und eingesperrt. Er saß ein Jahr in den Verliesen von Diktator Ben Ali und wurde gefoltert. Die persönliche Beziehung von Jean Asselborn zu seinem damaligen tunesischen Amtskollegen hat geholfen, diesen Mann zu befreien. »Er und seine Frau und Kinder schreiben mir seither jedes Jahr«, freut sich Asselborn. »In all den Jahren als Außenminister war dies eine humanitäre Aktion, die mir viel Motivation gab, mich mit Energie für die Menschenrechte und den Rechtsstaat einzusetzen.« Mit diesem Satz ist wohl alles gesagt, was Jean Asselborn ein Herzensanliegen ist: die Wahrung der Menschenrechte, der Kampf für Demokratie und für den Rechtsstaat. Diese Haltung stellt er einmal mehr im Frühjahr 2020 unter Beweis, als er nach langem Streit mit EU-Partnern und zähen Verhandlungen zwölf Minderjährige aus völlig überfüllten griechischen Flüchtlingslagern nach Luxemburg holt. Er erklärt die Rettung der Flüchtlinge zu einer Frage der Menschlichkeit. »Bei diesem Thema entscheidet sich, ob sich die Europäische Union noch in den Spiegel schauen kann.«
Asselborn ist einer, der nahbar ist. Trotz seiner Macht kommuniziert er mit allen auf Augenhöhe. Er setzt aber diese Macht dort ein, wo er Politik gestalten und Verhältnisse verändern kann. Unter Diplomatie versteht er, präsent zu sein und auf der ganzen Welt möglichst viele Amtskollegen und Entscheidungsträger persönlich zu besuchen und kennenzulernen. Ein internationales Netzwerk von Freunden ist sein Kapital.
Wenn er quer über den Globus unterwegs ist, dann ist der Außenminister in seinem Element: Allein im Jahr 2017 legte er 305.260 Kilometer auf seinen Reisen zurück, zu Lande und in der Luft. Im Vergleich dazu: Die Distanz zum Mond beträgt 384.400 Kilometer. Insgesamt absolvierte er in dem genannten Jahr 92 offizielle Missionen und besuchte 31 Länder. Als Außenminister war er 250 Tage auf Dienstreise.2 Jean Asselborn erklärt diese Auslandstermine mit einer »politischen Notwendigkeit«, denn Luxemburg ist nach Malta das zweitkleinste Land in der EU. »Es ist die Gelegenheit zu zeigen, dass Luxemburg bereit ist, Verantwortung in Europa und in der Welt zu übernehmen, dass wir ein glaubwürdiger und engagierter Partner sind. Das entspricht unserer Haltung und unseren Interessen«, sagt Jean Asselborn in seiner ersten außenpolitischen Erklärung vor dem Parlament3 im Jahr 2005. Und das gilt auch heute noch.
Neben dem Auftrag, im Interesse Luxemburgs und der Europäischen Union tätig zu sein, geht es Jean Asselborn bei seinen Reise-Aktivitäten auch darum, Anteil an den Problemen und Sorgen der Bevölkerung jenes Landes zu nehmen, das er gerade besucht. Er ist nicht der klassische Typ eines Außenministers, der gerne repräsentiert und punktgenau das Protokoll verfolgt, er ist schon eher persönlicher Botschafter und Menschen-Versteher. Er ist einer, dem alles nahegeht. Jean Asselborn ist in seiner Klasse als Außenminister gleichzeitig auch ein politischer Aktivist und Humanist.
So wie er von »persönlichen Erfolgen« spricht, ist er auch imstande und bereit, über seinen »größten Misserfolg« zu reden, eine Eigenschaft, die für Vertreter der höchsten politischen Ebene nicht selbstverständlich ist. Jean Asselborn ist nicht nur Minister für auswärtige Angelegenheiten, sondern auch Minister für Immigration und Asyl. Und jener »größte Misserfolg« ist »ohne Zweifel die Unfähigkeit, im Herbst 2015 unter luxemburgischem EU-Vorsitz des Innenministerrates die Verteilung von Migranten und Flüchtlingen aus Italien und Griechenland nicht geschafft zu haben. Dies vor allem wegen der Visegrád-Länder Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowakei.«
Bis heute wirkt diese negative Erfahrung nach, sie lastet auf dem Gewissen und belastet den politischen Anspruch von Jean Asselborn. »Die Ohnmacht, elementarste Menschlichkeit in der EU nicht durchsetzen zu können, das Prinzip der Solidarität und der Verantwortung mit Füßen zu treten, hat mir schon sehr zu schaffen gemacht. Die Geschichte wird wohl festhalten, dass wir ab 2015 nicht mehr im Einklang mit den Grundwerten der Europäischen Union sind, so wie sie in den Römischen Verträgen mit dem Begriff ›Gemeinschaft‹ definiert sind.«
Jean Asselborn ist auf der EU-Bühne einer der letzten Europäer seiner Art. Er weiß als Luxemburger, wie wichtig in Europa und in der Welt ein sehr persönliches Beziehungsgeflecht ist. Das ist seine Praxis und seine Art, Politik zu betreiben. Und weil er aus Luxemburg kommt, bringt er zudem die wichtigsten Tugenden mit, über die ein europäischer Politiker verfügen muss: Er ist kompromissfähig. Und er vergisst nie, wie dieses Europa und vor allem seine mächtigen Mitspieler aus der Perspektive der kleinen Staaten wirken. Die vermeintlich Großen sind manchmal die ganz Kleinen.
Nachschrift: Sämtliche nicht anders gekennzeichnete Zitate stammen aus den persönlichen Gesprächen mit Jean Asselborn, die ich im Zuge der Recherche zu diesem Buch mit ihm geführt habe. Der Text wurde während der Corona-Krise Mitte April 2020 fertiggestellt.
1. UMRINGT VON EUROPAS HISTORIEJean Asselborns Arbeitsplatz
Was für eine Geschichte: Dort, wo Luxemburgs Außen- und Migrationsminister Jean Asselborn sein Büro hat, stand einst das Bett von Ludwig XIV. Der Sonnenkönig schlief dort, wo der Chefdiplomat des Großherzogtums heute Amtskollegen empfängt, Verhandlungen führt, Projekte initiiert, mit der ganzen Welt telefoniert und in den sozialen Medien kommuniziert. Viermal legte sich der Monarch hier zur Ruhe. Von Donnerstag, 21. Mai 1687, bis Montag, 26. Mai 1687, weilte Ludwig XIV. in Luxemburg, nicht aus Vergnügen, sondern in militärischer Mission. Er wollte sich die strategisch bedeutende Stadt, die unter spanischer Verwaltung stand, kurzerhand unter den Nagel reißen, was ihm auch mühelos gelang. Unter seiner Regentschaft entwickelte sich Frankreich zu einer politischen und kulturellen Vormacht in Europa.
Seinen Feldzug ließ Ludwig XIV. auch penibel dokumentieren. Mit ihm reiste der Chronist Jean Baptiste Racine, einer der bedeutendsten Autoren der französischen Klassik. Er begleitete den König auf Schritt und Tritt und zeichnete das Geschehen akribisch im heutigen Arbeitszimmer von Asselborn auf. Der machtbewusste König wusste genau, worauf es ankommt. Ludwig XIV. überließ nichts dem Zufall. Er achtete auf sein Image und überprüfte jeden Text, der über ihn geschrieben und für die Nachwelt aufgezeichnet wurde. Den Begriff »Message Control« gab es damals noch nicht, die Methode aber ganz offensichtlich schon.
Wir stehen mitten im Büro des Außenministers, in diesem stilvollen Ambiente, und Jean Asselborn erzählt gerne die Geschichte von Ludwig XIV., wenn er Gäste mit seiner umfassenden Wärme und Herzlichkeit empfängt.4 Seit Anfang 2017 residiert Luxemburgs Chefdiplomat in diesem Gebäude, einem der ältesten und schönsten der Altstadt von Luxemburg in der Rue du Palais de Justice Nummer 9. Das Bâtiment Mansfeld, wie es offiziell heißt, trägt den Namen des ehemaligen Gouverneurs Graf Peter Ernst I. von Mansfeld. Er baute Mitte des 16. Jahrhunderts für sich selbst einen Gouverneurspalast in der Stadt. Im 20. Jahrhundert war das Gebäude der Gerichtspalast Luxemburgs. Ab 2009 wurde das prächtige Bauwerk in der Mini-Metropole umfassend renoviert und umgebaut. Jetzt ist das Palais am Ende einer verwinkelten Gasse der Sitz des luxemburgischen Außen-, Europa- und Migrationsministeriums.
Die Affinität Jean Asselborns zu Europa ist nicht gespielt, auch nicht überzogen, sondern entspricht seiner tiefen Überzeugung für das europäische Friedensprojekt und gleichzeitig seiner tiefen Ablehnung von Nationalismus und Rassismus. Vor dem Eingang zu seinen Amtsräumen steht nur eine Fahne. Und es ist nicht die des Großherzogtums, sondern die Fahne der Europäischen Union, das blaue Banner mit dem Kranz aus zwölf goldenen Sternen.
Jean Asselborn fühlt sich in diesen Räumen voller Geschichte und Geschichten sichtlich wohl. Sein Büro, in dem Ludwig XIV. vier Nächte verbrachte, ist ein großer, hoher und heller Raum mit dunklem Holzboden, einem offenen Kamin und aufwendiger Deckenstuckatur aus dem 17. Jahrhundert.
Das Arbeitszimmer wirkt schlicht, funktional und ist größtenteils modern eingerichtet. Die Ausstattung könnte in jedem größeren Einrichtungshaus gekauft worden sein. Den Raum beherrscht ein riesiger Schreibtisch mit dunkler Glasplatte. Akten, Bücher, Mappen und Dokumente stapeln sich hier, dazwischen liegen Reise-Andenken. Ein Laptop steht geöffnet auf dem Tisch. Schlichte Regale säumen den Kamin. Dieser wird nicht mehr benutzt, dafür fehlen dem Außenminister Zeit und ruhige Momente. Die barocke Sitzgarnitur in hellem Satin vis-à-vis des Schreibtisches passt so gar nicht zum nüchternen Geschmack des Chefdiplomaten. »Die war schon hier«, erzählt er. Als feiner ästhetischer Kontrast hängt über der Sitzbank ein abstraktes Bild des bekannten luxemburgischen Malers Guy Michels. Das Werk in seinen braunen und beigen Tönen fällt auf.
Pflichtprogramm: Außenminister Jean Asselborn beim Akten-Studium in seinem Büro
Auf dem kleinen Beistelltisch vor dem Sofa hat Jean Asselborn bewusst eine Miniatur der Bronze-Skulptur »Non-Violence« (Gewaltlosigkeit) des schwedischen Künstlers Carl Fredrik Reuterswärd platziert. Das Original wurde 1985 vor dem Gebäude der Vereinten Nationen am East River in New York City installiert und stellt einen übergroßen Revolver, einen Colt Python, dar, dessen Lauf verknotet ist. Das Kunstwerk gilt mittlerweile als universelles Symbol gegen jede Form von Gewalt und war ein Geschenk Luxemburgs an die Vereinten Nationen. Für den Außenminister ist die kleine Skulptur ein Statement, ein deutlicher Hinweis für jeden Besucher: Jean Asselborn ist ein glühender Verfechter des Systems der Vereinten Nationen, des Multilateralismus als Garant für eine internationale, auf Recht beruhende und durch Regeln abgesicherte Weltordnung. In seinem Denken ist Jean Asselborn Pazifist.
Direkt von seinem Büro gelangt man in einen Besprechungsraum und dann ins Freie auf eine große Terrasse. Wenn man seinen Blick von hier aus über den Fluss Alzette richtet, sieht man das hellgelbe Geburtshaus des ehemaligen französischen Außenministers Robert Schuman, dem Architekten der Europäischen Union. Es ist ein unauffälliges einstöckiges Gebäude. Heute ist es Sitz des Europäischen Studien- und Forschungszentrums.
Jean Asselborn zeigt stolz auf das Schuman-Haus, er sieht in dem europäischen Politiker gerne einen Luxemburger, was dieser aber gar nicht war. Geboren wurde Robert Schuman in den Wirren des 20. Jahrhunderts als Reichsdeutscher in Luxemburg-Stadt, gestorben ist er als französischer Staatsbürger. Was unerwähnt bleibt, ist die Tatsache, dass hinter dem Gründervater des europäischen Einigungswerkes ein Mann namens Jean Monnet steht, der die Idee eines Vereinten Europas mit einem Plan flankierte, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Monnet, einem französischen Unternehmer und Wirtschaftsberater, gelang es wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, Schuman von dem Konzept zu überzeugen, die Produktionsbeschränkungen für deutschen Stahl aufzuheben, wenn Deutschland seinerseits bereit wäre, seine Ressourcen mit Frankreich zu teilen. Konkret schlug Monnet eine Kohle- und Stahlindustrie vor, in der nicht nur Franzosen und Deutsche, sondern auch Italiener, Belgier, Niederländer und Luxemburger ihre Ressourcen und Märkte zusammenschließen würden. Frankreichs Außenminister Schuman übernahm den Plan von Monnet, warb für ihn und setzte ihn als Politiker um. Das Ziel beider war gleich: Kriege auf europäischem Boden für immer zu vermeiden.5
Robert Schuman war durch und durch Europäer, und genau so sieht sich auch Jean Asselborn. Was ihm dabei hilft, ist nicht nur seine gelebte europäische Identität, sondern auch die historische, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung seines Heimatlandes. Für Luxemburg bedeutet die Europäische Gemeinschaft das Ende einer Sandwich-Situation zwischen den großen Nachbarn Deutschland und Frankreich und damit auch das Ende einer Existenz als Spielball zwischen Mächten. Entsprechend tief ist das europäische Bewusstsein der meisten Luxemburger – was Eurobarometer-Umfragen seit vielen Jahren auch deutlich zeigen. Bürger keines anderen EU-Mitgliedslandes sind so sehr von der europäischen Integration überzeugt wie Luxemburger. 46,6 Prozent der Bevölkerung sind nicht in Luxemburg geboren.
Der Außenminister, der das Amt seit dem Jahr 2004 innehat, kann und will sich der Geschichte seines Landes auch nicht entziehen. Er nutzt diese Geschichte und die Stellung Luxemburgs geschickt auf der europäischen und internationalen Bühne und verhilft so dem Land zu einer Bedeutung, die in keinem Verhältnis zu seiner Größe steht. Jean Asselborn umschreibt diesen Zustand gerne mit den Worten: »Kleines Land, großes Ausland.«
Luxemburg, die heimliche EU-Hauptstadt
Wenn der Minister auf seiner Terrasse über das Selbstverständnis und die Rolle seines Landes erzählt, kommen ihm Sätze wie »Luxemburg ist, was es ist« über die Lippen. Wenn er dem Schuman-Haus den Rücken kehrt, sieht er den jungen Stadtteil Kirchberg. Auf dem Plateau über dem Zentrum türmen sich Büros von Niederlassungen internationaler Konzerne und die monumentalen Bauten europäischer Institutionen und Behörden: Der Europäische Gerichtshof (EuGH), der Europäische Rechnungshof, die Europäische Investitionsbank (EIB), das Sekretariat des Europäischen Parlaments, die Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) haben hier ihren Sitz. Die beiden letztgenannten EU-Behörden sind während der Amtszeit von Jean Asselborn in der luxemburgischen Hauptstadt angesiedelt worden. Besonders für den Sitz der Europäischen Staatsanwaltschaft hat sich der Außenminister nachdrücklich eingesetzt. Luxemburg ist die heimliche EU-Hauptstadt, sagen jene, denen Brüssel zu laut, zu aufgeblasen und zu hektisch ist.
Der Kirchberg ist aber auch Tummelplatz weltbekannter Architekten, die hier außergewöhnliche Bauwerke errichtet haben. Das Museum für moderne Kunst zum Beispiel, vom Architekten Ieoh Ming Pei, macht Luxemburg um ein spektakuläres architektonisches Gebäude reicher. Oder die eindrucksvolle Philharmonie des Pritzker-Preisträgers Christian de Portzamparc. Die Konstruktion ist atemberaubend, die Klangqualität darin ebenso.
Auf dem Weg zum Außenministerium stößt man ganz unauffällig auf einen anderen Teil europäischer Geschichte: Es ist eine kleine Gedenktafel aus Messing, die an einer Hauswand montiert ist. Die Gedenktafel ist Josy Zinnen gewidmet, der vor Jahrzehnten hier an der Ecke Rue du Palais de Justice und Rue de la Monnaie gelebt hat. Josy Zinnen, geboren am 28. März 1912, war ein bekannter Widerstandskämpfer gegen das totalitäre Naziregime. Weil er sich zur Wehr setzte, kam er in das Konzentrationslager Mauthausen, nahe der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Er starb am 31. Mai 1945 an den Folgen der Qualen des Konzentrationslagers, wenige Wochen nach der Befreiung des KZ am 4. Mai durch Truppen der US-Armee. Auch an diese dunkelste Seite europäischer Geschichte wird durch die Gedenktafel an Josy Zinnen vor dem Eingang des luxemburgischen Außenministeriums erinnert.
Was lehrt die Geschichte Jean Asselborn? »Man muss die Probleme Hass, Intoleranz, Nationalismus und Menschenverachtung direkt ansprechen. Man muss den Menschen hier in Europa und überall immer wieder diese Vergangenheit vor Augen führen und sagen, wozu rechte Parteien fähig sind, wohin der Weg mit ihnen führen kann.« Der Außenminister warnt in einem unserer Gespräche »vor dem Zurückfallen in nationalistische Gefühle, denn damit hat alles in den 1930er-Jahren begonnen. Wir dürfen nicht schlafwandelnd in solch eine Situation zurückkehren.«
Ein Mittel gegen aufkommenden Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ist für ihn die dem europäischen Projekt innewohnende Bestimmung »Gemeinschaftssinn und Solidarität«. Sie sind »kein Allheilmittel«, das weiß Jean Asselborn, »aber sollte der Gemeinschaftsgedanke wie in der Migrationskrise weiter missachtet werden, dann steht die Zukunft der Europäischen Union auf dem Spiel«.
2. WAS DISZIPLIN UND EHRGEIZ BEWIRKENVom Arbeiter zum dienstältesten Außenminister der EU
Herkunft und Familie
Vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wird Jean Asselborn am 27. April 1949 im luxemburgischen Steinfort geboren. Hier, im heute knapp 6000 Einwohner zählenden Ort an der Grenze zu Belgien, lebte seine Familie in bescheidenen Verhältnissen, und das schon seit Generationen. »Ich bin in ein Arbeitermilieu hineingeboren. Ich komme ja aus einer Familie, die nie ein Haus oder ein Auto besessen hat. Aber wir haben zufrieden gelebt«, sagt Asselborn offen über seine sozialen Wurzeln. Er wächst äußerst bescheiden in einer kleinen Gemeindewohnung auf. Der Vater, Philippe Asselborn, ist Alleinverdiener und arbeitet als Kranführer in einem Stahlwerk im Süden des Landes. Die Mutter, Irma Joachim, ist Hausfrau. Sie kümmert sich um ihre zwei Kinder und die Familie. »Wir waren ja nicht arm, aber wir mussten sparen. Meine Mutter hat das Geld, das mein Vater nach Hause brachte, immer genau eingeteilt: für Essen, für Wohnen und für Kleidung.« An seine Mutter erinnert sich Jean Asselborn sehr gerne, er erzählt auch oft von ihr. Er war ihr Lieblingskind. »Sie hat mir immer zugehört. Ich war ihr schon näher als dem Vater.«6 »Obwohl ich so etwas wie das Lieblingskind meiner Mutter war, war es meine Schwester Marie-Andrée, die sich in den späten Jahren unserer Mutter, als diese von der Krankheit gezeichnet war, fast Tag und Nacht um sie gekümmert hat und immer für sie da war. Dafür gebührt ihr mein brüderlicher, großer Dank.«
Sein Vater ist im ganzen Ort bekannt und auch sehr beliebt. »Zeit seines Lebens hat er sich im Fußballverein engagiert. Er hat darauf geachtet, dass alles perfekt organisiert ist. Der Rasen musste gemäht und der Platz jederzeit spielbereit sein.« Während Jahrzehnten war Philippe Asselborn Kassenwart beim F. C. Sporting Steinfort und die gute Seele des Fußballvereines.
Aus seiner politischen Einstellung macht der Vater nie ein Hehl: Als Stahlarbeiter ist es für ihn selbstverständlich, Mitglied der sozialistischen Gewerkschaft und der Sozialdemokratischen Partei zu sein. Täglich liest der Vater die sozialistische Tageszeitung Tageblatt, er hat die Zeitung abonniert. Jean Asselborns Mutter hingegen interessieren die neuesten Nachrichten aus der Welt der Politik kaum, für sie spielt der Glaube, die Religion, eine größere Rolle. »Sie ist auch regelmäßig in die Kirche gegangen. Mein Vater jedoch hatte etwas mehr Distanz zur Religion.«
Schon als Jugendlicher (1965) hat Jean Asselborn gerne die Trommel geschlagen
Das Familienleben verläuft harmonisch, die Eltern von Jean Asselborn sind zufrieden mit dem, was sie erarbeitet haben und ihren Kindern an bescheidenem Wohlstand bieten können. »Es fehlte an nichts. Die Eltern haben für mich und meine jüngere Schwester alles getan und alles gegeben.«
Die Kindheit von Jean Asselborn verläuft durchaus behütet, eingebunden in den Familienverband, unaufgeregt und ohne Besonderheiten. »Bei uns hat es überhaupt kein Brimborium gegeben.« Die Grundschule absolviert der Sohn ohne Probleme, danach ist es für die Eltern ganz selbstverständlich, dass ihr Sohn auf das Gymnasium wechselt. Er soll eine sehr gute Ausbildung erhalten, um es besser zu haben als die Eltern und Großeltern, er soll zu größerem Wohlstand kommen. Das wird ihm nachdrücklich vermittelt, Tag für Tag. »Meine Mutter hat mir immer gesagt: ›Du gehst nicht im blauen Overall arbeiten.‹« Sie will ihr Kind nicht im Blaumann sehen, sondern im dunklen Anzug mit Krawatte, dem sichtbaren und unmissverständlichen Symbol des Aufstiegs.
1967: »Jetzt will ich Geld verdienen« – Jean Asselborn wird Schichtarbeiter bei Uniroyal
Dieser Traum der Mutter geht vorerst nicht in Erfüllung. »Ich habe zu einem gewissen Moment mit 17 Jahren die Schule abgebrochen.« Es ist ein Thema, über das Jean Asselborn nicht gerne spricht. Es gehört nicht zu seinen liebsten Geschichten, sodass er gleich ablenkt, wenn er darauf angesprochen wird. »In der Schule war ich nie besonders gut, ich hatte es satt. Und ich sagte mir, ›jetzt will ich Geld verdienen‹«, erzählt er. Gegenüber dem luxemburgischen Wochenmagazin Revue sagt er einmal, »kein so gescheiter Junge zu sein, wie viele glauben«.7 Jean Asselborns Geschichte ist von Unterschätzungen geprägt.
Überzeugt davon, dass es die richtige Entscheidung ist, verlässt der Teenager die Schule. Nach seiner fünften Klasse im Lycée des Garçons de Luxembourg beginnt er für den Reifenhersteller Uniroyal in Steinfort zu arbeiten. Mitte der 1960er-Jahre hat sich Uniroyal, ein großes belgisch-amerikanisches Unternehmen, in der Gemeinde niedergelassen, um dort eine Produktionsstätte für Reifencord zu errichten. In Steinfort gibt es bis in die 1960er-Jahre nur wenige Beschäftigungsmöglichkeiten.
Die gesamte Region an der belgischen Grenze ist bis zu dieser Zeit nicht gerade gesegnet mit Investitionen, gut bezahlte Arbeitsplätze sind rar. Bis 1932 hat Steinfort mit seinen zahlreichen Sandsteinbrüchen eine Hüttenindustrie gehabt, »die Schmelz« genannt, der größte Arbeitgeber weit und breit. Nach dem Zweiten Weltkrieg dauert es jedoch lange, bis es wirtschaftlich langsam bergauf geht. Mit der Ansiedlung von Uniroyal verbessert sich die Situation spürbar, moderne Arbeitsplätze entstehen. Noch heute ist der Nachfolger von Uniroyal, Textilcord, ein wichtiger Betrieb in der Region, rund 150 Angestellte verdienen hier ihr Geld.
Jean Asselborn beginnt nach dem »Examen de passage«, einer Prüfung, die man in Luxemburg vier Jahre vor der Matura bzw. vor dem Abitur machen muss, im Jahr 1967 im Labor von Uniroyal zu arbeiten. In dieser Abteilung werden die Qualität des Materials und eine bestimmte Technik des Reifencordes überprüft. »Ich war Arbeiter und habe 75 Luxemburger Francs in der Stunde verdient. Für mich war klar, dass ich sofort Mitglied der sozialdemokratischen Gewerkschaft werde. Im Betrieb war ich der Vertrauensmann der jungen Arbeiter, und ich war auch der gewählte Vertreter der Jugendabteilung des Luxemburger Arbeiterverbandes (LAV)«, erzählt Asselborn.
Von der Reifen-Fabrik in die Gemeindeverwaltung
Nach einem guten Jahr im Labor von Uniroyal beendet Asselborn sein Arbeitsverhältnis in diesem Unternehmen. Durch eine Stellenanzeige, die er zufällig in der Zeitung liest, wird er motiviert, etwas Neues zu versuchen. Die angebotene Arbeit klingt interessant: Gesucht wird ein Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung der Stadt Luxemburg. »Das wäre etwas für mich«, denkt Jean Asselborn. Er ist bereit, sich zu verändern. Die Voraussetzung für die Anstellung ist ein positives Ergebnis bei einem Examen, das die Stadtverwaltung durchführt. Er meldet sich an und schafft die Aufnahmeprüfung. Im Herbst 1968 wird er Beamter. Sein Aufgabengebiet in der Stadtverwaltung ist überschaubar, wenn auch nicht sonderlich herausfordernd. »Da habe ich Steuerkarten im Sekretariat der Gemeinde Luxemburg geschrieben und Volkszählungsdaten ausgewertet.«
Wenige Monate später, am 1. April 1969, wechselt Jean Asselborn erneut den Arbeitsplatz. Er geht zurück nach Steinfort, wo er in der Gemeinde das Einwohneramt übernimmt. Er wird Nachfolger von Marie Manderfeld, auch »Joffer Maria« genannt, einer »Institution« in der Gemeindeverwaltung Steinfort, die sich seit Kriegsende um das Einwohneramt gekümmert hat. Eine Dame, die während mehr als zwei Jahrzehnten mit großer Jovialität und Zuvorkommenheit das Empfangsgesicht der Verwaltung war. »Ihre Einstellung hat mir als Vorbild für meine Arbeit und den Umgang mit den Bürgern gedient.«
»Dort habe ich Passanträge für die Ortsbewohner ausgefüllt und mit der Hand die Cartes d’identités geschrieben und abgestempelt. Durch diese Arbeit lernte ich alle Menschen im Ort kennen. Jeder, der zu mir kam, erzählte mir seine Geschichten und alle seine Probleme.« Jean Asselborn hört aufmerksam zu, was ihm die Menschen anvertrauen, er erfährt dadurch viel Privates, Freud und Leid eines jeden Antragstellers für ein neues Reisedokument. Durch seine vielen Gespräche im Einwohneramt weiß Jean Asselborn sehr bald, wo die Menschen der Schuh drückt, was sie bewegt, welche Anliegen sie haben und was sie von den kommunalen Politikern an konkreten Maßnahmen erwarten. Jean Asselborn ist über alle Entwicklungen im Ort im Bilde. »Diese Arbeit hat mich schon sehr geprägt«, erzählt er Jahrzehnte später, gekleidet in seinen dunklen Anzug. »Man kann wohl sagen, das war der stille Beginn seiner politischen Laufbahn«, beschreibt ein Weggefährte diese Zeit Asselborns in Steinfort.
Auch wenn die Beschäftigung am Einwohneramt seine umfassende Neugierde zunächst befriedigt, äußerst informativ ist und viel Gelegenheit zur Kommunikation gibt, was dem Wesen von Jean Asselborn durchaus entspricht – er redet gerne, hat für jeden ein offenes Ohr und scherzt mit allen Menschen –, wirklich zufrieden mit dem Leben und seiner beruflichen Aufgabe ist er nicht. »Da ist etwas eingerissen, wo ich auch dabei war: Am Abend nach der Arbeit gingen wir zum Kartenspielen ins Gasthaus, wir haben ein oder zwei Bier getrunken und viel geraucht. Auf die Dauer war mir das nicht geheuer. Ich bin da in einen Rhythmus hineingekommen, aus dem ich schnell wieder rauswollte.«
Der Ehrgeiz packt ihn erneut, Jean Asselborn will aus dieser bequemen, aber begrenzten Welt ausbrechen. Die Arbeit am Einwohneramt entwickelt sich zur Routine, die Bewohner und ihre Probleme kennt er, die abendlichen Gasthausbesuche waren eine Zeit lang schön, gehen ihm aber mehr und mehr auf die Nerven. Zufällig sieht Jean Asselborn auf dem Schreibtisch einer Kollegin des örtlichen Büros der Krankenkasse ein neues Mathematik-Buch liegen. Er will wissen, warum das Buch über moderne Mathematik bei ihr auf dem Tisch liegt. Es ist ihr Lehrbuch für die Abendkurse, antwortet sie. In der Hauptstadt besucht sie eine Abendschule, um das Abitur – oder die Matura, wie es in Österreich heißt – im zweiten Bildungsweg nachzuholen. »Ich dachte mir gleich, das wäre auch etwas für mich«, erzählt Jean Asselborn begeistert. Kurz bevor er damit beginnt, drei Klassen im luxemburgischen Athenäum in Abendkursen zu absolvieren, schreibt er sich im Jahr 1972 als Mitglied der Sozialistischen Partei Luxemburgs ein, der Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei (LSAP), wie sie offiziell heute noch heißt.