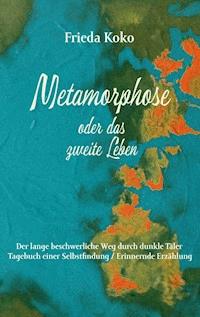
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Unter dem Pseudonym Frieda Koko schildert die Autorin in "Metamorphose oder das zweite Leben" den Verlauf einer Analyse und wie sich durch verschiedene Änderungsprozesse aus der fremdbestimmten, untergeordneten, ängstlichen Marie eine befreite, kraftvolle, selbstbestimmte, selbstbewusste Frau entwickelte, die schließlich zu sich selbst fand. Aus den gesellschaftlichen und familiären Zwängen befreite sie sich und lebte ihr Leben aus sich heraus: authentisch, bewusst und achtsam. Den stets gesuchten Schatz fand sie in sich. Ihre Gefühle wurden geheilt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich danke meinem Arzt, meinem Therapeuten, meinem Wegbegleiter, der mir half, das zweite Mal geboren zu werden und an dessen Größe ich reifen durfte.
Inhaltsverzeichnis
Der Tod
Tod und Leben
Neubeginn
Loslassen
›Ein anderes Gefühl‹ – Liebe
Metamorphose
Innerer Frieden
Entblätterung
Entscheidung gegen das Leben
Sterben – dem Tod nahe
Krankheit
Ende eines Weges
Unbekannt
Mutlosigkeit
Sucht
Veränderung – Verrückung Umwandlung
Befreiung
Mutter – Tochter – Beziehung
Wiederbegegnung mit einem Freund
Mit – Gefühl, Mit – Leid
Liebesfieber
Glück
Vergangenes
Schokolade auf meiner Haut
Loch 50
Ambivalenzü
Liebe in Wien –
Gestorbene Liebe
Abschied eines ›geliebten, schmerzhaften‹ Lebens –
Entwurzelung / Abnabelung
Marie wurde auf einem großen Bauernhof in einem im Tal gelegenen kleinen Dorf geboren. Ihr Elternhaus war ein großes, altes, gut erhaltenes, unter Denkmalschutz stehendes Fachwerkhaus, umgeben von vielen Wirtschaftgebäuden und Stallungen, welches man auf einer kleinen Anhöhe erreichte, nachdem man das majestätische, weiße Hoftor passiert hatte. Durch eine große Eingangstür gelangte man auf die Deele, ein Museums ähnlicher, riesiger, hoher Raum, in dem früher die Strohballen durch die Deckenklappe auf den Boden befördert wurden. Hinter dem Wohnhaus stand im angrenzenden Garten das alte Backhaus, in dem in früheren Zeiten das Brot gebacken und der Schnaps gebrannt wurde.
Die Geschichte der Familie reichte bis in das Jahr 1680 zurück. In der Darstellung eines mächtigen Stammbaumes, der im Ein gangsbereich des Wohnhauses zu sehen war, konnten die vielen familiären Verzweigungen nachvollzogen werden. Die beiden mächtigen Linden hinter dem Haus schienen die weitläufie Familiengeschichte zu repräsentieren und konnten sicherlich, hätten sie berichten können, vieles aus zurückliegenden Jahrzehnten und Jahrhunderten erzählen. Auch in schriftlicher Form waren die Generationen zurückzuverfolgen. In einem recht umfangreichen Stammbuch war jede einzelne Familienverzweigung dokumentiert. Von vielen Schicksalen, die sich in der Familie ereignet hatten, wussten die Mauern der zahlreichen Gebäude zu erzählen. So gab es eine Aufzeichnung aus dem Jahre 1863 – in klarer, fast gemalter Schrift, in der der Tod zweier Geschwister durch Scharlach innerhalb von elf Tagen beklagt wurde. – Welch eine Tragik!
Marie konnte sich an die Erzählung ihrer Mutter erinnern, die in der Todesnacht ihrer Schwägerin eine Gestalt wahrgenommen hatte, die sich von ihrem kleinen Sohn, der wegen der schweren Erkrankung der Mutter hier untergebracht war, verabschiedete. Seltsame Begebenheiten, vorausahnende Geschehnisse, die sich derzeit ereigneten – sagenumwobene Zeiten!?
In den damaligen Jahren war es üblich, dass zumindest ein Mädchen aus der Familie ins Kloster ging. So geschah es, dass die 1868 geborene Tochter, sechstes Kind der Familie sich dahin begab als sie 21 Jahre alt war. Nach ersten Klosterjahren und Missionstätigkeiten in Afrika wurde sie 1895 mit nur 27 Jahren erste Generaloberin der Missionsbenediktinerinnen in Tutzing – eine sehr erfolgreiche, starke, bemerkenswerte, ehrwürdige Frau. Marie war nach ihr benannt worden. Einst hatte man darauf gehofft dass auch sie diesen klösterlichen Weg gehen würde, denn in regelmäßigen Abständen erschien eine Abordnung aus Tutzing, um diese Möglichkeit zu ventilieren und das Interesse daran zu bekräftigen.
Maries Eltern waren alt und hatten schon vier Kinder aufgezogen. Ihr Nachkömmling, Nesthäkchen wuchs somit alleine auf und wurde behätschelt und betätschelt, genoss zugleich aber auch eine umfassende, verwirrende Erziehung von allen Familienmitgliedern gleichzeitig. Der Vater war von sehr strenger Natur. Wenn er das Haus betrat, verstummten alle anwesenden Mitglieder der Familie. Jeder sprang auf und brachte sich in eine geschäftige Position. Es gab eine eng gefasste Strukturierung des Tages, die Mahlzeiten wurden pünktlichst genau eingenommen. Alles verlief nach Plan und Absprache, jeder hatte seine Aufgabe. Bei Tisch durfte nicht gesprochen werden. Niemand wagte auch nur einen Ton zu sagen. Wer sich nicht an die Regel hielt, musste den Tisch verlassen. Oft kam es vor, dass Maries Schwester Ria, als sie klein war, in den dunklen Keller eingesperrt wurde, wenn sie nicht gehorchte. Was für alle anderen Kinder der Familie eine Tragödie darstellte, war es für Ria keine, denn sie hatte schnell erkannt, dass man durch das schwierig zu erreichende Fenster wieder in die Freiheit kam. Geschickterweise machte sie aus der Not eine Tugend, indem sie aus dem Keller ein paar Eier entwendete, um damit im Sandkasten, wo ihre Geschwister schon warteten, ›Sandkuchen‹ zu backen. Auch Marie wurde der Keller angedroht, was bei ihr eine enorme Wirkung hinterließ, denn dieser Aufenthalt dort blieb ihr dadurch erspart.
Die Mutter, eine stolze, würdevolle Frau, nahm eine besondere Position in der Familie ein. Sie bewahrte stets Haltung, ihre äußere Erscheinung war immer korrekt und fast ehrwürdig. Zurückhaltung, aber gleichzeitig eine liebevolle Wärme vermittelnd und ihre stetige Hilfsbereitschaft machten ihre Beliebtheit und ihr großes Ansehen aus. Eine beeindruckende Dame.
Auf Anstand und Sitten wurde großen Wert gelegt. Diesbezügliche Regeln mussten von allen Kindern sorgfältig abgeschrieben werden in der Hoffnung, dass sie somit beherrscht würden. Verstieß ein Kind gegen sie, mussten sie mehrmals geschrieben werden. Um den endgültigen Schliff bezüglich Erziehung, Anstand und Benehmen zu erhalten, stand ein zwei- bis dreiwöchiger Aufenthalt bei Onkel Franz, dem Bruder des Vaters, einem Pastor, auf dem Plan.
Der Vater war ein gradliniger, einflussreicher Mann. Er zeigte sich hilfsbereit allen Dorfb wohnern und Familienangehörigen gegenüber, verlangte von allen aber sehr viel. Mit einer oft rigiden Härte regierte er auf dem Hof und in der Familie. Als Marie eines Tages einen kleinen Hund bekam, der in seiner quirligen, unruhigen, ungestümen Art das kleine Mädchen einige Male in unklarer Absicht ansprang, war das dem Vater nicht geheuer. Kurzerhand entledigte man sich des Tieres, es wurde erschossen. Brutale Vorgehensweisen, die sich auch in den ü blichen Schlachtungen von Schweinen und dem Köpfen von Hühnern zeigten. Marie litt jeweils mächtig, konnte sich aber nicht entziehen. – Auch die auf dem Hof beschäftigten Angestellten gingen nicht zimperlich miteinander um. Sollte jemand auf das Ekelhafteste geärgert werden, weil er einen boshaften Streich gespielt hatte, so kam es schon mal vor, dass der Peiniger abends mit einer toten Maus oder Ratte in seinem Bett rechnen musste.
Marie, die keine altersgleichen oder altersähnlichen Leidgenossen in der Familie hatte, wuchs ziemlich allein und einsam auf und konnte diese schwer zu verarbeitenden Erlebnisse nicht mit anderen teilen, sondern stand oft fassungslos und sprachlos vor solchen Ereignissen. Ja, sie war alleine und klein im Kreise vieler Erwachsener, der Eltern und der viel älteren Geschwister. Wenn die Familie, und die war groß, wenn Verwandte zu Besuch kamen und beisammen saß, wurde das kleine Mädchen aus dem Raum geschickt, mit der Bemerkung, von den Gesprächen eh nichts zu verstehen. An eine Gesprächsbeteiligung war gar nicht zu denken. Marie gehorchte artig, verließ den Raum und fühlte sich einsam, unerwünscht, unwissend, isoliert. Es tat sehr weh. Das Schweigen wurde zu ihrem treuen Begleiter, ebenso war sie sich sicher, nichts zu wissen und nichts zu können.
Der innerliche Druck führte schon damals zu hoher gesundheitlicher Anfälligkeit. Immer wieder meldeten sich die Bronchien, lange Zeit litt sie unter Keuchhusten. Vieles hatte sie herauszurufen und herauszubrüllen in ihrer Not, doch der Mut und die Worte fehlten. Maries Umgang mit Freundinnen wurde selektiert. Mona war ihre einzige Spielkameradin in dem Ort. Die Eltern waren miteinander befreundet und so trafen sich die beiden Mädchen oft, um miteinander zu spielen. Später hörten sie zusammen Musik, planten kleine Feste, bei denen erste Jungenbekanntschaften gemacht wurden. Das alljährliche Schützenfest war jeweils ein großes Ereignis, bei dem, ab einem gewissen Alter, unter anderem die ersten Versuche mit Alkohol und dem Rauchen erlebt wurden.
Dann eines Abends im Herbst verunglückte Maries Bruder mit seinem Motorrad. Geblendet durch ein entgegen kommendes Fahrzeug überschlug er sich mehrmals und zog sich schwere Hirnverletzungen zu, er filins Koma. Tagelang bangte die gesamte Familie um ihn, bis nach geraumer Zeit Entwarnung gegeben wurde, der geliebte Bruder aufwachte und die Lebensgefahr überstanden war. Erleichterung vor allem auch für die kleine Schwester,
Nach der Grundschulzeit besuchte Marie ein Mädchengymnasium in der benachbarten Stadt. In den ersten Jahren war der Schulort nur mit dem Zug zu erreichen. Ein Bummelzug war es, der für die Strecke eine Stunde benötigte. Der Vorteil dieser äußerst langsamen Fortbewegung war es, dass noch genügend Zeit verblieb, restliche Hausaufgaben zu erledigen. Wenn diese Arbeiten geschafft waren, wurde Karten gespielt. Nach wenigen Jahren legte man die Bahnstrecke still. Busse wurden eingesetzt, um die Schüler und Schülerinnen zu ihrem Schulort zu befördern. Zeitverkürzt gestaltete sich die Fahrerei, da mit dem Bus eine direkte Strecke möglich war. Die Gemütlichkeit der großzügigen Eisenbahnwaggons wurde ersetzt durch völlig überfüllte Beförderungsmittel. Einen Sitzplatz zu fi den glich einem Lottogewinn. Dichtgedrängt standen die Jugendlichen im Mittelgang. Die rollende Hausaufgabenverrichtung, wie sie im Zug möglich war, hatte sich damit erledigt. Kritisch wurde es im Winter. Die nach wenigen Kilometern zu erklimmende Steigung am Haarstrang, einen Höhenzug hinter dem Tal, war prinzipiell kein Problem. Lag jedoch Schnee, und dieses war in der Region, in der Marie wohnte, häufig der Fall, war es jedes Mal eine Zitterpartie: Kommt der Bus die Steigung hoch oder nicht, oder bleibt er gar in den noch nicht beseitigten Schneemassen stecken? Meistens ging es gut aus, sodass die Schule pünktlich erreicht wurde. Einige Male jedoch konnte der Bus die Steigung nicht überwinden. Das hieß, es ging nicht weiter, es ging nichts mehr. Kurzentschlossen entschieden sich dann einige Schüler und Schülerinnen und auch Marie, die verbleibende Strecke von ungefähr 15 km zu Fuß zu bewältigen. Eine kalte, aber auch lustige Angelegenheit. Völlig unterkühlt, zum Teil durchnässt erreichten die ›tapferen‹ Schulbesucher mittags, zu dem Zeitpunkt, als der Unterricht bereits beendet war, das Schulgebäude. Der scheinbare Ehrgeiz zeigte Wirkung. Voll des Lobes und des Mitgefühls wurden die abgehärteten Krieger empfangen. Während der anschließenden Rückfahrt nach Hause schlief so mancher Wanderer erschöpft ein
Behütet, beobachtet und gemaßregelt lebte Marie mit ihrer Familie in dem kleinen Ort. Die großen Geschwister hatten das Elternhaus bereits verlassen, um sich in der großen, weiten Welt ausbilden zu lassen. Nur ihr ältester Bruder Palo lebte noch mit ihr und den Eltern gemeinsam auf dem Hof. Vater erkrankte zunehmend häufi er, wodurch die häusliche Situation noch wesentlich angespannter wurde. Marie hielt es nicht mehr aus. Sie fand keinen Ausweg aus dieser empfundenen Unerträglichkeit. Zu ihrer Befreiung wünschte sie sich schließlich Vaters Tod. Und ... wenig später, an einem Samstagabend im Oktober, schon morgens hatte er seiner Frau seine Vorahnung offenbart, dass heute sein letzter Tag sein würde, trank er mit einem Nachbarn den letzten Schnaps zum ›Abschied‹ und als Marie am Nachmittag über den Hof ging, nahm er sie an die Hand und sagte leise: »Du bist noch zu jung, um keinen Vater mehr zu haben,« verstarb der Vater plötzlich abends an einem Herzinfarkt. Unruhig war er den Nachmittag über gewesen, ängstlich, vorausahnend? Daraufhin benachrichtigte man gegen Abend den Hausarzt, der sein Cousin war. Dieser erschien sofort und wollte ihn mit der Injektion eines Medikamentes zur Ruhe bringen. Beim Einstich der Spritze rief der Vater: ›Das ist ja Mord!‹ Er filzurück und war tot. Ein Schock für die gesamte Familie, besonders für Marie. Durch den Aufschrei erschrocken, sah sie durch den Türspalt und erblickte den zusammengesunkenen, leblosen Vater. Kopflos, im Schock und wie von Sinnen lief sie hinaus in die Dunkelheit, um ihren Bruder Peer zur Hilfe zu holen. Aber sie fand ihn nicht. In ihrem Schock wurde sie von einem Dorfb wohner aufgegriffen, der sie nach Hause zurück brachte. Was war geschehen, was hatte sie sich gewünscht? Sie durfte nicht denken, konnte nicht überlegen. Schreck, Starre, Verzweiflung, Trauer, Verwirrtheit, Schuld drückten sie zu Boden.
In einem unstillbaren Nasenbluten zeigte sich anschließend ihre psychische und körperliche Erschütterung – grausam war es. In dem am nächsten Morgen in der Kirche stattfidenden Gottesdienst brach Marie zusammen, als der Pfarrer den Tod ihres Vaters verkündete. Ria brachte sie daraufhin zu den benachbarten Ordensschwestern im Kloster. Dort legte man sie in einen dunklen Raum und bedeckte sie mit kühlen feuchten Tüchern, um das mittlerweile wieder eingesetzte heftige Nasenbluten zu stoppen. Mit ihren quälenden Gedanken war sie hier allein, ganz allein, bis man sie nach einer langempfundenen Zeit endlich nach Hause holte. Das heftige Nasenbluten hielt an, war nur phasenweise zu stoppen. Marie blutete und blutete und blutete, war verletzt, verwundet, geschockt. Sie sprach nur das Nötigste, so, als sei ihre Zunge erstarrt und gelähmt.
Das Nachtlager der heranwachsenden Marie diente für die kommenden fünf Tage als Aufb hrungsstätte des toten Vaters innerhalb des Hauses auf der große Deele. Eine sehr unsanfte Weise. Maries Schlafstätte war von dem Moment an das Totenbett des verstorbenen Vaters. Ihren Wärme gebenden Ruheort hatte sie nun nicht mehr. Man hatte ihn ihr genommen. Sie litt, sie litt, sie litt. – Trauer, Schmerz, Schuldgefühle, Sprachlosigkeit, immer wieder Nasenbluten, Ohnmachtsanfälle und Angst befi len sie. Wie gelähmt nahm sie an der Beisetzung des Vaters teil. Eine große Beerdigung war es, mit vielen Abschied nehmenden Gästen. Sie alle folgten dem Sarg auf einem schmuckvoll hergerichteten Leiterwagen, der von zwei Pferden gezogen wurde, durch den Ort bis zum Friedhof. Majestätisch!
Am Unterricht in der Schule nahm Marie im nächsten halben Jahr nur noch körperlich teil. Die von ihr gewünschte Befreiung hatte einen hohen Preis, sie wurde immer depressiver, funktionierte jedoch mühsam weiterhin. Schmerzhaft musste sie erkennen, dass sie statt einer Befreiung nun eine doppelte Belastung, einen unsäglichen Schmerz, unerträgliche Schuldgefühle in sich trug.
Von nun an übernahm der älteste Sohn der Familie, Maries Bruder Palo die Geschäfte und Belange des Hofes. Drei Personen waren von der einst großen Familie übrig geblieben: die Mutter, Bruder Palo und Marie. Da es der Mutter sehr schlecht ging, weil sie mit dem Abschied ihres Mannes große Schwierigkeiten hatte, war es wichtig und ein stilles Gesetz, dass sie nicht alleine sein durfte. Marie übernahm als Tochter selbstredend vorwiegend die Funktion der Anwesenden. Sie war immer für ihre Mutter da. Eine sehr lange Zeit benötigte auch das Mädchen, die Trauer zu verarbeiten. Immer wieder verfilsie in ihren Schweigezustand. Sie war körperlich anwesend, hatte aber psychisch, so schien es, abgeschaltet, sich in ihre eigene innere schmerzvolle Welt zurückgezogen. In der Schule ließ man ihr diesen Raum, ohne sie zu bedrängen.
Nach etwa einem halben Jahr änderte sich Maries Zustand. Langsam, in nur sehr kleinen Schritten verließ sie ihren Schutzraum und wagte sich mehr und mehr in die Außenwelt zurück. Freundinnen standen ihr zur Seite. Vor allen anderen war es Carmen, die ihr Vertrauen gewonnen hatte und die zuverlässig an ihrer Seite stand. Es entwickelte sich zwischen den beiden Schülerinnen eine intensive Freundschaft. Carmen wohnte am Schulort, so war ein spontanes Treffen am Nachmittag aus Gründen der räumlichen Distanz nicht möglich. Fanden nach dem Unterricht zusätzliche Kurse oder sportliche Aktivitäten statt, blieb Marie über die Mittagszeit bei ihr. Die Freundschaft festigte sich zunehmend, ein wohltuender Zustand für die beiden gleichgearteten Mädchen. So wechselten sie auch zusammen die Schule, um am Nachbarort das Abitur zu machen. Es gab viele Gemeinsamkeiten. Ihre Freunde, Rolf und Boris, die sie fast zur gleichen Zeit kennenlernten, studierten die gleiche Fachrichtung und das auch am gleichen Ort. Das vereinfachte vieles. Man traf sich, um miteinander Unternehmungen zu planen und durchzuführen, Feste zu feiern oder gemeinsam Urlaub zu machen. Innerhalb der Woche sahen sich die beiden Männer an ihrem Studienort, wenn die Zeit es zuließ. An den Wochenenden fanden die gemeinsamen Aktivitäten zu viert am jeweiligen Wohnort statt. Eine feste wohltuende Freundschaft
Maries ältester Bruder Palo, der mit ihr und der Mutter nach dem Tode des Vaters zusammen auf dem Hof lebte,





























