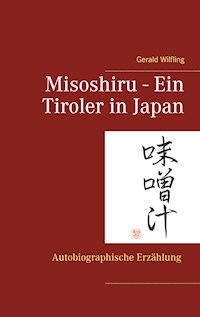
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Misoshiru ist eine aus Sojabohnenpaste hergestellte Suppe und auch der Titel meines Reiseberichtes sowie autobiographischen Erzählung über mein Leben als junger Mann in Japan, wo ich 3 Jahre lang Erfahrungen als Ausländer aber auch gut integriert in die japanische Gesellschaft gemacht habe. Die Geschichte spielt in Osaka/Japan Mitte der 1990er Jahre, ist aber auf Grund der heute noch kaum veränderten Struktur der japanischen Gesellschaft immer noch aktuell und zeitlos! Sie erzählt in autobiographischer Form von meinen Beweggründen, meinen Erfahrungen, Emotionen, Ängsten aber auch über Land und Leute, welche mir auf dem Weg dorthin wie auch natürlich in Japan selbst begegnet sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1. KAPITEL
Die Motoren summten leise. Schlecht hatte ich geschlafen, und jetzt, da ich auf die Uhr schaute, merkte ich, dass es nicht einmal zwei Stunden waren. Mein Nacken schmerzte und ich wusste schon nicht mehr, wie ich meinen Kopf halten sollte, denn auf dem für einen Flugzeugsitz recht unbequemen Ding, rollte er mir ständig auf irgendeine Seite. Die Verdunkelungsblenden waren heruntergezogen um das gleißende Licht abzuhalten. Ich öffnete eine, doch die an die Dunkelheit gewöhnten Augen sahen kaum etwas und der dumpfe Schmerz in meinem Kopf veranlasste mich, es sofort wieder zu schließen. Meine Uhr zeigte 12 Uhr 34, und obwohl ich erst siebeneinhalb Stunden unterwegs war, war ich doch schon träge und zu jeder Bewegung zu faul. In meinem Rucksack unter meinem Sitz hatte ich einen von meiner Mutter wohlgemeinten Lebensmittelvorrat an eineinhalb Kilo Birnen, Bananen, in einer Plastikdose mit viel Stanniolpapier umwickelten Kuchen und einen Sack Pasta, denn „echte italienische Ravioli wirst du ja sicher lange nicht mehr zu essen bekommen", wie mir meine Mutter beim Abschied sagte. Wie hatte ich mich doch gesträubt, das alles mitzunehmen, doch jetzt, da ich diese Dinge unter mir im Rucksack wusste, wurde ich fast sentimental und war glücklich, sie doch eingepackt zu haben. Zwei Bücher hatte ich auch noch dabei und überdies Unterlagen von einem zwei Monate lang besuchten Japanischkurs. Wie immer, wenn ich eine lange Reise antrat, hatte ich mir vorgenommen, viel zu lesen und diesmal besonders meinen immer noch spärlichen auf vielleicht vierzig japanische Wörter beschränkten Wortschatz mit Lernen zu erweitern. Doch wie auf jeder Reise hatte ich auch diesmal nach kurzer Zeit alles wieder fein säuberlich verstaut und mich auf meine Lieblingsbeschäftigung, das Tagträumen, verlegt. Wie weit war ich doch schon weg von zu Hause. Eigentlich hatte ich bereits, als ich am Münchner Flughafen an Bord ging, das Gefühl, nicht mehr in dieser alten, damals hatte ich noch gedacht engen Welt Europa zu sein. Irgendwie stimmte das auch. Mit dem Besteigen des Flugzeuges war es, als wäre ich in die Welt eines Kinofilmes gerutscht – nur dass es für unvoraussehbare Zeit kein Entkommen aus dieser noch kaum begonnenen Filmwelt gab.
Mein ganzes Leben, vierundzwanzig Jahre lang, hatte ich bis auf sechs Monate Sprachaufenthalt in Großbritannien, eingekeilt im kleinen westlichen Teil Österreichs, in Tirol verbracht. Mit sechzehn hatte ich das erste Mal durch den Einfluss meiner damaligen recht hübschen Englischlehrerin etwas von der weiten, in meiner Heimat nicht nur durch die Berge begrenzten Welt gespürt. Und seit damals wuchs auch in mir der Traum, endlich einmal aus meinem schönen, heilen Leben auszubrechen. Doch ganz so einfach war das gar nicht, denn zum Ersten musste ich noch zwei lange Jahre die Schulbank drücken, und zum Zweiten hatte ich auch noch kaum gearbeitet, und somit stand meinem ersten Fluchtversuch vorerst alles im Wege. Aber der Wunsch danach schlief in mir, und wenn ich mit meinen Freunden darüber sprach, lachten alle, denn kaum jemand verspürte dasselbe Bedürfnis. Der Schulabschluss nahte. Obwohl es hieß, von meiner heimlich verehrten Englischlehrerin Abschied zu nehmen, so bedeutete es auch eine bisher kaum gekannte Freiheit.
Als ich dann den nach zwei Monaten hart verdienten Arbeitslohn endlich in den Händen hielt, juckte es mich, und nachdem ich meine Eltern vom ernsten Willen, in London Englisch lernen zu wollen, überzeugt hatte – ich weiß immer noch nicht, wie mir das gelungen war –, gab es nur noch die Angst vor dem Ungewissen, das auf mich zukam, in mir. Doch als ich mich an einem Sprachcollege angemeldet hatte und der größte Teil meines ersten selbstverdienten Geldes durch eine Anzahlung im Nu weg war, gab es kein Zurück mehr. Und dieser Schritt sollte mein ganzes Leben, bis zum heutigen Tag, bestimmen und in eine Bahn werfen, die ich wohl zu jener Zeit nie hätte ahnen können – denn dort traf ich meine erste und bis jetzt auch einzige große Liebe, Satoko, eine Japanerin.
Es war an diesem regnerischen Montagabend Mitte Februar, als ich und mein damaliger italienischer Freund Pietro diesen allwöchentlichen Kaffeeabend unserer Sprachschule aufsuchten. Pietro war an diesem Abend nicht recht begeistert von der Idee, dort hinzugehen, und nur meiner Überredungskunst war es zu verdanken, dass er sich doch entschloss, mich zu begleiten. Als wir eintrafen, war es überraschend still im untersten Stock unserer Schule, wo dieses Treffen immer stattfand. Ich öffnete rein zufällig die Tür zu einem der Klassenzimmer und spähte hinein, und da war es auch schon zu spät. Ich hätte mir denken können, dass etwas faul an der ganzen Sache war, doch jetzt, da wir von Lehrern und den spärlich gekommenen Schülern gesehen worden waren, gab es kein Zurück mehr. Es war einer dieser langweiligen Spielend-lernen-Abende, die wir immer zu vermeiden trachteten. Pietros Gefühl hatte ihn also nicht getäuscht und ich konnte verstehen, dass er recht schlecht auf mich zu sprechen war. Als wir eintraten, fand gerade die Partnersuche für ein neu beginnendes Wörterkettenspiel statt, und wie es der Zufall so wollte, kamen dieses damals so klein und zierlich erscheinende japanische Mädchen Satoko und ich zusammen. Es stellte sich heraus, dass wir schon seit über einem Monat Klassenkollegen waren, nur hatte ich bis jetzt eigentlich noch nie so richtig Notiz von ihr genommen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich von diesem Moment an kaum noch an etwas erinnern kann, denn als wir so am Boden nebeneinander saßen und Wörter aufschrieben, konnte ich plötzlich außer ihr nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Es war wohl wirklich "Liebe auf den ersten Blick".
Von dort an sahen wir uns fast jeden Tag und unsere Long-Distance-Beziehung begann, denn nach knapp vier Wochen musste ich zurück nach Österreich.
Während dieser Zeit schrieben wir uns viel, manchmal fünf und noch mehr Briefe pro Woche, und meine Liebe zu Satoko und auch das Briefeschreiben selbst ließen mich diese eher unangenehme Zeit relativ gut überstehen. Der Ernst des Lebens, das Arbeitsleben, stand unweigerlich vor mir, und da ich eigentlich gar keine Wahl hatte, begann ich bald darauf in einer großen internationalen Firma als Büroangestellter mein kleines Dasein für den großen Traum zu fristen.
Meine Eltern hatte ich recht langsam und ganz gut auf das erste Treffen mit meiner Freundin vorbereitet, aber eigentlich war das von vornherein kein Problem, denn sie waren und sind immer noch recht liberal und ließen mir schon in den etwas stürmischen früheren Jahren viele Freiheiten, die andere in diesem Alter nicht hatten.
Die nächsten drei Jahre verbrachten Satoko und ich getrennt, ich in Tirol und Satoko in London, wir sahen uns jedoch recht häufig und schrieben uns wie immer unaufhörlich Briefe. Auch als sie sich entschied, nach drei langen Jahren nicht nach Japan zurückzukehren und stattdessen in Wien für über ein Jahr noch Deutsch zu lernen, änderte das nicht viel an unserer Situation, denn auch hier konnten wir uns außer am Wochenende kaum sehen. Während all dieser Jahre hatte ich meinen großen Traum, noch einmal eine zeitlich unbegrenzte Reise zu unternehmen, nicht aufgegeben. Er schlummerte in mir, und nur manchmal, wenn mich mein kleines Büro, meine Arbeit oder ganz einfach mein Leben anwiderten, kam mir der Gedanke, alles hinzuwerfen und abzuhauen. Doch wohin? Ohne Satoko konnte ich mir in der Zwischenzeit kaum noch ein Leben vorstellen. Langsam rückte noch dazu das Ende der Zeit in Europa für meine Freundin näher, und als sie den Termin ihrer Rückkehr auf Anfang März festsetzte, kündigte ich kurzerhand und entschied mich, das Abenteuer Japan anzugehen.
Ich muss zugeben, dass ich mich schon einige Monate vorher mit dem Gedanken getragen hatte, doch eine einmal nicht sprachverwandte Sprache zu lernen. Eines Tages nun, ich glaube es war so im September, fand ich ganz zufällig in unserem Briefkasten eine Broschüre der Volkshochschule Innsbruck und unter anderen Sprachen gab es auch einen Anfängerkurs für Japanisch. Ich erinnere mich noch genau, wie eilig ich es plötzlich hatte, mich dort anzumelden, denn womöglich war die Maximalteilnehmerzahl schon überschritten. Ganz so war es dann doch nicht. Kaum fünf Leute hatten sich bis jetzt dafür interessiert und unter diesen befand sich noch dazu der Ehemann der in Österreich lebenden Japanerin Ayako, welche den Kurs führte. Ihr Unterricht war angenehm und ihre vielen Erzählungen über Leute, Land und Kultur in Japan machten das Lernen einfach und interessant. Dennoch dauerte es nur ganze zwei Monate, bis der Kurs mangels Teilnehmern wieder sein Ende fand. Bis dahin hatte ich jedoch schon die einfachste Grammatik und einige wichtige Phrasen gelernt, und heute denke ich, dass dies der wirklich ausschlaggebende Grund für meine Entscheidung, Satoko nach Japan zu begleiten, war.
Je näher der Abschiedstag kam, desto bewusster nahm ich meine Umgebung wahr, denn für wie lange ich meine Heimat, die schönen Berge, meine Familie und Freunde und einfach die friedliche Atmosphäre nicht mehr sehen und fühlen könnte, wusste ich damals noch nicht. Als Ende März mein letzter Arbeitstag kam, spürte ich Erleichterung, aber auch den Druck, ob ich es auch wirklich schaffen könnte und nicht schon nach ein paar Monaten wieder enttäuscht zurückkommen würde. Ich muss eingestehen, dass ich auch Angst hatte. Angst vor dem Ungewissen, dem fremden Land, so weit weg von jeder Hilfe meiner Eltern, mit denen ich bis jetzt gelebt hatte, den Schwierigkeiten und einfach Angst vor der Größe der Welt. Ich würde das erste Mal auf mich ganz allein gestellt sein in einem Land, dessen Sprache ich nicht konnte, dessen Kultur mir fremd war. Satoko hatte schon Anfang März Abschied genommen und war nach über fünf Jahren weg von ihrer Heimat zurückgekehrt nach Japan. Sie stammte aus Osaka, einer Stadt, von der ich eigentlich nur schlechte Dinge gelesen und gehört hatte. Luftverschmutzung plage die Leute und machte das Leben schwer, Menschenmassen in Zügen, U-Bahn-Stationen und Geschäften schon in den frühen Morgenstunden ließen Stress aufkommen, Grünanlagen, geschweige denn da und dort einen Baum gäbe es kaum, und Motorradgangs und Yakuza, die japanische Mafia, würden in den Nächten die Stadt tyrannisieren. Oder waren das doch nur alles Vorurteile und Schauermärchen? Auf jeden Fall gab es jetzt kein Zurück mehr. Drei Wochen hatte ich noch bis zum endgültigen Abschied und die wollte ich, neben meinen Reisevorbereitungen, mit Schifahren und Ausgehen verbringen. Das tat ich dann auch und genoss meine letzten Tage in meiner Heimat. 14. April: Der große Tag war da. Schon Tage vorher hatte ich mit dem Herrichten und Packen meiner Sachen begonnen und brachte es bis zu meinem Abreisetag auf stattliche 23 kg, aufgeteilt auf einen großen Koffer und einen Tramperrucksack den ich neu gekauft hatte. Dank meiner Mutter kam dann auch noch ein Anzug dazu. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich nur mit zwei Paar Jeans und meinem Jogger gefahren, aber mit „in Japan trägt doch jeder einen Anzug, du wirst schon sehen", war ich zwar immer noch nicht von der Wichtigkeit eines Anzugs überzeugt, aber überredet. Als ich dann um 7:00 Uhr früh mein Gepäck aufnahm und vor unser Haus, in dem ich aufgewachsen war, trat, war mir doch recht mulmig zumute, fast melancholisch. Überaus schwerer fiel mir der Abschied von meiner damals erst 15-jährigen Schwester Nina, die mich nicht wie meine Eltern zum Flughafen München-Riem begleitete. Endlich saß ich auf dem Rücksitz unseres Autos und von niemandem beobachtet, wischte ich mir dann doch eine Träne aus den Augen. Am Flughafen ging alles recht schnell und nach vielen Umarmungen und Küssen meiner Eltern war ich allein.
Und jetzt saß ich im Flugzeug. München – Paris – Anchorage – Tokyo – Osaka. 21 Stunden Reisezeit und bis jetzt waren noch nicht einmal ganz acht Stunden vergangen. Die verdunkelte Kabine des Flugzeuges und das leise Zischen der Klimaanlage gaben mir das Gefühl von Ruhe, und in der Abgeschlossenheit fühlte ich mich nach all dem Stress und der Aufregung der letzten Tage geborgen. Neben mir saß zusammengekauert ein kleines, etwas rundliches Mädchen und ich sah ihr an, dass auch sie den Flugzeugsitz nicht besonders bequem fand. Ich muss dann endlich etwas eingeschlafen sein, denn als ich aufwachte, roch es nach Kaffee und die Stewardess reichte gerade ein Tablett mit dem Abendessen herüber. Oder war es doch das Frühstück? Ich hatte jegliches Zeitgefühl verloren, und da mir schrecklich langweilig war, begann ich mit meiner Sitznachbarin zu plaudern. Es handelte sich mehr um eine Zeichensprache als eine Konversation. Jedenfalls war ihr Name Michie, so viel konnte ich herausbekommen. Ihr flaches, etwas blasses Gesicht passte recht gut zu ihrem übrigen Aussehen und ihre tief schwarzen dauerwellgelockten, langen, wie eine Löwenmähne aufgebauschten Haare ließen ihren Kopf noch größer erscheinen. Sie hatte gerade als Austauschstudentin zwei Monate in München Deutsch gelernt, doch da uns schon ermüdet durch den Flug und auch aus Mangel an Wörtern die Kommunikation etwas schwerfiel und ermüdend war, zückte ich aus meinem Rucksack unter meinem Sitz mein kleines Reiseschach. So verbrachten wir die nächsten Stunden angeregt mit Schachspielen und die Zeit verging fast wörtlich genommen wie im Flug. Als dann endlich die Meldung des Piloten, dass wir im Landeanflug auf Tokyo seien, durch die Bordsprechanlage kam, waren meine Müdigkeit und Trägheit im Nu vergangen. Noch einmal gingen mir meine Zweifel durch den Kopf. Würde ich mich als Junge vom Land im Dschungel der Großstadt zurechtfinden, mich an das Leben und die fremde Kultur anpassen können? Wie würden mich, den Gaijin, die Leute behandeln? Was würden Satokos Eltern denken, wenn ich plötzlich auftauchte und mich als Freund ihrer Tochter vorstellte? Es ist unmöglich, mich an all das, was mir damals durch den Kopf ging, zu erinnern, aber Angst vor dem Ungewissen beschreibt vielleicht am besten, was ich fühlte.
Dann ging alles recht schnell, und nach einem kurzen Zwischenstop am Flughafen Narita in Tokyo und einem weiteren anderthalbstündigen Flug Richtung Süden nach Osaka setzten wir endlich am Flughafen Itami auf. Meine Traumwelt Japan war Wirklichkeit geworden.
Es war heiß, als ich aus dem Flugzeug stieg, und die Luft atmete sich weich und leicht, wahrscheinlich durch die hohe Luftfeuchtigkeit, die sich auf der Inselwelt Japan durch das nahe gelegene Meer ergab. Der Flughafen selbst war kaum anders als die wenigen Anderen, die ich bis jetzt gesehen hatte, jedoch überraschenderweise für eine Drei-Millionen-Stadt und Metropole wie Osaka mit einem Einzugsgebiet von über fünfzehn Millionen Leuten relativ klein. Einen Tag vor meiner Abreise hatte ich Satoko noch einmal angerufen, und sie versicherte mir, mich vom Flughafen abzuholen. Ich hoffte innig, sie würde auch wirklich da sein. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich für die ersten Tage wohl ohne sie nicht allein auf die Straße wagen würde, aus Sorge, gleich verloren zu gehen. Ich folgte den anderen Passagieren meines Fluges zur Passkontrolle und trat, nachdem ich mein Gepäck abgeholt hatte und am Zoll vorbei war, nach draußen in die Ankunftshalle.
Das Erste das mir auffiel, war, dass ich plötzlich weit und breit der einzige Ausländer war, umgeben von Hunderten auf andere Fluggäste wartenden Japanern. Ich fühlte mich ihren Blicken ausgesetzt und unwohl. Plötzlich war ich das Tier im Zoo, so ging es mir durch den Kopf. Einige der Leute starrten mich auch unverhohlen mit großen Augen an. Trotz der vielen Leute erkannte ich Satoko sofort. Erleichterung. Wir umarmten uns, doch was war das? War sie nicht ein wenig zu kühl und abweisend? Warum bekam ich keinen Kuss? Da war wieder der alte eifersüchtige Gerald. Ich musste über mich lächeln. Irgendwie verdrängte ich es dann und schob diese dummen Gedanken meiner Müdigkeit zu.
Aus ihren früheren Erzählungen wusste ich, dass Satoko ganz in der Nähe des Flughafens im Haus ihrer Eltern lebte und dort würde ich die nächsten Wochen verbringen können. Als wir so durch den Flughafen zur Bushaltestelle spazierten, fielen mir die vielen großen und bunten Neon-Werbeschilder auf. Nichts konnte ich lesen. Chinesische oder vielmehr japanische Schriftzeichen überall. Wie schon im Flughafen, gab es auch davor noch jede Menge Leute. Eine unendlich scheinende Menschenschlange wartete am Taxistand. „Verrückt“, ging es mir durch den Kopf. Als wir endlich wieder ein wenig Luft um uns hatten, drehte ich mich um und starrte noch einmal auf das brodelnde Menschengewirr zurück. Pralles Netz mit zappelnden Fischen! Verrückt!
Der unerwartet alte Bus rüttelte uns durch. Draußen pfiff die fremde Welt vorbei. Immer wieder sah ich rote Lampions vor Geschäften. Konnte ich am Flughafen wenigstens noch ab und zu ein englisches Wort geschrieben finden, so wäre ich auf mich alleingestellt jetzt hoffnungslos verloren gewesen. Nicht einmal die Straßenzeichen und Wegweiser waren auf Englisch. Ich war eingetaucht in das Meer von Eindrücken, Häusern, Menschen und unlesbaren Schriftzeichen. Der Bus hielt. „Get off", hörte ich Satoko schreien. Mit all meinem Gepäck war es gar nicht so leicht, mich durch die gedrängt stehenden Menschen im Bus zu schieben. Geschafft! Der Bus war weg. Da standen wir. Ein Zug ratterte ein wenig entfernt durch die Stadt, Autos zischten vorbei. Es war heiß. Weiter. Stress.
Nachdem wir den Bahndamm überquert und hinter uns gelassen hatten, kamen wir in ein etwas ruhigeres Gebiet. Die Hochhäuser und Banken hatten kleineren, recht zierlichen, privaten Wohnhäusern mit kleinen Vorgärten Platz gemacht. Alles war gepflegt und sauber. Endlich standen wir vor Satokos Heim, und eigentlich war es bis jetzt gar nicht so schlimm gewesen, denn von der Bushaltestelle bis hierher hatte es weniger als zehn Minuten gedauert. Als wir ankamen, arbeitete Satokos Vater gerade im Garten. „Konnichi wa. Hajimemashite", was so viel heißt wie „Guten Tag", hatte ich mir vorgenommen zu sagen. Es kam dann doch anders heraus. Jedenfalls lächelte er und sagte etwas Ähnliches. Ich schätzte ihn so auf 55 Jahre. Er war mindestens einen Kopf kleiner als ich. Sein Haaransatz war schon recht weit zurückgegangen, jedoch seine dicken, noch recht starken, kaum angegrauten Haare gaben ihm ein fast jugendliches Aussehen. Sein Gesicht war flach, freundlich. Seine etwas zusammengekniffenen Augen strahlten Wärme aus. Wir verstanden uns, jedoch die Worte fehlten dazu, denn er sprach weder Englisch noch ich Japanisch.
Vor der Eingangstür empfing uns Satokos Mutter. Sie war so um die Fünfzig, noch kleiner als Satoko, und es war ihr anzusehen, dass sie Spaß liebte. Ihr Gesicht drückte Heiterkeit aus und ihr burschikoser, kurzer Haarschnitt unterstrich dies noch.
Ihren Gesten entnahm ich, dass sie mir das Haus zeigen wollte. „Ojama shimasu". Von der Diele aus ging es über eine kleine Holzstufe, vor der einige Paar Schuhe standen, in die eigentlichen Wohnräume. Diese waren abgetrennt mit einer naturholzgitterartigen Schiebetür, die mit weißem Papier bespannt war. Dieses alte traditionelle Zeichen japanischer Innenarchitektur hatte ich in einem Wohnhaus wie diesem nicht erwartet. Auch drinnen war alles recht zierlich und klein und ganz eindeutig nicht für Menschen meiner Körpergröße gebaut. Naturfarben wie Braun und Beige überwogen. Der ganze untere Teil des Hauses bestand eigentlich neben Küche und Bad nur aus einem einzigen großen Raum, der durch eine cremeweiße, mit Reisähren bemalte und mit einem schwarz lackierten Holzrahmen gefasste Papierschiebetür geteilt war. Der Raum, in dem ich stand, hatte ganz eindeutig westliche
Strukturen und wurde, wie ich annahm, als Esszimmer benutzt. Durch die halb geöffnete Schiebetür jedoch blickte ich in ein ganz anderes Zimmer. Der Boden war mit Tatami, das sind Reisstrohmatten, ausgelegt, und außer einem nur etwa 30 cm hohen, länglichen Tisch, einem kleinen Wandschrank und einem Fernseher in einer Ecke gab es nichts. Es war ein sehr schlichter und doch zugleich warmer Raum. Später erfuhr ich, dass sich in diesem Zimmer das eigentliche Familienleben abspielte. Es war dort, wo man am Nachmittag grünen Tee trank, abends zusammen am Boden saß und die Füße unter den Tisch steckte, wo Satokos Eltern schliefen und wo man sich auch zum Frühstück wiedertraf. Vorbei ging es an der winzigen Küche, aus der ein Schwall warmer, dampfender, nach bisher nicht gekannten Gewürzen riechender Dampfwolken herausströmte.
Über eine steil nach oben führende Holzstiege wurde ich dann von Mieko, Satokos Mutter, in mein eigentliches Zimmer geführt. Beim Eintreten sagte sie noch etwas, doch war es leider schon zu spät und ich hatte mir am niedrigen oberen Holzrahmen der Schiebetür schon meinen Kopf angehauen. Ich sah ihr an, wie sie sich bemühte, ein Lachen zu unterdrücken. „Nicht für meine Körpergröße gebaut", übersetzte mir meine Freundin. Das Zimmer selbst war kaum anders. Es war, wie ich später des Öfteren nachgemessen hatte, so um die fünf Meter lang und nicht einmal 1,90 Meter breit. Der Boden war wie auch das restliche Haus mit Tatami ausgelegt. Am jeweiligen Ende gab es je ein großes Fenster, von denen aus man die nur knapp zwei Meter entfernten Wände der Nachbarhäuser fast berühren konnte. Trotzdem fühlte ich mich wohl. Es roch süßlich nach Reisstroh und Holz. Von draußen hörte ich das Klingeln und Rasseln einer nahe gelegenen Pachinko-Halle und das Surren und Zischen einer kaputten Neon-Werbeschrift. Was für eine fremde Welt.
Nachdem ich mich frischgemacht hatte, kam auch schon Satoko, um mich zum Abendessen zu holen. Ich wünschte mir ein bisschen Zeit, um meine Gedanken zu ordnen und meine Eindrücke zu verdauen.
Der Esstisch war inzwischen randvoll mit kleinen Tellern gedeckt, auf denen buntes Gemüse, Pickels und einige recht undefinierbare andere Speisen angerichtet waren. Als Hauptspeise gab es Tonkatsu, mit Brösel panierte Schweinsfilets und dem Geschmack nach ganz wie ein österreichisches Wienerschnitzel. Dazu klebrigen, strahlendweißen Reis. Mieko hatte gedacht, man müsse mich langsam in die kulinarische Welt Japans einführen und mich nicht schon am ersten Tag mit extravaganten Sonderheiten schockieren. Ich war froh darüber. Sie war eine ganz ausgezeichnete Köchin, wie ich im Laufe der nächsten Monate herausfinden sollte, und da auch eines meiner liebsten Hobbys das Kochen und vor allem das Essen war, verstanden wir uns gut.
Nachdem wir unser Abendessen und auch unsere Konversation mit dem Nachtisch, einer roten, geleeartigen süßen Bohnenpaste, abgerundet hatten, schlug Yoshinobu einen Spaziergang vor. Er wolle mir noch vor dem Schlafengehen das Stadtviertel Toyonaka, in dem ich jetzt wohnte, zeigen.
Als wir hinaustraten in den zierlichen Garten, hatte es zu dämmern begonnen und war schon fast dunkel geworden. Ein seltsamer Geruch lag in der Luft und es war angenehm warm. Yoshinobus Garten war nicht mehr als ein links und rechts jeweils ein Meter breites Blumenbeet, dazwischen führte ein mit eigroßen, runden Bachsteinen ausgelegter Weg zum Hauseingang. Veilchen blühten und im Hintergrund gab es einen fast wie einen Bonsai zugeschnittenen Pinienbaum und einen Ahornstrauch mit filigranen, blass-grün glänzenden kleinen Blättern. Auf dem Erdboden wucherte Moos.
Kaum hatten wir den Bahndamm überquert, wurde es wieder belebter und vor allem lauter. Die schmalen Straßen und Gassen waren bunt mit Neonreklameleuchten beleuchtet und hell. Aus einer Karaokebar dröhnte Musik. Zu viele Eindrücke für den ersten Tag. Nie im Leben hätte ich aus diesem Straßengewirr je wieder herausgefunden. Ich war verwirrt, vor allem aber auch müde und froh, als wir wieder zu Hause ankamen.
In meinem Zimmer war bereits meine Schlafstätte ausgebreitet worden. Der Futon, eine etwa 10 cm dicke mit Pflanzenfasern gefüllte Matratze, fühlte sich weich an und duftete würzig. Ich hätte mir gerne noch einmal mein heute Erlebtes durch den Kopf gehen lassen, als ich da so lag, aber es dauerte nur Minuten, bis ich in einen tiefen, traumlosen Schlaf fiel. „Oyasumi nasai!"
2. KAPITEL
Es dämmerte, als ich aufwachte, fast noch dunkel war es draußen. Als ich da so in diesem fremden Zimmer lag, ging mir durch den Kopf, wie sich mein Leben, seit ich Satoko kennen gelernt hatte, doch verändert hatte. Fünf Jahre waren wir nun schon zusammen und ich war immer noch vernarrt in sie wie am Anfang. Welchen Lauf hätte mein Leben doch genommen, wenn wir uns nicht an diesem verregneten Montagabend in dieser Englischschule in London getroffen hätten? Wahrscheinlich hätte ich mich dann doch nie zu einem weiteren Ausriss aufraffen können und wäre immer noch zu Hause im Dorf, würde täglich in den einzigen Pub gehen und über den letzten Urlaub sprechen. Jetzt, da ich hier lag, hätte ich nie mehr getauscht. Ich war in meinen einzigen großen Traum gerutscht. „Traum und Wirklichkeit! Kein Unterschied!“, ging es mir durch den Kopf.
Ganz so war es dann doch nicht, als ich durch lautes Pochen an der Tür aus meinem Halbschlaf und damit zurück in die Wirklichkeit des Traumes gerissen wurde. Inzwischen war es draußen schon hell geworden. Satoko stand mit einer Tasse gelblichem, ungesüßtem und recht herb schmeckendem grünen Tee in der Tür. Wie mir schon am Vortag beim Abendessen erzählt wurde, hatte man sich bereits nach Japanisch-Sprachschulen für mich umgesehen und auch eine gefunden, deren Sprachkurs für Anfänger gerade erst vor vier Tagen begonnen hatte. Die rationale japanische Denkweise ließ mir auch nicht nur einen Tag Zeit, um mich zu orientieren. Aber die Sprache zu erlernen war ja auch neben Satoko einer der Hauptgründe gewesen, hierher zu kommen und Zeit zur Orientierung würde ich ohnehin noch genug haben.
Das Frühstück überraschte mich. Auf dem Tablett am Tatami-Boden in Satokos Zimmer, das neben meinem im ersten Stock lag, gab es eine Schüssel mit fast leuchtend weißem Reis, dazu ein verquirltes rohes Ei, Sojasauce, eingelegtes Gemüse und eigenartige papierähnliche Streifen getrockneten Seegrases, welches Nori hieß. All das aßen wir auf dem Boden sitzend, vor dem laufenden Fernseher, aus dem die ratternde Stimme einer Reporterin kam. Nebenbei erklärte mir Satoko meinen für heute geplanten Tagesablauf. Da sie zur Arbeit gehen müsse, würde mich ihr Vater Yoshinobu am Morgen so gegen halb neun zur Schule begleiten und mir auf dem Weg dorthin genauestens erklären, wie man Tickets kauft und mit welchem Zug ich wieder zurückfinden würde. Mit dem mir in die Hand gedrückten U-Bahn- und Zugplan konnte ich beim besten Willen nichts anfangen. Das Gewirr von bunten Linien, verbunden mit den nur auf Japanisch angeschriebenen Stationsnamen, war im wahrsten Sinne des Wortes verwirrend und zugleich auch beängstigend, denn versehentlich in den falschen Zug gestiegen, schien es mir schier unmöglich, alleine wieder aus diesem Irrgarten herauszufinden. Am Nachmittag würden Satokos Vater und sie selbst dann mit mir zu einem für Osaka recht berühmten Gebiet zum Kirschblütenschauen gehen.





























