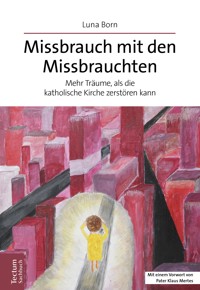
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Luna Borns Geschichte als Missbrauchsopfer der römisch-katholischen Kirche ist bewegend und aufrüttelnd zugleich. Schonungslos schildert sie ihren langen Weg durch die Instanzen und das Ankämpfen gegen das System Kirche. Die klerikalen Widerstände, auf die die Autorin bei ihrem Spießrutenlauf von der Anzeige bis zur Anerkennung gestoßen ist, lassen uns fassungslos zurück. Das Besondere an Luna Borns Fall: Sie wird letztendlich von einem nicht zuständigen Bistum im Namen der katholischen Kirche als Opfer anerkannt, nachdem das eigentlich zuständige Bistum den Vorgang über Monate hinweg verschleppt hatte. Umfangreiches Beweismaterial eröffnet uns den Blick auf die ungeheuerliche Dimension dieses Skandals. Mit ihrer Geschichte legt Luna Born exemplarisch offen, welche Strukturen in der katholischen Kirche Missbrauch begünstigen und verschleiern. Ihr Lebensweg macht anderen Betroffenen Mut und ist ein wertvolles Zeugnis für alle, die mit Betroffenen arbeiten und sich für einen würdevollen Umgang mit Missbrauchsopfern engagieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Luna Born
Missbrauch mit den Missbrauchten
Luna Born
Missbrauch mit den Missbrauchten
Mehr Träume, als die katholische Kirche zerstören kann
Tectum Verlag
Luna Born
Missbrauch mit den Missbrauchten
Mehr Träume, als die katholische Kirche zerstören kann
© Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2019
E-Pub 978-3-8288-7290-5
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN 978-3-8288-4340-0 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlaggestaltung: Tectum Verlag, unter Verwendung eines Gemäldes der Autorin
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internet:www.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeAngaben sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für meine Kinder,
die keine Kinder mehr sind,
und für meine Eltern,
die seit dem KleinenWunder
wieder meine Eltern sind
Vorwort
Im Bayerischen Rundfunk wurde im Frühjahr 2019 ein bemerkenswertes Gespräch zwischen der ehemaligen Nonne Doris Wagner und dem Wiener Kardinal Christoph Schönborn ausgestrahlt.1 Thema des Gesprächs war – vor dem Hintergrund der persönlichen Missbrauchserfahrungen von Doris Wagner in der katholischen Ordensgemeinschaft DAS WERK – der geistliche und sexuelle Missbrauch in der katholischen Kirche. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten als Höhepunkt des Gesprächs den Moment, als Doris Wagner Kardinal Schönborn fragte: „Glauben Sie mir meine Geschichte?“ Kardinal Schönborn antwortete: „Ja, ich glaube Ihnen.“
Der Kardinal hätte mehrere andere Möglichkeiten gehabt, auf diese Frage zu antworten. Entweder: „Ich muss erst die andere Seite hören, bevor ich mich entscheide, ob ich Ihnen glaube.“ Oder: „Sollte Aussage gegen Aussage stehen, so gilt die Unschuldsvermutung für die von Ihnen beschuldigten Personen.“ Er hätte auch eine Unterscheidung treffen können: „Persönlich glaube ich Ihnen, aber in meiner Eigenschaft als Kardinal bin ich eine Amtsperson, und da bin ich an Verfahren gebunden, bevor ich die Entscheidung treffe, wem ich glaube.“ Oder: „Unter vier Augen beantworte ich Ihnen diese Frage gerne. Aber hier vor laufenden Kameras geht das leider nicht.“ All dies tat Kardinal Schönborn nicht. Er sagte einfach: „Ich glaube Ihnen.“
Ich vermute, dass Kardinal Schönborn nach dieser Antwort viel Kritik und Anfeindung erfahren hat und erfährt. Der Hauptvorwurf gegen ihn wird wohl lauten: „Wie können Sie die Unschuldsvermutung, ein zentrales Gut des Rechtsstaates, im Umgang mit Beschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs einfach aufkündigen? Die Unschuldsvermutung gilt doch auch für Priester. Als Bischof haben Sie im Übrigen auch eine besondere Fürsorgepflicht gerade gegenüber den Priestern.“
Zu den immer wiederkehrenden Vorwürfen gegenüber kirchlichen Aufarbeitungsprozessen gehört die Behauptung, dass es neben den Opfern von Missbrauch inzwischen auch eine zweite Kategorie von Opfern gibt: fälschlich beschuldigte Priester. Nun will ich zwar nicht leugnen, dass es diese Fälle auch gibt – und dass die Beschuldigten in solchen Fällen selbstverständlich Anspruch auf volle Rehabilitation haben. Oft wird aber auch zur Begründung der Behauptung darauf hingewiesen, dass Gerichte Anklagen – sofern sie nicht wegen der Verjährungsfrist oder aus anderen Gründen von der Staatsanwaltschaft im Vorfeld schon abgelehnt wurden – aus Mangel an Beweisen zurückgewiesen haben, das heißt im Namen der Unschuldsvermutung. Doch mit solchen Urteilen ist gerade nicht gesagt, dass Falschbeschuldigungen vorliegen. Der deutsche Bundesgerichtshof formuliert das so: „Verurteilt werden darf ein Angeklagter nur dann, wenn sich das Gericht (…) die feste Überzeugung, d.h. die persönliche Gewissheit verschafft hat, dass der Angeklagte die ihm vorgeworfene Tat begangen hat. Kann das Gericht diese uneingeschränkte Überzeugung nicht erlangen, so muß es nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten diesen freisprechen, mag ein noch so hoher Grad von Wahrscheinlichkeit für seine Täterschaft sprechen.“2 Kurzum, ein Freispruch ist zwar zwingend geboten, wenn das Gericht nur zu 99 % von der Schuld des Angeklagten überzeugt ist. Das verbietet jedoch Freunden, Angehörigen und Seelsorgern keineswegs, weiterhin dem Opfer zu glauben.
Genau um dieses schwierige, komplexe, nicht vermeidbare Problem geht es in dem vorliegenden Erfahrungsbericht von Luna Born: Welche Rolle spielt die Bereitschaft zu glauben, und welche Rolle spielt die Unschuldsvermutung, wenn Vertreter kirchlicher Institutionen – Ordensobere, Bischöfe, Missbrauchsbeauftragte – den Berichten von Betroffenen begegnen? Kommen sie den Betroffenen mit einer Haltung des Vertrauens entgegen, oder nehmen sie die Haltung einer von der Unschuldsvermutung her begründeten methodischen Skepsis ein? Und wie sieht dies jeweils aus der Perspektive der Betroffenen aus? Lassen sich Vertrauen und methodische Skepsis miteinander verbinden, oder ist hier zunächst eine Entweder-oder-Entscheidung bei den kirchlichen Vertretern gefragt? Und wenn ja: Gibt es dafür Kriterien? Es gibt ja keinen Automatismus des Glaubens.
Unschuldsvermutung
Der Schlüssel zum Verständnis der vorliegenden Geschichte von Luna Born scheint mir also die Frage nach dem Status der Unschuldsvermutung bei der Aufarbeitung von Missbrauch zu sein. Unbestritten ist: Die Unschuldsvermutung ist eine hart erkämpfte Errungenschaft des Rechtsstaates. Im deutschsprachigen Raum war es übrigens der Jesuit Friedrich Spee, der in seinem epochemachenden Werk Cautio Criminalis von 16313 die elementare Bedeutung des Grundsatzes in dubio pro reo / im Zweifel für den Angeklagten herausgearbeitet hat. Mit der Unschuldsvermutung geht die Überzeugung einher, dass der Staat mit dem Anspruch überfordert ist, vollkommene Gerechtigkeit herzustellen. Im Fall der Fälle muss er auf die Gefahr hin, dass Opfer nicht zu ihrem Recht kommen, die beschuldigte Person frei gehen lassen, sofern ihre Schuld nicht zweifelsfrei bewiesen werden kann.
Für die Aufarbeitung von Missbrauch in Institutionen, insbesondere auch in der Kirche, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass es für die Beziehung zwischen Institution und betroffenen Personen eine Ebene geben muss, die mit juristischen Kategorien nicht vollständig erfasst werden kann, sondern ihr vorgelagert ist. Ich erinnere mich an Begegnungen mit den Betroffenen von sexuellem Missbrauch durch Jesuiten am „Eckigen Tisch“ in Berlin im Jahr 2010. Es gab zwei Punkte, die im Vorfeld zu klären waren: zum einen der Anonymitätsschutz für diejenigen Opfer, die diesen Schutz für sich beanspruchten, obwohl gleichzeitig die Begegnung unter hoher öffentlicher Beobachtung stand. Zum anderen aber auch die Klärung der Gesprächsebene selbst, auf der wir uns gemeinsam bewegen würden: Die Anwälte hatten uns Jesuiten vor allen Äußerungen während der Begegnung gewarnt, die anschließend in juristischen Verfahren von anwesenden Betroffenen „gegen uns“ verwandt werden könnten. Sich darauf einzulassen hätte aber bedeutet, dass wir den Betroffenen gegenüber nur stumm zuhörend dagesessen hätten. Eine Begegnung, die diesen Namen wenigstens ansatzweise verdient, hätte es dann nicht gegeben. So war es auch wichtig, im Vorfeld klarzustellen, dass die Sprache, die wir unsererseits sprechen würden, nicht im Sinne juristischer Terminologie zu verstehen sei.
Vor dem juristischen Diskurs liegt der Vertrauensdiskurs. Aus der Geschichte von familiärem Missbrauch ist ja bekannt: Ein Kind muss im Durchschnitt sieben Mal sprechen, bevor man ihm glaubt. Wenn Eltern ihren Kindern, die ihnen von einem Verbrechen berichten, das ihnen angetan wird, mit der Haltung begegnen: „Bevor ich dir glaube, muss ich erst einmal überprüfen, ob das stimmt, was du sagst, indem ich der bezichtigten Person die Chance gebe, sich auch dazu zu äußern“, bedeutet dies, dass Eltern ihren Kindern zunächst einmal nicht glauben. Es ist aber für die Qualität der Beziehung entscheidend, ob ich sofort oder zögerlich glaube. Ähnliches gilt für pädagogische Beziehungen und auch für die Seelsorge: Seelsorger oder Seelsorgerinnen haben das Recht, Vertrauen und Glauben zu schenken. Das ist keineswegs ein Freibrief für Beliebigkeit: Die Glaubenszusage in einem vertrauensvollen Gespräch ist im Fall der Fälle kein irrationaler Akt. Vielmehr gibt es benennbare Kriterien für Glaubensentscheidungen, Plausibilitätskriterien, Glaubwürdigkeitskriterien, Übereinstimmungen mit Aussagen anderer Personen, Disclosure-Effekte und vieles andere mehr.
In kirchlichen Äußerungen, auch von höchsten Stellen, ist erfreulicherweise inzwischen zu vernehmen, man sei bereit, den Opfern zuzuhören. Das bedeutet aber, wenn es nicht bloß um eine formale Anhörung gehen soll: nicht in der Haltung einer Person zuzuhören, die methodisch an Verdachtshermeneutik auf das Gesagte hin festhalten muss, da sie die Unschuldsvermutung im Hinterkopf hat. Eine Grundbereitschaft zu glauben muss da sein, wenn man mit Empathie für die Person und mit Interesse an dieser Person zuhören will.
Nun sind aber Bischöfe, Schulleiter oder Pfarrer nicht nur Seelsorger, sondern auch Amtspersonen mit Verpflichtungen gegenüber beschuldigten Personen. Es waren die Mitarbeitervertretungen in den kirchlichen Institutionen, die Bedenken gegenüber einer zu großen Vertrauensbereitschaft von Vorgesetzten gegenüber „mutmaßlich“ Betroffenen hatten, denen gegenüber dann die bezichtigten Angestellten keine Chance mehr hätten. Der Rollenkonflikt zwischen empathisch-seelsorglichem Zuhören und den Pflichten als Amtsperson kann Vorgesetzte tatsächlich überfordern. Das ist der Hauptgrund dafür, dass in den kirchlichen Richtlinien die Stelle des „unabhängigen Beauftragten“ als Ansprechperson geschaffen wurde, die das Recht hat, Betroffene in dem Prozess zu begleiten, ohne – gerade wegen ihrer Unabhängigkeit – in den Loyalitätskonflikten zu stecken, in denen die Amtspersonen stehen. Im Fall des vorliegenden Berichts von Luna Born scheint mir das bisherige Scheitern des Aufarbeitungsprozesses damit zu tun zu haben, dass in allen entscheidenden Augenblicken dann doch die Bereitschaft zu glauben oder sogar die bereits gegebene Zusage zu glauben durch das Beharren auf der Unschuldsvermutung ausgesetzt wurde. Der juristische Diskurs siegt über die Beziehungs- und Begegnungsdimension, auf die Betroffene angewiesen sind – und die im Übrigen auch heilend werden kann für die betroffene Institution.
Hier liegt übrigens auch das Problem all jener kirchlichen (und anderen öffentlichen) Äußerungen, welche die „Aufarbeitung“ sämtlich an die Staatsanwaltschaften delegieren wollen. Einerseits: Im Rahmen der geltenden Gesetze gilt, dass Strafvereitelung strafbar ist – das trifft selbstverständlich auch auf Personalverantwortliche und Bischöfe zu, die Straftaten vertuscht und Täter vor der strafrechtlichen Aufarbeitung geschützt haben, sodass diese sich heute hinter der Verjährungsfrist verstecken können. Kirchliche Autoritäten sind dazu verpflichtet, bei Gesetzesverstößen von Klerikern und anderen Angestellten mit den staatlichen Autoritäten zusammenzuarbeiten. Es gibt kein Sonderstrafrecht für Kleriker und kirchliche Angestellte. Andererseits: Die Aufgabe der Gerichte besteht in der strafrechtlichen Aufarbeitung von Straftaten nach der Maßgabe rechtsstaatlicher Prinzipien – und dazu gehört die Unschuldsvermutung. Gerade deswegen machen viele Opfer mit der öffentlichen Gerichtsbarkeit sehr schmerzliche Erfahrungen. Bedürfnisse nach Vertrauens- und Anonymitätsschutz werden sehr oft nicht angemessen berücksichtigt. Wenn der Missbrauch Jahre zurückliegt, schlägt die Verjährungsfrist zu. Und schließlich enden Verfahren sehr oft mit Freispruch für die Beschuldigten aus Mangel an Beweisen, nachdem Aussage gegen Aussage stand. Für die Betroffenen beginnt nach solchen Erfahrungen mit der staatlichen Gerichtsbarkeit eine neue Phase der Ausgrenzung.
„Anerkennungszahlung“
Am Bericht von Luna Born fallen die Ambivalenzen der kirchlichen Gesprächspartner im Umgang mit den „Anerkennungszahlungen“ auf. Das entspricht der Logik ihrer Geschichte, weil die Zahlung ja der materielle Ausdruck einer „Anerkennung“ ist, oder anders gesagt: Weil die Institution mit der Auszahlung der 5.000 Euro ihre Zusage „Ich glaube dir“ materialisiert. Aber genau dieses „Ich glaube dir“ steht in der Geschichte von Luna Born auf brüchigem Boden. Das spürt die Betroffene ganz deutlich. Und es schmerzt. Es geht nämlich um viel mehr als um Geld.
Das Institut der Anerkennungszahlung von 5.000 Euro basiert auf der Unterscheidung zwischen „Anerkennung“ und „Entschädigung“. Die Anerkennungszahlung ist keine Entschädigungszahlung. Erstmalig durchgeführt wurde sie im Herbst 2010 von uns Jesuiten als materialisiertes „Ich glaube dir“ – übrigens damals gegen erheblichen Widerstand der Deutschen Bischofskonferenz. Ich meine, dass die Einrichtung dieser Zahlung besser ist als ihr Ruf. Sie macht etwas Wichtiges sichtbar und macht im Fall der Geschichte von Luna Born eben auch sichtbar, dass die Zusage des „Ich glaube dir“ nicht trägt.
Die Zahlung war seinerzeit eine Reaktion auf eine Forderung der Opferseite im Frühjahr 2010 an den Jesuitenorden. Die Betroffenen forderten die Auszahlung von (allerdings weitaus höheren) Pauschalbeträgen. Pauschalbeträgen deswegen, da sie der Täterseite, in diesem Fall den Verantwortlichen im Jesuitenorden, nicht das Recht einräumen wollten, selbst zu bestimmen, welches Leid größer und welches Leid geringer war, um dann die „Entschädigungszahlungen“ entsprechend zu staffeln.
Die Höhe der geforderten Beträge war für den Orden nicht darstellbar. Die Forderung nach dem pauschalen Charakter der Beträge war jedoch einsehbar. So kam es seitens des Ordens zu der Entscheidung für den Pauschalbetrag von 5.000 Euro als „Anerkennungszahlung“. Darüber hinaus gab es in vielen Fällen Entschädigungszahlungen im eigentlichen Sinne des Wortes: Finanzierung von nachzuholenden Bildungsabschlüssen, Nachzahlungen bei Therapien, Ergänzungszahlungen für Rentenbeiträge und vieles andere mehr. Solche „Entschädigungszahlungen“ beanspruchten und beanspruchen angesichts der Schwere des zugefügten Schadens nicht im vollen Sinne des Wortes zu „entschädigen“. Dennoch konnte in vielen Fällen eine Ebene der Begegnung gefunden werden, in der Beträge je nach Bedarf individuell vereinbart wurden. Angesichts des „Missbrauchs des Missbrauchs“ gerade in diesem Bereich ist hinzuzufügen: Weder die Anerkennungszahlungen noch die individuell bemessenen Entschädigungszahlungen sind als Schweigegelder zu verstehen. Das wäre sonst die Fortsetzung des Missbrauchs. Keine betroffene Person wird von den kirchlichen Institutionen dazu verpflichtet zu schweigen, um die Täter oder die Institution zu schützen.
Die öffentliche Debatte um Entschädigungsleistungen ist bis heute nicht zur Ruhe gekommen. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass noch keine Regelung gefunden worden ist, die auch auf der öffentlich-politischen Ebene eine Chance hat, einvernehmlich anerkannt zu werden. Es steht bis heute die Frage im Raum, ob die Lösung der Entschädigungsfrage nicht darin bestehen könnte, eine unabhängige Kommission einzurichten, die entscheidet, wie hoch Entschädigungsansprüche im Fall der Fälle sind, und die zugleich Orden und Bistümer dazu verpflichten kann, die Beträge entsprechend auszuzahlen.
Eine solche unabhängige Kommission müsste auf nationaler Ebene agieren. Das wird vermutlich nicht ohne Solidarität zwischen armen und reichen Bistümern, zwischen armen und reichen Orden, zwischen Bistümern und Orden möglich sein. Damit wäre dann aber auch eine Lösung für das Problem gefunden, das in dem vorliegenden Bericht von Luna Born überdeutlich wird: das unterschiedliche Agieren der unterschiedlichen Bistümer. Anerkennungen, die in dem einen Bistum ausgesprochen werden, werden in dem anderen Bistum bestritten und umgekehrt. Den Betroffenen wird ein kafkaesk anmutendes Hin und Her zwischen unterschiedlichen Zuständigkeiten, immer wieder neuen Verfahren und Formalitäten zugemutet, das nachvollziehbar zermürbt und die letzten Vertrauensressourcen auf der Opferseite verbraucht. Denn auch dies ist ja immer mit zu bedenken: Eine betroffene Person, die sich an die Institution wendet, erbringt eo ipso eine Vertrauensleistung, mit der achtsam umzugehen ist.
Rom
Der Bericht von Luna Born macht schließlich deutlich: Niemand weiß, wer in Rom entscheidet, schon gar nicht die Betroffenen. Niemand weiß, was in der Kommunikation zwischen Rom und den Bistümern geschieht. Denn Rom kommuniziert nur durch die Bischöfe. Ich kenne bis heute keinen Fall, in dem eine betroffene Person aus Rom selbst eine Antwort erhalten hat. In Rom spitzt sich das Strukturproblem der katholischen Kirche bei der Aufarbeitung von Missbrauch in dem Maße zu, wie Rom gerade versucht, die Aufarbeitung „römisch“ zu lösen, nämlich „oben“, zentral. Selbstaufklärung in monarchischen Strukturen funktioniert aber nicht.
Mitleidssprache hilft Betroffenen nicht, auch dann nicht, wenn sie aus Rom oder anderen höchsten Stellen erklingt. Das Gegenteil ist der Fall. Mitleidssprache gegenüber Betroffenen beruht auf einer irrtümlichen Rolleneinschätzung. Ganz schwierig wird es, wenn, wie im Fall von Luna Born, Verfahren aus „Mitleid mit den Betroffenen“ eingestellt werden, weil diese angeblich oder tatsächlich durch den Missbrauch und die Aufarbeitung des Missbrauchs in einer schwierigen „psychischen Verfassung“ seien und die Fortführung des Verfahrens ihnen deswegen nicht guttue. Kein Wunder, dass diese Form von „Mitleid“ bei Betroffenen als Zynismus ankommt, nach dem Motto: Je schlimmer der Missbrauch und die Wirkungen des Missbrauchs auf das Opfer, umso schneller muss das Verfahren eingestellt werden, und zwar mit Rücksicht auf die Opfer.
Hinter dieser Logik steht eine Mentalität, die das Schweigekartell um den Missbrauch stabilisiert. Das Argument lautet: Aufklärung und Aufarbeitung ist für die Opfer nicht gut, weil sie die Opfer retraumatisiert. Nun ist es ja richtig: Durch das Öffentlichwerden des Missbrauchs wurden bei vielen Opfern schmerzliche Erfahrungen und Szenen angetriggert, und es begann damit für sie ein äußerst anstrengender Prozess. Und natürlich gab und gibt es auch Betroffene, die sich aus Selbstschutzgründen oder aus Gründen des Schutzes ihrer Familien dazu entschieden haben, kein weiteres Verfahren anzustrengen. Wenn Belastungen für die Betroffenen aber paternalistisch zum Vorwand genommen werden, Betroffene zurückzuweisen, wenn diese darauf drängen, dass das Verfahren in Rom in Gang gesetzt wird, dann ist das blanker Zynismus.
Nicht hilfreich ist es auch, wenn die Mitleidssprache in kirchliche Zornessprache über die Täter und ihre Taten kippt. Jüngstes Beispiel dafür ist die verunglückte Rede von Papst Franziskus zum Abschluss des römischen „Missbrauchsgipfels“ im Februar 2019. In ihr lässt er seinem Zorn gegenüber den Tätern freien Lauf und solidarisiert sich so implizit mit den Opfern. Doch die Solidarisierung beruht auf einer falschen Rolleneinschätzung. Kirchliche Verantwortungsträger entziehen sich so den Opfern als Gegenüber auf der „Täterseite“. Das gilt auch für die Mitleidssprache. Den Schmerz der Opfer „mitfühlen“, ihnen sagen, dass man für sie bete, Bedauern über „Betrüblichkeiten“ bekunden und mit dem Eingeständnis kombinieren, man könne leider nichts tun – all das ist Gift für die Aufarbeitung und eine Belastung für die Betroffenen.
Pater Klaus Mertes, Mai 2019
Der rote Faden
Vorwort
Voraboder Warum mein Buch ein Glücksbuch ist
Liste der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartneroder Um den Überblick nicht zu verlieren
Teil 1
Wie alles begannoder Das Bild von Ösen und Haken
Die Konfrontation oder „Wieso hattest du auch immer so eine süße, rote, kurze Hose an!“
Der Übergangoder Warum es wichtig ist zu wissen, wie alles begann
Aus meinem Tagebuch: Der Schmerz
Das Glücksgefühl, gehört zu werden
Die Ernüchterung oder Der Erstkontakt mit dem zuständigen Bistum
Herr Eins
Der Fragenkatalog
Aus meinem Tagebuch:„KleineWunder“
Hintergrundwissen: Kleine medizinische Abhandlungoder Wie mein Hirn tickt
Wie es im zuständigen Bistum weitergingoder Die verschiedenen Männer des zuständigen Bistums
Herr Zwei
Herr Drei
Herr Vier!
Zurück zum zuständigen Bistum
Herr Fünf und die 1.000 Euro Therapiekosten
Herr Sechs, der Gutachter für das Glaubwürdigkeitsgutachten
Hintergrundwissen: Energetisches Schulterzuckenoder Die Möglichkeit, Verantwortung zu verschieben
Wie es dann weiterging oder Noch mehr Kontaktpersonen – alles Männer!
Herr Sieben, der Sonderbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz
Der zuständige Bischof, Herr Acht
Aus meinem Tagebuch: DU bist nicht allein!
Der Strafrichter sollte es nun richten oder Was zu weit geht, geht zu weit
Herr Neun und Herr Zehn
Hintergrundwissen: Vermischung von staatlichem Rechtssystem und Seelsorge oder Wie es mir gerade gefällt
Die Anerkennung durch das nicht zuständige Bistum oder So sieht Seelsorge aus
Die Zeitungsartikel in der Lokalpresse oderIch gehe an die Öffentlichkeit
Das vorläufige Finale mit dem zuständigen Bistum oder Die Umkehr der Schuldfrage
Hintergrundwissen: Verdrehung des SchuldPfeils
Das vorläufige Happy End oder Mehr Träume, als die katholische Kirche zerstören kann
Der aktuelle Stand oder Das kann ja wohl nicht wahr sein oder Der Fisch stinkt doch vom Kopf her oder Und noch eine Glücksbotschaft
Teil 2
Struktur und Strukturprobleme der katholischen Kirche, die Missbrauch und Vertuschung möglich machen und vereinfachen oder Die Kirche ist nicht schuld,verantwortlich ist der einzelne Mensch
Zwangszölibat
Reiner Männervereinoder Sind Frauen Christen zweiter Klasse?
Die Doppelmoral der katholischen Kirche: Exemplarische Beispiele
Die katholische Kirche und Sexualitätoder „… und wenn was schiefgeht …“
Vorbereitung der Priester auf das Zwangszölibat
Künstlich erhöhte moralische Instanz der Geistlichen
Die Monarchie
Paralleljustiz – eine Ergänzung
Noch einmal: Vermischung von staatlichem Rechtssystem und Seelsorge oder Wie es mir gerade gefällt
Noch einmal: Energetisches Schulterzuckenoder Die Möglichkeit, Verantwortung zu verschieben
Noch einmal: Verdrehung des „SchuldPfeils“
LEITLINIEN
für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker, Ordensangehörige und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz
Das sechste Gebot: Du sollst nicht die Ehe brechen oder „Des Pudels Kern“
Das gute Ende
Danke
Anmerkungen
Abbildungsverzeichnis
Vorab
oder
Warum mein Buch ein Glücksbuch ist
Nun ist es bald so weit! Beim Schreiben dieser Zeilen ist mein Buch fast fertig. Auf der einen Seite kann ich kaum erwarten, es in den Händen zu halten, und freue mich riesig. Auf der anderen Seite macht es mich nervös, wenn ich mir vorstelle, dass es wirklich veröffentlicht werden soll.
Die Cover-Idee gefällt mir sehr gut – das Bild ist eines meiner Lieblingsbilder von denen, die ich 2014 und 2015 gemalt habe. Nach Rücksprache mit meinen privaten Beraterinnen und Beratern werden auch meine anderen Bilder in Farbe mit ins Buch aufgenommen. Das bereitet mir Bauchschmerzen, denn ich halte mich selbst nicht für eine begnadete Malerin. Aber die Bilder haben mir wirklich geholfen. Das große Thema war und ist „Gefühle malen“, denn es war sehr schwierig, Gefühle zu fühlen und sie dann auch noch zum Ausdruck zu bringen. Ich liebe Wörter, doch da war und ist immer noch eine Grenze, die ich wahrnehme; sobald es um die Dimension der Ohnmacht geht oder das Ausmaß der Einsamkeit, fehlen mir die Worte, und da kamen mir die Farben gerade recht. Ich bitte also um Nachsicht und Großherzigkeit, wenn es um die Beurteilung der Bilder geht, habt dabei das Thema „Gefühle zum Ausdruck zu bringen“ bitte im Herzen! Gestern war meine Freundin hier, und wir haben zusammen gekocht. Sie sah die Bilder und ging sie sehr still durch. Sie wusste das große Thema nicht, als sie plötzlich meinte, sie könne meine Gefühle in den Momenten, als ich malte, spüren. Das macht mir Hoffnung, dass es Euch vielleicht auch so gehen mag.
Ich habe das Buch unter meinem Künstlernamen veröffentlicht und lange mit mir darum gerungen, ob es feige ist, ob ich mich nicht zeigen will. Doch nachdem ich mich dazu entschlossen hatte, das Buch so zu veröffentlichen, habe ich eine riesige Entlastung wahrgenommen. Auch jetzt spüre ich noch die Erleichterung und merke, wie groß mein Schutzbedürfnis für mich und auch für meine Familie ist. Pater Mertes meinte zu mir in diesem Kontext: „Ja, natürlich, Schutz ist das Wichtigste in diesem Zusammenhang. Ihr müsst euch doch als Betroffene jetzt nicht auch noch für die Aufarbeitung opfern.“ Ja, so ist es wohl.
Ich habe mich ebenso dazu entschieden, all die Menschen zu schützen, mit denen ich es im Rahmen der Missbrauchsanzeige zu tun hatte. Auch wenn ich vieles von deren Handeln und Nicht-Tun nicht verstehen kann und es mich schmerzt, respektiere ich, dass jede und jeder von uns „nur“ ein Mensch ist. Ich würdige daher den Schutz aller und habe alle Namen im direkten Zusammenhang mit meiner Geschichte geändert. Bei Menschen mit einmaliger Funktion, wie z.B. dem Papst, ist diese Art von Schutz wohl nicht möglich.
Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich die Menschen – vor allem die Männer des zuständigen Bistums – denn benennen könnte, um sowohl der von mir empfundenen Anonymität als auch deren Schutz gerecht zu werden. Ich habe mich dazu entschieden, sie in der Reihenfolge ihres Erscheinens durchzunummerieren. Das trifft für mich den Kern des Unpersönlichen und macht das Ausmaß der verschiedenen Ansprechpartner spürbar deutlich. Ich habe selbst beim Schreiben immer wieder den Überblick über die Zuordnung der Männer verloren. Welche Nummer war jetzt noch der zuständige Bischof? Ach ja, er persönlich kam ja erst relativ spät ins „Spiel“, er ist Herr Acht!
Um es Euch Leserinnen und Lesern leichter zu machen, habe ich eine Liste der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen erstellt. Diese Liste findet Ihr auf dem beigelegten Lesezeichen, denn so ist sie immer griffbereit. Den Beschuldigten habe ich „Pfarrer Täter“ genannt, das drückt für mich am besten aus, welche Doppelrolle er ausfüllt. Auf den besonderen Hinweis einer meiner privaten Lektorinnen hin, weise ich ausdrücklich darauf hin, dass es sich um die römisch-katholische Kirche handelt. Wir haben versucht, den korrekten Begriff so oft wie möglich zu nutzen, um den weiteren katholischen Kirchen kein Unrecht zu tun.
Zum Thema Unrecht: Ich habe mich sehr bemüht, alle Persönlichkeitsrechte und Urheberrechte zu berücksichtigen. Im Grunde ist es kein Problem gewesen, Genehmigungen einzuholen, und es hat zu sehr netten und auch intensiveren Austauschen geführt. Sollten trotz allem versehentlich Rechtsverletzungen vorliegen, bitte ich das zu entschuldigen und mir umgehend mitzuteilen. Sollte einer oder eine von Euch mein Buch zitieren wollen, um sein eigenes Werk zu untermalen oder zu untermauern, bitte ich um eine kurze Anfrage an den Verlag, der sie mir weiterleiten wird.
Ich vermute, dass sich der eine oder die andere in meiner Darstellung nicht genug gesehen fühlt. Vielleicht sind Herr Eins und Herr Zwei persönlich getroffen, weil sie ihr – sicher ehrlich gemeintes – Bemühen nicht genug gewürdigt sehen. Das täte mir leid, wenn dem so wäre! Und doch ist das, was ich geschrieben habe, mein persönliches Empfinden. Es kann gut sein, dass Herr Eins seinen Fragenkatalog nicht so gemeint hat, wie er in großen Teilen bei mir ankam. Ich nehme mir aber hier in meinem Buch die Freiheit, genau das in den Mittelpunkt zu stellen: mein Erleben und meine Gefühle als Opfer und als Betroffene von sexueller Gewalt durch einen Priester der römisch-katholischen Kirche. Denn bei diesem Thema geht es genau darum – oder es sollte genau darum gehen! Darum bitte ich auch alle, die mit uns Betroffenen zu tun haben, ihre eigenen Gefühle, ihre „Haken und Ösen“ und „offenen Handschuhe“ in voller Eigenverantwortung extern zu bearbeiten und möglichst nicht im Kontakt mit uns auszuleben und somit in den Vordergrund zu stellen.
Ich habe das Buch in zwei Teile aufgeteilt. Dabei habe ich den Kapiteln bestimmte Zitate vorangestellt. Diese Zitate dienen nicht der bloßen Illustration und dem Nachweis der Aktualität, sondern sollen – wie ein Motto – einen ersten Zugang zu dem jeweiligen Kapitel öffnen und die im jeweiligen Kapitel zu beleuchtenden Inhalte erläutern. Es handelt sich also um Motto-Zitate.
Im ersten Teil erzähle ich meine Geschichte. Dabei spielt der stattgefundene Missbrauch nur eine sehr untergeordnete Rolle. Es geht mir hier nicht darum, was wie genau vor vielen Jahren passiert ist. Das ist ein Teil meines Lebens, und er interessiert niemanden wirklich im Detail, sondern wäre nur schwere Kost. Und doch kam ich nicht darum herum, sozusagen als Grundlage für das Buch, kurz zu schildern, wie alles begann und warum das, was passiert ist, überhaupt möglich war und dann auch noch für so lange Zeit.
Eine Freundin meinte nach dem Lesen, es sei das schwerste Kapitel – und dann ist es auch noch das erste! Bittet haltet durch, lest es quer, überfliegt es, lasst es andere lesen und für Euch passend zusammenfassen, was auch immer! Es ist nur die Grundlage. Ich selbst bin aufgrund meiner Geschichte kaum dazu in der Lage, Berichte über sexuelle Gewalt in welcher Form auch immer zu lesen oder anzuschauen. Ich konnte das Buch von Daniel Pittet „Pater ich vergebe Euch!“4 zu großen Teilen in den genauen Beschreibungen nicht lesen, da ich sofort dissoziiere und erstarre. Ab dem Kapitel „Die Anzeige“ wurde es leichter und für mich und mein Buch auch sehr hilfreich. Ich schreibe das, um Euch allen Mut zur Lücke zu machen und Euch dazu zu ermuntern, mein Buch dann dort weiterzulesen, wo es wieder möglich wird. Für mich selbst war es ein entscheidender Schritt zur Erkenntnis und zur Annahme meiner Geschichte, als ich zuließ und wahrnahm, dass ich reagiere, wenn es um Bilder und Geschichten von sexueller Gewalt geht.
Der erste Teil – der meine Geschichte vor allem ab der Antragstellung bis Juli 2019 enthält – besteht aus mehreren kleineren Abschnitten: Da gibt es die chronologische Geschichte, gespickt mit meiner Wut, Briefen und Zitaten aus den vielen, vielen E-Mails.
Es gibt neutralere Texte, die allgemein sowohl die Strukturproblematik der römisch-katholischen Kirche als auch zum Beispiel eine kleine medizinische Erklärung über die Verarbeitung von Traumafolgen oder über Trauma und Retrauma beinhalten. Dann habe ich beim Recherchieren meiner eigenen Tagebücher und Aufschriften sehr persönliche Texte gefunden, die zum Teil einen Platz gefunden haben. Auch diese sind optisch in „Der rote Faden“ abgesetzt. Und dann gibt es noch die Bilder, über die ich schon geschrieben habe. Es steht jeder und jedem von Euch frei, was Ihr lest und in welcher Reihenfolge. Durch die verschiedenen sichtbaren Abhebungen ist es leicht – so hoffe ich –, eine persönliche Reihenfolge des Lesens herzustellen.
Der zweite Teil des Buches enthält die Strukturen der römisch-katholischen Kirche, die ich im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal und der Aufarbeitung problematisch und ursächlich erlebe und wahrnehme, systematisch und aufgegliedert. Drei Kapitel sind bereits im ersten Teil enthalten, da gibt es nichts hinzuzufügen, und sie werden auch aus Umfangsgründen nicht doppelt erscheinen, andere habe ich geändert, angepasst, ergänzt oder ganz neu geschrieben. Endgültige Lösungen habe ich nicht wirklich, manchmal Ideen, aber ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe, der römisch-katholischen Kirche fertige Lösungen zu präsentieren.
In meinem Exposé habe ich mein Buch mehrfach ein „Glücksbuch mit Happy End“ genannt. Für mich ist es das auch – trotz der Schwere des Themas von Missbrauch und sexueller Gewalt, von Vertuschung, von Wut und von Täterschutz. Es ist ein Glücksbuch, weil es mir zum Beispiel zu vielen glücklichen Momenten verholfen hat. Nicht immer im Sinne von „Ich-lache-mich-kaputt-Glück“, sondern vielen anderen und auch wundervollen Arten des kleineren und stilleren Glücks.
So bin ich wegen der posttraumatischen Belastungsstörung sehr eingeschränkt in meinem Beruf belastbar. Das ist bitter! Und manchmal macht es mich einsam in den vielen Stunden, in denen ich nicht mehr so arbeiten kann wie früher. Und dann ist es viel leichter, wieder in die alten Geschichten abzurutschen, und somit drehe ich mich dann im Kreis. Und dann kam plötzlich dieses Buch in mein Leben, wie ein Blitz oder eigentlich wie eine Sternschnuppe und damit die Gewissheit, dass ich es schreiben werde, dass genau das jetzt gerade dran ist. Ich kann meinen Missbrauch nicht rückgängig machen, ich kann den Täter – leider – nicht dazu zwingen, Verantwortung zu übernehmen und sich bei mir zu entschuldigen. Aber ich kann dazu beitragen, dass der jetzt herrschende Missstand, der fatale Umgang mit uns als Betroffenen, dass der aufgezeigt wird. Dass jetzthingeschaut wird. Und meine Geschichte seit dem Antrag 2014 macht es so deutlich! Eins zu eins, so scheint es mir, kann ich daran die Systemprobleme aufzeigen. Es ist wunderbar, eine sinnvolle Beschäftigung zu haben, das Gefühl zu bekommen, sinnvoll – also wirklich voller Sinn – etwas zu erschaffen. Das Gefühl macht mich glücklich!
Und dann ist es tatsächlich so, dass ich jetzt, mit über 50 Jahren, plötzlich schlauer bin als noch vor einem Jahr. Ich weiß definitiv mehr. Über mich, über unser Grundgesetz, über den Aufbau der römisch-katholischen Kirche, aber auch noch mehr über Traumafolgestörungen, über fragmentierte Erinnerungen, über das 6. Gebot der römisch-katholischen Kirche. Und auch, ganz banal, wie viele Zeichen mit Leerzeichen eine DIN-A5-Seite ausmachen – darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, bei all den Büchern, die ich schon gelesen habe.
Das macht mich glücklich, die Erfahrung, gelernt zu haben!
Und dann habe ich all die vielen neuen Menschen kennengelernt, die plötzlich ohne viel Zutun meinerseits da waren. Ja, es war auch sicher etwas Mut dabei, als ich Pater Mertes an einem Sonntagnachmittag anmailte, weil sein Name in Verbindung mit dem Missbrauchsskandal immer wieder auftaucht. Und ich das große Bedürfnis nach Kontakt und Unterstützung hatte. Und er rief einfach zehn Minuten später an! Einfach so. Er kannte mich nicht, meine Geschichte vage, und rief bei allem, was er zu tun hat, mich an! Das sind echte Glücksmomente, wenn ich das Gefühl bekomme, ich bin nicht mehr allein! Und das ist nur ein Beispiel.
Und dann das Glück der KleinenWunder – ich werde nicht vorweggreifen, es ist ein großes Glücksgefühl, meine Eltern sicher und stabil wieder an meiner Seite zu wissen. Der Schmerz ist nicht weg, der kindliche Schmerz, warum habt ihr mir nicht geglaubt und mich nicht beschützt? Nein, der Schmerz ist da, und er darf da sein, aber die Eltern sind auch wieder da! Was für ein Glück!
Ich habe mich im Februar 2019 oft gefragt, warum ich während des Krisengipfels nicht auch in Rom war. Ich konnte noch nicht. Ich saß an meinem Buch, an dem Traum, dem Lebenstraum, ein Buch zu schreiben! Und dann mit diesem wichtigen Thema unter dem neuen Aspekt: kein Opferbuch, sondern ein Glücksbuch.
Natürlich träume ich davon, dass genau mein Buch der Tropfen ist, der das Fass der Ungeduld und des Zu-Viels in Bezug auf die römisch-katholische Kirche und den aktuellen Umgang mit uns Betroffenen endlich zum Überlaufen bringt. Ja! Was für ein Traum! Ich wage wieder, groß zu träumen – mit meinem Buch. Aber auch wenn es das noch nicht ist, bin ich mir sehr sicher, dass mein tägliches Schreiben, meine Recherchen, meine Verhandlungen mit den Verlagen, mein Mut, auch noch meine Bilder zu veröffentlichen, ein großer kleiner Tropfen in dem schon ziemlich vollen Fass ist. Vielleicht braucht es noch mehr Bücher, noch mehr Talkshows, noch mehr Demonstrationen, aber mein Buch ist hoffentlich ein kleiner großer Teil, der das starre und rigide System der römisch-katholischen Kirche zum Wanken bringt.
Ganz vielleicht kommen – endlich – die Entscheidungsträger der römisch-katholischen Kirche ja auch von selbst darauf, dass radikale und auch kleinere Veränderungen – jetzt – nötig und möglich sind. Und ganz vielleicht kann mein Buch sogar dazu etwas beitragen.
Vielleicht hilft mein Buch auch Menschen, die noch vor der Entscheidung stehen, ob sie den Missbrauch anzeigen wollen und können, oder Menschen, die noch immer von sexueller Gewalt durch Geistliche betroffen sind, dabei, das Leid offenzulegen und Anzeige zu erstatten. Ich kann es niemandem wirklich anraten, in dem Sinne, dass es einfach geht, dass es leicht ist. Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen: Mir persönlich hat die erlebte Ungerechtigkeit, die Verschleppung und die Vertuschung zu meiner riesengroßen Wut und letztendlich mit viel innerer Arbeit und viel äußerer Unterstützung zur Annahme meiner Geschichte verholfen.
Und noch eins weiß ich heute ganz sicher: Es lohnt sich, sich zu vernetzen. Du bist nicht allein – ganz sicher nicht! Auch wenn es sich vielleicht im Moment immer noch und immer wieder so anfühlt. Das ist „nur“ ein Teil der Traumafolgestörung, das ist ein Teil, den es sich lohnt, aufzulösen, weil wir dann weniger ohnmächtig sind. Schon die Erfahrung, dass ich mich gehört und verstanden fühle – von den Menschen, die mich bei dem Buch begleiten, lässt mich weich und stark zugleich werden.
Es bleibt mir noch zu erwähnen, dass ich inzwischen fast täglich das unglaubliche Glücksgefühl genieße, geführt zu sein. Auch wenn ich es schon länger wieder wusste, dass es eine göttliche Kraft gibt, auch für mich, hat mich das Schreiben des Buches spüren lassen, wie sehr ich geschützt und behütet werde, welche himmlische Unterstützung ich erfahren darf – gerade mit und durch mein Buch Missbrauch mit den Missbrauchten! Was für ein Glücksgefühl!
Luna Born, Juli 2019
Liste der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
oder
Um den Überblick nicht zu verlieren
Aus dem zuständigen Bistum oder von dort eingesetzt:
Herr Eins: Kriminalbeamter im Ruhestand und ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Kommission für Fälle sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen
Herr Zwei: Kirchenjurist und Mitarbeiter in der Kommission
Herr Drei: Psychotherapeut
Herr Vier!: Rechtsanwalt und vom zuständigen Bischof – Herr Acht – ernannter Voruntersuchungsführer
Herr Fünf: Stellvertretender Generalvikar
Frau Eins und Frau Zwei: Von Herrn Vier! eingeführte neue Vernehmerinnen
Herr Sechs: Vom zuständigen Bistum vorgeschlagener Gutachter für ein Glaubwürdigkeitsgutachten meiner Person
Frau Drei: Kirchenrechtsprofessorin, sollte Herrn Zwei ersetzen
Herr Sieben: Der Sonderbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger im kirchlichen Bereich
Frau Vier: Sekretärin von Herrn Sieben
Herr Acht: Der zuständige Bischof
Herr Neun: Sekretär von Herrn Acht
Herr Zehn: Vom zuständigen Bischof vorgeschlagener Strafrichter
Herr Vierzehn: Seit Juni 2019, der innerkirchliche „Richter“ im Verfahren
Herr Fünfzehn: Seit Juni 2019, der neu ernannte Präventionsbeauftragte
Weitere Personen, mit denen ich es zu tun hatte:
Frau N.: Ansprechpartnerin im nicht zuständigen Bistum
Der Journalist
Rechtsanwalt, seit 2011 Mitglied des ständigen Beraterstabs des Erzbischofs von Berlin zur Beratung in Fragen des Umgangs mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener
Rechtsanwältin, vom oben genannten Rechtsanwalt empfohlen, weil er mir nicht weiterhelfen konnte, da er die Gegenseite vertritt
Herr Elf: Leiter der Deutschen Bischofskonferenz
Herr Zwölf: Sekretär von Herrn Elf
Herr Dreizehn: Ansprechpartner in Rom
Teil 1
„Für die meisten ist
die Schamschwelle und Hürde,
sich als Opfer zu outen,
sehr hoch.
Es ist für sie ein Kraftakt, sich zu öffnen.“
Aus: Badische Zeitung vom 09.11.2018,Zitat von RÄ Dr. A. Musella, Missbrauchsbeauftragte des Erzbistums Freiburg
Wie alles begann
oder
Das Bild von Ösen und Haken
Vielleicht begann alles mit dem Gefühl, falsch zu sein. Von Anfang an, noch vor der Geburt, war ich, so, wie ich bin und mich entschieden hatte, zu sein, falsch, denn ich sollte und musste unbedingt ein Junge werden.
Da mein Vater mit fünf Schwestern einziger männlicher Nachkomme war, hatte er den Auftrag, den heiligen Familiennamen sicher weiterzugeben. Das erste Kind meiner Eltern war meine Schwester. Die große Familie hoffte auf ein zweites Kind – und das war dann ich! Ich weiß nicht wirklich, wie es meinen Eltern mit dem Thema ging. Ob sie sich ganz von diesem Großfamiliendruck befreien konnten? Ob sie innerlich ganz frei waren von Wünschen und Vorstellungen? Damals war das sicher schwieriger als heute, denn heute können auch wir Frauen leichter und selbstverständlicher unseren Geburtsnamen behalten und weitergeben. Getreu des Familienauftrags habe ich das auch – noch unbewusst – getan! Aber damals?
Nun, ich wurde ein Mädchen und bin – dem Himmel sei Dank, trotz meiner Geschichte – sehr froh darüber. Inzwischen, mit dem großem JA zu meiner Geschichte, kann ich mich heute fragen: Wie hätte ich sonst all das erleben können? Wie sonst hätte ich all die Erfahrungen gemacht, die mich heute hier sitzen lassen, um das zu schreiben, was es zu schreiben gibt? Mein Auftrag für dieses Leben scheint unter anderem zu sein: „Es kann viel passieren – doch ich habe mehr Träume und bin in der Lage, sie umzusetzen, als die Erlebnisse und Erfahrungen mit der römisch-katholischen Kirche zerstören können!“
Geprägt von dem Gefühl, vom ersten Moment an nicht richtig zu sein, nicht vollkommen, nicht ganz, gab es von Anfang an ein „Lag“ – mein Lieblingsausdruck für einen Mangel, der bestimmte Situationen anzieht, für die Öse, die ich hinhalte und in die andere sich mit ihrer Geschichte einhaken. Oder, wie meine Tochter es zu sagen pflegt: Das war wohl der hingehaltene offene Handschuh, den andere sich anzogen.
Im Nachhinein ist mein Start ins Leben eigentlich ein bisschen schade, denn meine Eltern haben noch zwei weitere Kinder bekommen, beide Jungs! Aber es ist auch ein weiterer klarer Ausdruck für mich, dass es notwendige Grundlagen gibt für „persönliche Geschichten“, „Schicksal“ oder wie jeder oder jede es nennen mag.
Nun, niemand kann in die Zukunft schauen, und so wurde ich unter diesem Druck geboren und mit diesem Gefühl, „einfach nicht richtig zu sein“. Auch das Gefühl, den Erwartungen nicht zu entsprechen, begleitete mich durch diese familiäre Konstellation. Und dabei geht es mir nicht darum, zu sagen, wer schuld an meiner Geschichte ist, sondern lediglich um einen Versuch zu erklären, wie das, was passiert ist, so lange und so oft geschehen konnte.
Auch der Täter wird seine Geschichte haben, seine Gründe, warum er sich mir und anderen gegenüber so verhalten hat und vielleicht noch immer verhält. Ich kenne sie nicht, und es liegt an ihm, sich damit auseinanderzusetzen. Da ich das, was war, nicht mehr rückgängig machen kann, ist das Einzige, was ich heute von ihm erwarte, dass er sich zu seinen Taten bekennt, dazu steht und die volle Verantwortung dafür übernimmt, vor mir, den weiteren Betroffenen und vor all denen, die ihn decken und schützen. Ist das wirklich zu viel erwartet?
Ich schweife ab. Der Täter war ein guter Freund meiner Eltern. Als ich noch ein Säugling war, zog meine Familie ins Ausland. Der Täter wurde kurze Zeit später als Missionar in das gleiche Land entsandt, wie es die Katholiken nennen. Nachdem ich den französischen Film „Das Schweigen der Hirten“5 gesehen habe, frage ich mich heute, ob der Täter bereits im Vorfeld pädophile und/oder übergriffige Verhaltensweisen aufgezeigt hatte und deswegen ins Ausland verschickt wurde. Das würde zumindest zum Teil erklären, warum das zuständige Bistum und der zuständige Bischof ihn so schützten und schützen. Es wäre ein noch größerer Skandal, wenn das nachgewiesen werden könnte.
Die Missionsstation lag hoch oben in den Bergen, und bis die Straße besser ausgebaut wurde, war die Fahrt in den ersten Jahren lang und nicht ungefährlich. Aber meine Eltern fuhren oft dorthin, sie fühlten sich sicher wohl und irgendwie zu Hause mit den aus Deutschland stammenden Mitgliedern der Station. Wenn wir nicht hinfuhren, kamen die Menschen von dort zu uns: Ostern, Taufen – es gab immer wieder Gelegenheiten.
Der Täter war der Held. Groß, charismatisch, gutaussehend, immer strahlend und fröhlich, ein Liedchen auf den Lippen, stellte er auch seine Kollegen in der Missionsstation in den Schatten. Gab das böses Blut? Ich weiß es nicht. Konflikte wurden nicht offen besprochen. Weder dort noch bei uns in der Familie, meiner Erinnerung nach, aber ich war ja noch ein Kind.
So wuchs ich auf in einer „glücklichen Familie“, mühsam nach außen perfekt dargestellt und geprägt vom römisch-katholischen Glauben. Es gab vor allem „Schwarz und Weiß“, „Gut und Böse“, „Richtig und Falsch“, wenig dazwischen und wenig Reflexion darüber. Die Missionsstation als katholisch geprägter Ort und vor allem der damalige „Held“ galten als „weiß“, „richtig“ und „gut“. Ohne Zweifel! Eine gute Grundlage für sexuelle Übergriffigkeiten.
Alles fing ganz harmlos an. Wie sicherlich so oft. Natürlich durften wir Kinder auf dem Schoß des Freundes sitzen. Natürlich wurden wir gedrückt und festgehalten, wer sollte – oder wollte – sich schon etwas dabei denken. Es passierte schleichend, dabei was das eigene System von „Richtig und Falsch“ schon richtig durcheinander. War das wirklich ein Schlüssel, der so drückte, wenn ich auf seinem Schoß saß? War es wirklich nur ein Spiel, um mich zum Lachen zu bringen, wenn er mich auf dem „Schlüssel“ hin und her schob, nach vorne und nach hinten? Der schleichende Anfang, eine völlige Verharmlosung der körperlichen Kontakte und Übergriffe vernebelten meine Wahrnehmung sicher zusätzlich.
Es ist bekannt, dass Täter oft ein sehr inniges und persönliches Verhältnis zu den Opfern aufbauen. Als ich Jahrzehnte später eine mir damals nahestehende Person, die auch mit uns lebte, fragte, ob sie auch betroffen sei, ob er sie auch missbraucht habe, konnte sie das klar verneinen. Aber sie berichtete auch, dass sie als Kind oft eifersüchtig gewesen sei, weil der damalige Held mich so offensichtlich bevorzugte und mehr mochte. Meine Mutter verehrte ihn, es gab keinen Zweifel über seine Integrität, er wurde als Mann Gottes idealisiert und nicht infrage gestellt.
So gab es auch keine Zweifel, als ich unter anderem verstört von einem Besuch der Außenstelle der Missionsstation weiter oben in den Bergen wiederkam, in dem eine Familie gerade ein Baby bekommen hatte, das ich gerne hatte besuchen wollen. Der Täter wohnte zu der Zeit ebenfalls dort. Keine Fragen, warum ich plötzlich Vaginalentzündungen hatte, warum für mich das Winterlied „Scheiden tut weh“ aus tiefster Überzeugung „Scheide tut weh“ hieß. Oder später, wenn er mich dazu einlud, mit ihm Ferien zu machen, in Israel oder in Malente (ein kleiner Ort in der Nähe des Plöner Sees) – es gab keine Fragen, oder wenn doch, konnte er eventuelle Zweifel schnell zerstreuen und bagatellisieren. „Was nicht sein darf, das ist auch nicht“, eine weitere perfekte Grundlage für übergriffiges Verhalten, für sexuelle Gewalt von vermeintlichen Autoritätspersonen.
Der Missbrauch ging über Jahre. Subtil und unterschwellig zu Beginn, zunehmend und drängender, als ich älter wurde und sich die Gelegenheiten ergaben. Tatsächlich hat er nie „eingestöpselt“ – wie er es nannte –, tatsächlich hat er mich nie vergewaltigt, aber er ist mit mir nackt baden gegangen, hat sich an mir gerieben bis zum Samenerguss, er hat masturbiert, und ich musste ihm zuschauen, ihn anfassen, mich auskleiden, meinen Schoß zeigen, mich auf ihn legen, mich unter ihn legen … Wenn er fertig war, hat er immer gelacht, ziemlich tief und dröhnend, als wäre alles witzig … Tiefes Lachen in bestimmten Situationen halte ich bis heute schlecht aus.
Als Jugendliche hatte ich ein schwieriges Verhältnis zu meinen Eltern. Als ich 16 Jahre alt war, zog ich aus und übernahm die volle Verantwortung für mich und meinen Alltag.
Er – der Täter – war ein vermeintlich sicherer Ansprechpartner in den Zeiten, „immer für mich da“, ich vertraute ihm. Und meine Wahrnehmung war und blieb vernebelt, mit dem Grundgefühl, nicht korrekt zu sein, und den zunehmenden, scheinbar harmlosen Grenzüberschreitungen, schleichend und manipulierend. Immer wenn andere dabei waren, waren „nur die Umarmungen zu lang“, regelmäßig wanderte seine Hand auf meinen Po, und er drückte mich damit an sein Geschlechtsteil, groß, erigiert, wie ich spüren konnte. Selbst ich wusste später, dass es kein Schlüssel war. Es wurde intimer, wenn wir allein waren. Als ich älter wurde, bot er mir vorher Alkohol an. Später habe ich einmal einen Stuhl unter die Türklinke geklemmt und wurde davon wach, weil er an der Klinke rüttelte und der Stuhl drohte umzukippen. Bei dem Urlaub in Malente versprach er im Vorfeld zwei Einzelzimmer, als ich dann dort ankam, meinte er lediglich, es hätte nur noch Doppelzimmer gegeben.
Erst als erwachsene Frau und mit viel therapeutischer Unterstützung konnte ich der Wahrheit ins Auge schauen, und ich konfrontierte ihn mit meinen Erinnerungen und meinem Wissen.
HaHaHa
„Der Teufel war’s?
Von wegen!
Am Ende des Bischofsgipfels in Rom sucht der Papst die Schuld für sexuellen Missbrauch bei höheren Mächten. (…)
Er wird sagen,
Missbrauch durch Kleriker sei,
‚wenn eine gottgeweihte Person zum Werkzeug Satans‘ werde.“
Aus: DIE ZEIT, 10/2019 vom 28.02.2019; S. 48, von Evelyn Finger
Die Konfrontation
oder
„Wieso hattest du auch immer so eine süße, rote, kurze Hose an!“
War das sein Ernst? War das wirklich seine Antwort auf meine Fragen und die schweren Anschuldigungen, die gerade als Worte zwischen uns standen? Schüchtern eher und noch unsicher im Vortrag, hatte ich es endlich gewagt. Endlich! So lange hatte ich mit mir gerungen, so lange trug ich schon die Fragen nach dem „Warum?“ und „Was alles?“ und „Wie oft?“ mit mir, und das war seine Antwort? Eine unbändige Wut packte mich und drohte mich mitzureißen, mich fortzuspülen in die Abgründe des Hasses und der Gewalt … Und doch kam sie – die Wut – nicht durch, verbarg sich erneut hinter meiner zunehmenden Unsicherheit und dem Zweifel. „War ich vielleicht doch schuld? Welche Hose meint er nur? Und wieso hatte ich sie angezogen? Hatte ich immer diese Hose an?“ Gedanken rasten durch meinen Kopf und mein Herz, und ich fühlte mich klein und wusste nicht, was ich sagen sollte. Freundlich bot ich ihm an, ihn zum Bahnhof zu fahren!
Als ich anschließend nach Hause kam, hatte ich höllische Kopfschmerzen. Ich fühlte mich müde und ausgelaugt. Ich hatte mir so viel von dem Gespräch erhofft und nur deswegen zugestimmt, dass er noch einmal in meine Wohnung kommen durfte, obwohl sich alles in mir gesträubt hatte und ich sicher war, dass es keine gute Idee war, ihn zu mir einzuladen. Ich erinnerte mich plötzlich an seinen letzten Besuch, ich war so froh gewesen, dass er sich mit Freunden aus alten Zeiten ankündigte, da fühlte ich mich sicherer. Und doch fiel mir schaudernd der Moment ein, als er mir beim Abschied – wie so oft – die Hand auf den Hintern schob, um sich nah und näher und noch näher an mich ranzudrücken und sich an mir zu reiben. Ich spürte seinen erigierten Penis durch die Hose durch und wollte mich freimachen, als er anfing zu lachen. Dieses Lachen, immer dieses Lachen. Als er merkte, dass die anderen sich nach uns umdrehten, ließ er mich plötzlich los, und ich verlor das Gleichgewicht und fing an zu zittern.
Und doch brachte ich ihn nach der Konfrontation zum Bahnhof! Was für ein Abhängigkeitsverhältnis, kann ich heute nur feststellen. Danach brach ich zusammen.
Tage später erst konnte ich mir das Gespräch wieder durch den Kopf gehen lassen. Mir gegenüber also kein Nein und keine Verleugnung. Im Gegenteil, er erzählte, er würde auch mit anderen Frauen und Mädchen „schmusen“. Es sei doch nicht so schlimm. Auf meine Frage, wie er sein Verhalten mir und den anderen gegenüber mit dem Zölibat vereinbaren könnte, meinte er: „Solange ich nicht einstöpsle, also mit dir schlafe, halte ich das Zölibat doch ein!“ Eine völlige Verharmlosung des Geschehenen.





























