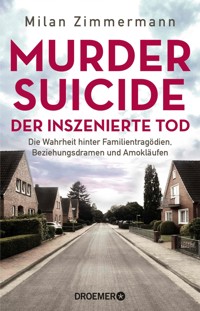
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Selbstmörder, die zu Mördern werden - ein neues Thema von True Crime! War es ein Unfall, oder war es Mord? Der Neurologe Dr. Milan Zimmermann beantwortet diese Frage am Beispiel wahrer Geschichten über Familientragödien, Beziehungsdramen und Amokläufe mit unschuldigen Toten - sogenannte erweiterte Suizide. Ob bei spektakulären Verbrechen wie einem Amoklauf oder dem Germanwings-Absturz, ob bei Familientragödien oder dem gemeinsamen Tod eines betagten Ehepaars:Erweiterte Suizide sind immer Tragödien, denn unschuldige Menschen werden aus dem Leben gerissen. Solche Fälle beherrschen immer die Schlagzeilen: Das Interesse der Öffentlichkeit ist groß und die Anteilnahme oft bemerkenswert Allein die Zahlen sind erschreckend: Etwa 11% der Morde an Frauen, 19% der Morde an Kindern und 3% der Tötungen von Männern geschehen im Rahmen von erweiterten Suiziden. Bis zu 29% der Frauen und bis zu 60% der Männer, die ihre Kinder töten, begehen im Anschluss Suizid. Milan Zimmermann ist der gefragte Experte auf diesem Gebiet. Er untersucht seit langem erweiterte Suizide. Die Ergebnisse seiner Arbeit präsentiert er nun einem breiten Publikum in bester True-Crime-Manier in diesem Sachbuch: Anhand einzelner wahrer Fälle begibt er sich auf die Suche nach den Motiven, die erweiterte Suizide auslösen. Er beschreibt die unterschiedliche Vorgehensweise von Männern und Frauen und geht auf einige bekannte Fälle wie den Amoklauf von Winnenden und den Absturz einer Germanwings-Maschine ein. Am Anfang fast jeder solchen Untersuchung steht die Frage, ob es sich um ein Verbrechen oder einen Unfall handelt. In der Regel steht dann die Frage im Raum, wer der Täter und wer das Opfer ist. Dabei helfen moderne kriminaltechnische Untersuchungen, Nachlässe und Interviews mit Familienangehörigen, Freunden und Bekannten, Licht in das Dunkel zu bringen. Mit seinen anschaulichen Fallschilderungen lässt uns Milan Zimmermann an dieser spannenden und oft überraschenden kriminalistischen Spurensuche teilhaben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Milan Zimmermann
Murder SuicideDer inszenierte Tod
Die Wahrheit hinter Familientragödien, Beziehungsdramen und Amokläufen
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ob bei spektakulären Verbrechen wie einem Amoklauf oder dem Germanwings-Absturz, ob bei Familientragödien oder dem gemeinsamen Tod eines betagten Ehepaars: In allen diesen Fällen finden nicht nur die Täter den Tod, sondern sie reißen unschuldige Menschen aus dem Leben. Die Kriminologie spricht dann von erweiterten Suiziden, und eine schockierte Öffentlichkeit fragt nach den Ursachen und Umständen der Tat. Moderne kriminaltechnische Untersuchungen, Nachlässe und Interviews mit Familienangehörigen, Freunden und Bekannten helfen, Licht in das Dunkel zu bringen und Motive und Abläufe zu rekonstruieren. Milan Zimmermann hat viele solcher Verbrechen untersucht. Mit seinen anschaulichen Fallschilderungen lässt er die Leser*innen erstmals an dieser spannenden und oft überraschenden kriminalistischen Spurensuche teilhaben.
Inhaltsübersicht
Widmung
Wand des Schweigens
Am Ende bleiben nichts als Fragen …
Die Macht der Sprache
Die Melancholie der Worte
Trauen Sie sich, anderen Menschen von Ihren seelischen Problemen zu erzählen
Ein Blick in die Untiefen der Seele
Ein tödlicher Ausflug an den Wannsee
Abgründe der Eifersucht
Der Besuch der Nachbarin
Eine gespenstische Szenerie
Wenn Schüsse gleichzeitig töten
Eine Fahrt ins Ungewisse
Tod im Marmormeer
Eine fatale Konstruktion
Ein lang gehegter Plan
Nichts scheint so, wie es ist
Das Grauen in der Pandemie
Der Täter ist kein Unbekannter
Wenn aus Zuneigung Eifersucht und Hass sprießt
Die Sache mit der Empathie
Gefühl der Gefühlsleere
Sie erwachten nicht mehr aus ihrem Albtraum
Sie waren den unbarmherzigen Wogen der Empfindungen ausgeliefert
Sie wanderte ziellos durch die Betonwüste
Der Amoklauf
Er zeigte in den Himmel
Die zwei Gesichter des Insulins
Wenn die eigene Hoffnungslosigkeit übertragen wird
Was Suizide und erweiterte Suizide gemeinsam haben
Gemeinsame Einsamkeit
Wollte er dieses Ende wirklich?
Die Suche nach einer Erklärung für das Unerklärliche
Eine dramatische Odyssee in Zeiten der Pandemie
Tötung mittels Stoffwindel – eine gemeinsame Entscheidung?
Sie wollte sich vom Balkon stürzen
Gleichzeitig in den Tod?
Die Welle der Einsamkeit
Dammbruch der Gewalt
Die vielen Gesichter des Unfassbaren
Er nahm sie alle mit in den Tod
Sind Suizidattentäter suizidal?
Sind Amokläufe erweiterte Suizide?
Wege aus der Dunkelheit
Trauen Sie sich zu fragen
Die vielen Wege aus der Dunkelheit
Wieso müssen wir uns das Leben so schwer machen?
Wie können wir Amokläufe verhindern?
Die gewaltige Kraft des Gesprächs
Macht der Worte
… und dann nahm er sie mit in den Tod
Literatur
Dank
Meiner Ehefrau Schehresade
und
meinen Eltern
Teil I
Wand des Schweigens
Ein Prolog
Am Ende bleiben nichts als Fragen …
Mittwochabend, 16. Februar 2022. Ein Supermarktparkplatz in Kirchheim unter Teck in der Nähe von Stuttgart. Ein neunundfünfzig Jahre alter Polizist des Landeskriminalamts schoss mit seiner Dienstwaffe unvermittelt auf eine achtundfünfzigjährige Frau und tötete sie dabei. Es stellte sich heraus, dass sie seine von ihm getrennt lebende Ehefrau war. Sie beendete an dem Abend ihren Arbeitstag in dem Bio-Markt. Der Mann wurde wenig später in seinem auf dem Parkplatz stehenden Wagen tot aufgefunden. Es wurde in der Folge bekannt, dass er sie wohl schon vorher mehrfach bedroht hatte.
Oktober 2021. Landkreis Lüneburg. Der Prozess gegen einen siebenundachtzigjährigen Mann begann. Er lebte seit drei Jahren mit seiner gleichaltrigen Ehefrau in einem Seniorenwohnheim. Sie war an Demenz erkrankt, er selbst auf den Rollstuhl angewiesen und erblindet. Mehrmals stach er auf das Gesicht und den Hals seiner Frau ein. Anschließend hielt er das Küchenmesser an seinen eigenen Hals, verletzte sich aber nur leicht. Er sagte, er habe sie nun »erlöst«. Die Angst, dass er sie nicht mehr richtig versorgen könnte, spielte laut seiner Aussage vor Gericht eine wichtige Rolle.
12. März 2021. München. Ein Lehrer um die vierzig stürzte sich mit seiner kleinen Tochter aus einem Fenster seiner Schule aus achtzehn Metern Höhe. Er hinterließ einen Abschiedsbrief. Zu möglichen Motiven wurde aber nichts weiter bekannt.
24. November 2020. Washington, USA. Eine fünfundfünfzigjährige Psychologin war im Sorgerechtsstreit mit ihrem geschiedenen Ex-Mann. Sie betäubte die Zwillingstöchter und erschoss sie anschließend. Dann brachte sie sich ebenfalls mittels einer Schussabgabe um.
17. November 2020. Wien-Donaustadt. Eine einunddreißig Jahre alte Mutter tötete ihre drei Kinder durch Ersticken unter einem Kopfkissen. Sie schilderte im Strafverfahren, dass sie mit den Kindern »in den Himmel gehen« wollte, da sie für diese keine Zukunft unter der Obhut des von ihr getrennt lebenden Ehemanns und seiner möglichen neuen Partnerin gesehen habe. Sie hatte die Befürchtung, dass er die Kinder zu sich nehmen werde. Sie habe auch überlegt, ihn ebenfalls zu töten. Nach der Tat kam es zu mehreren Suizidversuchen, die die Mutter überlebte. Sie soll unter Depressionen gelitten haben. In den Monaten vor der Tat sei es zu wiederholten Konflikten mit dem Ehemann gekommen. Sie vermutete eine außereheliche Beziehung zu ihrer Tante in Nepal. Außerdem äußerte sie die Befürchtung, dass er Gift in ihr Essen mische. Sie wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
21. Februar 2020. Manching in Oberbayern. Eine achtunddreißigjährige Frau erstach zunächst ihre beiden Töchter, drei Jahre und zehn Monate alt, mit einem Küchenmesser in einem Pkw vor dem Airbus-Werk, wo sie tätig war. Danach stieg sie in einem nahe gelegenen Bürogebäude über ein Treppengeländer und stürzte aus großer Höhe in den Tod.
22. Februar 2013. In der Nähe von Köln. Ein Vater tötete seine zwei und vier Jahre alten Töchter mit Hammerschlägen. Anschließend fuhr er auf der Autobahn A61, nachdem er auf einem Rastplatz gewendet hatte, als Geisterfahrer frontal in einen Lkw. Er starb bei dem Aufprall. Außerdem wurde bei dem Auffahrunfall mindestens eine Person schwer verletzt.
26. Januar 2012. Langenfeld bei Köln. Ein vierunddreißigjähriger Familienvater tötete sein neun Monate altes Kind und seine ein Jahr jüngere Frau mittels Chloroformintoxikation. Am nächsten Tag brachte er auch seinen fünfjährigen Sohn um, steckte das Haus in Brand und starb selbst an einer Kohlenmonoxidvergiftung. In seinem Abschiedsbrief schrieb er, dass er in der Vergangenheit viele Fehler begangen habe und der Überzeugung sei, seiner Familie »keine lebenswerte Zukunft« mehr bieten zu können. Er hätte sie in eine »tiefe Trauer gestürzt«, wenn er am Leben geblieben wäre, aber auch mit seinem »alleinigen Tod«. Davor habe er sie »bewahren« wollen. Erst später stellte sich heraus, dass er als selbstständiger Programmierer viele Schulden angehäuft hatte. Er war mit vielen Aufträgen in Verzug gekommen und hatte sich ein großes Lügenkonstrukt aufgebaut, das vor der Tat zu kollabieren drohte. Vor dem Familienmord hatte er die Wohnung schon einmal in Brand gesetzt. Dabei war niemand verletzt worden, das Feuer hatte gelöscht werden können.
19. Oktober 1992. Ein Reihenhaus in Bonn. Die beiden Lebensgefährten Petra Kelly und Gert Bastian wurden mit Kopfschussverletzungen tot aufgefunden. Kelly, Gründungsmitglied der Partei Die Grünen, starb dabei im Alter von vierundvierzig Jahren an einem absoluten Nahschuss, was zu vielen Spekulationen führte. Eine Beteiligung Dritter wurde allerdings ausgeschlossen. Ausgegangen wurde schnell von einer Tötung durch den neunundsechzigjährigen Bastian. Die Frage, ob sie möglicherweise im Schlaf von dem ehemaligen Generalmajor getötet wurde, ist seitdem immer wieder aufgeworfen worden. Frühere Aussagen zu einem potenziellen Einverständnis Kellys wurden in der Folge vorsichtiger formuliert. Möglicherweise ging Bastian davon aus, dass sie nicht ohne ihn leben wolle, und brachte sie deshalb vor seinem Suizid um. Auch er war Mitglied bei den Grünen und engagierte sich wie Petra Kelly in der westdeutschen Friedensbewegung.
Immer wieder wird in Zeitungen oder anderen Medien von sogenannten erweiterten Suiziden berichtet. Ein Mann, der gemeinsam mit seiner Ehefrau in den Tod geht. Ein anderer, der seine Frau und Kinder umbringt und sich danach tötet. Eine Frau, die sich und ihre Kinder mit in den Tod nimmt. Ein Amoklauf, bei dem der Täter viele Menschen erschießt und dann entweder Suizid begeht oder einen »suicide-by-cop« provoziert, einen Suizid durch einen Polizisten. Dies lässt uns mit Fassungslosigkeit und Ängsten zurück.
Vielfach beschränken sich die Verfasser dieser Nachrichten auf eine Aufzählung der Opfer, geben höchstens einige wenige Details zu den Motiven bekannt. Meist aber bleibt die Frage nach dem Warum offen. Dies führt häufig zu Spekulationen.
Erweiterte Suizide, also eine Verbindung von Mord und Selbsttötung, teilen jedoch viele Charakteristika mit alleinigen Suiziden. So trifft das zum Beispiel auf zugrunde liegende psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen zu. Es ist aber möglich, sie zu verhindern. Der wichtigste Ansatz zur Prävention besteht meiner Meinung nach in einer Aufklärung und damit einhergehenden Destigmatisierung von psychiatrischen Erkrankungen, über die in der Gesellschaft oft noch viele Vorurteile bestehen. Damit sind die Hürden für Betroffene, über ihre dunklen Gedanken zu reden, leider in vielen Fällen sehr hoch.
Es ist ein schwieriges Thema, und ich will mich diesem mit Beispielen aus der Literatur annähern. Sie beleuchten die potenzielle Vorgeschichte von erweiterten Suiziden und geben Informationen, die sonst kaum bekannt sind. Ich gehe auf die Kriterien ein, die vorhanden sein müssen, um einen erweiterten Suizid als solchen zu benennen (Teil I). Auf männliche Täter, die mehr als jede andere Gruppe in erweiterte Suizide verwickelt sind (Teil II), und welche Hintergründe bei weiblichen Tätern eine Rolle spielen (Teil III). In Teil IV beschäftige ich mich mit gemeinsamen Suiziden bei älteren, meist vorerkrankten Menschen und der Frage, welchen Einfluss Einsamkeit auf psychiatrische Erkrankungen hat und ob die SARS-CoV-2-Pandemie durch Lockdowns und Social Distancing zu einer möglichen Zunahme von Depressionen und Suizidalität (ge)führt (hat). Spezielle Unterkategorien von erweiterten Suiziden wie Terroranschläge und Amokläufe werden in Teil V thematisiert. In Teil VI geht es um Hilfsangebote und Präventionsstrategien.
Ich spreche Tabus an, was ein wichtiger Schritt hin zur Destigmatisierung dieser Erkrankungen darstellt. Unerlässlich wird es dabei sein, in die Tiefe und oft auch Abgründe der menschlichen Seele abzutauchen.
Ein paar Worte nun zu meiner Person, damit Sie verstehen, warum ich mich mit diesem ungewöhnlichen Thema beschäftige. Primär bin ich Neurologe und auf die Behandlung und Erforschung von Erkrankungen wie Demenz oder Parkinson spezialisiert. Meine Promotion habe ich während und nach dem Studium allerdings im Institut für Rechtsmedizin der Charité bei Prof. Dr. Michael Tsokos erstellt. Mich hat die Beschäftigung mit komplexen, vielschichtigen Themen immer schon fasziniert. Entscheidend war für mich der Ansporn, mit meinen Erkenntnissen möglicherweise dazu beizutragen, dass Suizide und erweiterte Suizide in Zukunft besser verhindert werden können beziehungsweise bessere Präventionsprogramme entwickelt werden können.
Seit 2013 habe ich mich dementsprechend neben meiner neurologischen Spezialisierung intensiv mit dem Thema beschäftigt, initial über 2000 Obduktionsakten ausgewertet, mich mit Sektionsprotokollen, Abschiedsbriefen und Polizeiberichten, Zeitungsberichten und der gesamten Literatur zu erweiterten Suiziden auseinandergesetzt.
Durch meine Spezialisierung in dem Fach Neurologie und meine Weiterbildung in der Psychiatrie habe ich zudem eine fundierte Ausbildung zum Thema psychiatrischer Krankheitsbilder wie Depressionen, Psychosen, Persönlichkeitsstörungen und Suchterkrankungen.
In diesem Buch führe ich die Erkenntnisse zusammen, da ein Verständnis von erweiterten Suiziden nur über ein tiefgreifendes Wissen über Suizidalität und zugrunde liegende neuropsychiatrische Krankheitsbilder möglich ist. Ich zeige auf, dass eine Trennung von psychiatrischen und neurologischen oder anderen somatischen Erkrankungen jeder logischen Grundlage entbehrt, da sie allesamt ihren Ursprung in Störungen von Zellfunktionen haben. Unwissen kann Angst verursachen. Aus Unwissen können Vorurteile keimen. Unwissen mündet fatalerweise in Stigmatisierungen. Daraus nährt sich der Mahlstrom, in den Betroffene immer stärker hineingezogen werden. In das tiefe Schwarz der unerbittlichen Einsamkeit. Dem entgegenzuwirken, ist mein Anspruch.
Eine von vielen Fragen Ihrerseits wird sicher sein, wie ich persönlich mit dem Thema auf emotionaler Ebene umgegangen bin? Wie konnte ich mich denn abgrenzen? Tatsächlich ist das kaum möglich, wenn man so intensiv in diese persönlichen Tragödien und Familiengeschichten eintaucht. In detektivischer Arbeit habe ich diese so weit wie nur möglich rekonstruiert, was mich auch als Wissenschaftler durchaus oft sehr mitgenommen hat. Das Wissen um die große Bedeutung von Suizidprävention und die Einsicht, dass man dadurch potenziell vielen Menschen helfen kann, ermöglichte mir besser, auf objektiver, analytischer Ebene diese Abgründe der menschlichen Seele zu ergründen, ohne selber zu stark emotional mitgerissen zu werden.
Jedes Jahr begehen weltweit rund eine Million Menschen Suizid. Lassen Sie uns zusammen alles daransetzen, betroffenen Menschen zu helfen.
Noch ganz wichtig: Die in diesem Buch beschriebenen Geschichten basieren allesamt auf wahren Fällen. Hier gilt: Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und Hinterbliebenen sind Namen und bestimmte Details verfremdet, auch sind einige Geschichten aus verschiedenen Fällen zusammengesetzt. Natürlich sind mir viele Einzelaspekte und Hintergründe nicht bekannt, dazu zählen oft die Vorkommnisse und Konflikte vor der Tat. Nicht wenige Täter nehmen ihre Motive mit in den Tod.
Dennoch: Die Geschichten stehen Modell für die klassische Typologie und Hintergründe von erweiterten Suiziden und werden gestützt von internationalen wissenschaftlichen Studienergebnissen.
Die Macht der Sprache
An dem Tag arbeitete ich als Famulant auf einer interdisziplinären Station, auf der verschiedene Fachrichtungen zusammenarbeiten. Ich war also noch ein Student und absolvierte eine Art klinisches Praktikum. Es war ein überaus anstrengender Tag, weil ich zusätzlich eine Fortbildung absolvieren musste, sodass ich parallel Aufgaben auf der Krankenstation erledigte und mich auf die Online-Fortbildung konzentrierte. Trotzdem erhaschte ich zwei Sätze einer Konversation von Kollegen, die mich noch eine Zeit lang beschäftigen sollte.
»Die Patientin ist doch sehr empathielos. Sie scheint tief in ihrer Depression zu stecken.« Diese Assoziation irritierte mich in hohem Maße. Depressiv und empathielos? Wenn selbst Ärztinnen und Ärzte so denken, wie weit verbreitet sind dann solche Vorurteile in der allgemeinen Bevölkerung, vor allem bei Menschen ohne medizinische Vorbildung?
Derartige Assoziationen sind gefährlich, weil sie nichts mit der Realität zu tun haben und zu einer allgemeinen Stigmatisierung beitragen. Depressive Menschen sind nicht empathielos. Aber wie kann es zu solchen Gedanken kommen? Ein wichtiges Symptom im Rahmen einer Depression ist das »Gefühl der Gefühllosigkeit«. Das ist für die Betroffenen ein außergewöhnlich belastender Schwebezustand. Der wiederum führt zu einer massiven inneren Unruhe. Es erscheint kaum möglich, starke Gefühlsschwankungen wie Trauer oder Freude zu empfinden. Man kann im ungünstigsten Fall weder lachen noch weinen. Und jeder weiß, wie Weinen uns beruhigen beziehungsweise entlasten kann.
Das Gefühl der Gefühllosigkeit spiegelt sich ebenso in der Mimik und Gestik wider. Das Gesicht kann »starr« erscheinen, wenig ausdrucksstark, die Gestik ist auf ein Minimum reduziert. Werden Urteile über andere Menschen auf der Basis solcher oberflächlichen Äußerlichkeiten gefällt, kann man dies schnell als Empathielosigkeit deuten.
Es könnte zudem der Eindruck entstehen, dass depressive Menschen keine Sozialkontakte wünschen. Auch dies trifft häufig nicht zu. Es erfordert deutlich mehr Energie, den Antrieb aufzubringen, Konversationen und andere Interaktionen mit Menschen zu führen, die Sehnsucht danach ist aber oft sehr ausgeprägt. Viele Betroffene leiden extrem unter Gefühlen von Einsamkeit. Sie werden dann vielfach als »unkommunikativ« und damit »unsozial« abgestempelt. Eine fatale Schlussfolgerung. Schüchterne Menschen oder von sozialen Ängsten Betroffene kennen das. Und meist ist das Gegenteil der Fall. Im Vergleich zu vielen Mitmenschen nehmen sie ihre Umwelt und die Gefühle von anderen deutlich intensiver wahr. Das ist mein Verständnis von Empathie.
Menschen mit Attributen wie Empathielosigkeit zu belegen, ist natürlich auch ein einfacher Weg, sich nicht weiter mit ihnen beschäftigen zu müssen. Denn selbstverständlich benötigt es deutlich mehr »Aufwand«, mit von Depressionen Betroffenen zu interagieren. Neben dem Unwissen ob der Symptome von depressiven Menschen und allgemein der Erkrankung Depression kommt damit auch die Komponente hinzu, dass es angenehmer und unkomplizierter ist, Interaktion mit nicht depressiven Leuten aufrechtzuerhalten. Viele müssen sich Aussagen anhören, dass sie sich doch »gefälligst zusammenreißen« sollen, nicht »kindisch« reagieren dürfen. Dass es sich um schwere Erkrankungen handelt, die einer Therapie bedürfen, ist offenbar vielen Menschen nicht bewusst.
Eine weitere Situation fällt mir dazu ein. Ich pendele jeden Tag von Stuttgart nach Tübingen, wo ich arbeite. Auf diesen langen Zugfahrten höre ich meist ungewollt die ein oder andere teils merkwürdige Unterhaltung mit. Dann, im Bus vom Bahnhof in Tübingen zur Klinik, sitzt immer eine Gruppe von Freundinnen, die lautstark Gespräche führen, genauer gesagt, oft über andere Leute lästern.
An einem Morgen war der frühere Küchenchef ihrer Firma der Fokus ihrer Konversation. In breitem schwäbischem Dialekt gab die eine Frau Folgendes zum Besten, was mich noch Stunden später und auch heute noch schlichtweg wütend macht:
»Man munkelt, dass er Burn-out hat. Das habe ich irgendwo gehört.«
»Hat er deshalb aufgehört?«, fragte die Gesprächspartnerin, die gegenüber der Frau saß.
»Wie kann man schon nach kurzer Zeit im Job mit Burn-out ausfallen?«, gab die Dritte im Bunde zum Besten.
Danach ging es um die eher dürftige Essensqualität in der Kantine – es fehlte ja ein zuverlässiger, kompetenter und stressresistenter Küchenchef.
Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen werden häufig als Personen gesehen, die an den Leistungsanforderungen der Gesellschaft scheitern oder sogar »zerbrechen«. Es wird ihnen eine Unfähigkeit angeheftet, mit Stress adäquat umzugehen, zu funktionieren. Dabei spielt auch mit hinein, dass man versucht, sich durch solche Lästereien und indem man andere niedermacht, selber zu überhöhen. Man funktioniert ja im Alltag – im Gegensatz zum Küchenchef.
Das sind übrigens auch typische Muster beim Mobbing. Solch teilweise leider tief verwurzelten Stigmata sind extrem gefährlich und können die Spirale aus Ängsten, Isolation und Depression weiter und weiter beschleunigen.
Psychiatrische, psychosomatische und neurologische Erkrankungen sind zudem oft nicht gut »greifbar«. Das liegt vor allem daran, dass es an Hintergrundwissen und Aufklärung darüber mangelt. Unwissen hat schon immer Angst verursacht, Angst wiederum hat immer schon Ausgrenzung, Stigmatisierung und Vorurteile hervorgebracht. Dies spiegelt sich nicht zuletzt durchaus auch in Begrifflichkeiten wie »Irrenhaus«, »Irrenanstalt«, »Klapse«, »Irre«, »Debile« oder »Idioten« wider. Bei psychiatrischen Erkrankungen kommt es zu Zellfunktionsstörungen oder Veränderungen im Neurotransmittersystem. Sie haben also einen somatischen Hintergrund. Aber dieser ist nun mal nicht so offensichtlich und meist nicht so unkompliziert zu behandeln, als wenn ein Patient eine offene Fraktur des Schienbeins hat.
Fatal ist zudem eine oft unbegründete Angst, auch von Angehörigen und sogar Medizinern, Suizidalität aktiv anzusprechen. Betroffene sehnen sich oft danach, die Möglichkeit zu haben, über solche belastenden Gedanken zu sprechen. Allein das Gespräch darüber kann zu einer starken Reduktion der inneren Spannungen führen. Es erlaubt einem, seinen Zustand mit einem anderen Menschen zu teilen. Ansonsten vergräbt man seine Sorgen tief in seiner Seele, was einen von innen heraus immer mehr »aushöhlen« kann. Die generell stark verwurzelte Angst, übrigens auch bezüglich der medialen Berichterstattung, besteht darin, durch das direkte Ansprechen die Suizidalität überhaupt erst auszulösen. Also die an Depressionen leidenden Patienten erst auf die Idee zu bringen, sich das Leben zu nehmen, ihnen die Suizidalität zu »implantieren«.
Das Gegenteil ist aber meistens der Fall. Wie wollen Sie einem Menschen helfen, wenn Sie sich nicht anhören wollen, was er über sein Leiden zu berichten hat? Natürlich ist es eine große Verantwortung, die man sich da gegebenenfalls aufbürdet. Aber es ist Voraussetzung und der erste Schritt dafür, derart fatale Ereignisse wie Suizide zu verhindern und einem Menschen aus seiner schweren, teils hoffnungslosen Dunkelheit herauszuhelfen.
Madelyn Gould, US-amerikanische Psychiaterin, führte zu dieser alles entscheidenden Frage zusammen mit ihrem Team eine Studie durch, die 2005 publiziert wurde. An ihr nahmen 2342 Schüler von mehreren Highschools im Staat New York teil. Die Hälfte der Schüler erhielt einen Fragebogen, in dem explizit nach Suizidalität gefragt wurde, die andere Hälfte einen Fragebogen ohne Bezug auf diese Thematik. Die Studie erstreckte sich über zwei Tage.
Nach der Durchführung konnte kein signifikanter Unterschied bezüglich Depressivität oder suizidalen Gedanken zwischen den beiden Gruppen ausgemacht werden, das heißt, die Fragen haben keine Suizidalität ausgelöst. Danach führten die Wissenschaftler eine sogenannte Stratifizierung der Daten durch. Sie verglichen verschiedene Untergruppen miteinander. Dabei stellten sie fest, dass bei der von ihnen definierten »Hochrisikogruppe« (darunter fielen Schüler mit Depressionen, Substanzabhängigkeit und Suizidgedanken in der Vergangenheit) beeindruckenderweise sogar eine Abnahme ihres »Stressniveaus« und ihrer Suizidalität verzeichnet werden konnte, nachdem sie den Fragebogen ausfüllten, der Bezug auf Suizidalität nahm. Dies wurde verglichen mit der »Hochrisikogruppe«, die den Fragebogen ohne Bezug zu Suizidalität erhielt.
Der US-amerikanische Psychologe Thomas Joiner und seine Kolleginnen und Kollegen untersuchten die Auswirkungen von krankheitsbezogenen Informationen, die den Patienten nach Diagnose ihrer psychischen Erkrankung zur Verfügung gestellt wurden. Hier spielten sie mit offenen Karten. Sie vermittelten in verständlicher Sprache alle relevanten Informationen zu dieser Erkrankung. Dies kam bei den Patienten sehr gut an, auch in dem Sinne, dass sich ihre Stimmung verbesserte. Es ist also von eklatanter Bedeutung, ehrlich und ohne unbegründete Ängste im Detail und selbstverständlich in verständlicher Sprache über die Krankheit aufzuklären. Man nennt dies in der Literatur teilweise »Psychoedukation«. Selbst die Aufklärung über eine Krankheit kann Teil des Heilungsprozesses werden.
Die Melancholie der Worte
Auch Philosophen und Schriftsteller wie der französische Literaturnobelpreisträger Albert Camus beschäftigten sich intensiv mit dem Thema Suizidalität. Diese sei eng mit dem Begriff des »Absurden« verwoben, meinte er, und das Absurde war ein Hauptthema seiner Arbeiten. Camus nutzt in seinem Werk Der Mythos des Sisyphos als Allegorie das Schicksal eines Protagonisten aus der griechischen Mythologie. Sie alle kennen den Begriff »Sisyphusarbeit«. Sisyphos ist von den Göttern dazu verdammt worden, in der Unterwelt einen Stein auf einen Gipfel zu schieben. Kurz vor seinem Ziel rollt der Stein wieder ins Tal herunter, und er muss von Neuem beginnen. Es gibt unterschiedliche Erklärungen für den Grund für diese unglaublich frustrierende Strafe. Eine Version handelt davon, dass Sisyphos Thanatos, den Gott des sanften Todes, fesselte und damit verhinderte, dass weitere Menschen in dieser Zeit starben, also in die Unterwelt gehen mussten. Er selbst entkam dann noch ein zweites Mal dem Tod durch eine weitere List.
In seinen Ausführungen kommt Camus immer wieder zu der Erkenntnis, dass aus der Konfrontation mit dem Absurden eine Form der Freiheit sowie eine positive Lebenseinstellung resultieren kann und sollte. Diese Philosophie spiegelt sich vor allem in folgendem Zitat: »Dieses Universum, das nun keinen Herrn mehr kennt, kommt ihm weder unfruchtbar noch wertlos vor. Jedes Gran dieses Steins, jedes mineralische Aufblitzen in diesem in Nacht gehüllten Berg ist eine Welt für sich. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.«
Jeder, der über Suizidalität schreibt, wird hoffentlich intensiv über diese Frage nachdenken: Können Zeitungsberichte, Bücher, Filme oder Lieder über Suizidalität fatale Wirkungen auf Menschen mit Suizidgedanken haben? Und wenn ja, welche?
Vor Kurzem habe ich mir Die Zauberflöte in der Stuttgarter Staatsoper angeschaut. Natürlich hatte ich die Oper zuvor schon mehrfach gesehen, aber ich war gespannt in Hinblick auf die angekündigte moderne Version der Geschichte. Es wurden verschiedene Projektionen auf eine große Leinwand geworfen, in der sich zwei Öffnungen befanden, aus denen die Schauspieler ab und zu herauskamen und ihren Part sangen. Es fehlten leider kunstvolle Bühnenbilder, und pandemiebedingt konnten sich nur wenige Schauspieler auf der Bühne aufhalten. Auf der anderen Seite lief mir vielleicht gerade deshalb bei folgender Passage ein Schauer über den Rücken. Schien das trostlose Bühnenbild mit der weißen Wand im Hintergrund doch die innere Leere, Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit von Papageno widerzuspiegeln. Ich horchte auf:
’s ist umsonst! Es ist vergebens!
Müde bin ich meines Lebens!
Sterben macht der Lieb’ ein End
Wenn’s im Herzen noch so brennt.
…
Nun wohlan! es bleibt dabey,
Weil mich nichts zurücke hält!
Gute Nacht, du falsche Welt!
…
Halt ein, o Papageno! und sey klug.
Man lebt nur einmal, dies sey dir genug.
Der Papageno-Effekt wurde von einem der führenden Forscher auf dem Gebiet der Suizidpräventionsforschung, dem an der medizinischen Universität Wien forschenden Thomas Niederkrotenthaler, definiert. Dies geschah in Anlehnung an Papageno, einen berühmten Protagonisten aus Mozarts Zauberflöte, der von drei jungen Knaben von seinem Suizidvorhaben nach dem vermeintlichen Tod seiner Geliebten Papagena durch ein Gespräch abgehalten werden konnte – wie es auch das obige Zitat zum Ausdruck bringt. Niederkrotenthaler wies in verschiedenen Übersichtsarbeiten und Studien nach, dass Berichte oder Filme, die auf die Bewältigung von suizidalen Krisen fokussiert sind und über Suizidprävention aufklären, zu abnehmenden Suizidgedanken und -raten führen können.
In einer Untersuchung konnten sie zum Beispiel feststellen, dass es durch das Lesen eines Artikels eines Forschers zum Thema Suizidprävention zu einer signifikanten Abnahme von Suizidgedanken und einem Anstieg des Wissens über Suizidprävention kam. Teilgenommen hatten daran 545 Menschen aus der Allgemeinbevölkerung. Dabei ergab sich kein Unterschied zu einer Interventionsgruppe, die den Bericht eines Wissenschaftlers lasen, der auch von eigenen Erfahrungen bezüglich der Überwindung einer suizidalen Krise berichtet hatte.
Hollywoodfilme mit Happy End oder Geschichten, in denen die Hauptperson von Suizidgedanken abgebracht werden konnte, erzielten in anderen Studien ebenfalls schützende Effekte. In Australien wurde die Auswirkung einer dreiteiligen Dokumentationsreihe mit dem Fokus auf Männer mit Suizidgedanken und deren Suche nach medizinischer Hilfe untersucht und dies im Zusammenspiel mit den klassischen Archetypen beziehungsweise dem gesellschaftlichen »Bild eines Mannes« betrachtet. Bei den 337 teilnehmenden Probanden, erwachsenen Männern, konnte eine positive Beeinflussung ihrer Einstellung zum Einholen professioneller Hilfe nachgewiesen werden. Ebenso sind auch entsprechende Websites mit Aufklärungsinhalten zum Thema Depression und Suizid mit positiven Effekten assoziiert.
Solche speziellen Studien betrachten dabei nicht die Auswirkung auf Suizidraten, sondern generell die Beeinflussung von Suizidgedanken und die Inanspruchnahme von Hilfe oder den Rückgang von depressiven Symptomen. Außerdem wurden in den meisten Untersuchungen bislang Patienten mit akuten Suizidgedanken ausgeschlossen. In kleineren neueren Studien wurden aber auch bei Menschen mit akuten Suizidgedanken positive Effekte erzielt durch zum Beispiel Berichte über Menschen, die eine suizidale Krise überwunden haben.
Demgegenüber konnte gezeigt werden, dass vor allem wiederholte »sensationsträchtige« Berichterstattungen – insbesondere über Suizide berühmter Menschen – zu einem Anstieg von Suizidalität geführt haben. In dem Zusammenhang spricht man in Anlehnung an den Roman Die Leiden des jungen Werther, der 1774 von Johann Wolfgang von Goethe veröffentlicht wurde und dem eine vermeintlich erhöhte Suizidrate folgte, vom Werther-Effekt. In diesem berühmten Werk der Literaturgeschichte, der zur Epoche des »Sturm und Drang« gezählt wird, begeht Werther ob der Unerreichbarkeit von Lotte, die mit Albert verlobt und später verheiratet ist, mittels eines Kopfschusses Suizid. Angelehnt ist dieses Werk wohl an eigene Erlebnisse Goethes. Als Vorbild für die Geschichte könnte seine platonische Beziehung zu Charlotte Buff gedient haben, für die Selbsttötung sein Freund Karl Wilhelm Jerusalem.
Aufgrund der vermeintlichen Zunahme von Suiziden wurde das Buch oder das Tragen der Werther-Tracht (blauer Frack, gelbe Weste, Stiefel mit braunen Stulpen) in verschiedenen Städten verboten. Dabei ist es im Nachhinein wegen nicht erfolgter Erfassung der Suizide nicht klar, ob es überhaupt zu einem Anstieg von Selbsttötungen gekommen war.
In den letzten Jahren wurden verschiedene Empfehlungen für Medienberichterstattungen entwickelt. Hierbei sollte auf sehr »sensationsträchtige Darstellungen«, die konkrete Beschreibung der Suizidmethoden und die Verwendung von subjektiven, wertenden Begriffen wie zum Beispiel »Selbstmord« oder »Freitod« verzichtet werden. Jedem Artikel sollen Hinweise auf Organisationen oder Telefonnummern folgen, bei denen Betroffene niederschwellig Hilfe erhalten können. Interviews mit Experten auf dem Gebiet der Suizidprävention sollen zu einer deutlichen Reduktion von Suizidgedanken beitragen. Dies scheint sowohl der Fall zu sein, wenn die Experten von eigenen überwundenen suizidalen Krisen berichteten, als auch, wenn sie Informationen über Suizidprävention vermittelten oder von anderen Betroffenen berichteten, die suizidale Krisen überwinden konnten. Als gefährlich wurden vor allem Serien ausgemacht, in denen ein hohes Maß an Identifikation mit der Hauptfigur aufgebaut wird, die im Laufe der Geschichte Suizid begeht. Besonders gefährdet seien dabei Zuschauerinnen und Zuschauer, die einen ähnlichen soziodemografischen Hintergrund aufwiesen wie die Hauptperson oder sich in der Phase der Ambivalenz, dem Abwägen von verschiedenen Szenarien, befinden.
Ein berühmtes Lied, das immer wieder als potenzieller Auslöser von Suiziden oder sogar einer »Suizidepidemie« in den Wirren der großen Weltwirtschaftskrise der Dreißigerjahre diskutiert wird, ist »Gloomy Sunday«. Das ist die englische Version eines von Lászlo Jávor 1932 in Ungarn geschriebenen und von dem Pianisten Rezső Seress 1933 vertonten Liedes »Szomorú vasárnap«. Es handelt von den Suizidgedanken eines Mannes, der hofft, mittels Suizids mit seiner verstorbenen Partnerin wiedervereint zu werden. Neunundsiebzig Versionen des Lieds sind seitdem weltweit veröffentlicht worden, so unter anderem von Billie Holiday:
Sunday is gloomy
My hours are slumberless
Dearest, the shadows
I live with are numberless
…
Angels have no thought
Of ever returning you
Would they be angry
If I thought of joining you?
Verzögert zu der Veröffentlichung des Lieds 1933, dessen Zeilen wie die eines Abschiedsbriefs klingen, scheint es ab 1936 zu einem Suizidcluster in Ungarn gekommen zu sein. Darunter versteht man das Auftreten von mehreren Suiziden, die in einem bestimmten Zusammenhang zueinander stehen – in dem Fall mit dem überaus melancholischen und traurigen »Gloomy Sunday«.
Dokumentiert sind zumindest siebzehn Suizide, die damit in Verbindung gebracht werden können. Zum Beispiel lief zum Zeitpunkt des Suizids das Lied, oder es gab Hinweise in den Abschiedsbriefen der Verstorbenen. Unter anderem wurde von einem Gerücht berichtet, dass ein junger Mann in Rom sein ganzes Geld an einen Bettler weitergab, der »Gloomy Sunday« summte, und kurz darauf in einen nicht weit entfernten Fluss sprang. Verschiedene Radiostationen wie die BBC spielten das Lied über Jahrzehnte nicht mehr (wohl bis 2002), aus Angst, dass sie damit andere Menschen zum Suizid motivieren könnten. Möglicherweise fühlen sich Betroffene durch die traurige Grundstimmung des Lieds in ihrer eigenen inneren Zerrissenheit, in ihrer Ambivalenz kurz vor der Entscheidung, Suizid zu begehen, in einer bestimmten Form verstanden und finden eine Begleitung auf ihrem eingeschlagenen fatalen Weg.
Das Lied alleine führt sicher nicht zu Suiziden, dazu gehören ein meist langjähriger Abwägungsprozess und weitere später zu diskutierende Faktoren. Nicht vergessen werden dürfen die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung herrschenden schwerwiegenden wirtschaftlichen Probleme mit hoher Arbeitslosigkeit sowie die Auswirkungen und Bedrohungen durch das aufkommende Nazi-Regime.
Trauen Sie sich, anderen Menschen von Ihren seelischen Problemen zu erzählen
Bislang habe ich schon viele Patientinnen und Patienten im Notfalldienst in der Klinik behandelt, bei denen schnell der Verdacht auf eine psychische Genese der körperlichen Symptome aufkam oder der Hinweis auf eine im Vordergrund stehende Depression bestand. So erinnere ich mich an eine Patientin, die sich spätabends mit seit Monaten bestehender Schwindelsymptomatik vorstellte. Sie konnte nur wenige Schritte gehen, schwankte dabei sehr bedrohlich und knickte nach wenigen Schritten in den Beinen zusammen. Ohne Begleitung konnte sie kaum laufen.
Die neurologische körperliche Untersuchung dient primär dazu, die möglicherweise betroffenen Hirnareale oder peripheren Nerven abzugrenzen. Diese Zuordnung war aufgrund der geäußerten vielseitigen Symptome allerdings nicht möglich. Die Untersuchung der Reflexe, Kraft und des Berührungsempfindens blieb gänzlich unauffällig. Dann sprach sie von einem kleinen Hautpunkt über dem rechten Schulterblatt. Drücke man darauf, würde der Schwindel deutlich zunehmen und sie für ein bis zwei Sekunden bewusstlos werden. An der Stelle tastete man eine kleine Verhärtung, möglicherweise ein Lipom, also ein in der Regel gutartiger Tumor des Fettgewebes.
Nachdem sie mich darum bat, auf dieses Areal zu drücken, wurde sie auf die Sekunde bewusstlos, richtete sich aber ebenso schnell wieder auf. Dies ließ sich zumindest durch unseren westlichen, schulmedizinischen Ansatz überhaupt nicht erklären. In der Untersuchung wirkte sie in ihrer Schwingungsfähigkeit deutlich eingeschränkt, das heißt, ihre Mimik und Gestik blieben ohne größere Gefühlsäußerungen, und die Stimme war durchgehend monoton. Als ob sie sich in einen unsichtbaren Kokon oder Schutzpanzer gehüllt hätte. Sie vermied konsequent den Blickkontakt. Gleichzeitig spürte ich ein starkes Misstrauen, das immer größer wurde, als ich eine mögliche psychosomatische Genese ansprach und nach Symptomen einer Depression fragte.
Ein großes Problem stellt nicht zuletzt das oft sehr reduzierte Selbstwertgefühl depressiver Menschen dar. Das kann dazu führen, dass sich depressive Menschen selber die Schuld für ihre Situation geben. Es schwingen dabei starke Insuffizienzgedanken mit. In einer Leistungsgesellschaft wie der unseren werden psychiatrische Erkrankungen leider sehr schnell als Unfähigkeit, Versagen und Schwäche ausgelegt. Es kommt oft zu starken Einschränkungen und Problemen im Alltags- und Berufsleben. Dies wird dann leider fatalerweise von außen gerne gleichgesetzt mit Unfähigkeit, fehlender Widerstandsfähigkeit, eingeschränkter Belastbarkeit, Faulheit, mangelndem Fleiß oder gar Dummheit. Hier sind wir wieder bei dem Ausspruch »Reiß dich doch einfach mal zusammen«. Es wird Betroffenen möglicherweise sogar unterstellt, dass sie ihre Symptome gezielt hervorbringen.
Insgesamt kann man sich gut vorstellen, wohin dies führen kann. Die zunehmende Isolation zieht die Betroffenen immer weiter ins Unglück. Dazu kommt dann auch noch die Coronapandemie, die mit einer starken Einschränkung von auch psychiatrischen Behandlungsangeboten einhergeht und die Hürden und Ängste, sich in einer akuten Belastungssituation in einer psychiatrischen Klinik vorzustellen, nur noch weiter verstärkt. Es entsteht ein starkes Misstrauen, wieder in eine solche »Schublade« eingeordnet zu werden.
Bildlich muss ich dabei oft an den Sturz in den Mahlstrom von Edgar Allan Poe denken – nur dass der selbstzerstörerische Kampf gegen sich selbst und nicht gegen einen Strudel an der norwegischen Küste ausgetragen wird.
Kann man denn überhaupt aus diesem Mahlstrom entkommen? Die wichtigsten Werkzeuge sind Aufklärung über und Destigmatisierung von psychiatrischen Erkrankungen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die Gesellschaft Betroffenen offener begegnet, mit mehr Verständnis, Geduld und letzten Endes Empathie. Trauen Sie sich, Suizidalität offen anzusprechen. Nur so lässt sie sich auch verhindern.
Wir sollten zudem mehr darauf achten, wie wir mit unserer Sprache umgehen. Begriffe wie »geisteskrank«, »schizophren« oder »Psycho« sollten aus unserem Vokabular gestrichen werden. Natürlich werden wir der unglaublich komplexen und wertvollen Persönlichkeitsstruktur von Menschen ebenfalls nicht gerecht, wenn wir von »Depressiven« reden. Es handelt sich beileibe um eine Art Pars pro Toto, bei dem der Mensch mit seiner Krankheit gleichgesetzt wird. Dies muss uns immer bewusst sein und uns dazu verleiten, die Mühe von längeren Paraphrasien (also Umschreibungen) einzugehen, da wir sonst mit unseren sprachlichen Äußerungen zur Stigmatisierung beitragen.
Auf der anderen Seite sehe ich psychosomatische Erkrankungen oder Symptome als Sprache des Unterbewusstseins, Hilfeschreie der Seele, als »Verkörperlichung« von massiven inneren Konflikten und Kämpfen. Wir müssen also nicht nur auf unsere eigene Sprache achten, wir müssen auch lernen, besser zuzuhören, um diese Sprache zu verstehen.
Hier möchte ich auf zwei Fälle eingehen, die mich sehr beschäftigt haben. Natürlich sind beide wahren Geschichten verfremdet und ausgestaltet, um keine Rückschlüsse auf Patienten zu erlauben.
Es war ein klassischer Vierundzwanzig-Stunden-Dienst. Morgens um acht ging es mit der normalen Stationsarbeit los, bis 16:30 Uhr. Es handelte sich um den Tag vor einem Feiertag, sodass die Stationsbesetzungen ohnehin schon reduziert waren. Gleichzeitig zur Versorgung der Station musste ich an einer Fortbildung teilnehmen. Gegen siebzehn Uhr startete danach dann mein Dienst. Wie es zu erwarten war, war ich bis gegen fünf am nächsten Morgen durchgehend mit Untersuchungen von Notfallpatienten in der interdisziplinären Notaufnahme beschäftigt. Viele kamen, weil sie mögliche schwere Nebenwirkungen nach der Coronaimpfung befürchteten – insbesondere Sinusvenenthrombosen.
Gegen 3:30 Uhr erreichte mich der Anruf eines Notarztes, der gerade in der gynäkologischen Klinik war. Sie seien dazu gerufen worden, weil eine Patientin ungefähr eine halbe Stunde nach der Gabe einer Infusion von Paracetamol über die Vene sich nicht mehr bewegte. Das Telefon wurde dem gynäkologischen Kollegen gegeben, der aufgeregt und völlig perplex schilderte, dass die Arme und Beine der Patientin schlaff und kraftlos seien. Er hebe sie hoch, und sie würden sofort wieder auf das Bett herunterfallen. Da sei keine Muskelanspannung mehr. Auch würde die junge Frau nicht mehr sprechen. Er vermute einen Schlaganfall. Zur Vorgeschichte konnte er mir nur mitteilen, dass die neunzehn Jahre alte Frau, die vor wenigen Monaten nach Deutschland gekommen sei, vor drei Wochen eine Ausbildung zur Röntgenassistentin begonnen habe. Sie lebe im Schwesternwohnheim. Seit drei Wochen habe sie stärkste Schmerzen im linken unteren Bauchbereich, weshalb sie sich zunächst in der Gynäkologie vorgestellt hatte.
Ich sagte dem Kollegen, dass sie sofort zu uns gebracht werden soll, und zwar in den Schockraum. Dieser ist ein speziell ausgestatteter Raum, in dem alle Notfallmedikamente und diagnostischen Verfahren wie Ultraschall und Computertomografie schnell zur Verfügung stehen. Ich informierte rasch die zuständige Pflege sowie den Neuroradiologen und zerbrach mir in den sieben Minuten bis zur Ankunft den Kopf darüber, was die Patientin haben könnte.
Meine Gedanken wurden jäh vom schrillen Klingelton des unsäglichen Notfalltelefons unterbrochen, das ich in meiner Wut mehr als einmal auf den nächstgelegenen Tisch gedonnert hatte. Die Patientin lag starr auf einer Notfallliege. Bauch und Beine waren mit einem Gurt fixiert. Ich versuchte, ihr Gesicht zu lesen – aber es war völlig ausdruckslos. Keine Andeutung von Schmerz, keine Träne. Die Stirn war völlig faltenlos. Augen und Mund geschlossen. Die Hautfarbe fahlgrau. Auf Ansprechen reagierte die Patientin zunächst nicht. Ich hob den Arm hoch, nachdem ich ihn vom Gurt befreit hatte, aber er fiel von selbst wieder auf die Liege. Das Gleiche geschah mit ihren Beinen. Ich setzte Schmerzreize an den Füßen sowie den Beinen. Normalerweise sollten diese reflexartig zurückgezogen werden. Es passierte aber nichts. Meine Fragen nach Drogen, Medikamenten oder Vorerkrankungen wurden vom Rettungsdienst mit Schulterzucken beantwortet.
Auch wenn ich keine Antworten erhielt, fragte ich die Patientin so behutsam und empathisch, wie es die akute, möglicherweise lebensgefährliche Situation zuließ, immer wieder nach ihrem Namen. Ich fragte sie, ob etwas Schlimmes passiert sei in den letzten Tagen und ob sie Drogen genommen habe. Ich bildete mir ein, dass sie ein leises Nein hauchte. Dann sah ich, wie eine kleine Träne aus dem linken Auge die nun zunehmend rosafarbene Wangenhaut nach unten rann. Ich hatte eine Vermutung – aber wie bei allen psychosomatischen Krankheitsbildern müssen zunächst immer schwerwiegende somatische Ursachen ausgeschlossen werden. Auch ein Verschluss der Arteria basilaris, eine der Hauptadern des Gehirns, kann zu komatösen Zuständen, Sprachstörungen und Lähmungen der Arme und Beine führen. Es wäre dann Ausdruck eines schweren Schlaganfalls.
Ich rief die Oberärztin an und diskutierte mit ihr kurz die Situation. Wir kamen in den wenigen Sätzen, die wir austauschten, zu dem Schluss, dass wir in der Situation eine Computertomografie mit Kontrastmittel machen mussten, um den Verschluss des Gefäßes auszuschließen, auch wenn wir beide an ein anderes Krankheitsbild dachten. Die Bildgebung stellte sich als unauffällig heraus.
Eine halbe Stunde später »wachte« die junge Frau aus der Starre auf. Sie konnte wieder Arme und Beine bewegen und, zwar langsam und sichtlich geschwächt, selbstständig zur Toilette gehen. Ihre beste Freundin war auch im Notaufnahmezimmer und sprach mit ihr. Ohne Einwirkung von spezifischen Medikamenten überwand sie den »psychischen Ausnahmezustand« (ein weiterer, meiner Meinung nach despektierlicher Begriff, der oft bei Ankündigungen durch den Rettungsdienst verwendet wird). Ein dissoziativer Stupor ist ein auch durchaus lebensgefährlicher Zustand einer völligen Regungslosigkeit des Körpers und fehlender Sprachproduktion, der im Rahmen schwerer psychiatrischer Erkrankungen wie einer posttraumatischen Belastungsstörung, einer Schizophrenie oder schwerer Depressionen auftreten kann. Dies kann so weit gehen, dass die Betroffenen künstlich ernährt werden müssen oder ein Harnblasenkatheter gelegt werden muss, da sich die Blase nicht mehr entleert.
Natürlich fragte ich die Patientin nach psychosozialen Belastungsfaktoren, die sie verneinte. Aber vielleicht spielte der Arbeitsbeginn in dem neuen, für sie fremden Land, fern von ihrer Familie eine Rolle. Aber sie wollte nicht näher darauf eingehen. Sie äußerte verständlicherweise den Wunsch, nach Hause zu gehen. Auch ein Gespräch mit einem Psychiater wünschte sie nicht. Sie mied den Blickkontakt mit mir. Als ob sie dem Kegel eines auf sie ausgerichteten grellen Scheinwerferlichtes ausweichen wollte.
Da sie wieder stärkste Schmerzen im Bauchbereich angab, bot ich ihr aber noch eine internistische Untersuchung an. Der stimmte sie zu. Auch die ausführliche Untersuchung mittels Laborabnahme und Magenspiegelung bei den internistischen Kollegen ergab keinen auffälligen Befund. Sie ging dann mit der Freundin nach Hause.
Eine weitere junge Patientin, an die ich oft denken muss, traf ich ebenfalls in der Notaufnahme. Sie hatte zu Hause immer wieder motorische Entäußerungen der Arme und Beine gezeigt, wie bei einem Krampfanfall. Auch bei ihrer Vorstellung in der Klinik zitterte sie an beiden Armen und Beinen, die Extremitäten befanden sich in einer schwer zu lösenden verkrampften Beugehaltung, die Augen waren fest verschlossen. Sie weinte ununterbrochen.
Der Notarzt hatte ihr schon recht hohe Dosen von Beruhigungsmitteln intravenös gegeben, ohne dass sich ihr Zustand veränderte. Es handelte sich um einen sogenannten dissoziativen Anfall, der auch im Rahmen von schweren Belastungsreaktionen wie nach Trennungen auftreten kann, was auch bei der Patientin kurz zuvor geschehen war. Häufig hilft es bei derartigen Anfällen nur, abzuwarten, bis er von selber aufhört aufgrund der nachvollziehbaren starken Erschöpfung, was bei der Patientin auch nach ungefähr einer Stunde geschah. Da ich eine akute Suizidalität bei der ausgeprägten Reaktion nicht ausschließen konnte, organisierte ich eine Verlegung in die Psychiatrie.
Die beiden Geschichten sind nicht die Regel. Solche schweren Symptome treten nur selten auf. Trotzdem kennen wir alle mehr oder weniger leichte psychosomatische Beschwerden. Sie drängen sich uns auf, wenn wir Liebeskummer haben, stressige Zeiten im Beruf erleben, vor Prüfungen stehen oder Auftritte absolvieren müssen. Durchfall, Übelkeit, Magenschmerzen, Sodbrennen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen – um nur die häufigsten Reaktionen kurz aufzuzählen. Aber natürlich sind auch positive Reaktionen möglich – denken Sie nur an die klassischen Schmetterlinge im Bauch. Somatische Symptome können möglicherweise als Mittel genutzt werden, das häufig unaussprechliche, nicht greifbare Mysterium in unserer innersten Seele anderen mitzuteilen. Sie fungieren als eine Sprache, mit der andere Menschen leider immer noch besser erreicht werden können, als wenn direkt über die dahinter liegenden Ängste, Sorgen oder generell innere Zerrissenheit gesprochen wird. Sie sind gesellschaftlich weiterhin deutlich akzeptierter als seelische Erkrankungen, die einem schnell als charakterliche Schwäche, fehlende Belastbarkeit, Leistungsverweigerung oder Ähnliches ausgelegt werden. Die ist vor allem der Fall in stark hierarchisch oder gar militaristisch organisierten Betrieben.
Man spricht in dem Zusammenhang von »sozial erwünschtem Verhalten«. Auch kulturelle Aspekte können hier mit hineinspielen. Oft sind psychosomatische Beschwerden Ausdruck eines Hilferufs in für die Betroffenen ausweglos erscheinenden Situationen. In den meisten Fällen sind diese Symptome nicht zu kontrollieren. Die junge Frau war nicht in der Lage, ihren Körper anzusteuern und damit zu bewegen. Es sind, wie zuvor erwähnt, keine artifiziellen Störungen, das heißt, dass die Betroffenen die Symptome nicht selber hervorrufen. Das wäre der Fall beim Münchhausen-Syndrom oder Münchhausen-by-Proxy-Syndrom. Bei psychosomatischen Symptomen oder Erkrankungen sind die Patientinnen und Patienten den Symptomen meist ausgeliefert oder haben kaum Kontrolle über die Beschwerden. Es ist keine Schauspielerei und genauso ernst zu nehmen wie eine klassische somatische Erkrankung!
Wenn es zu schweren unerklärlichen somatischen Beschwerden kommt, für die bei verschiedenen Ärzten keine Erklärung gefunden wird, muss dies immer als Warnsignal gesehen werden – auch für eine mögliche Suizidalität. Deshalb mein Appell an Sie: Achten Sie auf solche Symptome und versuchen Sie, diese als mögliche Warnsignale zu deuten für eine tiefe innere Zerrissenheit beziehungsweise Krise, insbesondere dann, wenn sich keine somatische Ursache gefunden hat.
Ein Blick in die Untiefen der Seele
Ich denke öfter zurück an die Zeit, als ich an meiner Doktorarbeit saß. Etliche Male bin ich den Weg vom Berliner U-Bahnhof Turmstraße zur Rechtsmedizin der Charité gehetzt. Vorbei an Bistros, Dönerläden, Mehrfamilienhäusern. Die Erinnerungen vermengen sich mit Gedanken an die rechtsmedizinischen Kurse. Der beißende Geruch von Formalin bahnt sich seinen Weg zum Riechnerv, gepaart mit dem übel riechenden Film auf der Haut, den nasse Kunststoffhandschuhe hinterlassen. Egal wie oft man sich die Hände wäscht. Eine extrem unangenehme Kälte schlägt mir jedes Mal beim Verlassen der U-Bahn-Station entgegen.
Die Arbeit an meiner Dissertation fiel zu großen Teilen zusammen mit den Vorbereitungen zum Zweiten Staatsexamen, weshalb die Erinnerungen auch gefärbt sind von dem Bild eines ständig unter Strom stehenden, extrem gestressten Studenten, der von Termin zu Termin eilte. Viele Stunden verbrachte ich dabei in den Archiven des rechtsmedizinischen Instituts und versank dabei förmlich in den tragischen Schicksalen. Obduktionsakten bestehen schließlich nicht nur aus dem in nüchterner, medizinischer Fachsprache gehaltenen Sektionsprotokoll. Teilweise enthalten sie die ersten Ermittlungsergebnisse, Polizeiberichte, Zeitungsartikel, Abschiedsbriefe, Protokolle von Zeugenbefragungen vor Gericht und vor allem eines: Tatortfotos. Dies dient der genauen Dokumentation der Auffindesituation und der anschließenden Rekonstruktion des Tatablaufs.





























