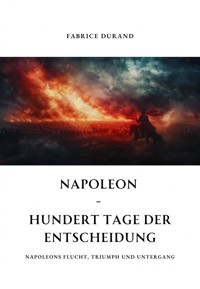
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Frühjahr 1815 geschieht das Unvorstellbare: Napoleon Bonaparte, der einst gefürchtete Kaiser der Franzosen, entkommt aus seinem Exil auf der Insel Elba. Was folgt, sind die Hundert Tage, eine der dramatischsten Episoden der europäischen Geschichte. Mit ungebrochenem Willen und strategischer Brillanz zieht Napoleon in einem beispiellosen Feldzug durch Frankreich, um sich erneut die Krone zu sichern. Dieses Buch beleuchtet die letzten Monate im Leben eines Mannes, der einst die Geschicke Europas bestimmte. Von seiner waghalsigen Flucht über die euphorische Rückkehr bis hin zur katastrophalen Niederlage in der Schlacht von Waterloo, zeigt Fabrice Durand in fesselnder Weise die Höhen und Tiefen Napoleons letzter Herrschaftsperiode. "Napoleon - Hundert Tage der Entscheidung" ist eine packende historische Erzählung über Macht, Ambition und das unaufhaltsame Rad des Schicksals. Ein Muss für jeden, der die Faszination und Tragik des größten Feldherrn aller Zeiten verstehen möchte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Napoleon - Hundert Tage der Entscheidung
Napoleons Flucht, Triumph und Untergang
Fabrice Durand
Die Rückkehr vom Exil: Napoleons Flucht von Elba
Vorbereitung der Flucht: Planung und Geheimhaltung
Die Rückkehr von Elba nach Frankreich, die Napoleon im März 1815 unternahm, war das Ergebnis sorgfältiger Planung und akribischer Geheimhaltung. Diese Flucht war nicht nur ein bedeutendes historisches Ereignis, sondern auch ein Zeugnis Napoleons strategischen Könnens und seines ungebrochenen Ehrgeizes. Der Erfolg dieses Unternehmens hing von der Fähigkeit ab, die Bewegungen der loyalen Anhänger und die Aufmerksamkeit der Gegner genauestens zu koordinieren.
Nachdem Napoleon im April 1814 nach seinem ersten Abdanken auf die Mittelmeerinsel Elba verbannt worden war, begann er fast umgehend mit Vorbereitungen, um seine Rückkehr nach Frankreich sicherzustellen. Elba war, trotz seiner Abgeschiedenheit, zu klein, um Napoleons Energie und Tatendrang lange zu binden. Bereits im Januar 1815 intensivierten sich Napoleons Vorbereitungen. Dabei war ein wesentlicher Faktor die diplomatische und militärische Lage in Europa, die er genau beobachtete. Die Koalitionsmächte, die Napoleons Absetzung erreicht hatten, waren von inneren Spannungen und Misstrauen geprägt, was Napoleon eine vorsichtige Öffnung für seine Rückkehr einräumte.
Ein entscheidender Aspekt der Vorbereitung war die Geheimhaltung. Napoleon wusste, dass er nur dann erfolgreich und ungehindert nach Frankreich zurückkehren konnte, wenn sein Plan vollständig im Verborgenen blieb. Dazu nutzte er vertrauenswürdige Anhänger, darunter den General Henri-Gatien Bertrand, der zusammen mit anderen Loyalisten wesentliche organisatorische Aufgaben übernahm. Diese ernannten Vertrauten sammelten heimlich Informationen und bereiteten logistische Aspekte wie Schiffe, Proviant und Truppen vor. Dabei mussten alle Aktivitäten so verdeckt wie möglich durchgeführt werden, um keinen Verdacht bei den auf Elba stationierten Alliierten zu erwecken.
Ein weiterer Schlüssel zur Geheimhaltung war das strikte Regiment auf Elba selbst. Napoleon führte eine disziplinierte Verwaltungsstruktur ein, die ihm erlaubte, Aktivitäten zu kontrollieren und Informationen zu filtern. Diese administrative Kontrolle erstreckte sich über den Hafen von Portoferraio, wo Napoleon sicherstellte, dass nur ihm loyale Seeleute Zugang hatten. Sein Anwalt und enger Vertrauter Antoine Christophe Saliceti spielte dabei eine bedeutende Rolle, indem er Informationen sammelte und Napoleons Pläne koordinierte.
Parallel dazu wurde das Netz von Unterstützern auf dem europäischen Festland aktiviert. Botschafter François de Montgaillard und Polizeiminister Joseph Fouché arbeiteten im Hintergrund, um sicherzustellen, dass Napoleon bei seiner Rückkehr auf Unterstützung zählen konnte. Fouché, ein Meister konspirativer Machenschaften, sicherte Informationsflüsse und baute eine geheime Kommunikationslinie zwischen Elba und Frankreich auf. Diese verdeckten Operationen ermöglichten es Napoleon, ausführliche Kenntnisse über die politische Situation in Frankreich zu erhalten und die beste Zeit für die Rückkehr abzuschätzen.
Die Vorbereitungen auf Elba gingen auch mit verstärkter militärischer Ausbildung einher. Napoleon überprüfte regelmäßig die auf der Insel stationierte Armee, schulte deren Kampfbereitschaft und vergrößerte die Truppen durch Loyalisten, die von Frankreich aus heimlich nach Elba befördert wurden. Dieses Crescendo an Aktivitäten wurde jedoch raffiniert durch eine Fassade von Normalität getarnt. Als Tarnung inszenierte Napoleon große Feierlichkeiten und Festlichkeiten, wie den Geburtstag seines Sohnes, während parallel die letzten Vorbereitungen für die Flucht getroffen wurden. Diese Feierlichkeiten sollten die Alliierten täuschen und beruhigen, um ihnen den Eindruck zu vermitteln, dass Napoleon keine Fluchtpläne hegte.
Ein wichtiger Teil der Logistik war die Beschaffung eines geeigneten Schiffs. Nach mehreren Sondierungen entschied sich Napoleon für die Brigg "Inconstant". Die Brigg wurde heimlich vorbereitet und unter falscher Flagge registriert, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Schließlich wurde am 26. Februar 1815 das endgültige Signal zur Abfahrt gegeben. In einer konzertierten Aktion bestiegen Napoleon und seine Männer das Schiff und verließen unter dem Deckmantel der Dunkelheit Elba.
Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Vorbereitung von Napoleons Flucht von Elba war ein Meisterwerk der Planung und Geheimhaltung. Durch strikte Geheimhaltung, loyale Anhänger und diplomatisches Geschick gelang es Napoleon, seine Rückkehr nach Frankreich zu orchestrieren. Es war diese akribische Vorbereitung, die das Fundament für die darauf folgenden dramatischen Hundert Tage legte – eine Periode, die Europa für immer verändern sollte.
Die Überfahrt: Napoleons riskante Reise über das Mittelmeer
Die Nachricht der Verbannung Napoleons nach Elba verhallte nicht lange, bevor der Kaiser der Franzosen beschloss, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und eine waghalsige Rückkehr zu planen. Die Flucht von der Insel Elba, eine kleine Mittelmeerinsel vor der Küste Italiens, war ein Akt der Kühnheit und Verzweiflung, der seine Rückeroberung von Frankreich einleitete.
Am Abend des 26. Februar 1815 begann Napoleons riskante Überfahrt über das Mittelmeer. Der Kaiser hatte seine Flucht sorgfältig vorbereiten lassen, indem er seine Gefolgsleute und einige loyale Soldaten in seine Pläne eingeweiht hatte. Für die Überquerung des Mittelmeers ließ er eine kleine Flotte vorbereiten, bestehend aus der Brigg „Inconstant“ und einigen kleineren Schiffen. Dank rigoroser Geheimhaltung konnten die Vorbereitungen unbemerkt bleiben. „Die Dunkelheit der Nacht war seine Verbündete“, wie es in zeitgenössischen Berichten heißt.
In der Nacht, als alles bereit war, verließ Napoleon die kleine Hauptstadt Portoferraio an Bord der „Inconstant“. Das Schiff und seine Begleiter stachen in See, wohlwissend, dass die britische Marine in der Nähe patrouillierte. Schon allein die Überfahrt war mit hohen Risiken behaftet. Zum einen mussten sie der britischen Blockade entkommen, zum anderen drohte die Gefahr eines Sturmes oder eines anderen natürlichen Unglücks im Mittelmeer.
Napoleon war sich aller dieser Risiken bewusst. Wie er später Didier schrieb: „Die See war rau, und der Wind stand gegen uns. Doch mein Entschluss war fest; es gab keinen Weg zurück.“ Die moralische und psychologische Belastung dieses Unternehmens darf nicht unterschätzt werden. Jede Kurzwelle und jedes fremde Segel am Horizont könnte das endgültige Ende seiner Ambitionen bedeuten.
Glück und präzises Timing spielten eine zentrale Rolle bei der Flucht Napoleons. Der Kaiser navigierte nicht nur zwischen militärischen und natürlichen Gefahren, sondern musste auch die moralische Unterstützung seiner wenigen loyalen Anhänger aufrechterhalten. Das Ziel war die Kontaktaufnahme mit loyalen Kräften auf dem französischen Festland, um den Sturz Ludwigs XVIII. vorzubereiten.
Es gibt kaum detaillierte Berichte über die genaue Überfahrt, doch es wird allgemein angenommen, dass die Reise etwa drei Tage dauerte. Am 1. März 1815 erreichte die „Inconstant“ die südfranzösische Küste nahe Cannes. Napoleons riskante Reise über das Mittelmeer war erfolgreich beendet, doch dies war lediglich der Beginn einer viel größeren Herausforderung: die Rückeroberung von Paris und die Wiederherstellung seines Imperiums in nur hundert Tagen.
Das Ende der Überfahrt markierte einen Wendepunkt in Napoleons Bestrebungen und stellte den Auftakt zu seiner dramatischen Rückkehr an die Macht dar. Die Vorbereitungen und Geheimhaltung, die äußerst riskante Überfahrt und letztlich das sichere Erreichen des französischen Festlands waren ein Zeugnis seines ungebrochenen Willens und seiner militärischen Brillanz. Diese Episode wird als eine der kühnsten und beeindruckendsten Fluchtgeschichten der Geschichte erinnert.
In abschließender Betrachtung ist die Überfahrt über das Mittelmeer nicht nur ein Kapitel von Napoleons militärischen Abenteuern, sondern auch ein Beispiel für entschlossenen Mut und strategisches Geschick. Sie leitete die finale Phase seiner spektakulären Karriere ein, die später zur Schlacht von Waterloo und seinem endgültigen Sturz führen sollte.
Mit ruhiger Hand, umgeben von loyalen Anhängern und getragen von einem unbezwingbaren Ehrgeiz, setzte Napoleon seine Reise fort, die ihm und der Welt noch ein letztes, großes Drama bringen sollte.
Landung in Frankreich: Empfang auf dem Festland
In den frühen Morgenstunden des 1. März 1815 setzte das kleine Konvoi, bestehend aus Napoleons Schiff "Inconstant" und mehreren weiteren Begleitern, auf einem Küstenabschnitt bei Golfe-Juan an Land. Für seine Anhänger sollte dieser Moment einer der denkwürdigsten in der Geschichte werden, da er den Beginn einer dramatischen und unerwarteten Rückkehr markierte. Die Wahl dieses Ortes war keineswegs zufällig; während andere Orte wie Cannes in Betracht gezogen worden waren, entschied sich Napoleon strategisch für Golfe-Juan wegen dessen relativer Isolation und Nähe zu potenziellen Unterstützern im Landesinneren.
Die Landung selbst verlief ohne Zwischenfälle, was erstaunlich war angesichts der Wellen von Ungewissheit, die über Napoleons Flucht schwebten. Nachdem er sich vom Schiff begeben hatte, versammelte Napoleon seine kleine Entourage, zu der etwa 1.100 Männer gehörten. Männer, die bereit waren, ihr Leben für den zurückgekehrten Kaiser zu riskieren. Der Geheimplan dieser Landung hatte sich bewährt, und keiner der anwesenden königlichen Truppen oder lokalen Behörden hatte den geringsten Verdacht gehabt.
In den ersten Momenten nach dem Verlassen der Küste mag es den Beteiligten wie der Beginn eines waghalsigen Abenteuers vorgekommen sein. Für Napoleon jedoch war dies nichts weniger als eine Schicksalsmission. Wie Napoleon Bonaparte selbst in seinen Memoiren festhielt: „Ich spürte, dass meine Sache gerecht war. Kein Hindernis konnte mich davon abhalten, Frankreich erneut zu führen, so wie ich es früher getan hatte“ (Bonaparte, 1815).
Die Ankunft Napoleons in Frankreich wurde bald zur Sensation. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer über die Dörfer und Städte, und die Reaktionen waren gemischt. Einige in der Bevölkerung begrüßten ihn mit offenen Armen. Besonders in den kleineren Städten und Dörfern entlang seines Marschweges war die Begeisterung fast legendär. „Er war für sie der Kaiser, der Mann, der dem Land einst Ruhm und Größe gebracht hatte,“ wie der Historiker Alphonse de Lamartine später schrieb (Lamartine, 1835).
Es gab jedoch auch Skepsis und offene Feindseligkeit. Die royalistische Regierung, die von König Ludwig XVIII. geführt wurde, erachtete Napoleons Rückkehr als Bedrohung und verweigerte jegliche Anerkennung. Diese Haltung sollte jedoch nicht nur von den Machthabern, sondern auch von Teilen der Armee und der wohlhabenderen Klassen geteilt werden, die an der bestehenden Ordnung festhalten wollten. „Napoleon hat uns einst ins Verderben geführt. Wir dürfen ihm nicht erlauben, es erneut zu tun,“ äußerte sich ein prominenter Politiker der Zeit in einem anonymen Pamphlet (Anonym, 1815).
Doch für Napoleon war der Empfang durch das einfache Volk entscheidend. Auf seinem Marsch nach Norden, der als legendärer „Adlerflug“ in die Geschichte eingehen sollte, wurde er von Bauern, Kleinbürgern und sogar einigen abtrünnigen Soldaten begleitet. Jede Etappe seiner Reise wurde zu einem Akte des Triumphs, unterstützt durch die wachsende Zahl an Anhängern. Besonders in den Dörfern und kleineren Städten der Provence wurde sein Wille zur Rückkehr mit tosendem Applaus und Blumenteppichen begrüßt – ein Symbol für den unerschütterlichen Glauben an die Rückkehr des "Kaisers der Herzen".
Die Landung in Frankreich markierte also nicht nur den Beginn von Napoleons letztmanch einem hoffnungsvollen aber auch kühnem Abenteuer, sondern auch einen Punkt, an dem die Widerstandskraft und die Loyalität der französischen Bevölkerung auf die Probe gestellt wurde. Die Art und Weise, wie seine Landung angenommen wurde, legte den Grundstein für seine erneute Hegemonie und offenbart die Komplexität und die Zerrissenheit einer Nation im Angesicht eines bedeutsamen Moments ihrer Geschichte.
Der Marsch nach Paris: Die Reise durch die Provenzalischen Dörfer
Napoleons Marsch durch die provenzalischen Dörfer auf seinem Weg nach Paris ist eine der faszinierendsten und dramatischsten Episode seiner Rückkehr zur Macht. Diese Reise bietet einen tiefen Einblick in die politische und soziale Landschaft Frankreichs zu Beginn des 19. Jahrhunderts.
Nachdem Napoleon am 1. März 1815 in Golfe-Juan an der Côte d'Azur an Land ging, begann seine Reise gen Norden. Diese Marschroute war eine wohlüberlegte Entscheidung. Der südliche Teil Frankreichs, die Provence, war eine Region, die Napoleon kannte und in der er zahlreiche Unterstützer erhoffte.
Die ersten Tage der Reise waren geprägt von nervöser Erwartung. Napoleon und seine kleine Armee von etwa 1.100 Mann, bestehend aus treuen Veteranen, Elitesoldaten und einigen Freiwilligen, wussten, dass jeder Schritt von entscheidender Bedeutung sein würde. Ihre Reise führte sie zuerst durch die Städte Cannes und Grasse, bevor sie in die tiefer gelegenen Gebiete der Provence eindrangen.
Empfang in Digne: Zeichen der Unterstützung
Einer der wesentlichen Abschnitte dieser Reise war der Durchmarsch durch Digne, eine Stadt, die ein bedeutendes Zeichen der Unterstützung für Napoleon war. In Digne wurde er von einer enthusiastischen Menge begrüßt, die seine Rückkehr als Zeichen der Hoffnung und Befreiung von der ungeliebten Bourbonenherrschaft sah. Zeitgenössische Berichte beschreiben die Szene mit lebhaften Details: „Die Straßen waren gesäumt von Menschen, die jubelten und ‚Vive l’Empereur!‘ riefen.“ (Quelle: Mémoires du général baron de Marbot).
Der Taktische Halt in Sisteron
Weiter ging die Reise nach Sisteron, wo Napoleon bewusst einen strategischen Halt einlegte. Sisteron war nicht nur ein strategisch wichtiger Ort aufgrund seiner Lage am Fluss Durance, sondern auch ein Punkt, an dem Napoleon die Gelegenheit ergriff, seine Truppen zu konsolidieren und seine Position zu stärken. Hier kam es zu einer interessanten Begegnung mit dem Bürgermeister der Stadt, der anfangs skeptisch war, aber schließlich Napoleon seine Unterstützung zusicherte, nachdem er die Begeisterung der Soldaten und Bürger sah.
Einzug in Gap: Moralische Stärkung der Truppen
Der Marsch führte Napoleon und seine Männer weiter nach Gap, wo abermals eine große Menschenmenge ihnen zujubelte. Die Unterstützung, die er in diesen Dörfern und Städten erhielt, war für Napoleon und seine Armee von unschätzbarem Wert. Es hieß: „Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in Gap wollte nichts mehr, als dass der Kaiser in ihrer Stadt siegreich einziehe.“ (Quelle: Histoires de Napoléon). Diese moralische Unterstützung war entscheidend, da sie nicht nur Napoleon selbst motivierte, sondern auch eine Kettenreaktion von Unterstützungsbekundungen in den folgenden Ortschaften auslöste.
Überquerung des Col Bayard: Eine mutige Entscheidung
Ein besonders bemerkenswerter Abschnitt dieser Reise war die Überquerung des Col Bayard. Dies war ein risikoreiches Manöver, da der Pass zu dieser Jahreszeit schwer passierbar war. Napoleons Entscheidung, diesen Weg zu wählen, anstatt die besser gesicherten Straßen zu nutzen, war strategisch durchdacht: Er wollte den königstreuen Truppen ausweichen und die Unterstützung der Bevölkerung mobilisieren. Die Überquerung symbolisierte auch seinen unbedingten Willen und Mut, der viele Zweifler in seinen eigenen Reihen überzeugte.
Der Empfang in Grenoble: Der endgültige Durchbruch
Der letzte, entscheidende Moment auf Napoleons Weg nach Paris war sein Empfang in Grenoble. Diese Stadt stellte einen Wendepunkt dar, da die Royalisten keine nennenswerte Militärpräsenz aufrechterhalten konnten und die Bevölkerung überwältigend zu Napoleon stand. In Grenoble erlebte Napoleon den endgültigen Durchbruch: „Die Mauern der Stadt erbebten unter den Rufen der Menschenmassen, und nicht ein einziges Schwert wurde gegen den Kaiser erhoben.“ (Quelle: La campagne des Cent-Jours von Adolphe Thiers).
Diese Reise durch die provenzalischen Dörfer war ein Meisterwerk der Propaganda und Demonstration Napoleons Fähigkeit, die Massen zu mobilisieren. Jeder Schritt war geprägt von kluger Taktik, emotionaler Ansprache und dem geschickten Einsatz militärischer und politischer Strategien. Die Unterstützung, die er auf diesem Marsch erhielt, legte den Grundstein für seinen erneuten Einzug in Paris und die damit einhergehende kurze Wiederherstellung seines Kaiserreichs.
Napoleons Marsch durch die Provence war ein spektakuläres Beispiel seines Charmes und seiner Führungskraft, die selbst nach Jahren der Abwesenheit die Herzen und Köpfe der Menschen für sich gewinnen konnte. Diese Episode war nicht nur ein militärischer Triumph, sondern auch ein politischer Siegeszug, der die Bühne für seine Rückkehr zur Macht und die folgende Herrschaft der Hundert Tage bereitete.
Reaktionen der Bevölkerung und des Militärs: Unterstützer und Gegner
Als Napoleon am 1. März 1815 in der Nähe von Golfe-Juan an der südlichen Küste Frankreichs landete, begann ein dramatischer Akt der Geschichte, dessen Erfolg oder Misserfolg maßgeblich von den Reaktionen der Bevölkerung und des Militärs abhing. Die Flucht vom Exil auf Elba und die darauffolgende Rückkehr nach Frankreich konnten nicht ohne eine breite Unterstützung gelingen. Doch sowohl die Zivilbevölkerung als auch das Militär standen in diesem entscheidenden Moment der Geschichte gespalten gegenüber dem zurückkehrenden Kaiser. Die Meinungen und Emotionen reichten von leidenschaftlicher Unterstützung bis hin zu entschiedener Ablehnung, was die Komplexität dieses historischen Wendepunkts widerspiegelt.
Die erste Begegnung Napoleons mit der örtlichen Bevölkerung fiel auf seine Landung am 1. März 1815. Augenzeugen berichten von einem gemischten Empfang: Während einige Anwohner ihn als Befreier und legitimen Herrscher begrüßten, begegneten andere ihm mit Misstrauen und Ablehnung. Die langen Jahre der napoleonischen Kriege hatten erhebliche Verluste und Leiden gebracht, sodass viele Menschen von der Rückkehr des „Adlers“ unbeeindruckt blieben. Doch Napoleons Charisma und seine Fähigkeit, Menschen zu überzeugen, sollten ihm schon bald zugutekommen.
Ein besonders bemerkenswertes Ereignis war seine Begegnung mit dem 5. Linienregiment unter dem Kommando von Colonel Labédoyère. Dieses Regiment war loyal zur Bourbonenmonarchie, die Napoleon abgesetzt hatte. Napoleon konfrontierte die Soldaten und bewegte sie mit einer eindringlichen Rede, in der er seine Loyalität zu Frankreich und sein Versprechen einer besseren Zukunft bekräftigte. Colonel Labédoyère wechselte daraufhin die Seiten und schwor dem ehemaligen Kaiser Treue. Dieses Ereignis markierte einen Wendepunkt und setzte eine Kettenreaktion in Gang, die zu Napoleons Erfolg beitrug.
In den folgenden Tagen passierte Napoleon mehrere Städte und Dörfer, darunter Grenoble und Lyon. In Grenoble wurde er von einer immer größer werdenden Menschenmenge begrüßt. Der Historiker Jean Tulard beschreibt die Szene so: Zahlreiche Bewohner von Grenoble liefen hinaus, um Napoleon zu begrüßen, als ob er ein Befreier wäre. Seine bloße Anwesenheit schien den Menschen neue Hoffnung und Zuversicht zu geben. Mit jedem Schritt in Richtung Paris wuchs die Unterstützung, sowohl in der Zivilbevölkerung als auch im Militär. Viele von Napoleons ehemaligen Generälen, die zunächst zögerten, schlossen sich ihm schließlich an, überzeugt von der Aussicht, die glorreichen Tage wiederherzustellen.
Aber es gab auch bedeutenden Widerstand. König Louis XVIII. und seine Regierung unternahmen zahlreiche Anstrengungen, um die Unterstützung für Napoleon zu untergraben. Flugblätter und Verlautbarungen, die Napoleon als Usurpator und Bedrohung für den Frieden darstellten, wurden verbreitet. Sogar einige Militärkommandanten blieben den Bourbonen treu und versuchten, ihre Einheiten gegen Napoleon zu mobilisieren. Diese Versuche blieben jedoch weitgehend erfolglos, da der Enthusiasmus für die Rückkehr des Kaisers unter den Soldaten überwog.
Eine weitere bedeutende Gruppe von Gegnern bildeten die Royalisten und andere, die von der Bourbonenregierung profitiert hatten. Diese Gruppen sahen in Napoleons Rückkehr eine Bedrohung für ihre neu gewonnenen Positionen und Privilegien. Der Historiker David Chandler erläutert: Die Royalisten und die konservative Elite hatten allen Grund, Napoleons Rückkehr zu fürchten. Ihre Stellung und ihr Einfluss schienen plötzlich gefährdet. Doch aufgrund der schwankenden Loyalitäten innerhalb des Militärs und der Bevölkerung blieben ihre Anstrengungen, einen koordinierten Widerstand zu organisieren, erfolglos.
In den letzten Tagen seines Marsches nach Paris war Napoleons Triumph fast vollständig. Immer mehr Einheiten des französischen Heeres schlossen sich ihm an, oft ohne einen Kampf. In der Hauptstadt selbst wurden die Nachrichten über seine nähere Ankunft mit nervöser Erwartung und Spekulation aufgenommen. Jean-Louis Ernest Meissonier, ein berühmter zeitgenössischer Maler, hielt später fest: Paris war wie im Bann. Die Stadt wartete gespannt, und die Menschen strömten auf die Straßen, um zu sehen, welchen Lauf die Ereignisse nehmen würden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Napoleons Rückkehr von Elba ohne die vielfältigen Reaktionen der Bevölkerung und des Militärs unmöglich gewesen wäre. Unterstützer und Gegner prägten gleichermaßen diesen historischen Moment, der die Bühne für die dramatischen „Hundert Tage“ mit ihren Höhepunkten und dem endgültigen Untergang bereitete. Die Mischung aus Unterstützung und Widerstand zeigt deutlich die gespaltene Stimmung im Frankreich des frühen 19. Jahrhunderts, die Napoleon letztlich für seine eigenen Zwecke zu nutzen verstand.
Der König flieht: Ludwigs XVIII. Taktik und Abreise
Die Nachricht von Napoleons Flucht von der Insel Elba im Februar 1815 erreichte Paris mit erschreckender Geschwindigkeit. Louis XVIII., der seit dem Sturz Napoleons und der Restauration der Bourbonenmonarchie 1814 auf dem Thron saß, wurde von dieser Entwicklung völlig überrascht. Der von den Alliierten eingesetzte König fand sich plötzlich in einer Position wieder, in der seine Regierung und sogar sein Leben bedroht waren. In einer Mischung aus Taktik, Panik und politischem Kalkül beschloss Ludwig XVIII., aus Paris zu fliehen, um den drohenden Rückschlag für die Bourbonen-Dynastie zu vermeiden.
Mit dem Wissen um Napoleons charismatische Anziehungskraft auf das militärische und bürgerliche Publikum, war Ludwig klar, dass ein schneller und entschlossener Aktionsplan notwendig war. Die allgemeine Meinung der Bevölkerung und insbesondere des Militärs tendierte zu einer Sympathie für den zurückkehrenden Kaiser. Ludwig XVIII. wusste, dass er sich nicht auf die Unterstützung der Armee oder des Volkes in einem direkten Konflikt verlassen konnte. Dies wurde durch Berichte verstärkt, die von desertierenden und zu Napoleon überlaufenden Soldaten berichteten, noch bevor der Kaiser Frankreich erreicht hatte.
Ein intensives diplomatisches und militärisches Beratergremium wurde einberufen, um die Situation zu bewerten. Hier zeigte sich die Unsicherheit und die Zersplitterung der bourbonischen Verwaltung unter immensem Druck. Die Berater waren sich zwar einig, dass Ludwig vor der Ankunft Napoleons die Hauptstadt verlassen sollte, jedoch gab es unterschiedliche Meinungen darüber, wie und wohin die Flucht verlaufen sollte.
Ludwig XVIII. und sein Hofstaat beschlossen schließlich, zunächst ins nördlich gelegene Lille zu fliehen. Lille, bekannt für seine robusten Festungsanlagen und loyale Garnison, schien eine sichere Zuflucht zu bieten. Am 19. März, einem Tag bevor Napoleon Paris erreichte, begab sich Ludwig auf den beschwerlichen Weg nach Nordfrankreich. Der König verließ den Tuilerienpalast in aller Eile, was seine persönlichen Unsicherheiten und die prekäre Situation der Bourbonenmonarchie offenlegte. Zusammen mit ihm flohen mehrere wichtige Mitglieder des Hofes und zahlreiche Minister.
Die Flucht war nicht nur ein physischer Akt der Bewegung, sondern auch ein symbolischer Rückzug der bourbonischen Herrschaft vor der revolutionären Kraft, die Napoleon verkörperte. Die anstehende Abreise aus Paris wurde als notwendige Maßnahme dargestellt, um das Land vor einem weiteren Bürgerkrieg zu bewahren, doch viele sahen darin einen Akt der Feigheit und des mangelnden Vertrauens in die eigene Herrschaft.
Unterwegs nach Lille erfuhr Ludwigs Gefolge von der erdrückenden Realität, dass Napoleons Vormarsch nahezu überall auf jubelnde Menge stieß und dass die einst loyal geglaubten Soldaten und Offiziere mehrheitlich zu Napoleon überliefen. Lille, der ursprünglich festgelegte Zufluchtsort, zeigte bereits Zeichen der Unsicherheit und des drohenden Überlaufs zu den napoleonischen Truppen. Folglich entschloss sich Ludwig XVIII., nach wenigen Tagen Aufenthalt, erneut, dieses Mal nach Gent in das heute belgische Territorium, zu fliehen. Diese Stadt wurde gewählt wegen ihrer geopolitischen Lage, die sie nahe genug an der französischen Grenze und doch unter schützender niederländisch-britischer Kontrolle hielt.
Die Zeit von Ludwigs Aufenthalt in Gent war von hochintensiven diplomatischen Bemühungen geprägt. Er bemühte sich, die Unterstützung der verbündeten Mächte zu sichern und sie zur baldigen Intervention in Frankreich zu bewegen. Der König stand in enger Verbindung mit dem Wiener Kongress, der gerade zu einem Abschluss kam und versuchte, das Interesse der Alliierten an einer Wiederherstellung der bourbonischen Monarchie zu bekräftigen. In einem Brief an den österreichischen Staatsmann Metternich betonte Ludwig die Wichtigkeit eines vereinten Europas: „Dies ist nicht allein eine Kriegsfrage, sondern eine Angelegenheit der künftigen Stabilität und Ordnung für ganz Europa“.
Während Napoleons Triumphzug und die jubelnden Mengen in Paris den 20. März 1815, der als Beginn der Hundert Tage bekannt werden sollte, feierten, verbrachte Ludwig XVIII. die Tage in Gent in gespannter Erwartung. Schon bald formierte sich unter Anleitung des Wiener Kongresses eine siegreiche Koalition, die nur darauf wartete, den endgültigen Schlag gegen Napoleon zu führen. Ludwig XVIII. bereitete sich darauf vor, in den Moment des Sieges erneut als machthabender König Frankreichs nach dem Ende von Napoleons zweite Herrschaftsperiode einzutreten.
Die Taktik und rasche Abreise Ludwigs XVIII. spiegelte die ungewisse und fragile Natur der bourbonischen Herrschaft zu dieser historischen Zeit wider. Obwohl als Akt der Vorsicht und strategischem Rückzug konzipiert, offenbarte Ludwigs Flucht auch die tiefsitzenden Schwächen und den Verlust der Legitimität, unter dem die Bourbonen-Monarchie litt. Trotz der Rückkehr auf den Thron nach der Schlacht von Waterloo war die Untermauerung der bourbonischen Monarchie nach Napoleons dauerhafte Abdankung im Exil eine Aufgabe von monumentalem Ausmaß.
Die Machtübernahme: Napoleons Einzug in Paris
Napoleons Wiederkehr nach Paris im Jahr 1815 gehört zu den dramatischsten Ereignissen der europäischen Geschichte. Diese Rückkehr, die in weniger als einem Monat von seiner Flucht von der Insel Elba zur Machtübernahme führte, ließ Europa den Atem anhalten. Nachdem er sich vom südlichen Frankreich bis zur Hauptstadt durchgekämpft hatte, war der endgültige Triumph seines Einzugs in Paris am 20. März 1815 ein symbolträchtiger Moment, der Nahtstelle und Wendepunkt zugleich darstellte.
Die Umstände seiner Machtübernahme waren nichts weniger als spektakulär. Die Gerüchte über seine Entschlossenheit und seine Rückkehr auf französischem Boden hatten sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Die Nachricht, dass die „Adler“ zurückkehrten, entfachte sowohl Beifall als auch Angst. Während sein Zug durch Frankreich voranschritt, verlor Louis XVIII. nach und nach die Kontrolle über das Land und seine Truppen, die zu Tausenden zu Napoleon überliefen. Eine bemerkenswerte Episode dieser Reise war, wie der Historiker Andrew Roberts bemerkt, die Begegnung zwischen Napoleon und einem royalistischen Regiment bei Grenoble, wo Napoleon unbekümmert seinen Mantel öffnete und den Soldaten anbot, zu schießen, sollten sie ihn als Verräter betrachten: „Hier ist euer Kaiser! Tötet ihn, wenn ihr wollt!“ Doch stattdessen wurde er mit Jubel und Rufen der Treue überschüttet.
Der Einzug in Paris am 20. März war von dramatischen und emotionalen Szenen geprägt. Als Napoleon mit seinen Getreuen und einer ständig wachsenden Armee von Anhängern die Stadt betrat, war die Bevölkerung gespalten. Manche sahen in ihm den Retter Frankreichs, der die Jahre der Feindschaft mit den europäischen Mächten und die fragile politische Situation beenden könnte, während andere, vor allem die Royalisten, in Angst erstarrten und sich vor dem kommenden Umsturz fürchteten. Der französische Schriftsteller Stendhal, der selbst Zeuge dieser Ereignisse war, beschreibt die Atmosphäre in der Hauptstadt als eine Mischung aus Euphorie und Anspannung, angeheizt durch diese jähe und unerwartete Wendung des Schicksals.
Napoléon richtete sich nach seiner Ankunft direkt an das Volk und die Nationalversammlung, um seine Position als rechtmäßiger Herrscher Frankreichs zu bestärken. Seine ersten politischen Schritte waren sowohl taktisch als auch symbolisch. Er versprach Frieden und Einheit und betonte die Notwendigkeit, die Errungenschaften der Revolution zu bewahren und zu schützen. Charles Esdaile, ein führender Napoleon-Historiker, betont, dass Napoleon sich dessen bewusst war, wie wichtig es war, sofort Vertrauen und Unterstützung des Volkes sowie der Staatsorgane zu gewinnen. Dies tat er unter anderem durch öffentliche Deklarationen, in denen er die Verpflichtung betonte, die „Freiheiten und Errungenschaften“ der Republik zu bewahren.
Ein zentrales Element seines erfolgreichen Einzugs und seiner anschließenden Machtfestigung war das geschickt orchestrierte Medienspektakel. Der Propagandist und Publizist Louis de Bourrienne, ein ehemaliger Weggefährte, spielte dabei eine entscheidende Rolle. Zeitungen und Flugblätter, die Napoleon als den Retter und legitimen Herrscher inszenierten, wurden in großer Zahl verbreitet, und patriotische Lieder und Aufführungen wurden in den Straßen und Theatern von Paris veranstaltet. Diese Maßnahmen verstärkten das Bild, dass seine Rückkehr von breiter Unterstützung getragen wurde.
Es war jedoch klar, dass das diplomatische und militärische Spiel noch nicht gewonnen war. In Paris angekommen, begann Napoleon sofort mit der Reorganisation der Verwaltung und der Armee. Die Angst vor einer erneuten Invasion der alliierten Mächte war allgegenwärtig, und Napoleon wusste, dass nur ein starkes, geschlossenes Frankreich in der Lage sein würde, sich gegen die bedrohliche Koalition der europäischen Mächte zu behaupten. Als Teil dieser Anstrengungen versuchte er, seine Regierung durch einen schnell anberaumten Volksentscheid zu legitimieren, der seine Rückkehr und seinen Herrschaftsanspruch absegnen sollte.
Napoleons zweiter Einzug, der als „die Herrschaft der Hundert Tage“ in die Geschichte eingehen sollte, setzte eine Kette von Ereignissen in Gang, die schließlich in der Schlacht von Waterloo und seiner endgültigen Abdankung mündete. Doch in diesen ersten Tagen nach seinem Einzug in Paris, war er erneut am Gipfel seiner Macht, getragen von einer Volksbewegung, die in ihrer Dynamik und ihrer überraschenden Kraft seinesgleichen suchte.
Diplomatische Reaktionen: Europas Herrscher reagieren auf die Rückkehr
Als die Nachricht von Napoleons Flucht von Elba am 1. März 1815 Europa erreichte, setzten eine Flutwelle von diplomatischen Reaktionen ein, die sowohl Überraschung als auch Panik unter den Monarchen und Regierungen des Kontinents auslöste. Die europäischen Herrscher, die sich gerade erst vom Schrecken der Napoleonischen Kriege erholt hatten, standen erneut vor der Herausforderung, diesem formidablen Gegner entgegenzutreten. Die Reaktionen variierten, abhängig von den politischen und militärischen Interessen der einzelnen Länder, aber die gemeinsame Bedrohung durch Napoleon einte sie zumindest temporär.
Zu den wichtigsten Kongressmächten gehörten Großbritannien, Österreich, Preußen und Russland, deren Repräsentanten sich in Wien versammelt hatten, um die Nachkriegsordnung Europas nach Napoleons Niederlage zu gestalten. Der Wiener Kongress, der bereits stattgefunden hatte, um die Probleme und die territoriale Ordnung Europas zu regeln, sah sich plötzlich mit einem neuen, dringenderen Problem konfrontiert. Als Metternich, der österreichische Außenminister, von Napoleons Rückkehr erfuhr, kommentierte er: „Die Krise ist wieder da, und wir müssen schneller handeln als jemals zuvor.“ [1]
In Großbritannien reagierte Lord Castlereagh, der britische Außenminister, mit umgehenden Maßnahmen. Die britische Regierung sah sich nicht nur militärisch bedroht, sondern auch ideologisch, da Napoleons Rückkehr revolutionäre Bewegungen in anderen Teilen Europas inspirieren könnte. Castlereagh forderte sofortige Konsultationen mit den anderen Mächten des Wiener Kongresses. Tatsache ist, dass die britische Regierung keine andere Wahl sah, als sich erneut gegen Napoleon zu positionieren und bereit war, erhebliche Ressourcen bereitzustellen, um eine Wiederholung der Napoleonischen Herrschaft zu verhindern.
In Österreich äußerte sich Kaiser Franz I. besorgt über die Rückkehr des Mannes, der seine Tochter Marie-Louise geheiratet hatte. Diese dynastische Verbindung hatte Napoleon einst zu einer Art Familie gemacht, weshalb seine erneute Machtergreifung in Frankreich als besonders kompliziert angesehen wurde. Metternich und die österreichische Führung setzten sich jedoch schnell über familiäre Bindungen hinweg und priorisierten die Eindämmung Napoleons. In einer eindringlichen Note an die anderen Mächte schrieb Metternich: „Dies ist keine Zeit für Zögerlichkeit; wir müssen wieder eine Koalition schmieden.“ [2]
Russlands Zar Alexander I. teilte ähnliche Ansichten. Obwohl er einst mit Napoleon verbündet war, betrachtete er ihn jetzt als Gefahr für die europäische Stabilität. Zar Alexander erklärte: „Napoleon ist der Erzfeind der Ordnung in Europa. Wir dürfen nicht zulassen, dass er erneut Macht erlangt.“ Diese Entschlossenheit führte dazu, dass Russland seine Truppen mobilisierte und die diplomatischen Kanäle nutzte, um die Bildung einer neuen Allianz zu unterstützen. Die russischen Kräfte standen bereit, sobald das Signal zur Mobilmachung gegeben wurde.
Preußen, unter der Führung von Friedrich Wilhelm III., reagierte ebenfalls alarmiert. Nach den Belastungen und Verlusten durch die vorherigen Kriege gab es in Preußen wenig Geduld für eine Wiederholung der napoleonischen Dominanz. Die preußischen Militärführer begannen sofort mit Plänen für eine erneute Konfrontation, und in Berlin herrschte Konsens über die Notwendigkeit einer koordinierten europäischen Aktion. Die Worte des preußischen Außenministers, Karl August von Hardenberg, waren unmissverständlich: „Preußen wird an vorderster Front stehen, um dem korsischen Despoten die Stirn zu bieten.“ [3]
Die anderen europäischen Mächte, wie Spanien, Schweden und die italienischen Staaten, beobachteten die Entwicklungen mit großer Sorge, wenn auch mit unterschiedlichem Engagement. Viele von ihnen hatten innenpolitische Schwierigkeiten und konnten keine großen militärischen Beiträge leisten, unterstützten aber die diplomatischen Bemühungen der großen Mächte.
Die vielleicht bemerkenswerteste Reaktion kam jedoch vom Papst in Rom. Obwohl die Katholische Kirche politisch oft zurückhaltend war, sah Papst Pius VII. einen großen theologischen und moralischen Wert darin, gegen Napoleon Position zu beziehen. In einer päpstlichen Bulle verurteilte er Napoleon als „Feind des Friedens und der göttlichen Ordnung.“ [4] Diese klare Verurteilung signalisierte eine selten erlebte Allianz zwischen weltlichen und geistlichen Kräften gegen einen gemeinsamen Feind.





























