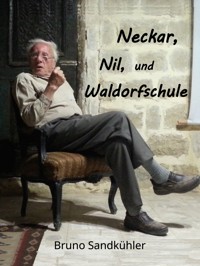
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Biografie spiegelt nahezu hundert Jahre des enormen technischen Fortschritts, der jedoch mit gravierenden Problemen einhergeht. Wirtschaftliche Globalisierung neben stetig zunehmender sozialer und politischer Polarisierung, Gefährdung von Klima und Umwelt, zunehmende Abhängigkeiten durch eine Digitalisierung, welche das verantwortliche Handeln der Menschen immer mehr verdrängt. Der Autor erlebt aber auch die Abkehr von einer rein materialistischen Weltsicht, zukunftsträchtige Initiativen hin zu einem Paradigmenwandel im sozialen Gefüge, im Bildungswesen, in der biologischen Landwirtschaft und in einer "Wirtschaft der Liebe".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titelblat der Kronecker-Chronik. Oben in der Mite die Urgroßeltern Leins, daneben rechts Omi Emma Kronecker
Bedankt seien
Susanne Appl &
Johannes Burges
sie haben ermöglicht,
dass aus dem Rückblick
endlich ein Buch wurde.
Meine Tochter Rachel, die
die mit fachkundigem Rat
zum Layout beigetragen hat.
Gerd Scherm für die Erlaubnis
zur Verwendung seiner Zeilen,
die so trefflich zu Sekem passen.
Meine Töchter Veronika und Rachel,
Sabine Boehm, Gabriele & Walter Hiller
und Dr. Hermann Becke für Wegbegleitung
und Fotos, die im Bildnachweis gekennzeichnet sind.
Die vielen Freunde, und besonders meine vier Familien – die
eigene, die Elsentalfamilie, die im Marsam, und die Sekemfamilie.
Wegmarken
1840 – 1931 Familiäre Ursprünge
1931 – 1938 Eintritt in eine turbulente Welt
Olgastraße 93a
Warngau, oberbayrische Idylle
1938 – 1945 Heselbach, Kriegszeit in Dresden
Ankunft im Sachsenland
Lausbubenzeit
Schule, Weiße Mäuse, und Chemie
Die Nacht des 13. Februar 1945
1945 –1 950 Kriegsende, Warngau, und wieder Stuttgart
Schuljahre in Stuttgart
Freundeskreise
1950 – 1951 Der Horizont weitet sich
Bussigny, St. Prex, und nach Italien
Lehrstück in Mailand
Mit Biglietto Circolare durch Italien
Intermezzo in Stuttgart und Heidelberg
1951 – 1953 Studienbeginn und allerlei Weichenstellungen
Spanien und der arabische Funke
Beim Katharerpapst
Paris, Rue de Montyon
Zwischenstation München
1953 – 1957 Freiburg und die Folgen – der Orient kommt in Sicht
Zufall als Lebensmotiv
Freiburger Studentenleben
Erste Erfahrungen als Reiseleiter
Wieder nach Ägypten
Mit Ägyptern durch Deutschland
1957 – 1958 Nach dem Staatsexamen – Reisen wird professionell
England-Irland
Marco Polo Reisen
Weiter nach Osten
Ceylon/Sri Lanka
Kabul-Taschkent-Moskau–Wien
1958 – 1960 Ägyptische Lebenswende
Multitasking
Auf historischen Spuren
Mit dem Auto durch die Türkei und Persien
London, British Museum
1960 – 1964 Mit Lissy, Ägypten und Dante
Endgültig Lissy
Uni-Dia Verlag
Geburt und Tod
Unsichtbare Begleitung
Ein wunderbares Lebensgeschenk
Peruanisches Intermezzo
1964 – 1969 Waldorfschule, Angelika und die neue Familie
Die Familie wächst
Schwarze Kunst und Schulleben
Immer wieder Warngau
1969 – 1973 Entwicklungspolitik – Umzug ins Schloss
Freie Hochschule Buslat
1973 – 1986 Michael Bauer Schule
Marco Polo Nachklänge
Indonesien und Neuguinea
Nordindien-Westtibet
Hong Kong und China
Äthiopien und Jemen
1986 – 1992 Familie und Schule – und die Provence
Klassenfahrten
Eine Ruine wird belebt
Das Haus leert sich
1992 – 1996 Angelika und die Filderklinik
Abschied
1996 – 2005 Neue Orientierungen
Jahrtausendwende
Samara
Waldorf in London
Waldorf Italia
Marokko
2005-2012 Ein Buch und seine Folgen
Renate und das Haus am Martinsberg
Hundeleben
Reisen in Sachen Waldorf
Gaza
Die Gesundheit kommt ins Spiel
Noch ein Abschied
Ins Elsental
2012 – 2017 Wer Wasser aus dem Nil getrunken hat …
Eine denkwürdige Malreise
Ein unglaubliches Geburtstagsgeschenk
Politische Turbulenzen und ein neuer Volkstribun
2017 – 2019 Sekem, lebendiger Fels in der Brandung
Leben in Qurna
Erneuter Weckruf
Nochmals UNI-Dia
Neue und alte Projekte
Ägyptische Entwicklungen
Hammo und das Jugendseminar
2019 – 2021 Dramatische Veränderungen
2022 Nachdenklicher Rückblick
Anhang Menschen in Qurna
Anmerkungen – im Text mit * gekennzeichnet
Bildnachweis
Großvater Anton Sandkühler
Großmutter Ida, geborene Bex.
1840 – 1931
Familiäre Ursprünge
Was ist Europa? Für mich ist es ein Familienquerschnitt, angereichert mit Freunden aus nahezu allen europäischen Ländern. Die Sandkühler-Familie wurde aus verschiedenen Ecken Europas zusammengeweht, dazu wieder in andere Gegenden auseinander bis in ferne Weltgegenden, so dass sie schließlich ein lockeres Gespinst bildet, das die Geschichte und Geographie dieses Europa wie auch der verschiedenen deutschen Regionen überspannt und in die weite Welt hinausreicht.
Irgendwann gab es im Umkreis des westfälischen Warendorf eine Sandkuhle, aus deren Erträgen ein Vorfahr seinen Lebensunterhalt fand und seine Familie ernährte. Das war also der Ur-Sandkuhler.
Dann verließen diese Sandkuhler die Sandkuhle und siedelten ins Fränkische über, so dass Konrad Sandkühler, mein Vater Konrad, am 15. Februar 1886 zu Würzburg geboren wurde. In meiner Geburtsurkunde steht folglich: ›Staatsangehörigkeit deutsch, da Vater Bayer‹. Das würde bei einem Würzburger Stirnrunzeln hervorrufen, fühlt er sich doch als Franke, nicht eigentlich als Bayer. Westfalen wie auch Franken waren und sind gut katholisch; zwei Schwestern und ein Bruder Konrads wurden Ordensleute: Tante Agathe leitete unter ihrem Ordensnamen Mater Maria Luzia von 1921 bis 1939 in Aschaffenburg die Haustöchterschule der Englischen Fräulein, und hatte dann dort »in den wohl schwersten Jahren für das Institut«* bis 1949 das Amt der Oberin inne.
Maria Evalina lebte in Rom im Kloster der Santissima Annunziata im Schatten der Vatikanstadt. Onkel Beda, 1889 geboren, hatte Geologie studiert und besaß eine Ziegelei in Hebertsfelden.
Zu Beginn des neuen Jahrhunderts zog die Familie nach München, und Vater besuchte dort das Wilhelmsgymnasium. Der Violinunterricht, den es dort gab, wurde zur Grundlage seiner lebenslangen Liebe zu Geige und Bratsche. Einer seiner Schulkameraden war der drei Jahre ältere Fritz von Bothmer, den er ein Vierteljahrhundert später an der Stuttgarter Waldorfschule wiedertreffen sollte.
Aus anderer Richtung konstituierte sich Mutters Familie mit ihren zwei Zweigen Kronecker und Leins. Mit Mora Abraham Schlesinger* floss ein musikalischer Strom in die Familie ein. Sein Vater Aldolph Martin Schlesinger hatte in Paris einen Musikverlag, in dem er Werke der bedeutendsten Komponisten des neunzehnten Jahrhunderts verlegte* Der junge Mora, der sich nun Maurice nannte, besuchte 1819 Beethoven, der ihm ein Albumblatt und ein Bild mit Haarlocke widmete und mehrere Kompositionen zum Druck übergab*. Richard Wagner arbeitete 1840 eine Zeitlang als Notenschreiber bei ihm, Schlesinger konnte sich aber für dessen Musik nicht begeistern, und Wagner äusserte sich in seiner Biographie nicht gerade glücklich über diese Zeit.
Seiner Geliebten Caroline Augustine Elisa Judée, geb. Foucault-de-la-Motte zuliebe konvertierte Maurice zum Christentum, und heiratete Elisa nach dem Tod ihres Mannes. Schlesinger und Elisa hatten aber schon vor der Heirat regelmäßig gemeinsame Sommerferien in Trouville an der Küste verbracht, wo 1836 der damals 15-jährige Gustave Flaubert sich in die elf Jahre ältere Elisa verliebte; sie blieb lebenslang sein Idol*. Im selben Jahr wurde Elisas Tochter Marie geboren, die als Marie Leins meine Urgroßmutter wurde. Damit verknüpfte sich der französisch-jüdische Familienzufluss mit dem schwäbischen, und gleichzeitig wurden damals schon die Keime für meine Reiselust gelegt. Mein Urgroßvater Christian Friedrich von Leins*, Absolvent des renommierten Stuttgarter Friedrich Eugen Gymnasiums, reiste als junger Architekt mit dem württembergischen Kronprinzen Karl nach Italien, nicht zuletzt, um Anregungen für den geplanten Bau der Villa Berg zu suchen. Spätere Reisen führten ihn zusammen mit seinem Freund Friedrich Wilhelm Hackländer nach Nordafrika, Palästina* und nach Spanien. Als württembergischer Hofbaumeister baute er dem historistischen Trend der Zeit entsprechend die Feuerseekirche in Stuttgart und weitere neugotische Kirchen in vielen Gemeinden des Landes, aber auch öffentliche Gebäude – zum Beispiel die Villa Berg, den klassizistischen Stuttgarter Königsbau und die alte Liederhalle – neben zahlreichen Wohnsiedlungen und Privathäusern, wie dem seines Freundes Hackländer in der Urbanstraße 13.
Ludwig, der jüngste und einzige Sohn*, betrieb in Berlin einen Kunsthandel, seine Einkaufsreisen führten ihn oft nach Italien. Dabei blieb er auf dem Gut einer reichen Engländerin in Scarperia bei Florenz hängen, was dann sehr viel später auch mich nach Italien führte.
Die Töchter Leins müssen ein munteres Gespann gewesen sein. In der Chronik ist zu lesen, wie sie auf ihrem Schulweg von der Uhlandstrasse ins Königin Katharinenstift zum Verdruss der Droschkenkutscher zu fünft eingehakt nebeneinander trabten, wo heute die vielbefahrene Konrad Adenauer Straße verläuft – immer wieder belustigt mich in meiner Vorstellung dieses Bild, wenn ich dort im heutigen Verkehr unterwegs bin. Meine Omi Emma war die jüngste dieser Schar. Mit ihrer Heirat kam eine weitere jüdische Farbe in die Reihe der Ahnen. Großvater Ernst Kronecker* war der Sohn des aus Schlesien stammenden Mathematikers Leopold Kronecker*, eines Gelehrten von umfassender Bildung, der sich nicht nur in der Mathematik einen Namen machte, sondern auch Astronomie und Philosophie studierte, nebenbei noch zeitweilig in der Bank seines Onkels mitarbeitete und nach der Heirat mit dessen Tochter deren Familiengüter verwaltete.
Der Sohn Ernst wuchs somit in Berlin in einem wohlhabenden und gebildeten Milieu auf, studierte Jura, war zum Christentum übergetreten, und brachte es zum Preußischen geheimen Kammergerichtsrat. Nach seiner Pensionierung siedelte die Familie nach dem Ersten Weltkrieg nach München über.
In Warngau, dem oberbayrischen Alterssitz der Großeltern, war es üblich, die Gehöfte nicht nach den amtlichen Namen der Bewohner zu nennen, sondern jedes hatte einen aus Tradition erwachsenen Eigennamen. Nachbar Johannes Bichler wohnte im Haus ›Schneiderkramer‹ und wurde somit ›Schneiderkramer Hans‹ gerufen, Balthasar Brenninger wohnte im Hof Rank und hieß deshalb der ›Rank Hausl‹. Beim Einzug meiner Großeltern wurde das frühere Bauernhaus ›Zum Silberkramer‹ umbenannt in ›Beim Geheimrat‹, und Omi war im Dorf die ›Frau Geheimrat‹, auch der Name ›Taubenberghof‹, den der Vorbesitzer seinem Projekt gegeben hatte, wurde im Familienkreis weiter benutzt.
Vater Konrad Sandkühler
Mutter Jutta Sandkühler, geb. Kronecker
Damit sind wir bei meiner Mutter Jutta* angelangt, der Tochter von Emma und Ernst. Sie war in der weltoffen-liberalen Berliner Gesellschaft aufgewachsen und interessierte sich für Literatur und Kunst ebenso wie für Naturwissenschaften. Sie machte eine Fotografenlehre, was für Frauen ›aus gutem Hause‹ damals sehr ungewöhnlich war. Als ihre Eltern nach München zogen, begegnete sie dort nach dem Krieg Konrad Sandkühler*. Er hatte Romanistik und Anglistik studiert, dann in Estland eine Stelle als Französischlehrer an der Ritter- und Domschule zu Reval angetreten. Da Russland das deutsche Zeugnis nicht anerkannte, musste er im Sommer 1914 einen Kurs bei der Alliance Française in Paris machen, und als der Krieg ausbrach, wurde er dort als wehrfähiger Deutscher interniert. So verbrachte er die Kriegsjahre bei Lanvéoc an der Rade de Brest. Zum Glück, denn dort war er fern vom Kriegsgeschehen. Er las viel, schrieb seine Gedanken über Nietzsche, Thomas Mann*, Hyppolite Taine und andere ins Tagebuch*, verfasste Gedichte und hatte reichlich Gelegenheit, sein Französisch zu perfektionieren. Über den CVJM* bekam er sogar eine Bratsche und Noten, so konnte er mit drei Lagergenossen ein Streichquartett bilden. Am 1. Oktober 1918 kehrte er nach München zurück und erlebte dort die Wirren der Revolution und die Räterepublik. In München traf er auch wieder seinen gleichaltrigen Musiklehrer und Freund Hans Neumeyer*, der ihm eine Stelle in Garmisch vermitteln wollte. Auf der Fahrt nach Garmisch brauchte der blinde Neumeyer eine Begleitung, und das war diesmal Fräulein Jutta Kronecker. Aus der Gymnasialstelle in Garmisch wurde nichts, aber Konrad und Jutta schlossen Freundschaft. Aus der Begegnung entsprang mein Bruder Stefan. Das Paar heiratete und Vater trat eine Gymnasialstelle als Französischlehrer in Nürnberg an. Dort wurde Stefan, und im Jahr darauf als zweites Kind meine Schwester Ida geboren.
Ein Kreis von Freunden und Kollegen interessierte sich für damals aufkommende Bestrebungen, Pädagogik zu reformieren. Als 1924 eine Gruppe von Stuttgarter Lehrern in Nürnberg Vorträge über Waldorfpädagogik hielt, erschloss sich für Vater eine neue Welt, was ihn zunächst nach Stuttgart zur pädagogischen Sommertagung, und dann 1925 zusammen mit seinem Nürnberger Freund Hans Rutz endgültig an die Waldorfschule brachte. Meine Mutter erzählte mir, das sich Vater nach der Tagung von Erich Schwebsch verabschieden wollte, dieser ihm aber sagte, es fände anderntags noch ein Sprachlehrertreffen statt, worauf er noch blieb; das Treffen sei aber ein von Schwebsch schnell eingefädelter Schachzug gewesen, um meinen Vater für die Schule zu gewinnen.
Familie Sandkühler und unsere Else. Danneckerstraße 23, Ende 1934
1931
Eintritt in eine turbulente Welt
Familie Sandkühler wohnte dann in Stuttgart in der Danneckerstr. 23 – Vater Konrad, Mutter Jutta, Sohn Stefan, Tochter Ida, und ab 1927 Sohn Martin. Dazu kam am Sonntag, dem 8. März 1931, eine weitere Persönlichkeit, die in der Kirche Sankt Eberhardt in der Königstrasse auf die Namen Bruno Christian Friedrich getauft wurde. Damals war es noch so, dass bei interkonfessionellen Ehen der katholische Teil das Versprechen abgeben musste, die Kinder katholisch zu erziehen. Aus Berichten von Zeitzeugen und vereinzelt erhaltenen Fotografien geht hervor, dass geraume Zeit später ein Umzug der Familie in die Olgastraße 93a stattfand, mitsamt dem nunmehr bereits der eigenen Füße mächtigen Neuankömmling Bruno. Mehr noch, dieser Bruno Christian Friedrich war sich inzwischen auch der eigenen Existenz so weit bewusst, dass Erinnerungen begannen, sein Inneres zu beleben und sich darin abzubilden. Bruchstückhaft zunächst, aber immerhin. Alles Folgende speist sich somit aus diesem Phänomen, das allerdings, im Inneren beheimatet, von Natur aus subjektiv und daher von außen gesehen verständlicherweise nicht objektiv zuverlässig ist. Nicht selten wurde Bruno somit später mit der Tatsache konfrontiert, dass Andere manches solcher Art Erinnerte ganz anders erinnerten – aber halt (meist) ebenfalls subjektiv. Wer diese Seiten liest, sollte solchen Sachverhalt bedenken.
Olgastraße 93a
Ein schönes Haus, ein herrliches Grundstück! – war es damals, in den dreißiger Jahren. Im Krieg zerstört, ist es dann der Spekulationsgier unserer Zeit zum Opfer gefallen und sein Charme verkam auf dem Weg zur maximalen Nutzung als ›modernes‹ ›Appartmenthaus‹. Doch damals war es der reinste Abenteuerspielplatz. Nicht nur der große Garten mit den alten Bäumen, sondern besonders auch der riesige Keller, von dem die Sage ging, er hätte eine Verbindung nach Nordwesten, unter der Stadtmauer hindurch bis zum Rathaus, einen Gang, durch den in Zeiten der Gefahr die Ratsherren sich in Sicherheit hätten bringen können. Leider konnten wir Geschwister das nicht ganz erforschen, der Keller wurde zum Züchten von Champignons genutzt und der hintere Teil war fast immer verschlossen. Heute ist er Tiefgarage.
Das Spielterrain erstreckte sich nach oben bis zum Bopser, nach unten über die kleine Grünanlage und die Staffeln bis zur Mozartstraße. Ein beliebter Ort der Muße war die etwa zweieinhalb Meter über der Straße liegende Balustrade, von der man die Vorübergehenden von oben beobachten konnte, ohne gesehen zu werden. Manchmal versuchten wir, mit Spucke Passanten zu treffen, und einmal wäre uns das fast übel bekommen, denn der Getroffene war SA-Mann, der sich wütend auf die Suche nach dem Urheber der Untat machte. Wir waren natürlich wie der Blitz von der Bildfläche verschwunden, aber er läutete an der Haustüre. Mutter wusste von nichts und konnte guten Gewissens den Mann beruhigen, aber sie konnte sich kaum über die Delinquenten im Zweifel sein. Am Abend gab es ein ernstes Gespräch. Wir wurden über unsern Status als Viertelsjuden und die daraus resultierenden Gefahren im Umgang mit Nazifunktionären aufgeklärt. Allerdings war das den Behörden damals wohl noch nicht besonders bewusst, sonst hätte Mutter wohl nicht das Mutterkreuz verliehen bekommen, als sie 1935 mit Christoph ihr fünftes Kind bekam, und ich wäre nicht einige Jahre später für das ›Privileg‹ des Besuchs einer Nationalpolitischen Eliteschule (›Napola‹) vorgeschlagen worden. Ich hätte das toll gefunden in meinem kindlichen Gemüt, denn da machte man Geländespiele, lernte Reiten, Schwimmen und Motorradfahren. Die Eltern fanden das gar nicht verlockend, und so ging der Kelch der politischen Gehirnwäsche an mir vorüber. Das war aber wie gesagt erst etwas später. Zunächst gab es andere Attraktionen. In den Regenrinnen neben den ›Stäffele‹ ließen wir unsere Miniatur-Rennwägele bergab sausen wie Caracciola und Bernd Rosemeyer, unsere Rennfahreridole. Verkehr gab es noch wenig, von Zeit zu Zeit kam der Lumpensammler mit seinem Karren vorbei, sein Ruf ist mir durch all die Jahrzehne lebendig in den Ohren: »Lompa, Babier, Alteïse«. Auch der Kräutermann aus dem Bayrischen Wald bot eine interessante Abwechslung; Mutter kaufte von ihm immer Tees, Meerettich oder andere Naturprodukte. Auf dem Treppenabsatz vor der Wohnungstür setzte er umständlich die große Kiepe ab und packte seine Schätze aus. Andere Hausierer boten Kurzwaren, Kochtöpfe und dergleichen an, der Scherenschleifer schob seine fahrbare Werkstatt durch die Straße, auch Bettler baten nicht selten um eine Gabe, obwohl an vielen Haustüren »Betteln und Hausieren verboten« stand. Einem Bettler hatte Mutter ein Paar nicht mehr benötigte Bergstiefel gegeben; als er sagte, er sei so hungrig, gab sie ihm noch einen Teller Suppe und er setzte sich damit auf die Treppe. Als sie nach einer Weile wieder hinaus ging, um Teller und Besteck zurück zu holen, war der gute Mann verschwunden, der Teller zwar leer, aber die verschmähte Suppe in die ebenfalls verschmähten Stiefel gekippt. Er hatte wohl Geld erwartet. Als mildernder Umstand darf angesehen werden, dass die Kochkünste von Mutter nicht zum Drübernachhauseschreiben waren.
Als ein besonders aufregendes Ereignis ist der Überflug des Zeppelins in Erinnerung, den wir von unserem Garten aus beobachten konnten.
Von der Olgastraße wanderte Vater täglich hinunter und hinauf zur Waldorfschule am Kanonenweg, der heutigen Hausmannstraße. Er lieferte mich im Kindergarten bei Fräulein von Grunelius ab*, und holte mich wieder, wenn die Schule zu Ende war. Zwischen Kindergarten und Straße war aber der Schulhof zu überqueren – ein gefährliches Unternehmen, denn da hieß es meist: »Ah Konrad, gut. dass ich dich treffe...« oder »eine kurze Frage, Herr Doktor...«. Besonders lebendig ist mir Karl Schubert* mit seiner gedrungenen Gestalt in Erinnerung, der stets auch von mir Notiz nahm; ›Jo, des is jo der Bruuuno‹. Sonst blieb ich meist unbeachtet. An Vaters Hand trat ich dann von einem Fuß auf den anderen, oder meldete mich nach einer Weile zu Wort: »Vater, wir wollen doch heim!« Am Weg lag beim Olgaeck die Bäckerei Wolfangel, und hatte das Warten allzu lang gedauert, gab es zum Trost eine Bretzel.
Sehr lebendig im Zusammenhang mit dem Garten in der Olgastraße erinnere ich mich der Besuche des schon erwähnten Grafen Bothmer*, Turnlehrer der Waldorfschule, mit dem Vater befreundet war; wenn er kam und uns im Garten spielen sah, beugte er seine hoch gewachsene Gestalt, stützte die Hände auf die Fußknöchel und forderte uns zum Bockspringen auf, was für Martin und mich immer eine besondere Herausforderung und ein Mordsvergnügen war.
In dieser Zeit durfte ich zweimal Ferien im Kinderheim des Ehepaars Ehmann in Großherrischwand im Südschwarzwald verbringen, das »in stiller Zurückgezogenheit inmitten eigener blumiger Wiesen und unweit ausgedehnter herrlicher Tannenhochwälder« liegt, wie es in einem Prospekt heißt. Da gab es anregende Gesellschaft verschiedenen Alters, wir spielten meist im Freien; viele der damaligen Spielkameraden wie zum Beispiel Irene Glatz traf ich sehr viel später als Kollegen in der Schule wieder. Beim zweiten Mal war Winter, alles meterhoch verschneit, so dass im Nachbarort Herrischried die Straßen zu Tunnels geworden waren, und man von den Häusern nur die Schornsteine sah, wenn man oben auf der Schneedecke lief.
Warngau, oberbayrische Idylle
In den Sommerferien war stets das Anwesen der Großeltern in Warngau zwischen München und Tegernsee unser Paradies. Der Taubenberg beim Dorf ist ein beliebtes Ausflugsziel mit Berggasthof und weitem Blick auf die Alpenkette. Von dem einstmaligen Gehöft ›Zum Silberkramer‹ war schon die Rede; ein Investor hatte es gekauft, um es zur Pension umzubauen; er ging aber nach dem Ersten Weltkrieg bankrott und verkaufte es unserem Opi Ernst Kronecker weiter, der den Umbau in seinem Sinn fertigstellte und das Haus bis zu seinem Tod im Jahr 1927 bewohnte, zusammen mit seiner Frau Emma, unserer geliebten Omi.
Wie schon berichtet, wurde sie im Dorf Frau Geheimrat genannt, und man sagte, dass sogar ihre Hennen und der Hahn immer »Frau Gehaimraat« riefen. Mit von der Partie war ›Tante Lene‹, die einst als Kindermädchen in die Familie Kronecker gekommen und dort eingewachsen war.
Eine Episode beim Hauskauf kam viel später ans Licht, als wir unter den Papieren von Opi einen Brief des Verkäufers fanden. Er bedankte sich bei Opi, weil dieser einen weit höheren als den vereinbarten Preis bezahlt hatte – sonst hätte der arme Mann die Immobilie quasi verschenkt, da die Inflation das Geld täglich wertloser gemacht hatte.
Das Haus der Großeltern in Warngau
Warngau war ein waschechtes oberbayerisches Dorf mit all seinen urigen Strukturen. In der Mitte Kirche und Friedhof, daneben die Wirtschaften – Altwirt und Neuwirt mit Theatersaal und Kegelbahn. Autos spielten damals keine Rolle, nur der Arzt in Holzkirchen hatte eins.
Auch Traktoren waren beileibe noch nicht selbstverständlich. Es galten noch die echten PS, d.h. OS, denn der Ochsenwagen war das Normale.
Wald und Wiesen bildeten die Lebensgrundlage. Die Kühe lebten auf der Weide, kamen abends in den Stall und wurden gemolken. Die Milch kam in die Molkerei Deflorin, wo sie offen über ein senkrechtes Gestell von gekühlten Edelstahlröhren lief – für uns Kinder ein spannender Anblick, weshalb wir uns immer gern zum Milchholen schicken ließen. In der Molkerei wurde auch der ›Tegernseer Camembert‹ hergestellt und in einem Verkaufsraum an langen Tischen verpackt; dabei bekamen wir gelegentlich ein ›vergratenes‹ Käsle geschenkt, das wir dann auf dem Heimweg genüsslich verspeisten.
Gemäht wurde von Hand, das Heu mit dem hölzernen Rechen gesammelt, auf dem hoch beladenen Ochsenwagen zur Scheune gebracht.
Die Scheune ein herrlicher Spielplatz – wenn wir Glück hatten, konnten wir hie und da sogar ein Ei finden, das eine streunende Henne dorthin verlegt hatte. Selbstverständlich liefen alle Hühner frei herum, wenn sie auch manchmal, wie die von Omi, innerhalb eines eingezäunten Bereichs blieben. Vor jedem Hof gab es den Misthaufen und einen vielfarbigen Bauerngarten.
Von dem ehemaligen Bauernhaus war kaum mehr etwas zu erkennen.
Aus dem Stall auf der Nordseite war ein großer Salon geworden, die ›kalte Pracht‹, seit Opis Tod kaum genutzt. Dahinter die Futterkammer, wo die große mäusesichere Blechtruhe stand, aus der Omi täglich ihr Quantum Getreide holte, mit dem sie durch die Hintertüre in den Garten trat und mit hoher Stimme »Komm, bi bi bi« rief; von allen Seiten stürzten dann eilig die Hühner herbei, um die ersten bei den ausgestreuten Körnern zu sein.
Dorf, Wald und Wiesen boten unerschöpfliche Möglichkeiten für Spiel und Welterfahrung. Der von den Quellen am Taubenberg gespeiste Dorfbach floß am Haus vorbei, nachdem einer seiner Zuflüsse vorher die Sägemühle am Waldrand betrieben hatte. Der Wagner fertigte die Karren und Ochsenwagen, wir bestaunten die große Drechselbank, wo Speichen und Radnaben entstanden. Gegenüber stand in der rauchigen Höhle der Schmied, Meister Wiesnet, am Amboß, formte das weiß glühende Eisen zu Radreifen, Nägeln und Hufeisen. Die Funken flogen, es zischte, wenn er das Eisen zum Härten in sein großes Wasserfass tauchte. Vor der Schmiede ein Hebelgestell, in dem Ochsen und Pferde mit Gurten unter dem Bauch angehoben wurden, um die Hufe zu pflegen oder sie zu beschlagen. Als man den fünfjährigen Bruno einmal nach seinem Berufsziel fragte, sagte er: ›Schmied!‹
Eine ganz andere Atmosphäre herrscht bei Schreiner Brenneisen, etwas weiter oben am Bach. Der eigenartige Geruch des auf dem eisernen Ofen im Wasserbad erwärmten Knochenleims, der Duft der verschiedenen Hölzer, der Lärm von Band- und Kreissäge, das charakteristische Geräusch des Hobels – und all das faszinierende Werkzeug!
Handsägen, Stemmeisen, die verschiedensten Hobel für Falze und Profile… Neben der Schreinerei hat Bader Kränzle seine Allerweltsambulanz.
Er verbindet Wunden, zieht Zähne, läßt mit Blutegeln aus dem Waldweiher zur Ader. Vor dem Haus verkündet ein Schild »Behandlung von Kassenmitglieder«, an dem unsere grammatikbewußte Mutter stets aufs Neue Anstoß nahm.
Bachaufwärts der Schneiderkramer Hans, mit bürgerlichem Namen Johannes Bichler. Er ist ein Rundum-Genie, Bauer, Zimmermann, Forstkenner. Immer freundlich und zu jeder Hilfe bereit, kommt er dann und wann zu uns, um den großen Garten zu mähen oder die Dachrinnen vom Laub zu befreien, das die beiden Riesenbäume, Linde und Rotbuche, jeden Herbst abwerfen. Auch er hat eine Werkstatt mit allerlei seltsamen Werkzeugen, Stemmeisen, Balkenbohrern, Profilhobeln und riesigen Zweimann-Baumsägen. Maschinen sucht man bei ihm vergebens, wenn er auch die Balken nicht mehr von Hand behaut, sondern in der Sägerei schneiden lässt. Der Schneiderkramer Hans ist natürlich auch bei der Feuerwehr. Ab und zu geht die Sirene auf dem Schulhausdach oben auf dem Hügel los, dann lassen die Bauern alles liegen und stehen, werfen sich in ihre griffbereit im Hausflur hängenden Uniformen, setzen die glänzenden messingbeschlagenen Helme mit dem ledernen Nackenschutz auf und rennen zum Sammelplatz vor dem Spritzenhaus.
Der Wagen mit der Handpumpe wird herausgezogen, die Schläuche entrollt und die Übung geht los – wenn es nicht gar ein echter Brand ist, sich ein Heustock entzündet hat. Zweimal erleben wir das schrecklich schöne Schauspiel eines Großbrandes und die generalstabsmäßige Arbeit der freiwilligen Feuerwehr zum Schutz der Nachbargehöfte.
Sind die Schuhe zu besohlen, so geht man zum Schwazer Franzl, der mit seinem kurzen Messer aus dem Rindsleder das passende Stück ausschneidet, mit dem Pfriem die Löcher sticht, den Zwirn durchs Pech zieht und die Sohle vernäht – wenn es nicht ausreicht, sie mit Holzstiften ringsum zu befestigen. Franzl lebt allein in seinem Häuschen am Waldrand, aber er gehört zu den Honoratioren des Dorfes, fehlt nie beim Bier, beim Schafskopfen, am Stammtisch. Jahrzehnte später, als er hochbetagt stirbt, stellt sich heraus, dass Franzl eine Frau war… Eine besondere Persönlichkeit ist auch der Rankbauer, bürgerlich Brenninger Hans, der als einer der wenigen ein Pferd besitzt. Sein Hof liegt gegenüber der Schmiede in der Mitte des Dorfes, das häusliche Leben spielt sich hauptsächlich in der Wohnküche ab, durch die man das Haus betritt. Rechts der große mit Holz befeuerte Herd mit Backrohr und Warmwasserschaff, die Kochstellen auf der gußeisernen Platte mit Eisenringen verschlossen, die je nach Topfgröße herausgenommen werden. Ständig köchelt oder brutzelt da etwas Leckeres. Abends sitzt Vater Brenninger im Herrgottseck unter dem Kruzifix auf der Eckbank und schnitzt seine Heiligenfiguren, Hirten, Könige oder Tiere für die Weihnachtskrippen. Mutter Brenninger kocht, näht, melkt die Kühe, auch die Kinder übernehmen selbstverständlich ihre Aufgaben in Haus und Hof. Von Balthasar, alias Hausl, wird später noch zu berichten sein, als er nach des Vaters Tod den Hof übernommen hatte und mit seiner Frau Anni unser bester Freund wurde.
Sonntags trifft sich Alt und Jung im Sonntagsstaat zum Hochamt, die Männer in Lederhosen mit bestickten Hosenträgern, silberner Uhrkette und gestrickten Wadenstutzen, am Hut den Gamsbart. Die Frauen in Dirndl und Trachtenhut. In der Kirche sitzen sie rechts, die Männer links, und jeder auf seinem angestammten Platz. Die Gemeinde hat eine beachtliche Musikkultur, ein kleines Orchester und den Kirchenchor. So gibt es allsonntäglich zur Messe Haydn, Mozart oder andere Kompositionen aus Barock und späteren Zeiten.
Nach der Messe geht’s im Sommer hinaus zum Schießstand hinter der Sägemühle, wo Tische und Bänke aufgestellt sind. Die Männer üben Scheibenschießen mit ihren Jagdstutzen, die Frauen und Kinder geniessen Weißwürste, Kalbshaxen, Bier und Tratsch. Ist später der Schießstand verlassen, so wird er für uns Buben zum Bergwerk, in dem wir hinter den Schießscheiben die Bleikugeln aus dem Lehm graben.
Die Jugend trifft sich zum Baden am Waldweiher, einem idyllischen See von vielleicht 200m Durchmesser. Auf der Bergseite speist ihn in der flachen Schilfzone der vom Taubenberg kommende Bach, auf der anderen liegt die Staumauer mit einem regulierbaren Schiebetor. Wenn ich Jugend sage, so ist das nicht exklusiv gemeint. Auch Omi mit ihren achtzig Jahren geht dort noch regelmäßig schwimmen. Das Gebüsch dient als Umkleidekabine, der schmale Grasstreifen als Liegewiese.
Heidelbeeren und Himbeeren sind nicht weit, und zum Durstlöschen gibt's das kristallklare Bachwasser. Weiter südlich im Waldtal, hinter der Sägemühle, liegt auf einer Lichtung das Haus, in dem Ehepaar Eisenreich wohnt. Eine Idylle, aber im Winter oft tief verschneit und kaum zu erreichen. Jenseits eine große Waldwiese, wo sich Hirsche und Rehe abends ein Stelldichein geben. Nach Eisenreichs ´Tod übernimmt Familie Lazi das Häuschen und betreibt einen Altkleiderhandel.
Schon durch Opi, unseren Großvater Kronecker, hatte sich das ›Geheimratshaus‹ zu einem Kulturzentrum gemausert. Honoratioren aus dem In- und Ausland kamen zu Besuch, später dann Freunde aus der Waldorfumgebung, es wurde musiziert – abgesehen von dem unermüdlichen Singen, das besonders Mutter pflegte, gab es Streichquartette und andere Kammermusik, denn Vater war ja ein leidenschaftlicher Geiger und Bratschist. Unter den Freunden war auch Familie Burges, Albert und Maria mit ihren vier Kindern, die ein Haus in Rottach am Tegernsee hatten und des öfteren zu Besuch kamen. Maria war in der ersten Waldorfschule Vaters Schülerin gewesen. Dass Burges‘ später einmal eine bedeutende Rolle in meinem Leben spielen würden, ahnte damals noch niemand.
Als kulturelles Element muss nochmals die Dorfmusik erwähnt werden.
Ganz in der bayrischen Tradition lebend, fehlte sie bei keinem Fest, keiner Hochzeit und keiner Beerdigung. Klarinette, Geige, die Blechblasinstrumente von der Trompete bis zur Basstuba, alles mit beachtlicher Könnerschaft gespielt. Dazu der Kirchenchor. Es gab keine Trennung zwischen weltlicher und geistlicher Musik, musiziert wurde zum Tanz ebenso wie für das Hochamt.
Ich gebe den Versuch auf, den Warngauer Kosmos halbwegs vollständig aufleben zu lassen, den Maibaum, die farbenprächtige Fronleichnamsprozession, den idyllischen alten Friedhof mit seinen schmiedeeisernen Kreuzen. Aber die Einsiedelei Nüchternbrunn soll noch erwähnt werden mit Quelle und Klausner, tief im Bergwald.
Und der Bahnhof, zwei Kilometer von unserem Haus entfernt, jenseits der Landstraße zum Tegernsee. Am Schalter löst man die kleine Fahrkarte aus steifer Pappe, die auf einem einfachen Druckmaschinchen ausgefertigt wird. Die Signalglocke schrillt, der Stationsvorsteher mit der roten Schirmmütze kurbelt die Schranke herunter und stellt die Signale auf ›Einfahrt‹; aus dem Wald im Süden taucht das Zügle der Tegernseebahn auf. Der Stationsvorsteher knipst die Karten, wünscht uns gute Reise, wir steigen ein. Wieder einmal sind unsere Ferien zu Ende.
Warngau aber bleibt für uns, später dann auch für Kinder und Kindeskinder, das Ferienparadies — bis nach dem Tod von Mutter und Tante Litty unser Stammbaum so verzweigt ist, dass wir uns ausrechnen, wie es mit der nächsten Generation über dreißig Eigentümer sein werden.
Schon jetzt hat sich die Sandkühler-Révy Familie so in die Welt verstreut, dass in den Ferien nur noch selten eine größere Anzahl von uns nach Warngau kommt. So wird nach Mutters Tod das Anwesen 1998 verkauft.
Der Leinshof in Heselbach im Murgtal. 2022
1939 – 1945
Heselbach, Kriegszeit in Dresden
1938 wurde der Stuttgarter Waldorfschule verboten, eine neue erste Klasse zu eröffnen. Sie kam weiterem Druck der Behörden zuvor und schloss sich selbst.
Ich wurde zunächst in die Jakobschule im Heusteigviertel aufgenommen, die älteste Grundschule Stuttgarts, aber ich habe an die wenigen Wochen dort keine deutliche Erinnerung, da wir kurz darauf in den Schwarzwald zogen, wo Urgroßvater Leins in Heselbach im Murgtal einst den Leinshof gebaut hatte. So begann meine eigentliche Schulzeit in der Dorfschule in Klosterreichenbach*.
Das Benediktinerkloster aus dem 11. Jahrhundert wurde damit der erste Markstein meiner Affinität zum Mittelalter. Auch die Schule war quasi mittelalterlich: 1585 als eine der ersten deutschen Volksschulen erbaut, war sie noch immer einklassig. Acht Jahrgänge lernten gemeinsam in einem Raum, die Älteren betreuten die Jüngeren, wenn der Herr Lehrer sich einer bestimmten Gruppe widmete. Besonders beeindruckte mich ein Blick aus dem Fenster auf den Gefängnisturm, als dort einmal ein kahlgeschorener Delinquent eingeliefert wurde.
Den Schulweg, etwa anderthalb Kilometer, machte ich zu Fuß, im Winter auf Skiern. Anfangs bekam ich von Mutter 20 Pfennig für eine Nudelsuppe im ›Gasthof Sōne Pension‹. Dass der Strich über dem n dessen Verdoppelung anzeigen sollte, wusste ich nicht, also war es für mich ›so 'ne‹ Pension. Später durfte ich dann beim Pfarrer Bökeler im Familienkreis zu Mittag essen. Die Pfarrerssöhne heckten allerlei Schabernack aus, gaben dem naiven Bruno einmal ein Metallstück in die Hand, Der Leinshof das an in eine Heselbach Elektrisiermaschine im Murgtal. 2022angeschlossen war, und als sich alle nach dem Tischgebet zur ›gesegneten Mahlzeit‹ die Hände reichten, schloss sich der Stromkreis zum Schrecken der nichtsahnenden Runde.
Der strenge Winter brachte ein besonderes Erlebnis, als eines Morgens ein Wasserrohr geplatzt war und alle Mäntel in der Garderobe zu Eiszapfen geworden waren. Da wurde nichts aus dem Schulbesuch.
Die steile Dorfstraße, die ins Tal hinunter führte, war unsere bevorzugte Schlittenbahn, auf der wir viel Spaß, aber auch mancherlei Unfälle hatten. Als ich 66 Jahre später mit Renate wieder einmal nach Heselbach kam, grauste mir noch im Nachhinein vor der waghalsigen Abfahrt. Allerdings war inzwischen die Straße asphaltiert und mündete unten auf die vielbefahrene Bundesstraße, während zu unserer Zeit dort noch kaum Autos fuhren.
Auch außerhalb des Winters erlebten wir den Leinshof und seine Umgebung als großes Abenteuergelände. Die Natur war noch ganz unberührt, am Hang lebten Unmengen von Feuersalamandern, wie ich sie später erst wieder um unser Waldhaus am Martinsberg bei Rottenburg traf. In der Murg konnten wir unter den Steinen oder in Uferhöhlen Forellen mit der Hand fangen, wenn wir flink genug waren, und uns die glatten Körper nicht gleich wieder entwischten.
Verkehrsmäßig lag Heselbach ganz aus der Welt. Die nächste Bahnstation liegt 12km entfernt in Freudenstadt. Heute bringt einen die Albtalbahn im Stundentakt nach Freudenstadt oder Rastatt. Wenn Vater in Stuttgart zu tun hatte, so bedeutete das eine Tagereise. Einmal im Winter kam er spät abends nachhause, ohne Mantel, halb erfroren. Wo hatte er denn den Mantel gelassen? Ein Motorradfahrer hatte Vater von Freudenstadt aus mitgenommen; der Mann hatte nur eine dünne Jacke und musste noch nach Forbach. Also hatte ihm Vater seinen Mantel gegeben, den der Mann zurück zu schicken versprach. Mutter war skeptisch, ob wir das gute Stück jemals wiedersehen würden, zumal Vater weder Namen noch Adresse des Motorradlers hatte. Die Tage verstrichen, ohne dass ein Paket eingetroffen wäre. Als wir die Hoffnung schon aufgegeben hatten, brachte ein Bote aus Forbach nicht nur den Mantel, sondern auch noch einen stattlichen Schwarzwälder Schinken. Das war in dieser Zeit eine Kostbarkeit – das Vertrauen hatte sich bewährt! An Ostern, im April 1939, geht das Leinshof-Intermezzo zu Ende. Wir siedeln um nach Dresden. Die dortige Rudolf Steiner Schule war durch eine Initiative von Elisabeth Klein beim ›Amt Hess‹ dem Verbot entgangen, Rudolf Hess und sein Adjudant Alfred Leitgen hielten eine schützende Hand über die Schule, und eine Gruppe von Lehrern der Stuttgarter Waldorfschule konnte dort ihre Arbeit noch bis 1941 fortsetzen*.
Ankunft im Sachsenland
›Mit freundlicher Genehmigung‹ entnehme ich ein Kapitel aus der ›Sandkühler'schen Zeitung‹, Ausgabe Weihnachten 2010, aus der Feder meines Bruders Martin. Was er da schildert, betrifft mich in gleicher Weise, denn unsere Unternehmungen fanden in der Regel gemeinsam statt – Martin ist vier Jahre älter, und Christoph, ›Der Kleine‹ erschien uns meist noch nicht der Teilnahme an den diversen Abenteuern würdig. Also hier Martins Bericht: »Die Maler waren trotz der Versicherung, die Wohnung sei fertig, noch am Werken, als wir in Dresden ankamen. Wir schliefen also ein paar Tage bei der Familie meines Patenonkels Martin Tittman in der Nähe.
Tagsüber trieb ich mich bei den Handwerkern in unserem Domizil herum und erlebte hier zum ersten Mal, dass einer ›Deutsch‹ sprach und ich es trotzdem nicht verstehen konnte. Wir waren gerade in der Wohnung, als einer der Maler uns aufforderte: »Chunge, mach doch emol bein Biedchen un hol mer e baar Zigredn!« Als ich ihn verständnislos anglotzte, lachten die Kerle sich halbtot und versuchten mir klar zu machen, wohin ich sollte: in das Büdchen, den Kiosk an der nächsten Ecke gehen, um eine Packung – e baar - Zigaretten zu holen. Wir trabten also los und ich sagte mein Sprüchlein auf, wobei ich mich bemühte, Wortlaut und Tonfall des Malers genau zu treffen, damit mich die Büdchenbesitzerin ihrerseits auch verstand. Das Biidchn, den Kiosk, wo wir die Zigaretten holen sollten, gibt es heute noch an der Verzweigung Radeberger/Bautzner Straße – mit prächtigen Graffitti verziert, aber nicht mehr im Betrieb. Das war dann der Einstieg ins Sächsische, das ich in der Folge, schon durch die Schulfreunde, mir schnell aneignete.
Die Radeberger Straße, in der wir wohnten, zweigte am Diakonissenhaus, wo die Prießnitz in die Elbe fließt, von der großen Bautznerstraße ab. Die Gehwege waren breit und am Straßenrand von wunderbaren Kastanien gesäumt, die uns dann im Herbst zu Wurfgeschossen und Material für unsere Schleudern dienten. Zwischendrin standen auch Bäume mit Mehlbeeren ›Mählfässln‹, die wir ähnlich kriegerisch verwendeten. Das führte im zweiten Jahr unseres Dortseins zu einer Straßenschlacht, die für uns beinahe schlimm ausgegangen wäre. Wir hatten wieder einmal vom Garten aus ein paar Jungens mit Mehlbeeren traktiert. Die warfen zurück, verschwanden dann aber plötzlich. Wir dachten uns nichts Schlimmes und spielten weiter im Garten, doch nach knapp einer halben Stunde tauchten etwa fünfzig Jungens vor unserem Garten auf, bewarfen uns drei erst mit Mehlbeeren und Kastanien, dann auch mit Steinen. Noch konnten wir uns hinter großen Pappschilden, die aus einer Schulaufführung stammten, schützend verbergen und aus unserer Deckung die Würfe der andern abwehren und erwidern. Dann aber rief uns unsere Mutter nichts ahnend ins Haus – wir mussten weg – und der Garten wurde unter Gejohle gestürmt und alles zerschlagen, was da irgendwie herumlag oder angepflanzt war.
Nach einiger Zeit wurde es aber den Kerlen zu langweilig und sie zogen wieder ab. Von Schulfreunden erfuhr ich dann, dass wir die berüchtigte ›Alaunbande‹ aufgescheucht hatten, die oft sogar abgebrochene Flaschenhälse und ähnliches als Wurfgeschosse benützte. Wir waren also nochmal glimpflich davongekommen.
Die Häuser in unserer Straße lagen immer in Gärten. Die Rückseite der Grundstückes grenzten an die Gärten der Häuser der Bautzner Straße.
In unserem Garten wuchsen herrliche Fliederbüsche – für uns nicht nur Augenweide, sondern auch willkommenes Mittel zur Aufbesserung des Taschengeldes; in der Fliederzeit verkauften wir nämlich Sträuße an die Passanten, ein großer Strauß kostete 10, ein kleiner 5 Pfennig; das Geschäft lief gut, und Mutter schmunzelte über unseren Eifer«.
So weit Martin in seiner ›Sandkühler‘schen Zeitung‹
Das Klassenbild hat den Krieg nicht unversehrt überstanden. Bruno neben Frau Fritsche.
Lausbubenzeit
Das andere Nachbargrundstück ging durch bis an die Bautzner Straße. Es war die Tanzschule der berühmten Mary Wigman*. Auch da gab es Bäume mit köstlich duftenden Früchten, nämlich Quitten. Erlaubnis hatten wir zwar hier keine zum Ernten, aber dort drüben kümmerte sich niemand um die Früchte, also waren in der Quittenzeit Mutters Einmachtöpfe voll davon. Der Duft von Gelee, Quittenspeck oder -Kompott durchzog dann die Wohnung. Einmal passierte es uns allerdings, dass wir eifrig beim Quittensammeln waren, als die Mittagspause der Tanzschülerinnen und -Schüler anfing. Über den Zaun zurück konnten wir nicht so schnell, so stiegen wir flugs auf den nächstbesten Baum.
Unsere Schwester Ida beobachtete von ihrem Fenster aus grinsend unsere Bemühungen, über einen Busch wieder in unseren Garten zu kommen. Die Tanzleute standen lachend unter dem Baum Wache und warteten nur darauf, dass einer von uns vom Busch durchbrach. Gott sei Dank waren wir aber Leichtgewichte und konnten entrinnen, sehr zur Enttäuschung der unten Lauernden. Wir stiegen aber dann oben in unser Treppenhaus und bewarfen die Eleven mit weichen Tomaten, die wir aus dem Abfall gefischt hatten.
Bruder Christoph brachte nicht nur interessante Leute ins Haus, er war auch leicht zu ungewöhnlichen Dingen anzustiften: für 10 Pfennig verzehrte er Regenwürmer oder Maikäfer – und für 20 Pfennig sammelte er sogar Pferdeäpfel, die es in Menge von den Brauereipferden gab, und warf sie anderen Jungens nach, während wir harmlos-unbeteiligt taten.
Einer meiner Schulfreunde, Johann Immanuel Maier-Smits, kurz ›JIM‹ genannt, besaß einen 8mm–Filmapparat. Was lag da näher, als alle möglichen Dinge ›zu drehen‹. So kamen wir eines Tages auf die Idee eines Films mit dem Titel ›Christoph und die saure Medizin‹. Um das Erschrecken über die Medizin, wie es der Film forderte, auch wirklich echt zu machen, mixten wir ein Gebräu zusammen, in dem Senf, Essig und Pfeffer wohl noch die harmlosesten Ingredienzien waren. Jedenfalls tat das Fläschchen die gewünschte Wirkung: unser Hauptdarsteller verzog grässlich sein Gesicht, tanzte vor Schreck über die ungewohnten Zutaten im Kreis, fuchtelte mit den Armen, weil ihm schier die Luft wegblieb — und wir hatten herrlichen Spaß dabei. Später, als dann der Streifen vorgeführt wurde, wirkte alles ganz natürlich und das Gelächter war groß.
Unsere Radeberger Straße führte nicht nur zur bekannten Waldschlößchen–Brauerei, sondern auch zu den Kasernen. Als dann einige Monate nach unserer Ankunft in Dresden der Zweite Weltkrieg ausbrach, gab es kaum einen Tag, an dem nicht Marschkolonnen auf der Straße vorbeizogen.
Der Krieg brachte viele Veränderungen: Man mußte abends vor allem die Fenster verdunkeln; dann waren Splitterschutzkisten, mit Sand gefüllt, vor die Kellerfenster zu stellen. Da die Sandschicht in Dresden kaum 30 cm unter dem Humus bereits anfängt, bot das Kistenfüllen keine Schwierigkeit, besonders für uns. Wir hatten nämlich angefangen, heimlich in einem der Nachbargrundstücke (mit Eingang bei uns) eine unterirdische Höhle zu graben, was bei dem Sandboden ganz leicht zu schaffen war. Bis zum Kriegsausbruch war es immer ein Problem gewesen, den Aushub irgendwo zu verteilen, jetzt wanderte er einfach in die Schutzkisten und keiner merkte etwas. Wir trafen uns in den diversen Höhlen mit Freunden, denn auch bei denen hatten wir gemeinsam gegraben. Für uns Brüder bot es keine Schwierigkeit, nachts auszubüchsen, denn wir wohnten im Parterre und etwa einen Meter unterhalb der Fenstersimse zog sich ein Steinvorsprung am Haus entlang, von dem wir bequem abspringen – und auch wieder hinaufklettern – konnten. Einmal mußten wir unseren Freund Gerd Hänel von schräg gegenüber abends abholen. Bei ihm ging es nicht so leicht; sein Zimmer lag im dritten Stock, jedoch außerhalb der Wohnung, – es war das Atelier seines malenden Vaters. Gerd war ›zur Tarnung‹ abends brav ins Bett gekrochen; wir wollten ihn gerade munter rütteln, als die Zimmertür aufging und sein Vater hereinkam. Wir hatten kein Licht gemacht und konnten gerade noch unter dem Bett des Freundes verschwinden, sodaß wir nicht bemerkt wurden. Später in der Nacht gruben wir dann mit ihm an seiner Höhle weiter. Wir waren so eifrig beim Werken, dass wir nicht bemerkten, wie tief wir bereits gegraben hatten; – plötzlich gab es ein leicht knirschendes Geräusch und wir drei Grabenden standen auf einmal bis zur Brust im Sand – die Wände hatten wir leichtsinnigerweise nicht abgestützt. Wir mußten ganz schön schuften, bis wir uns dann wieder freigeschaufelt hatten, denn zunächst konnten wir ja kaum die Arme bewegen. Die Eltern ahnten nichts von alledem, wunderten sich nur, dass die Sandkisten immer so schön überreichlich gefüllt waren, denn sonst waren wir beim Helfen nicht gerade besonders eifrig. Unsere Schwester Ida, elf Jahre älter als ich, war die einzige Vertraute, die wir in solche und andere Tätigkeiten einweihten, obwohl sie ansonsten weniger auf uns ›Kleine‹, als auf ihr Musikstudium und ihren Freundeskreis ausgerichtet war. Dieser Freundes- und Künstlerkreis traf sich oft auch bei uns – manchmal durften wir bei den Musikabenden zuhören oder den interessanten Diskussionen folgen, die lebhaft und ›international‹ waren (einige der Freunde stammten aus Frankreich, Belgien oder Norwegen, sie arbeiteten als ›Fremdarbeiter‹ in Dresden).
Eine der ›Nachtunternehmungen‹ endete fatalerweise doch so, dass unsere Eltern (und die Polizei) auf unser Treiben aufmerksam wurden. Die Gärten der Grundstücke in unserer Straße hatten meist da, wo zwei zusammenstießen, kleine Erhebungen, Terrassen, wo man geschützt im Freien sitzen konnte. Nach der Straße zu, etwa zwei Meter hoch, war davor eine Mauer, erst dann begann der jeweilige Gartenzaun. Einer unserer Lehrer wohnte ein paar Häuser weiter auf der anderen Straßenseite. Eines Nachts hatten wir Freunde uns hinter der Mauer des gegenüberliegenden Gartens ver-steckt und schleuderten kleine Steinchen auf die Fenster der Parterrewohnung dieses Lehrers. Nun war er aber nicht zu Hause und seine Frau ängstigte sich so, dass sie die Polizei verständigte. Wir waren noch eifrig bei unserem Treiben, als plötzlich hinter uns Hundegebell ertönte und energische Stimmen uns aufforderten, mit erhobenen Händen zu kommen. Einer der Freunde hatte sich mit einem Sprung über die Mauer in Sicherheit gebracht, für uns zwei andere war es zu spät, wir mussten mit aufs nahe Revier. Nach entsprechender Befragung stufte man das Vorkommnis als ›groben Unfug‹ ein. – Vater war noch abends in der Schule zur Lehrerkonferenz gewesen und kam erst nach 23 Uhr nachhause, wo er die Nachricht vorfand, er möge seinen Sprössling auf dem Polizeirevier in der Bautzener Straße abholen. Da stapfte ich also dann kurz vor Mitternacht neben ihm nach Hause. Er sagte nichts, aber sein Schweigen war mir weit unangenehmer als Geschimpfe.
Nicht weit von uns, auf der Elbseite der Bautzener Straße, wohnte eine andere Freundesfamilie, deren Kinder alle mit uns in die Rudolf Steiner– Schule gingen, die Familie Groh. Mutter Groh war eine echte Bubenmutter. Ihre fünf Jungen und die Tochter Sophia behandelte sie energisch, doch liebevoll und an ihrem Tisch saßen oft so viele Freunde ihrer Kinder, dass kaum mehr Platz war. Nach dem Krieg, als die Kinder ausgeflogen waren, war Lily Groh im Alters– und Pflegeheim Schloss Hamborn bei Paderborn als Hauswirtschafterin tätig und sorgte dafür, dass ›der Laden lief‹, was allgemein anerkannt wurde.
Vater Groh war Priester der Christengemeinschaft. Meist zog er sich vor dem Treiben in seiner Wohnung ins Arbeitszimmer zurückzog. Wir erlebten ihn dann nur bei den sonntäglichen Weihehandlungen in der Reichenbachstraße – wenigstens so lange, bis 1941 Schule und Christengemeinschaft auch in Dresden von den braunen Behörden verboten wurden.
Oft saßen wir bei Grohs im großen Garten, der sanft zur Elbe abfiel, nur durch den Uferweg vom Fluss getrennt. Manchmal brieten wir uns nachts am Feuer Kartoffeln, wenn wir uns nicht einfach nur unterhielten. Besonders mit den Brüdern Christoph und Trauger waren wir viel zusammen. Sie schliefen auch im Parterre, doch grenzte ihr Zimmer an das ihrer Schwester Sophia. Um diese nicht zu wecken, hatte einer der Brüder an sein Kopfkissen einen Bindfaden festgezurrt und das Ende zum Fenster herausgehängt. Wir mussten dann nur dran ziehen – wenn er nicht so fest schlief, dass er gar nicht merkte, dass plötzlich sein Kissen in Bewegung geriet. In diesem Fall blieb uns nichts anderes übrig, als doch durchs Fenster zu klettern und die Brüder wachzurütteln. Andere Freunde in dieser Zeit waren die drei Kinder der Familie Brücker: Helga, Hartmut und Willfest. Später kam noch eine kleine Schwester Ute dazu. Sie wohnten nur ein paar Häuser weiter und wir trafen oft bei ihnen oder bei uns zusammen.
Ihr Vater war Generalleutnant und als er einmal in Urlaub kam, war bei uns gerade die Zinnsoldatenschau aufgebaut. Wir luden ihn durch seine Kinder zur Besichtigung ein – und er kam tatsächlich, bewunderte unsere Dioramen, lobte die gute Aufstellung und Gestaltung und schrieb das dann entsprechend in unser Gästebuch*.
Nach Beendigung des Krieges saß er in dem berühmten Generalslager in der Nähe von Moskau gefangen, in dem die Insassen ›zur Strafe‹ nicht arbeiten durften. Er vertrieb sich die Zeit dann mit dem Zeichnen von geschichtlichen Karten aus dem Gedächtnis und mit Geschichtstabellen, die seinen Kindern später als Lernhilfe zugute kamen; oft haben wir bei Brückers Kasperletheater gespielt, Zaubervorstellungen gegeben oder Martin hat vorgelesen. Manchmal tobten wir natürlich sehr zum Leidwesen von Mutter Brücker im Haus herum und sie musste uns in den Garten scheuchen. Brückers zogen noch vor dem Angriff auf Dresden weg, in die Nähe von Aalen und in Weinheim an der Bergstraße und wir trafen sie nach dem Krieg wieder, – Helga wohnte einige Zeit sogar mit Mann und Kindern in Stuttgart-Degerloch ganz in unserer Nähe. Noch lange hatte Martin mit ihnen Kontakt.
Schule, Weiße Mäuse, und Chemie
Die Rudolf–Steiner–Schule in der Jägerstraße war sozusagen gleich um die Ecke; der kurze Schulweg war trügerisch durch das Gefühl ›da bin ich ja schnell‹, also kam ich oft zu spät. Das Dumme war, dass unsere Klasse zusammen mit der Zwölften dem Schulgebäude gegenüber im Haus der Familie Neuloh untergebracht war; kam man zu spät, musste man an der Wohnungstür läuten, dann ließ einen einer der ›Großen‹ ein. Also zweimal peinlich.
Wie schon gesagt, brach im Sommer nach unserer Umsiedelung der Krieg aus, von uns Buben zunächst mehr als spannendes Abenteuer erlebt, denn als Gefahr. Der Wehrmachtsbericht meldete die ›Heldentaten‹ der nach Polen einmarschierten Truppen, dann begann der Feldzug in Frankreich. Nach einigen Monaten hörten wir von den Urlauberzügen, die vom Balkan, von Dänemark und Holland eintrafen. Es wurde ein Sport, am Bahnhof Dresden-Neustadt die ankommenden Soldaten nach ausländischen Münzen anzubetteln, und bald hatten wir eine stattliche Sammlung von Fancs, Centimes, Gulden, Øre, Kopeken, Heller, Zloty, Ley und Drachmen zusammen, in Kleingeld ein kurioses Abbild der deutschen Truppenbewegungen.
Wir fühlten uns zwar bestimmt nicht als Militaristen, trotzdem waren die Zinnsoldaten eines unserer vielen Hobbies, aber mehr aus dem Interesse für Geschichte, das unter anderem durch ›Die Ahnen‹ von Gustav Freitag angeregt wurde. Die flachen Figuren gab es fertig bemalt oder blank in reicher Auswahl bei Spielwaren Zeuner in der Schlossstraße. Um halbwegs ansehnliche Szenen oder gar berühmte Schlachten aufzustellen, war natürlich eine erkleckliche Anzahl der kleinen Figuren notwendig, deren Finanzierung ein Problem darstellte. Da fand ich Arbeit bei der Gärtnerei Wittich an den Waldschlösschenwiesen; in den Gewächshäusern standen reihenweise Grünpflanzen, in jedem Topf eine rohe Kartoffelscheibe, auf der sich Blattwanzen oder Asseln einfanden. Meine Aufgabe war es, diese unerwünschten Gäste abzusammeln, wofür ich pro Stunde 35 Pfennige bekommen sollte. Herr Wittich war ein Geizhals und zahlte ungern, es gab immer wieder Ärger. Hatte ich aber mein Geld bekommen, dann machte ich mich eilends auf den Weg zu Spielwaren Zeuner, um es noch vor Ladenschluss in die Vermehrung der Zinnfigurenpopulation zu investieren.
Bei Zeuner waren wir bald als Stammkunden bekannt. Schaffte ich es nicht ganz bis sechs Uhr, so ließ man den Rolladen vor der Ladentür noch nicht ganz herunter, so dass ich noch drunter durchschlüpfen konnte. Da ich immer genau wusste, was als Nächstes auf der Wunschliste stand, war der Kauf schnell getätigt, der Rolladen wurde geschlossen, und ich zog mit einer Schachtel römischer Legionäre, ungarischer Panduren oder Ziethenscher Husaren nachhause. Um den Zuwachs zu beschleunigen, gingen wir dazu über, die Figuren ›blank‹, d.h. unbemalt zu kaufen und selbst zu bemalen. Das war zwar arbeitsintensiv, führte aber zu einem ›Fachstudium‹ in Uniform– und Trachtenkunde, denn alles musste stimmen – ein Husar des Generals von Ziethen war ohne seine charakteristische Fellkappe nicht denkbar und konnte auch nicht in den Stiefeln eines Seydlitz'schen Kürassiers daherkommen. Unsere Tante Litty, Louise Revy, war Kostümvorstand am Münchner Theater; sie lebte in Warngau und besaß eine Reihe farbig illustrierter Bände zur Kostümkunde, aus denen wir die nötigen Sachkenntnisse bezogen. Die Akribie, mit der jedes Detail der Uniformen wie auch des zivilen Trosses erforscht und mit Farbe und Zaponlack auf die Figuren gepinselt wurde, brachte uns die Anerkennung der passionierten Sammler, meist ehemaliger Offiziere und Generäle, die sich zu einem Club zusammengeschlossen hatten. Wir wurden gewissermaßen Ehrenmitglieder im Zinnsoldatenclub. Bald hatten wir über tausend Figuren beieinander und konnten von der Schlacht im Teutoburger Wald bis zur Völkerschlacht bei Leipzig historisch getreue Dioramen gestalten. Dabei waren nicht nur kriegerische Ereignisse von Interesse, sondern zum Beispiel auch eine aus Zigarrenkisten gebastelte mittelalterliche Stadt mit Fachwerkhäusern und der passenden Bevölkerung.
Aus dem Schulleben sind mir, abgesehen von den geliebten Oberuferer Weihnachtsspielen, besonders drei Dinge im Gedächtnis: zum einen eine Schriftschreib-Epoche bei unserer Klassenlehrerin Frau Fuchs, in der ich mich für die gotische Fraktur begeisterte, ganz besonders für die Initialen, die wir mit Gummi Arabicum bestrichen und mit echtem Blattgold belegten. Eine weitere Manifestation meiner Affinität zum Mittelalter. Das zweite Memorabilium bestand in der feierlichen Trauung mit meiner Klassenkameradin Felicitas Buder, bei der Alexander Magerstädt* als Priester amtierte. Das dritte war ein Vortrag von Korvettenkapitän Hans Erdmenger*, der für seine Rolle im Kampf um den norwegischen Erzhafen Narvik das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz verliehen bekommen hatte. Sein Sohn Jürgen besuchte unsere Schule, und Kapitän Erdmenger berichtete uns Schülern mehrmals von seinen Erlebnissen. Mit Jürgen, der als Direktor der Verkehrsabteilung der Europäischen Kommission in Brüssel tätig war, hatte ich fünfzig Jahre später im Rahmen unseres ›European Council for Waldorf Education‹ wieder zu tun; seine Mutter wohnte auf Hof Grub bei Wasserburg, wo ich später mehrfach mit Neuntklässlern zum Landwirtschaftpraktikum war.
Nach dem Englandflug von Rudolf Hess im Frühjahr 1941 wurde die Dresdner Rudolf-Steiner-Schule geschlossen. Vater als Beamter wurde zunächst in die Oberschule für Jungen übernommen, bis irgendwann die Behördern fanden, dass ein mit einer Halbjüdin verheirateter Anthroposoph nicht würdig sei, deutsche Jugend zu unterrichten. Sein Freund Carl Schuricht, der Dirigent der Dresdner Philharmonie, war jedoch froh, einen versierten Bratschisten zu bekommen, und so wurde Vater vom Lehrer zum Orchestermusiker.
Als Erbstück aus der Schulschließung waren die blauen Vorhänge der Weihnachtsspiel-Bühne bei uns gelandet. Das Kinderzimmer wurde zum historischen Schauplatz, die blauen Tücher bildeten den Himmel, an kreuz und quer gespannten Drähten hoch über dem Tisch drapiert und mit Wattewolken versehen. Bretter auf Böcken bildeten, mit Packpapier belegt, in der Mitte des Zimmers die Grundlage für eine Sandschicht und naturgetreue Landschaften, auf denen sich das Geschehen entfalten konnte. Daneben blieb gerade noch genug Platz für die Betten. Wie gut, dass Mutter das alles nicht nur mit Gleichmut, sondern mit regem historischem Interesse begleitete!
Nach der Schliessung der Rudolf Steinerschule übernahm die DKS unsere Bildung, die Dreikönigschule. 1495 gegründet, ein Traditionsinstitut, das sich aber inzwischen Reformrealgymnasium nannte. Es bekam durch den Waldorfzuwachs einen neuen Charakter. Die DKS war eine reine Jungenschule, so ergab sich daraus auch, dass unsere Klassenkameradinnen nun auf die Oberschule für Mädchen in der unweit gelegenen Weintraubenstraße, gingen. Unser sozialer Austausch konzentrierte sich fürderhin auf den Heimweg über den Staudengarten am Elbufer.
Der Schulbetrieb der DKS war stark von der Kriegszeit geprägt, ein Teil des Lehrerkollegiums war aus dem Ruhestand zurückgeholt worden, was gelegentlich durch Aussprüche wie »wenn ich aich nich underrichdn missde, gennt‘ch jetz im Barg schpaziern gähn*« kundgetan wurde.
Großes Glück hatte ich mit meinem Klassenlehrer Hoxhold, mit dem ich später noch Briefe wechselte. Auch Molo muss lobend erwähnt werden, Konrektor Johannes Müller, ein echter Pädagoge, der seine Schüler liebte. Und es gab Prof. Gneus, genannt Gne–us. Er betrat die Klasse mit markigen Sprüchen, wie »Nu, isch wer glei een rausholn aus dem Dimbel, ma sähn wie där zabbelt*«. Für meine mathematischen Defizite hatte er Spezialausdrücke parat: »Sankieler, du mademadisches Näbelhorn«, oder »du mademadischer Hungerdurm«. Auch »du zidronengelber Nussgnagger« ist mir in bleibender Erinnerung geblieben. Gne–us verstand es auch, sein Missfallen dadurch schmerzhaft zu äußern, dass er uns die Haare vor den Ohren verzwirbelte und in die Höhe zog.





























