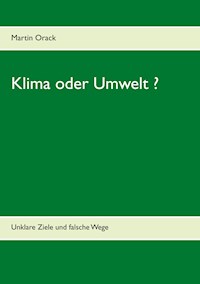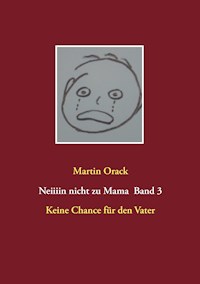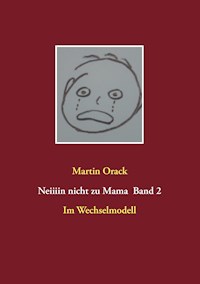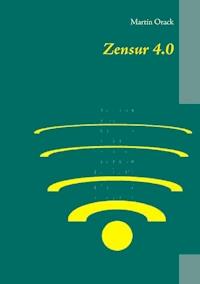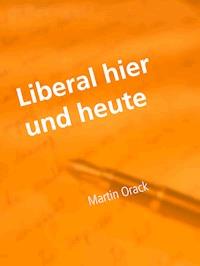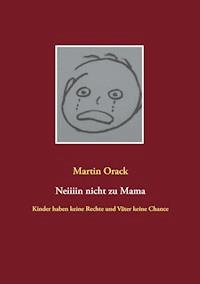
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mit dieser Schilderung eines anonymisierten tatsächlichen Falles wird aufgezeigt, wie bei der Trennung der Eltern zwar alle Beteiligten das „Wohl des Kindes“ als zentrales Anliegen immer wieder betonen, es aber nicht wirklich betrachten und verfolgen. In diesem wie in vielen ähnlichen Fällen wird die besondere Situation, die für den Vater als wichtigste Bezugsperson des Kindes spricht, gar nicht betrachtet. Es wird standardmäßig nur für die Mutter entschieden, der Vater wird als Störfaktor behandelt. Trotz der im BGB definierten Rechte des Kindes zum Umgang mit den Großeltern als Bezugspersonen, wird dies von den beurteilenden Personen nicht berücksichtigt. Die gesetzlichen Regelungen werden kritisch an Hand der Erfahrungen in diesem Fall kommentiert. Das Buch ist als Hilferuf eines betroffenen Kindes zu verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Die juristische Theorie und ihre Umsetzung
Tagebuch der Ehe und Familie vor der Trennung
Trennung erster Teil
Gerichtsentscheid und Jugendamt
Das Wohl des Kindes spielt überhaupt keine Rolle
Wechselmodell
Zweiter Gerichtsentscheid
Verhalten Mutter, Vater, Kind
Vertauschte Rollen
Beliebigkeit der Auslegung
Nachwort
Links, Kontakt
Vorwort
Mit der Schilderung eines anonymisierten tatsächlichen Falles wird aufgezeigt, wie bei der Trennung der Eltern zwar alle Beteiligten das „Wohl des Kindes“ als zentrales Anliegen immer wieder betonen, es aber nicht wirklich betrachten und verfolgen. Die vom Gesetz gewollte Gleichbehandlung von Mutter und Vater findet nicht statt.
In diesem wie in vielen ähnlichen Fällen wird die besondere Situation, die für den Vater als wichtigste Bezugsperson des Kindes spricht, gar nicht betrachtet, es wird standardmäßig nur für die Mutter entschieden, der Vater wird als Störfaktor behandelt.
Trotz der im BGB definierten Rechte des Kindes zum Umgang mit den Bezugspersonen Großeltern wird dies von den beteiligten Stellen nicht berücksichtigt.
Als Hilferuf für das betroffene Kind behandelt dieses Buch die Stationen einer Trennung, den Unterschied zwischen Recht haben und Recht bekommen.
Dies ist auch ein Aufruf an alle ähnlich betroffenen, insbesondere natürlich in Trennung lebenden Männer, zusammen das hier beschriebene gesetzwidrige Verhalten der beteiligten Institutionen und Personen anzuprangern und durch eine öffentliche Empörung und Diskussion eine Veränderung zu einem Gesetzes konformen Verhalten zu bewirken.
Im Mittelpunkt muss dabei immer das Wohl des Kindes stehen, nicht die Rache oder Bestrafung eines Elternteils gegen den anderen.
Die väterliche Seite der Familie kann und will die vom Familiengericht angeordnete physische und psychische Körperverletzung des Kindes nicht akzeptieren, will die Hoffnung nicht aufgeben, dass doch die Sorge um das Wohl des Kindes letztlich über alle Vorurteile siegt.
1. Die juristische Theorie und ihre Umsetzung
Gesetze und Grundsatzurteile scheinen niemanden wirklich zu interessieren. Man hat den Eindruck, dass weder Jugendamt noch Anwälte noch Familienrichter die Gesetze zu Trennung und Scheidung, insbesondere die entsprechenden §§ des BGB kennen oder zur Kenntnis nehmen oder gar anwenden.
Sie haben bisher auch noch nicht in ihrer täglichen Arbeit berücksichtigt, dass das Antidiskriminierungsgesetz die unterschiedliche Behandlung von Mann und Frau verbietet und dass deshalb gerade im geschilderten Fall die Kind-Vater-Beziehung zum Wohle des Kindes von besonderer Bedeutung ist.
Im folgenden werden ausschließlich die §§ des BGB zitiert, die Rechte und Pflichten aller Beteiligten zur Zeit der Trennung vor einer Scheidung behandeln. Die Scheidung, ihr Vollzug und ihre Auswirkungen sind nicht Thema dieser Darstellung.
Hier nun zunächst jeweils in direktem Bezug zu dem entsprechenden Paragrafen des BGB einige Kommentare zu diesen gesetzlichen
Regelungen auf Grund eigenen Erlebens.
BGB § 1627 Ausübung der elterlichen Sorge
Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl des Kindes auszuüben.
Bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen, sich zu einigen.
Kommentar:
Zunächst einmal klingt der Text gut. Eltern haben das Recht über ihre Kinder ohne Einfluss von außen allein, aber einvernehmlich zu entscheiden.
Die Eltern haben die Pflicht, sich zu einigen und das Wohl des Kindes als ausschließliches Kriterium anzuwenden.
Aber leider ist das Wohl des Kindes dabei zunächst ein weiter Begriff, es gibt keine Anhaltspunkte, wann Außenstehende eingreifen dürfen, oder wie die Rechte und Pflichten durchgesetzt werden können.
BGB § 1628 Gerichtliche Entscheidung bei Meinungsverschiedenheiten der Eltern
Können sich die Eltern in einer einzelnen Angelegenheit oder in einer bestimmten Art von Angelegenheiten der elterlichen Sorge, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, nicht einigen, so kann das Familiengericht auf Antrag eines Elternteils die Entscheidung einem Elternteil übertragen. Die Übertragung kann mit Beschränkungen oder mit Auflagen verbunden werden.
Kommentar:
Bei einer für das Kind unerheblichen Bedeutung einer Handlung ist die Pflicht zum Einvernehmen nicht gegeben. Es bleibt aber offen, was unerheblich ist. Vielleicht alles, was nicht durch andere §§ oder Gesetze geregelt wird?
Da aber nur Extreme gesetzlich geregelt werden, ist dann der Rahmen des Kindeswohls sehr eng gefasst, es gibt einen weiten ungeregelten Bereich, in dem die Eltern oder Elternteile einzeln frei über die Art der Betreuung und Erziehung des Kindes entscheiden können, ohne dass jemand eingreifen darf.
Ein sehr unterschiedliches Verhalten von Mutter und Vater gegenüber dem Kind kann für das Kind aber sehr belastend sein, eine Milderung oder Ergänzung der Erziehungsmaßnahmen durch gleichzeitige Anwesenheit beider Elternteile wie in einer Familie besteht ja bei wechselndem Aufenthalt und wechselnder Betreuung nicht mehr.
Ein Wechselbad ist eben kein wohltemperierte Bad mehr, das gilt auch für die Seele des Kindes.
BGB § 1631 Inhalt und Grenzen der Personensorge
(1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.
(2) Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.
(3) Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der Personensorge in geeigneten Fällen zu unterstützen.
Kommentar:
Dieser Paragraf ist in der Wirklichkeit ohne Bedeutung, denn Jugendämter, Familiengerichte und Psychologen werten das Schlagen und Misshandeln eines Kindes durch einen Elternteil nicht. Sie sehen (gesellschaftlich nach wie vor überwiegend akzeptierte) Schläge und psychische Misshandlungen nicht als unzulässigen Schaden des Kindeswohls an, also zu Gunsten der Sorgerechtsübertragung auf den anderen Elternteil, jedenfalls mindestens dann nicht, wenn der schlagende und misshandelnde Elternteil die Mutter ist.
Obwohl das Gesetz eindeutig sagt, dass diese Misshandlungen unzulässig sind, werten die beteiligten Stellen und Personen den Aufenthalt des Kindes bei der misshandelnden Mutter als an sich höherwertig an als den Aufenthalt beim gewaltfreien Vater. Obwohl das Gesetz ausdrücklich sagt, dass Mutter und Vater gleich zu werten und zu behandeln sind, wird traditionell nach alten gesellschaftliche Vorurteilen gehandelt.
Es ist nicht möglich, dagegen etwas zu unternehmen, es gibt keine Revisionsmöglichkeiten gegen Jugendämter oder Familiengerichte, diese Institutionen können machen und entscheiden, wie sie wollen.
Interpretationen von Psychologen haben großes Gewicht, auch wenn sie nur nach Aktenlage ohne Ansehen oder Anhörung der beteiligten Personen erfolgen oder Erkenntnisse angeblich wegen der Schweigepflicht nicht offengelegt werden gegenüber dem Jugendamt oder dem Familiengericht.
Jugendämter und Gerichte schreiten nur ein bei Lebens- oder Vermögensgefahr des Kindes. Körperliche oder seelische Verletzungen, die nicht unmittelbar lebensbedrohlich sind, werden nicht verfolgt.
BGB § 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.
(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt.
(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere
Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen,
Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen,
Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält,
Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind herbeizuführen,
die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge,
die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge.
(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen.
Kommentar:
bekräftigt das vorher beschriebene noch einmal.
Die im Abs (3) genannten Gründe, den Umgang mit einem Elternteil einzuschränken, wird ohne Zögern gegen schlagende Väter angewandt, aber nicht gegen schlagende Mütter.
Schläge von Vätern gelten immer als Ausdruck von Jähzorn oder erzieherischen Unvermögen. Schläge von Müttern gelten als wohlmeinende Erziehungsmaßnahme, jeder Mutter darf mal der Geduldsfaden reißen. Dieser traditionelle und gesellschaftlich gestützte Unterschied wird aber vom Gesetz nicht (mehr) gemacht, trotzdem aber von den beteiligten Einrichtungen und Personen nach wie vor so gewertet.
m keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, Schläge von Vätern sollen keineswegs verharmlost werden, sondern im Gegenteil müssen Schläge von Müttern genauso negativ gewertet werden. Gewalt, ob körperlich oder seelisch, ist immer zu vermeiden, besonders gegenüber Kindern. Gewalt ist immer ein Zeichen von Hilflosigkeit, ein Signal, dass von außen eingegriffen werden sollte, egal ob die Gewalt vom Vater oder der Mutter ausgeübt wird.
BGB § 1671 Getrenntleben bei gemeinsamer elterlicher Sorge
(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur vorübergehend getrennt, so kann jeder Elternteil beantragen, dass ihm das Familiengericht die elterliche Sorge oder einen Teil der elterlichen Sorge allein überträgt.
(2) Dem Antrag ist stattzugeben, soweit
der andere Elternteil zustimmt, es sei denn, dass das Kind das 14. Lebensjahr vollendet hat und der Übertragung widerspricht, oder
zu erwarten ist, dass die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Übertragung auf den Antragsteller dem Wohl des Kindes am besten entspricht.
(3) Dem Antrag ist nicht stattzugeben, soweit die elterliche Sorge auf Grund anderer Vorschriften abweichend geregelt werden muss.
Kommentar:
Das hört sich gut an. Man könnte meinen, dass es direkt umsetzbar wäre, wenn ein Elternteil misshandelt und der andere Elternteil dem Kind mehr bieten kann für seine Entwicklungsmöglichkeiten. Mag sein, dass das angewendet wird, wenn der Vater der misshandelnde und die Mutter finanziell und bildungsmäßig die bessere Umgebung bietet.
Dann genügt schon eine der beiden Voraussetzungen, um der Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu übertragen, wenn sie es beantragt. Wenn aber der Vater sogar beide Voraussetzungen erfüllt, wird ihm das Aufenthaltsbestimmungsrecht trotzdem nicht übertragen, und wenn es mit der „Ausrede“ ist, er sei ja beruflich zu engagiert, um sich ausreichend um das Kind kümmern zu können. Der sonstige familiäre Hintergrund wie Großeltern oder andere Verwandte wird von Jugendamt und Gerichten nicht anerkannt, jedenfalls nicht zugunsten des Vaters und ohne Rücksicht auf das Wohl des Kindes.
Eine Berufstätigkeit der Mutter wird nicht negativ gewertet, wird höchstens von Mitleid wegen der Notwendigkeit begleitet. Familiärer Hintergrund (Mutter der Mutter oder Schwester der Mutter) wird immer positiv bewertet, immer betrachtet, ein Bezug zum Vater des Vaters wird als unerheblich für das Kind gewertet. Das ist eine eindeutige Bevorzugung nach Geschlecht, ein Verstoß gegen das Antidiskriminierungsgesetz durch Jugendämter und Gerichte.
BGB § 1684 Umgang des Kindes mit den Eltern
(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt.
(2) Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind in der Obhut einer anderen Person befindet.
(3) Das Familiengericht kann über den Umfang des Umgangsrechts entscheiden und seine Ausübung, auch gegenüber Dritten, näher regeln. Es kann die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfüllung der in Absatz 2 geregelten Pflicht anhalten. Wird die Pflicht nach Absatz 2 dauerhaft oder wiederholt erheblich verletzt, kann das Familiengericht auch eine Pflegschaft für die Durchführung des Umgangs anordnen (Umgangspflegschaft). Die Umgangspflegschaft umfasst das Recht, die Herausgabe des Kindes zur Durchführung des Umgangs zu verlangen und für die Dauer des Umgangs dessen Aufenthalt zu bestimmen. Die Anordnung ist zu befristen. Für den Ersatz von Aufwendungen und die Vergütung des Umgangspflegers gilt § 277 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.
(4) Das Familiengericht kann das Umgangsrecht oder den Vollzug früherer Entscheidungen über das Umgangsrecht einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist. Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht oder seinen Vollzug für längere Zeit oder auf Dauer einschränkt oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn andernfalls das Wohl des Kindes gefährdet wäre. Das Familiengericht kann insbesondere anordnen, dass der Umgang nur stattfinden darf, wenn ein mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist. Dritter kann auch ein Träger der Jugendhilfe oder ein Verein sein; dieser bestimmt dann jeweils, welche Einzelperson die Aufgabe wahrnimmt.
Kommentar:
Dies untersagt beiden Elternteilen negative Aussagen über den anderen. Aber auch hier werden Mutter und Vater völlig ungleich behandelt. Vorwürfe der Mutter gegen den Vater werden kritiklos geglaubt, vor Gericht als „Aussagen“ bezeichnet, und helfen im Widerspruch zu diesem Paragrafen der Mutter, das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu bekommen. Vorwürfe des Vaters gegen die Mutter werden dem Vater als Schlechtmachen der Mutter, als Verstoß gegen das Wohl des Kindes angelastet, vor Gericht als „Behauptungen“ bezeichnet und verhindern, dass er das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommt.
Auslegungen des entsprechenden Verhaltens von Mutter und Vater sind immer zum Nachteil des Vaters ohne Rücksicht auf das Wohl des Kindes. Die begutachtenden Psychologen können immer das gewünschte Ergebnis in ihre Beobachtungen und Wertungen hineininterpretieren, wie später im Kapitel „Beliebigkeit der Auslegung“ an etlichen Beispielen aufgezeigt wird.
Es wird leider überhaupt nicht erwähnt, wie zu verfahren ist, wenn der Umgangsberechtigte und verpflichtete Elternteil den Umgang mit dem Kind nicht wahr nimmt. Oft wird unterstellt, dass das der Vater ist. Maßregelnde Aktionen werden von Jugendämtern und Gerichten im allgemeinen auch nur gegen solche Väter eingeleitet.
Aber es gibt, wie in dem in dieser Buchreihe beschriebenen Fall, durchaus auch Mütter, die den Umgang nicht wahr nehmen (wollen), eventuell auch weit weg ziehen vom Wohnort des Kindes. In solchen Fällen wird unterstellt, dass der Vater den Umgang aktiv verhindert, auch in diesem Fall gibt es also eher Maßregelungen gegen den Vater.
Eigentlich stellt sich schon die Frage, ob ein solches Verhalten des Umgangspflichtigen Elternteils nicht ausreichender Grund ist, die Sorge vollständig auf den alleinerziehenden Elternteil zu übertragen.
Mütter hätten da derzeit vielleicht eine Chance, Väter eher nicht.
BGB § 1685 Umgang des Kindes mit anderen Bezugspersonen
(1) Großeltern und Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient.
(2) Gleiches gilt für enge Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind tatsächliche Verantwortung tragen oder getragen haben (sozial-familiäre Beziehung). Eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung ist in der Regel anzunehmen, wenn die Person mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt hat.
3) § 1684 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. Eine Umgangspflegschaft nach § 1684 Abs. 3 Satz 3 bis 5 kann das Familiengericht nur anordnen, wenn die Voraussetzungen des § 1666 Abs. 1 erfüllt sind.
Kommentar:
Dies betont das Recht des Kindes auf Umgang mit Großeltern und anderen Verwandten, schränkt es aber zugleich wieder ein.
Denn die „Regel“ in Absatz 2 wird von Jugendämtern und Gerichten als ausschließliche Voraussetzung verwendet. Großeltern werden beim Aufenthalt des Kindes nur berücksichtigt, wenn vor der Trennung alle als Großfamilie in einer Wohnung oder einem Haus gelebt haben. Bei noch so geringer örtlicher Trennung der Großeltern von der Familienwohnung wird der §1685 nicht angewendet. Auch wenn beide Eltern berufstätig waren und deshalb das Kind, oft auch über Nacht ein Drittel seiner Zeit bei den Großeltern gelebt hat, interessiert das niemanden. Die Trennung der Eltern führt also gegen das Wohl des Kindes zur Trennung von den Großeltern, sie können bestenfalls am Aufenthalt des Kindes bei dem mit ihnen verwandten Elternteil teilhaben. Aus einem Aufenthalt des Kindes von einem Drittel der Zeit bei den Großeltern wird also bestenfalls ein Aufenthalt von weniger als einem Viertel der Zeit.
Auch wenn immer betont wird, dass vorhandene soziale Bindungen des Kindes erhalten bleiben sollen, werden Umgebung (Bekannte, Orte), Verwandte, insbesondere Großeltern dabei nicht gewertet, wenn die Mutter mit dem Kind wegzieht. Sofort ist das Argument da „bei der Mutter ist das Kind doch am besten aufgehoben, das ist seine wichtigste soziale Bindung“. Untersucht und belegt wird diese Behauptung nicht, schon gar nicht, ob der Wegzug vom Vater ein Herausreißen gegen das Wohl des Kindes ist. Bei der Mutter werden immer gute Gründe angenommen, dem Vater wird immer böses Verhalten unterstellt.
BGB § 1686 Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Kindes
Jeder Elternteil kann vom anderen Elternteil bei berechtigtem Interesse Auskunft über die persönlichen Verhältnisse des Kindes verlangen, soweit dies dem Wohl des Kindes nicht widerspricht. Über Streitigkeiten entscheidet das Familiengericht.
Kommentar:
Dies ist nicht umsetzbar, wenn der Vater Auskunft über Umgang, Wohnverhältnisse und Einkommen der Mutter verlangt. Es wird immer stillschweigend vorausgesetzt, dass die “arme“ und „besorgte“ Mutter Anspruch und Bedarf auf diese Auskünfte durch den Vater hat.
Die Wohn- und Personenumgebung der Mutter spielen keine Rolle, kein Jugendamt und kein Familiengericht wird einen Vergleich zum Wohle des Kindes durchführen. Es wird ausdrücklich von Jugendämtern und Familiengerichten betont, dass es nicht darum geht, wo es dem Kind besser geht, wo es alte Bezüge weiter pflegen und leben kann, sondern bestenfalls nur darum, ob es dem Kind gut (nicht miserabel schlecht) geht, also ob Lebens- oder Vermögensgefahr besteht oder nicht. Die andere Umgebung beim anderen Elternteil wird nicht untersucht.
Auf jeden Fall wird so verfahren, wenn die Mutter mit dem Kind ausgezogen ist. Es wird auf Verlangen des Vaters die Umgebung bei der Mutter in Augenschein genommen, nicht die Umgebung beim Vater, es gibt keinen Vergleich.
Umgekehrt würde das Jugendamt aber die für das Kind „gewohnte“ bisherige Umgebung bei der Mutter anschauen und auch ohne Besichtigung der neuen Umgebung beim Vater empfehlen, dass das Kind in der bisherigen Umgebung bei der Mutter leben sollte. „Bei der Mutter ist das Kind immer gut aufgehoben“, insbesondere in der bisherigen Umgebung.
Das ist eindeutig Diskriminierung des Vaters und damit gesetzeswidrig. Die Jugendämter und Familiengerichte scheuen sich trotzdem nicht, genau so zu argumentieren und zu verfahren.
BGB § 1687 Ausübung der gemeinsamen Sorge bei Getrenntleben
(1) Leben Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur vorübergehend getrennt, so ist bei Entscheidungen in Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, ihr gegenseitiges Einvernehmen erforderlich. Der Elternteil, bei dem sich das Kind mit Einwilligung des anderen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich aufhält, hat die Befugnis zur alleinigen Entscheidung in Angelegenheiten des täglichen Lebens. Entscheidungen in Angelegenheiten des täglichen Lebens sind in der Regel solche, die häufig vorkommen und die keine schwer abzuändernden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben. Solange sich das Kind mit Einwilligung dieses Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung bei dem anderen Elternteils aufhält, hat dieser die Befugnis zur alleinigen Entscheidung in Angelegenheiten der tatsächlichen Betreuung. § 1629 Abs. 1 Satz 4 und § 1684 Abs. 2 Satz 1 gelten entsprechend.
(2) Das Familiengericht kann die Befugnisse nach Abs 1 Satz 2 und 4 einschränken oder ausschließen, wenn dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist.
Kommentar:
Dies wird immer nur zum Nachteil des Kindes und gegen den Vater angewendet.
Die Mutter wird fast immer von Behörden, Versicherungen, Ärzten ohne Nachweis als erziehungsfähig und sorgeberechtigt anerkannt, es wird einfach unterstellt, dass sie allein handeln darf oder im gemeinsamen Auftrag handelt.
Die Mutter kann meistens sogar ohne Begleitung des Kindes bei Ämtern und anderen Einrichtungen das Leben des Kindes beeinflussende Änderungen veranlassen. Beispiele sind Ummelden, Kindergarten - Anmeldung, Kindergeld.
Dem Vater wird das selbst mit dem Kind an der Hand verweigert. Er muss einen Nachweis oder die zustimmende Unterschrift der Mutter beibringen. Einseitige alleinige Handlungen der Mutter kann der Vater nicht rückgängig machen lassen ohne erneute Zustimmung der Mutter, obwohl die Ausführung einseitig und rechtswidrig war.
Der Vater bekommt vom Familiengericht bestenfalls die Aussage „es war Unrecht, aber durch den Vollzug ist es Recht geworden“. Und auf der Grundlage der rechtswidrig von der Mutter veranlassten Änderungen werden dann weitere Folgerungen gezogen, die dem Vater Schritt für Schritt mehr Rechte nehmen, ihm das Kind rechtswidrig immer weiter entziehen, ohne dass er sich dagegen wehren kann. Versucht er es, dann wird ihm vorgeworfen, er verlasse den gesetzlich vorgeschriebenen Pfad der einvernehmlichen Einigung, zerrütte damit das Verhältnis gegen das Wohl des Kindes noch mehr und das ist dann in der Verhandlung um das Sorgerecht zu seinem Nachteil.
Rechtswidriges Verhalten der Mutter wird akzeptiert, Wohlverhalten des Vaters dazu verlangt.
Vollendete Tatsachen zu schaffen ist für die Mutter von Vorteil. Rechtswidriges Verhalten des Vaters wird meisten sofort abgeblockt, wird rückgängig gemacht oder aber erst recht gegen ihn verwendet.
Vollendete Tatsachen zu schaffen ist dagegen für den Vater auf jeden Fall von Nachteil.
Der Vater des Kindes hat fast immer das Nachsehen ohne Rücksicht auf das Wohl des Kindes.
Es gibt das internationale Haager Abkommen, das die Rückführung eines in ein anderes Land entführten oder entzogenen Kindes regelt, das aber wohl Deutschland bisher nicht ratifiziert hat. Das führt zu dem kuriosen Verhalten, dass deutsche Gerichte zwar auf Grundlage dieses Abkommens die von anderen Ländern verlangte Rückführung von Kindern in diese Länder vollzieht, aber nicht die Rückführung von Kindern nach Deutschland beantragt oder vollzieht. So wird es auch innerhalb Deutschlands praktiziert. Zieht die Mutter mit dem Kind rechtswidrig gegen den Willen des Vaters in einen entfernten Ort oder ein anderes Bundesland, so wird das Kind nicht zurückgeführt in seine bisherige Umgebung. Die rechtswidrig vollzogene Tatsache führt sogar dazu, dass der neue Wohnort unverzüglich als der derzeit überwiegende Aufenthaltsort des Kindes von allen beteiligten Stellen anerkannt wird. Das dortige Jugendamt und das dortige Familiengericht halten sich für zuständig, die Vorgeschichte spielt keine Rolle mehr. Die beteiligten Stellen am bisherigen Wohnort des Kindes legen den Vorgang zu den Akten, sind nicht mehr ansprechbar.
Es wird in solchen Fällen außerdem im allgemeinen vom Familiengericht festgestellt, dass ein wechselnder Aufenthalt bei der großen Entfernung nicht zumutbar ist und daher das Kind zwar rechtswidrig aber endgültig seinen Aufenthalt bei der wegziehenden Mutter hat, ohne jede Rücksicht auf die Umstände.
Wenn jedoch der Vater mit dem Kind in einen entfernten Ort zieht, wird alles unternommen, das Kind zurückzuführen, und die Stellen am bisherigen Wohnort behalten ihre Zuständigkeit.
2. Tagebuch der Ehe und Familie vor der Trennung
Kindsvater und Kindsmutter leben seit einem knappen Jahr zusammen in der Wohnung des Kindsvaters in B. als sie im Februar 2009 heiraten. Die Eltern und der Bruder der Mutter reisen dazu aus Tschechien an.
Die Kindsmutter ist zu dem Zeitpunkt bereits schwanger, will aber eigentlich noch kein Kind, der Kindsvater will es unbedingt, freut sich riesig.
Die verschiedenen Einstellungen sind wohl auch dem Altersunterschied geschuldet. Beide haben allerdings vorher gegenüber den Eltern des Vaters mehrfach geäußert, dass sie es darauf ankommen lassen, ob sie Nachwuchs zeugen oder nicht.
Sechs Monate nach der Hochzeit wird dann der Sohn Moritz geboren. Es kommt zu Komplikationen, Moritz wird in ein anderes Krankenhaus auf die Frühchenstation verbracht. Nach zwei Wochen darf er heim. In diesen zwei Wochen hat sich keine besondere Beziehung zwischen Mutter und Kind aufgebaut, beide Elternteile sind auf Besuche am Glaskasten beschränkt.
Der Vater nimmt ein Jahr Elternzeit, die Mutter zwei Monate. Sie teilen sich die selbstständige Erwerbsarbeit und die Betreuung von Moritz. Der Vater arbeitet während des einen Jahrs Elternzeit nur entsprechend dem zulässigen Hinzuverdienst, übernimmt also überwiegend die Betreuung von Moritz. Dies ist problemlos möglich, weil Moritz nicht gestillt wird.
Wenn beide Elternteile arbeiten oder etwas vorhaben, dann übernehmen die Großeltern väterlicherseits die Betreuung von Moritz. Manchmal erfolgt dies stundenweise in der Wohnung der Familie, überwiegend aber im Haus der Großeltern. Es handelt sich dann meistens um tageweisen Aufenthalt mit Übernachtung. So hält sich Moritz ab Geburt bis zur Trennung der Eltern ein Drittel seiner Zeit bei den Großeltern väterlicherseits auf, der Großvater wird für ihn dabei zu einer besonders wichtigen Bezugsperson. Er übernimmt dann jeweils überwiegend die Betreuung des Enkels wie Wickeln, Füttern und Spielen.
Die Großeltern mütterlicherseits leben in Tschechien. Diese Großeltern kommen alle drei Monate für fünf Tage zur medizinischen Versorgung und zum Besuch von Verwandten nach Deutschland.
Zwei Drittel seiner Zeit ist Moritz also bei den Eltern, wird dabei überwiegend vom Vater versorgt. Der Aufenthaltswechsel erfolgt jeweils nach einem bis wenigen Tagen für einen bis wenige Tage.
Das kann etwa wie folgt im zeitlichen Durchschnitt abgebildet werden:
Aufenthalt: ein Drittel bei den Großeltern,
zwei Drittel bei den Eltern
Betreuung: ein Drittel durch die Großeltern,
zur Hälfte durch den Vater,
zu einem Sechstel durch die Mutter.
Der geringe Umfang der Betreuung durch die Mutter ergibt sich zunächst aus der Elternzeit des Vaters, aber auch danach liefert die Mutter Moritz stunden- oder tageweise bei den Großeltern ab. Der Vater hat Moritz immer um sich, wenn er daheim ist, bezieht die Großeltern dann nur stundenweise ein.
Als Moritz ein halbes Jahre alt ist gründen die Eltern eine gemeinsame Firma, die ihnen zu gleichen Teilen gehört und in der sie beide in gleichem Umfang arbeiten, sie arbeiten nicht mehr auf ihren persönlichen Gewerbescheinen. Die Mutter wird als Geschäftsführerin eingetragen.
Der Vater hat sein Studium nicht beendet, die Mutter hat eine Ausbildung als Dekorateurin. Beide arbeiten fachfremd, zunächst auf ihren Gewerbescheinen, dann in ihrer gemeinsamen Firma.
Nach anderthalb Jahren wird das Gebäude gekauft, in dem sich die gemietete Wohnung im ersten Stock befindet. Damit steht für die Firma der gewerbliche Bereich im Erdgeschoss zur Verfügung. Der Erwerb erfolgt durch die Großeltern, sie stellen das zu 100% finanzierte Haus dem Sohn zur Verfügung.
Kurz danach macht die dreiköpfige Familie Urlaub bei den Großeltern mütterlicherseits in Tschechien.
Der arbeitslose älterer Bruder der Mutter kommt mit nach Deutschland und wird in einem bewohnbaren Bereich im Kellergeschoss mit seinen beiden Hunden (Labrador-Mischlinge) einquartiert. Die beiden Hunde halten sich im gewerblichen Bereich im Erdgeschoss und Keller auf.
Der Bruder wird in der gemeinsamen Firma angestellt und nimmt auch zunächst häufiger an Arbeitsaufträgen teil. Unterkunft und Verpflegung soll er durch Übernahme der Renovierung der gerade erworbenen gewerblichen Räume im Haus abarbeiten.
Dem Großvater väterlicherseits, fällt seit längerem und zunehmend auf, dass die Mutter versucht mit Liebesentzug, Wegsperren und Schlägen auf Hände, Po und Kopf Moritz gefügig zu dressieren. Er äußert sich mehrfach besorgt gegenüber beiden Elternteilen, der Vater versichert ihm glaubhaft, dass er es nicht macht und auch nicht will. Die Eltern der Mutter gehen in ihren jeweils wenigen Tagen ihrer Anwesenheit genauso lieblos und streng mit Moritz um.
Die Mutter hat mehrfach erwähnt, dass sie als Kind sehr unter der strengen Erziehung ihrer Eltern mit Schlägen gelitten habe. Sie gibt es aber jetzt so weiter an ihr Kind.
Der Vater und der Großvater waren und sind dagegen beide zutiefst überzeugte Pazifisten und lehnen jede Form der Gewalt ab, insbesondere im häuslichen Bereich und in der Erziehung.
Wenn der Großvater Moritz heim bringt, aber nur die Mutter anwesend ist, wehrt sich Moritz mit Strampeln und Schreien gegen die Übergabe, will wieder mit Opa gehen. Es ist herzzerreißend.
Der Großvater lässt sich aber nicht „erweichen“, sucht eher eine „Schuld“ bei sich, weil der Kleine vielleicht zu sehr verwöhnt wird bei den Großeltern. Aber so soll und darf es doch sein.
Es erscheint ihm schon ungewöhnlich, dass sich ein anderthalb jähriges Kind jedes mal so vehement gegen die Rückkehr zur Mutter wehrt.
Sobald der Vater anwesend ist, erfolgt die Übergabe von Moritz ohne Probleme und Trennungsschmerz.
In der Ehe beginnt es zu kriseln. Die Mutter hockt meistens mit ihrem Bruder zusammen, geht immer weniger Arbeiten. Da der Vater zu der Zeit keinen Führerschein hat, fährt sie ihn meistens mit dem Firmenwagen zu seinen Arbeitseinsätzen.
Schließlich reduziert sich ihr Einsatz für die Firma allein auf das Fahren. Sie verkündet, sie habe keine Lust mehr zu arbeiten, werde sich stattdessen mehr um Moritz kümmern.
Letzteres macht sie allerdings nicht. Sie liefert Moritz sogar vermehrt bei den Großeltern ab und überlässt die Betreuung daheim komplett dem Vater. Auch die Büroarbeit muss er dabei nebenher erledigen. Sie lässt alles liegen, nimmt die Geschäftsführung der gemeinsamen Firma nicht mehr wahr.
Wenn sie einen Job annimmt, rechnet sie das auf Grundlage ihres Gewerbescheins über ihr persönliches Konto ab.
Gleichzeitig stellt sie immer höhere finanzielle Ansprüche (Kleidung, Friseur, Bruder, Hunde). Der Vater versucht gutgläubig trotz der sinkenden Einnahmen über die Firma, ihre Wünsche seinerseits durch vermehrte Arbeit zu erfüllen.
Dann gibt es einen gravierenden Vorfall. Der Großvater betreut in deren Wohnung Moritz, weil der Vater im Werkkeller arbeiten will, die Mutter sich aber nicht um Moritz kümmern will, sondern mit ihrem Bruder im benachbarten Wohnkeller rumhängt.
Als der Großvater wieder gehen will, wird er von der Mutter angesprochen und gebeten, sich mit Moritz nicht mehr im Keller aufzuhalten, denn das könnte gefährlich werden. Sie habe der läufigen Hündin ein Lieblingsspielzeug von Moritz überlassen als Ersatzwelpe, und das würde die Hündin nun mit Bissen verteidigen. Der Großvater ist fassungslos, der Vater hat davon bisher nichts gewusst, war also auch nicht gewarnt. Die Mutter nimmt also billigend in Kauf, dass der Hund Moritz angreift, wenn der sein Spielzeug will.
In den nächsten Tagen verweigert die Mutter, den Vater noch zu fahren, und versucht auch zu verbieten, dass der Vater sich vom Großvater, seinem Vater, fahren lässt. Sie fahren trotzdem zunächst mit dem Firmenwagen, stellen ihn dann aber weg, so dass die Mutter auch keinen privaten Zugriff mehr hat. Der Großvater fährt den Vater mit seinem Wagen zu den Arbeitseinsätzen.
Das Verhalten der Mutter in der Wohnung wird immer Messy mäßiger. Sie kauft Nahrungsmittel über Bedarf ein, die sich unausgepackt stapeln und schlecht werden, sie entsorgt keine Abfälle, wäscht und putzt nicht. Das notwendigste muss der Vater nach der Arbeit noch erledigen, sobald er Moritz versorgt und schlafen gelegt hat. Er erledigt also Haushalt, Kinderbetreuung, die Büroarbeiten und die Erwerbsarbeit allein.
Die Mutter und ihr Bruder werden immer wieder ausfällig bis handgreiflich bei jedem Versuch, sie anzusprechen. Der Bruder hält sich inzwischen tagsüber überwiegend in der Familienwohnung auf oder die Mutter geht mit ihm in seinen Wohnkeller. Im Streitgespräch äußern beide mehrfach, das hätte sich ja bald alles erledigt.
Die Mutter hat offensichtlich kein Interesse am Kind und seiner Entwicklung.
Auch wenn sie damit nur den Vater verletzen will, darf sie nicht so mit dem Kind umgehen, es so auf dem Rücken des Kindes austragen.
Der Großvater überlegt, zum Jugendamt zu gehen, weil die Mutter Moritz häufig schlägt und mit Liebesentzug bestraft und wegen des unglaublichen Vorfalls mit den Hunden. Für ihn ist das Maß voll. Er will das aber nur mit Zustimmung des Vaters machen. Er bittet seinen Sohn, den Vater von Moritz, er solle es sich bis nächsten Montag überlegen, ob das Jugendamt unterrichtet werden soll.
Auf die Vorwürfe seiner Mutter, der Großmutter von Moritz, sich mit dieser Frau eingelassen zu haben, antwortet der Vater mit Blick auf Moritz: „Die Verbindung mit dieser Frau hat sich allein wegen dieses goldigen Kerls gelohnt“, und strahlt.
An diesem Mittwoch meldet der Vater einen Kita-Platz für Moritz an, die Mutter hat unterschrieben.
Am Donnerstag gehen Vater und Großvater vorbeugend zur Beratung durch eine Anwältin wegen der Äußerungen „das hat sich ja bald erledigt“. Sie vermuten eine bevorstehende Trennung und befürchten auch eine eventuelle Ausreise nach Tschechien.
Der Großvater will den Vater am Freitag zur Arbeit fahren, da meint die Mutter schnippisch, sie habe seinen Arbeitstermin für heute abgesagt, da sie keine Zeit und Lust habe, ihn zu fahren und auch nicht will, dass sein Vater ihn fahre!
Seinen Auftrag ohne Rücksprache abzusagen, ist ja wohl Firmen schädigend, eine Umsatz- und Einkommensverhinderung. Der Vater ist außer sich. Er verlangt, dass sie als Geschäftsführerin ihrem Bruder sofort die Kündigung ausspricht, weil er sowieso nicht mehr mitarbeitet und außerdem habe er die privaten Gegenleistungen nicht erbracht. Sie sagt die Ausführung der Kündigung zu. Auch wegen der Gefährdung von Moritz durch die Hunde fordert der Vater, dass ihr Bruder mit den Hunden am Montag ausgezogen sein muss.
3. Trennung erster Teil
Im folgenden wird in zeitlicher Abfolge dargestellt, wie sich die Trennung der Eltern gestaltet und insbesondere auf das Kind auswirkt, um in erster Linie dadurch herauszustellen, wie das Wohl des Kindes missachtet wird. Andere Auswirkungen der Trennung werden nur sporadisch nebenher erwähnt.
Der Großvater fährt am Samstag den Vater zur Bahn, der arbeitet drei Tage in Frankfurt.
Sie hoffen, dass die Mutter, ihr Bruder und Moritz in der Zeit nicht nach Tschechien verschwinden. Sie haben beide Angst, dass Moritz ins Ausland „entführt“ werden könnte.
Erste Woche
Nach seiner Rückkehr aus Frankfurt am Montag Abend kommt dann ein telefonischer Hilferuf vom Vater an den Großvater.
Die Mutter ist offenbar mit Moritz, ihrem Bruder, den Hunden, ihren zwei Katzen und Sack und Pack ausgezogen, unbekannt verzogen. Sie hat keinen Hinweis hinterlassen.
Sie hinterlässt also auch keine Begründung, warum sie bei Nacht und Nebel ausgezogen ist, ohne Vorankündigung oder Absprache, und warum sie Moritz mitgenommen hat, der bisher überwiegend von seinem Vater betreut und versorgt worden ist. Sie hat alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest ist. Es sind kaum noch Haushaltsgegenstände da und nichts an Kinderkleidung, Spielsachen und Kindergeschirr.
Moritz hatte außerdem eine Bindehautentzündung, starke Erkältung und hohes Fieber. Sie ist also mit dem kranken Kind ausgezogen ohne neuen festen Wohnsitz, hat nur irgendwo Unterschlupf.
Die Mutter hat außerdem das Firmenkonto geplündert, die für die Zahlung der fälligen Steuerschuld auf dem Konto stehenden 4000 € hat sie abgehoben, das Privatkonto ist auch fast leer.
Der Großvater schickt eine Mail an die Eltern der Mutter, ob sie von der Aktion und dem jetzigen Aufenthalt wüssten. Es kommt knapp und kalt zurück, das sei alles Schuld seines Sohnes, des Vaters von Moritz.
Da der Vater am Dienstag arbeitet, versucht der Großvater vorbeugend für ihn, die Sachlage zu klären.
Die alarmierte Anwältin rät zu Kontakt mit Jugendamt und Polizei.
Die für den Straßenzug zuständige Jugendamtmitarbeiterin und die Polizei werten es positiv, dass die Mutter alle Sachen von Moritz mitgenommen hat „ist er also gut versorgt!“ und sagen einhellig „bei der Mutter ist das Kind doch gut aufgehoben“.
Die Jugendamtmitarbeiterin macht dem Großvater im Telefonat keinerlei Zusagen, etwas zu tun. Er hat den Eindruck, dass sie die Mutter kennt und schon mehrfach mit ihr gesprochen hat. Warum hat sie dann keinen Kontakt mit dem Vater gesucht, um beide Seiten zu hören?
Offensichtlich ist die Mutter mit Wissen und Unterstützung des Jugendamtes rechtswidrig mit dem Kind weggezogen.
Die Kripo sieht keinen Handlungsbedarf, auch nicht wegen des veruntreuten Firmengeldes oder des unbekannten Aufenthalts von Moritz. Die Schilderung des Großvaters wird zwar aufgenommen, um es an den zuständigen Kollegen weiterzugeben. Nur der Ehemann und Kindsvater kann Anzeige erstatten. Den Kripobeamten interessiert die vermutete mögliche Gefährdung des Kindes (Ersatzwelpe, Schläge, Liebesentzug und Ablehnung) nicht, „das sagen alle so ähnlich“. Die Firmengelderveruntreuung sei rein zivilrechtlich zu klären, das sei keine polizeiliche Aufgabe!
Kindesentzug läge nicht vor, die Polizei wird deshalb auch nichts unternehmen, um den Aufenthalt von Moritz festzustellen.
Es gibt also Paragrafen im StGB und BGB, bei denen die Polizei nicht tätig wird, die nicht angezeigt werden können und/oder nicht verfolgt werden. Wozu gibt es dann diese Paragrafen?
Der Vater bekommt per SMS und dann auch am Telefon Kontakt mit der Mutter. Sie weigert sich, ihren Aufenthalt, die Umgebung von Moritz offenzulegen und sie lehnt den Umgang von Moritz mit dem Vater ab, was klar ein Verstoß gegen das gemeinsame Sorgerecht ist.
Am nächsten Tag, Mittwoch, rät die Anwältin entgegen vorher wieder davon ab, Anzeigen zu stellen.
Die Mutter sagt Stunden weisen Umgang des Vaters mit Moritz zu, morgen Nachmittag, lehnt aber eine Übernachtung von Moritz beim Vater kategorisch ab.
Die Schwester des Vaters fordert von der Mutter die von ihr mitgenommenen eigentlich ihrem Bruder, dem Vater von Moritz, ausgeliehenen Kindersachen zurück.
Der Großvater begleitet den Vater Donnerstag um 15:30 zur Bahn. Die Mutter und ihr Bruder übergeben ihnen Moritz für vier Stunden.
Die Mutter verkündet stolz, das Jugendamt B. sei nach Vorankündigung bei ihr gewesen und habe alles als bestens empfunden. Ihr Bruder und die Hunde waren nicht anwesend. Für Vater und Großvater stellt sich die Frage, was die Jugendamtmitarbeiterin eigentlich mit zwei Tagen Vorankündigung ohne festen Wohnsitz prüfen wollte. Woher weiß sie, dass es die neue Wohnung der Mutter oder nicht die einer Freundin ist, ob es das Zimmer und die Spielsachen von Moritz waren? Woher weiß sie, ob die beiden mit dem Bruder und den Hunden oder nicht oder mit wem sonst zusammenleben?
Vater und Großvater verbringen die Zeit mit Moritz abwechselnd beim Vater und bei den Großeltern. Der Großvater bringt Moritz dann wieder zur Mutter an der Bahnstation.
Der Großvater erbittet Aufenthalt von Moritz bei den Großeltern von Samstag früh bis Montag Abend, um seinen Umgangsanspruch mit den Großeltern wahrzunehmen. Die Mutter sagt es zu! Ihr Bruder beschimpft den Großvater.
Am nächsten Morgen, Freitag, auf der gemeinsamen Fahrt zum Arbeitsplatz des Vaters, ruft die Jugendamtsmitarbeiterin diesen an. Der Großvater bekommt das lange Gespräch indirekt mit, der Vater ist sehr ruhig und gefasst. Das Jugendamt lässt den Vater mit allen seinen Anliegen und Fragen abblitzen, lehnt ein persönliches Gespräch mit ihm ab, will nur ein gemeinsames Gespräch der Eltern moderieren. Der Vater ist einverstanden. Die Mutter ist offenbar schon länger mit der Mitarbeiterin im Kontakt, Einzelgespräche mit ihr wurden offenbar nicht abgelehnt. Die Jugendamtmitarbeiterin scheint nur Handlungsbedarf gegen den Vater zu erkennen.
Am nächsten Tag, Samstag, nimmt der Großvater um 10 Uhr an der Bahn Moritz in Empfang. Der Bruder der Mutter beschimpft den Großvater. Obwohl für die nächsten zwei Tage über 30 Grad angesagt sind, hat Moritz keine leichte Kleidung und keine Schirmmütze gegen die Sonne dabei, sondern nur einen dicken Fleece-Anzug mit Kapuze. Der Großvater verbringt mit Moritz den Tag abwechselnd bei den Großeltern und bei seinem Vater. Sie handwerkeln zusammen im Laden, zu den Mahlzeiten fahren sie zu den Großeltern.
Zweite Woche
Am Sonntag und Montag wird die Zeit mit Moritz abwechselnd beim Vater und bei den Großeltern verbracht.
Die Mutter bringt weitere ausgeliehene Sachen direkt zur Schwester des Vaters zurück.
Es trifft ein Brief an den Vater von der Anwältin der Mutter ein, sie verlangt summarisch 800 € Unterhalt im Monat und Auskunft über das Einkommen des Vaters. Dieses Standardverlangen ist unhaltbar im vorliegenden Fall, denn beide hatten vereinbart, gemeinsam Moritz zu betreuen und in gleichem Maß in der gemeinsamen Firma Erwerbseinkommen zu erarbeiten. Insofern müssten beide gegenseitig ihr Einkommen offenlegen, wobei die Mutter als Geschäftsführerin der Firma alle Unterlagen hat und daher für beide umfassender Auskunft geben können muss als der Vater für sich.
Der Großvater bringt Moritz um 17:30 zurück zur Mutter an der Bahn, sie ist heute allein da.
Der Frage nach einem neuen Termin weicht sie aus, es sei demnächst schlecht, sie habe einiges vor, wo sie Moritz dabei haben müsse. Sie sagt „müsse“, nicht „wolle“. Wegen des gemeinsamen Sorgerechts kann es solche Termine eigentlich nicht geben, mindestens müsste der Vater darüber zeitlich und inhaltlich informiert werden. Das Verhalten der Mutter erscheint rechtswidrig.
Telefonisch versucht der Großvater am Donnerstag, ihre Zustimmung für Moritz Aufenthalt bei seinen Großeltern für drei Tage ab Montag zu bekommen.
Überraschend und unbegründet verweigert sie plötzlich jeden Umgang von Moritz mit den Großeltern, die sollen das gerichtlich klären lassen, Großeltern hätten keinen Anspruch auf Umgang. Stimmt so zwar, aber Moritz hat Anspruch auf Aufenthalt bei seinen Großeltern.
Sie beschuldigt den Großvater des Rufmords und der Verleumdung wegen seiner Mail an ihre Eltern und den darin verwendeten Begriffen „Entführung und Unterschlagung“. Innerhalb der Familie kann man aber seiner Meinung nach wohl nicht von Rufmord und Verleumdung reden.
Sie lehnt eine zwischen ihr und dem Vater wechselnde Betreuung unter Einbeziehung der Großeltern ab.
Sie geht nicht darauf ein, dass auch auf Termine des Vaters Rücksicht zu nehmen wäre, die Aufteilung der Betreuung einvernehmlich erfolgen müsse, sie nicht nur von ihren Bedürfnissen ausgehen darf.
Sie ergänzt ihre Sichtweise damit, dass außerdem Moritz bei ihrer Wohnungssuche jetzt immer dabei sein solle, bis Montag einschließlich geht es daher gar nicht. Vielleicht am Dienstag, aber dann nur tagsüber ohne Übernachtung.
Nach ihrem Umzug käme er sowieso in den Kindergarten, da müsse er ja dann jeden Tag hin, dann könne er sowieso nicht mehr nach B. kommen!
Mit ihren Argumenten bestätigt sie also, dass sie noch keinen festen Wohnsitz hat, sondern mit Moritz nur irgendwo Unterschlupf gefunden hat. Es ist wirklich ein ungeheures Ansinnen von ihr, dass der Vater des Kindes das alles so hinnehmen soll. Der Großvater ruft bei der Jugendamtmitarbeiterin in B. an. Sie wimmelt ihn ab damit, dass sie sowieso nichts tun könne für die Großeltern. Einseitige durch die Mutter vollendete Tatsachen kann sie nicht ändern, das können nur die Eltern einvernehmlich oder das Familiengericht.
Für den Versuch zum Einvernehmen bietet sie wieder ein gemeinsames Gespräch mit den Eltern an. Da sich aber die Mutter bisher weigert teilzunehmen, ist es ein leeres Angebot.
Sie beendet das Gespräch mit dem Hinweis, dass sie dem Großvater persönlich die Formulierung übel nimmt, dass sie ihn bei der Polizei ins offene Messer hätte laufen lassen, weil sie ihn nicht benachrichtigt hat, dass sie den Aufenthalt der Mutter kennt.
Sie hätte nichts sagen dürfen wegen der Schweigepflicht.
Der Großvater hält ihr entgegen, dass sie reine Tatsachen hätte sagen können und müssen, wenn auch nicht die Inhalte von Gesprächen. Also hätte sie darauf hinweisen können und müssen, dass sie mit der Mutter bereits mehrmals allein gesprochen hat, aber natürlich nicht was, dass sie den Aufenthalt der Mutter kennt, aber nicht ihre Anschrift weitergeben kann und muss.
Ein anderes Verhalten ihnen gegenüber hätte Vater und Großvater bezüglich des Verbleibs von Moritz viele Sorgen erspart und nach deren Ansicht hätten mindestens der Vater, aber auch die Großeltern, als bisher wichtige Bezugspersonen von Moritz, das erwarten können.
Trotz ihrer Schweigepflicht gesteht sie dann mehr oder weniger zu: es gibt nur den Hinweis auf eine Gefährdung des Kindes bei der Mutter. Das habe sie geprüft und keine Auffälligkeiten oder Gefährdungen festgestellt.
Es gibt keine entsprechenden Hinweise der Gegenseite gegen den Vater, deshalb müsse sie seine Umgebung (die bisherige gewohnte Umgebung von Moritz) nicht prüfen oder vergleichen.
Das Jugendamt dürfe nicht auf besser/schlechter, sondern dürfe nur auf gravierend unzumutbar prüfen.
Sie geht nicht darauf ein, dass die Mutter zur Zeit keinen festen Wohnsitz hat, sie dort also eigentlich gar nichts prüfen kann. Der Großvater ruft die Anwältin des Vaters an wegen seiner Sorgen.
Die Mutter sagt dem Vater am Telefon zu, dass er Moritz von morgen Abend, Freitag, bis Samstag Abend über Nacht haben darf!
So sehr sich Vater und Großvater freuen, so sehr sind sie bestürzt, dass die Mutter das Aufenthaltsbestimmungsrecht unbehelligt einseitig allein für sich in Anspruch nimmt, obwohl volles gemeinsames Sorgerecht besteht und bisher der Vater überwiegend die Betreuung übernommen hatte, ergänzt durch die Großeltern.
Sie sehen auch dieses Verhalten der Mutter als rechtswidrig, finden aber niemanden, ob Jugendamt, Anwälte oder Polizei, die gewillt sind, dem Kind oder ihnen bei der Durchsetzung seiner und ihrer Rechte zu unterstützen.
Da der Vater am Freitag noch auf der Heimfahrt von der Arbeit unterwegs ist (Stau), holt der Großvater um 17 Uhr Moritz an der Bahn von der Mutter ab. Sie ist trotz der pünktlichen Bahn wie üblich verspätet und übergibt Moritz um17:20. Der Großvater fährt Moritz und seinen Vater zu einem kleinen Fest.
Die Mutter hat keine Mütze und keine Gummistiefel mitgebracht, dafür um viele Nummern zu große Hausschlappen, völlig ungeeignet für so ein kleines Kind.
Der Vater hat bei sich keine Sachen mehr für den Kleinen, weder Kleidung noch Fläschchen, oder, oder…, die Mutter hat beim Auszug alles mitgenommen und bringt auch jeweils keine Ausstattung für den Kleinen mit bei der Übergabe.
Die Rechtslage ist eigentlich so, dass der ausziehende Elternteil alle damit verbundenen Kosten (Neubeschaffungen) übernehmen muss, nicht der verlassene.
Die Großeltern geben dem Vater einige Kleinkindersachen aus ihren Vorräten.
Der Großvater fährt Moritz und seinen Vater zur Einschulung seines Patenkindes und holt die beiden nachmittags wieder ab.
Die Mutter kommt (von dem gemeinsamen Freund Hans gefahren) zum Vater. Sie wirkt wie eine lieblose, abweisende Übermutter, Lügen über Lügen und Fehlverhalten. Es kommt zum Streit zwischen Vater und Mutter wegen Umgang (sie will nur tagsüber ohne Übernachtung zugestehen), sie spricht dem Großvater den Umgang ganz ab, er solle sich nicht mehr einmischen.
Dabei übersieht sie völlig, dass es nicht um den Umgang mit dem Kleinen geht, sondern um Aufenthalt des Kleinen seinetwegen.
Sie kündigt an, Montag die gemeinsame Firma auflösen zu lassen (was sie bei der Rechtsform eigentlich nicht kann), sie will die Post an die Geschäftsführung zunächst nicht entgegen nehmen. Sie hätte keine Firmenunterlagen, es gäbe nur den Ordner beim Steuerberater. Wahrscheinlich hofft sie, dass mit Auflösung der Firma die Mitnahme der 4000€ erledigt ist.
Ihr Vorhaben würde auf jeden Fall die Firma und die Einkommenssituation stark beeinträchtigen, das widerspricht ihrer Forderung nach Unterhalt und richtet sich auch gegen das Wohl des Kindes.
Dritte Woche
Am Montag begleitet der Großvater den Vater zur Anwältin, er erteilt Auftrag wegen Aufenthaltsrecht und Unterhaltspflicht. Das Umgangsrecht der Großeltern müsste durch einen anderen Anwalt vertreten werden, weil es Interessenkonflikte geben könne. Darüber sind Vater und Großvater sehr enttäuscht, denn nach ihrer Meinung kann man die gemeinsame Betreuung durch Vater und Großeltern nicht trennen. Denn der Großvater ist dadurch eine wichtige Bezugsperson geworden und der eigentliche Aufenthaltsort B. umfassend begründbar.
Ohne Not wird eine wichtige rechtliche Position damit von der Anwältin aufgegeben.
Die Anwältin weist in ihrem Schreiben an die Gegenseite den Anspruch auf Unterhalt zurück wegen hälftiger Betreuung und Erwerbsarbeit, sie verlangt im Gegenzug Einkommensnachweise von der Mutter.
Sie meldet bei der Gegenseite Anspruch auf das Aufenthaltsbestimmungsrecht an.
Am nächsten Tag, Dienstag, übergibt die Mutter dem Vater und Großvater um 9:15 Uhr Moritz. Sie wird von einem unbekannten Mann begleitet (der Vater vermutet einen Tschechen aus einer ihm bekannten Arbeiter – WG, mit denen hatte der Bruder der Mutter viel Kontakt).
Moritz hat trotz 5 Grad Außentemperatur keine Mütze auf.
Die Mutter holt Moritz um 18:30 Uhr beim Vater wieder ab. Hans fährt sie, derselbe Mann von heute Morgen ist auch dabei. Hans bestätigt dem Vater: es ist ein Tscheche aus der WG, wo die Mutter mit Moritz derzeit Unterschlupf gefunden habe. Das ist eine überraschende Bestätigung der Vermutung. Moritz hat also ein Umfeld nur mit tschechisches Männern (mit Konsum von Alkohol und Drogen dort).
Eigentlich sollte man dem Jugendamt einen Hinweis geben, aber die können es wegen Voranmeldung ja nicht wirklich prüfen, außerdem ist die Mutter dort nicht gemeldet.
Der Notar teilt dem Vater mit, dass er das Ansinnen der Mutter, die Firma aufzulösen, abgewiesen hat. Sie könne als Geschäftsführerin zurücktreten oder die Firma als Miteigentümer verlassen, aber sie könne sie nicht ohne Zustimmung der Miteigentümer auflösen.
Die Mutter (allein) übergibt dem Vater und dem Großvater am Mittwoch um 9:00 Uhr an der Bahn Moritz. Moritz hat trotz einer Außentemperatur von nur 5 Grad wieder keine Mütze auf.
Die Mutter sagt zu, bald auf den Zugriff auf das persönliches Girokonto des Vaters zu verzichten, sie benutzt angeblich inzwischen nur ihr eigenes Konto.
Moritz ist abwechselnd bei den Großeltern und seinem Vater, übernachtet bei den Großeltern.
Am Donnerstag um 18 Uhr bringen Vater und Großvater Moritz zu seiner Mutter an der Bahn. Sie bekommen ihre Zusage für Samstag Vormittag. Die Mutter und der Vater streiten um Geld, akut die Heizungskosten über 2700 €. Die Mutter will dazu nichts beitragen, obwohl sie ja dort im Abrechnungszeitraum auch gewohnt und Einkommen erworben hat.
Sie habe leider gerade keine Zeit, ihr Zugriffsrecht auf das private Girokonto des Vaters zu löschen.
Am Samstag holen Großvater und Vater um 9:30 an der Bahn Moritz von der Mutter (allein) ab. Sie unterschreibt den vom Vater mitgebrachten schriftlichen Löschungsantrag ihrer Vollmacht auf das private Girokonto des Vaters.
Moritz ist wechselnd bei den Großeltern und seinem Vater. Vater und Großvater begegnen der Mutter im Einkaufszentrum. Hat sie dort einen Job, Moritz also heute nur aus Eigennutz gebracht?
Vater und Großvater bringen Moritz 19:15 an der Bahn zu seiner Mutter zurück. Wieder Streit zwischen Vater und Mutter um Geld, „mein Geld, unser Geld, 4000 Entnahme, 500 für Auto-Inspektion, Telefonrechnungen der Mutter, Heizungskosten“.
Vierte Woche
Am Dienstag bringt die Mutter mittags Moritz zum Vater (allein mit einem Auto). Sie bekommt angeblich die Wohnung von Hans.
Der Vater soll die Kündigung für ihren Bruder schreiben, obwohl es ihre Aufgabe als Geschäftsführerin wäre. Sie wird es unterschreiben. Moritz schläft beim Vater.
Am nächsten Tag ist Moritz abwechselnd beim Vater und bei den Großeltern, er schläft anschließend bei denen.
Der Vater ist dann bis Samstag arbeiten. Moritz schläft wieder bei seinen Großeltern. Am Samstag ist er bei seinem Vater. Moritz und seine beiden Cousinen übernachten bei den Großeltern.
Moritz wird am Sonntag um 15:15 von der Mutter (mit Auto und Hans) abgeholt. Moritz will nicht mit, schreit herzzerreißend und klammert am Großvater.
Fünfte Woche
Die Mutter bringt Moritz am Dienstag um 18:30 zu den Großeltern, kündigt die Abholung für morgen statt übermorgen an. Der Großvater ist nicht einverstanden. Sie fährt dann zum Vater, um Rechnungs- und Kontounterlagen zu kopieren.
Sie kündigt ihm an, dass Moritz doch nicht in drei Wochen für vier Tage wie mal zugesagt zu ihnen kommt, weil dann ihre Eltern da sein werden und ihn betreuen.
Moritz übernachtet bei den Großeltern, der Vater arbeitet. Mittags verabredet der Großvater mit der Mutter die Abholung von Moritz für 14:30. Später ruft die Mutter an, ob Moritz bis morgen 19:30 bleiben kann. Moritz übernachtet bei den Großeltern.
Moritz fühlt sich pudelwohl. Seine Mutter holt ihn nicht 19:30 ab, sondern ändert um 19:45 den Termin auf 20:30.
Moritz ist dann wieder nicht begeistert, mit ihr mitgehen zu müssen. Sie werden gefahren in einem unbekannten Auto, der Fahrer ist nicht zu erkennen.
Der Vater ist besorgt wegen des unklaren Umgangs, der unklaren Umgebung von Moritz.
Der Großvater schreibt zur Trennung der Eltern und der Rolle des Jugendamtes eine Mail an den DKSB (Deutscher Kinderschutzbund).
Sechste Woche
Montag ist Moritz bis Mittag bei seinem Vater, er übernachtet dann bei den Großeltern.
Moritz ist am nächsten Tag wechselnd bei seinem Vater und den Großeltern, er übernachtet bei seinem Vater.
DKSB in B. meldet sich beim Großvater, kündigt den Anruf einer Sozialpädagogin an.
Am Mittwoch ist Moritz wieder wechselnd bei den Großeltern und seinem Vater. Seine Mutter holt ihn dort (mit Hans) um 19 Uhr ab. Auf Wunsch des Großvaters, Moritz bereits in der Woche vor der Ankunft ihrer Eltern zu bekommen, schickt sie eine SMS „möchtet ihr Franz jetzt von Freitag bis Samstag haben?“.!!! Franz!!! sein vierter Vorname, nicht sein Rufname!
Nennt sie ihn jetzt etwa so? Was soll das? Moritz tut dem Großvater sehr leid. Will sie sich ohne Rücksicht auf das Kind vom Vater und den väterlichen Großeltern abgrenzen?
Die Mutter (mit Hans) bringt Moritz wie vereinbart freitags kurz nach 18 Uhr. Moritz übernachtet bei den Großeltern.
Samstag spielt der Vater mit Moritz und dessen Cousinen bei den Großeltern.
Um 18:45 holt die Mutter (mit Hans) Moritz ab, er klammert an Vater und Großvater und schreit herzzerreißend wie immer. Er tut dem Großvater so unendlich leid und der kann nichts tun. Es tut so weh, ihn so der Mutter übergeben zu müssen.
Die Situation mit dem ständigem Wechsel jeweils nach einem oder wenigen Tagen ist sehr zerrissen für das Kind, sicher eine Belastung. Und es entspricht für Moritz ganz und gar nicht seinem bisher gewohnten Umgang überwiegend mit Vater und Großeltern.
Siebte Woche