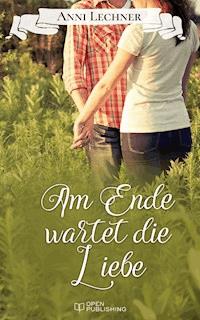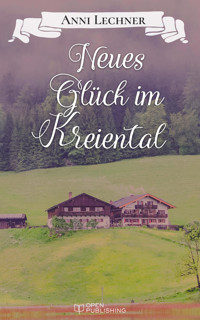
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Erich Fromm
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In den Bergen will Christine ihre Gedanken ordnen und neue Kraft finden. Das ist nötig, denn ihr Verlobter hat sie kurz vor der Hochzeit verlassen und auch beruflich läuft es bei ihr nicht wie erhofft. Ihre Tante Daniela hat ebenfalls Probleme, denn ihr kleiner Laden steckt in Schwierigkeiten und die Hilfe von Christine kommt zur richtigen Zeit. Christine findet Gefallen an ihrer neuen Aufgabe und der Aufenthalt, der eigentlich nur vorübergehend sein sollte, wird immer länger. Die Begegnung mit einem alten Jugendfreund macht ihr Leben vollkommen. Doch es gibt jemanden, der ihr dieses Glück nicht gönnt…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Anni Lechner
Neues Glück im Kreiental
Roman
Anni Lechner: Neues Glück im Kreiental
Copyright © by Anni Lechner
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Verlagsagentur Lianne Kolf.
Überarbeitete Neuausgabe © 2017 by Open Publishing Verlag
Covergestaltung: Open Publishing GmbH – Mathias Beeh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
eBook-Produktion: Datagroup int. SRL, Timisoara
ISBN 978-3-95912-240-5
Die Autorin
Anni Lechner wurde auf einem Bauernhof geboren und blieb der Landwirtschaft bis zu ihrem dreißigsten Lebensjahr treu. Acht Jahre lang bewirtschaftete sie den heimatlichen Hof, bis sie sich beruflich anders entschied und nach München zog. 1995 fing sie an, Geschichten aus dem bäuerlichen Umfeld zu schreiben und veröffentliche bis zum Jahr 2015 über 90 Heimat- und Bergromane. Sie ist dem bäuerlichen Umfeld noch immer verbunden und besucht regelmäßig ihre Schwester und deren Tochter, die mit ihrem Ehemann zusammen ihren früheren Hof bewirtschaftet.
Ein Hilferuf
1
Christine starrte auf die Ringe im Schaufenster und spürte einen bitteren Geschmack im Mund. Zwei Wochen war es jetzt her, dass Jens und sie dieses eine Paar aus Rotgold mit den kleinen Diamanten als Verlobungsringe ausgesucht hatten. Damals hatte sie sich riesig gefreut und geglaubt, bei ihrem Freund wäre es ebenso. Dabei musste Jens zu dem Zeitpunkt schon die Entscheidung getroffen haben, ohne sie ins Ausland zu gehen. Während ihr Blick sich an den beiden Ringen festsaugte, fragte sie sich, weshalb sie nichts bemerkt hatte. War sie denn wirklich so begriffsstutzig gewesen, wie Jens ihr gestern bei seinem Abschied wütend ins Gesicht geschleudert hatte? Vielleicht hatte sie wirklich zu sehr auf Verlobung, Heirat und Kinder gedrängt und nicht erkannt, dass Jens bei dieser Vorstellung Fluchtgedanken bekam.
Er hätte mir auch anders beibringen können, dass es mit uns nichts wird, dachte sie.
Christine seufzte, begriff aber gleichzeitig, dass die Wunde in ihrem Herzen nicht so sehr schmerzte und der Zorn über Jens’ feiges Verhalten überwog. Anstatt ihr klipp und klar zu sagen: So geht es nicht, hatte er hinter ihrem Rücken seinen Jobwechsel ins Ausland geplant und sie erst an dem Tag damit konfrontiert, an dem er abreisen musste.
Mit einer energischen Bewegung wandte sie dem Schaufenster des Juwelierladens den Rücken zu.
»Aus und vorbei. Der Teufel soll Jens holen und alle anderen Männer dazu!« Christine erschreckte damit einen jungen Mann, der gerade an ihr vorbeihastete, sich kurz umdrehte und verwundert den Kopf schüttelte.
Weshalb ein so hübsches Mädchen auf die Männerwelt sauer war, konnte er nicht verstehen. Gut einsfünfundsiebzig groß, schlank, aber mit guten Formen, einem hübschen, frischen Gesicht und strahlend blauen Augen sowie langem, seidigem Blondhaar – damit entsprach sie genau seinen Vorstellungen. Er überlegte, ob er sie ansprechen sollte, um ihr zu zeigen, dass es Männer gab, die eine Erscheinung wie die ihre durchaus zu schätzen wussten. Doch als er auf sie zuging, eilte Christine bereits mit raschen Schritten davon, ohne ihn zu beachten. Ein wenig zögerte er noch, dann setzte er seinen Weg fort. Schließlich gab es genug hübsche Mädchen auf der Welt, und es war gewiss lustiger, mit einem zu flirten, das nicht so schlechter Laune war wie dieser Blondschopf.
Der Anblick eines Reisebüros erinnerte Christine an eine weitere Gemeinheit ihres Verflossenen. In vierzehn Tagen begann ihr Urlaub, und sie hatte sich extra fünf Wochen freigenommen, um Jens’ großen Traum erfüllen zu helfen: die USA mit dem Wohnmobil von Küste zu Küste zu durchqueren. Jens wollte buchen, hatte es aber natürlich nicht getan.
Was mache ich bloß mit fünf Wochen Urlaub?, dachte Christine wütend und trat in das Reisebüro ein. Eine noch recht junge Angestellte saß hinter dem Schreibtisch und surfte so gebannt im Internet, dass sie die neue Kundin zuerst gar nicht beachtete.
»Einen Moment noch«, sagte sie schließlich. »Gleich ist meine Auktion bei Ebay vorbei und ich weiß, ob ich die Handtasche bekommen habe. Es ist nämlich eine ganz besondere, wissen Sie.«
Da gerade jemand ihr Gebot übertraf, hackte sie rasch in die Tasten, schaffte es aber nicht mehr, die Höchstbietende zu werden und schob schließlich die Computertastatur mit einem enttäuschten Ausruf zurück.
»Die Leute sind ja nicht ganz dicht, für das alte Gelumpe so viel zu bieten. So, was kann ich für Sie tun?«
Freundlich hört sich anders an, dachte Christine.
Daher bat sie nur um ein paar Prospekte, die sie zu Hause ansehen wollte, und verließ das Reisebüro wieder.
In dem Haus, in dem sie wohnte, sah sie zunächst in den Briefkasten. Das, was sie insgeheim erhofft hatte, lag nicht darin, nämlich ein Brief von Jens, in dem er erklärte, dass es nicht das endgültige Aus sein müsste und er in einem Jahr wieder nach Deutschland zurückkommen würde.
»Will ich ihn überhaupt wieder zurückhaben?« Die eigene Stimme hörte sich für Christine fremd und hart an.
Die Frage war jedoch berechtigt, denn Jens hatte sie nach Strich und Faden belogen. Das Vertrauen war zerstört und würde wohl nicht wiederkommen. Mit diesem Gedanken wollte sie gerade die Treppe hochsteigen, als sich eine Tür öffnete und eine ältere Frau den Kopf herausstreckte.
»Ich habe mir doch gedacht, dass ich Sie gehört habe, Fräulein Berger. Der Postbote hat einen Brief falsch eingeworfen. Ich habe erst gemerkt, dass er Ihnen gehört, als ich ihn gelesen hatte. Da ist er.« Mit diesen Worten steckte sie Christine ein arg zerfetztes Kuvert und mehrere handbeschriebene Blätter zu.
»Es geht um Ihre Tante. Sie hat Probleme«, setzte sie hinzu.
Christine verzog den Mund. Fremde Probleme waren das, was ihr gerade noch abging. Sie bedankte sich bei der Nachbarin und schüttelte innerlich den Kopf über die neugierige Frau, die den Brief wirklich nicht hätte lesen müssen. Immerhin stand auf den Resten des Umschlags deutlich Christines Name.
Während sie die Treppe hochstieg, begann sie den Brief zu überfliegen. Er stammte von der Schwester ihrer Mutter, die im tiefsten Oberbayern in einem Örtchen namens Kreiental lebte, von dem aus man nach Tirol hinüberspucken hätte können, wären nicht die Berge dazwischen gewesen. Der Tante ging es anscheinend wirklich nicht gut, denn die Schrift schwankte stark, oft waren halbe Sätze durchgestrichen und andere dafür in Anführungszeichen gesetzt worden.
Erst als Christine in ihrer Wohnung saß und eine Tasse rasch aufgebrühten Kaffees trank, wurde ihr etwas klarer, welche Sorgen Daniela Mergentheim plagten.
Die Frau besaß in Kreiental einen Tante-Emma-Laden, den sie mit ihrem Mann zusammen aufgebaut hatte und seit dessen Tod allein weiterführte. Wie es aussah, gingen die Geschäfte jedoch recht schlecht, denn sie beklagte sich in dem Brief über die ausbleibende Kundschaft. Im nächstgrößeren Nachbarort, Holzmatting, war nämlich ein Supermarkt eröffnet worden, der ihr den größten Teil ihrer Kunden abgenommen hatte. Der letzte Satz des Briefes bestand aus dem Bekenntnis, dass die Tante nicht mehr aus noch ein wüsste und daher Christine bat, zu ihr zu kommen und ihr zu helfen.
»Soll ich mich vielleicht vor den Supermarkt stellen, die Kunden mit dem Lasso einfangen und zu ihr schleppen?« Christine warf den Brief ärgerlich auf den Tisch und ging in die kleine Kochnische ihres Appartements, um das Abendessen zu machen.
Den Rest des Abends wechselten Wut und Trauer über Jens’ Verhalten und der Gedanke an Tante Danielas Hilferuf einander ab. In gewisser Weise war sie sogar froh über deren Brief, denn sonst hätte sie sich nur mit ihrem verflossenen Freund beschäftigt und das heulende Elend bekommen. So aber konnte sie über etwas anderes nachdenken und den Schmerz über ihre geplatzten Zukunftsträume ein wenig in den Hintergrund schieben.
Der Ton von Tante Danielas Brief hatte so verzweifelt geklungen, dass sie ihn einfach nicht ignorieren konnte. Sie sah die kleine, rundliche Frau förmlich vor sich, wie sie wieselflink die Regale ihres kleinen Ladens einräumte und für jeden ein freundliches Wort hatte. Zu ihr waren die Leute aus Kreiental nicht nur gekommen, um einzukaufen, sondern auch, um Neuigkeiten auszutauschen und sich einen Rat zu holen. Das alles sollte vorbei sein? Christine konnte sich das nicht vorstellen. Ihre Tante war doch eine Institution in Kreiental und, wie einmal einer ihrer Nachbarn erzählt hatte, fast beliebter als der Papst.
»Wahrscheinlich kommt sie über den Tod von Onkel Albert nicht hinweg!« Christine hatte es gedacht, gleichzeitig aber auch laut ausgesprochen.
Es war bedauerlich, dass Daniela und Albert keine Kinder gehabt hatten, sonst sähe die Sache wohl anders aus. Jetzt war sie so etwas wie ein Kinderersatz für die Tante.
Früher war sie häufiger nach Kreiental gekommen, doch seit ihr Vater als Beamter auf eine Dienststelle in Unterfranken versetzt worden war, war sie an den verlängerten Wochenenden und hohen Feiertagen immer zu ihren Eltern nach Hassfurt gefahren. Das allerdings tat sie seit fast einem Jahr nicht mehr, fiel ihr mit einem gewissen Schuldgefühl auf. Seit sie mit Jens zusammen war, hatte sie keine Zeit mehr für ihre Eltern und Verwandten gehabt. Mit gekrauster Nase erinnerte sie sich, dass Jens jeden Versuch, ihn ihren Eltern vorzustellen, abgeblockt hatte. Er hatte sie auch nicht zu seinen eigenen Eltern gebracht.
»Ich hätte schon damals aufmerksam werden müssen«, setzte Christine ihr Selbstgespräch fort. Jens war anscheinend nie an einer dauerhaften Beziehung mit ihr gelegen gewesen, sondern nur an einer lockeren Verbindung, die jederzeit beendet werden konnte. In diesem Augenblick war sie froh, dass aus ihren Plänen für eine gemeinsame Wohnung nichts geworden war, denn dann hätte sie wirklich Probleme.
Christine fand, dass sie sich lange genug mit Jens beschäftigt hatte und wandte sich wieder ihrer eigenen Situation zu. Ihr Blick wanderte von den Reiseprospekten, die sie auf die Anrichte gelegt hatte, zu Tante Danielas Brief und zurück.
Eine Reise nach Teneriffa oder gar nach Mauritius wäre nicht schlecht, dachte sie. Vielleicht gab es dort sogar den einen oder anderen interessanten Flirt.
Bei dem Gedanken lachte sie über sich selbst. Wenn sie allein reiste, würde sie wahrscheinlich nur missmutig in einer Ecke sitzen und sich über Jens ärgern. Fuhr sie hingegen zu ihrer Tante, hatte sie wenigstens einen Menschen, mit dem sie reden konnte. Dies gab den Ausschlag.
Rasch nahm sie den Telefonhörer, um ihre Tante anzurufen. Doch kaum hatte sie die ersten Ziffern der Vorwahl eingetippt, wurde ihr bewusst, dass sie die Nummer inzwischen vergessen hatte. Die Auskunft anrufen wollte sie nicht und beschloss daher, ihre Tante einfach zu überraschen.
2
Die vierzehn Tage bis zu Christines Urlaub brachten ihr erst richtig zu Bewusstsein, dass sie bei ihren Zukunftsplänen mit Jens auch einen Wechsel ihrer Arbeitsstelle ins Auge gefasst hatte. Er hatte ihr einen Posten in der Firma besorgen wollen, bei der er selbst beschäftigt war.
Beschäftigt gewesen war, korrigierte sie sich in Gedanken, denn Jens hatte ja seinen Arbeitsplatz aufgegeben, um ins Ausland zu gehen.
Nun würde sie sich selbst nach einer neuen Stelle umsehen müssen, dachte Christine, als sie das Firmengebäude an ihrem letzten Arbeitstag, einem Freitag, verließ. Ihr Wagen stand bereits fertig beladen auf dem Parkplatz. Gerade als sie einsteigen wollte, kam eine ihrer Kolleginnen vorbei.
»Sie fahren mit dem Auto weg, Frau Berger. Ich hab’ gedacht, Sie wollen mit ihrem Freund nach Amerika.«
»Ich hab’s mir anders überlegt.«
Da Christine die Frau nicht mochte, gab sie sich keine Mühe, freundlich zu sein. Sie setzte sich hinter das Steuer, startete den Wagen und fuhr mit einem Ruck los, der die andere mit einem Satz zur Seite springen ließ.
»Kannst du nicht aufpassen, du ...«, hörte Christine noch, dann blieb die Kollegin hinter ihr zurück.
Zum ersten Mal seit Jens’ Verschwinden konnte Christine wieder lachen. Das dumme Gesicht der anderen Frau tat ihrer verletzten Seele gut. Die Frau war eine ihrer unangenehmsten Kolleginnen und hatte durch ihre Intrigen und Hetzereien viel dazu beigetragen, dass sie an einen Arbeitsplatzwechsel dachte.
Für die nächste halbe Stunde beschäftigten sich ihre Gedanken mit den Chancen und Möglichkeiten, die sich ihr boten. In der heutigen Zeit waren sie nicht gerade rosig, aber Christine war sich sicher, es zu schaffen. Mittlerweile war die Stadt mit den grauen Häusern und all dem Lärm hinter ihr zurückgeblieben, und sie fuhr in flottem Tempo die Salzburger Autobahn entlang. Allerdings nur bis zur Einmündung des Umgehungsrings aus Richtung Norden. Über die A99 wälzten sich wahre Automassen heran und verursachten einen Stau, der einer Verkehrsmeldung im Autoradio zufolge bis zum Irschenberg reichen sollte.
Christine kämpfte sich bis zur nächsten Ausfahrt durch und fuhr dann über die Landstraße weiter. Sie würde auf diese Weise zwar länger brauchen, doch schneller als auf der Autobahn kam sie auf jeden Fall vorwärts.
Zunächst ging es über flaches Land und durch große Orte mit teilweise untypisch modern wirkenden Gebäuden, die den Speckgürtel um München bildeten. Nach einer Weile wurde die Landschaft hügeliger, und die Dörfer wurden kleiner und irgendwie anheimelnder. Kirchen mit Zwiebeltürmen oder gotischen Spitztürmen und behäbige Bauernhöfe wechselten einander ab. Neben der Straße erstreckten sich Felder und grüne Wiesen, gelegentlich durchquerte sie ein Waldstück, und einmal entdeckte sie am Waldrand sogar ein Reh, das von dem frischen Klee eines großen Feldes naschte. Fast überall waren Kühe zu sehen, die meisten braun und weiß gefleckt. Manchmal war auch eine schwarzbunte Kuh darunter und wirkte unter ihren Gefährtinnen wie ein friesischer Krabbenfischer, der sich ins Oberland verirrt hatte.
Christine wunderte sich, wie schnell sie auf andere Gedanken kam. Es war wohl doch die richtige Entscheidung gewesen, zu ihrer Tante zu fahren, dachte sie. In dieser Landschaft würde sie ihre Sorgen vergessen und zu sich finden können.
Mit diesem Vorsatz erreichte sie die Berge und fuhr in das lang gestreckte Tal hinein, an dessen hinterstem Ende Kreiental lag. Die Gegend wirkte nun nicht mehr so sanft und verspielt wie das Alpenvorland. Mächtige Felswände ragten zu beiden Seiten der Straße empor und säumten sie mehr als einen halben Kilometer weit, bevor sich das Tal wieder weitete. Christine kam sich beinahe wie ›in den Schluchten des Balkan‹ vor, einem der wenigen Karl-May-Romane, den sie gelesen hatte.
Wer hatte ihr den eigentlich geliehen?, fragte sie sich. Es musste einer der Buben aus Kreiental gewesen sein, aber sie kam nicht mehr darauf, wer.
Es war wie eine Fahrt in die eigene Vergangenheit. Christine hatte als Kind fast alle Ferien bei ihrer Tante und deren Mann verbracht und konnte die Namen der Dörfer nennen, bevor sie die Ortsschilder erreichte.
Ihr Blick wanderte über die saftigen Wiesen, die sich bis zu den Hängen der Berge hinzogen und dort von den dunklen Tannen des Bergwaldes abgelöst wurden. Hoch über den Tälern waren die Almen zu erkennen, und darüber wuchsen grau und felsig die Berggipfel empor, die im Süden teilweise noch weiße Kappen trugen.
Diese Berge gehörten bereits zu Tirol, so viel wusste Christine noch. Als Kind war sie mit einer Bande Gleichaltriger über den Kreienpass ins Nachbarland gewandert und hatte im ersten Tiroler Dorf Bonbons gekauft. Auf dem Heimweg stellten sie sich dann immer vor, richtige Schmuggler zu sein.
Ein großes, modernes Gebäude mit einem Flachdach und der großen Leuchtreklame einer bekannten Supermarktkette beendete Christines gedanklichen Ausflug in die Vergangenheit. Sie hatte Holzmatting, den letzten größeren Ort vor Kreiental, erreicht. Dann war dies wohl der von ihrer Tante beschriebene Supermarkt, der ihr die Kunden wegnahm.
Aus einer gewissen Neugier heraus lenkte Christine ihr Auto auf den dazugehörigen Parkplatz und stellte es dort ab. Der Parkplatz war nicht gerade leer, und als sie den Laden betrat, wimmelte es dort von Leuten. Christine unterschied die Städter, die zum Wandern in die Berge gefahren waren und sich hier ihre Brotzeit besorgten, von den Einheimischen, die zumeist einfacher gekleidet waren und teilweise sogar noch ihr Arbeitsgewand trugen. In den langen Regalreihen gab es fast alles, was der Mensch für den täglichen Bedarf brauchte, und die Leute kauften wie toll.
Christine hatte auf einen Einkaufswagen verzichtet, denn sie wollte nichts kaufen, sondern nur einmal schauen.
Während sie durch den Supermarkt schlenderte, dachte sie, dass er sich in nichts von den Geschäften in der Stadt unterschied. Irgendwie kam er ihr fehl am Platz vor. Doch er war wohl ein Teil des Fortschritts, der vor nichts haltmachte, mochte man es bedauern oder nicht.
Plötzlich hörte sie eine dienstbeflissene, ja fast schmeichlerische Stimme von der anderen Seite des Regals herüberdringen.
»Aber freilich haben wir Brühpech, Frau Horngacher. Deswegen müssen Sie net extra zu dem Museumsladen in Kreiental fahren.«
Bei diesen Worten stellten sich Christine die Stacheln auf. Das Geschäft ihrer Tante war alles andere als ein Museumsladen, sondern war immer ausgezeichnet geführt und ständig modernisiert worden. Sie eilte um das Regal herum und entdeckte eine ältere Bäuerin mit stämmiger Figur in einem dunklen Trachtenrock, dunkler Bluse und Mieder. Daneben stand ein junger Mann, der die Dreißig gerade einmal angekratzt haben konnte. Er trug einen vorne offenen weißen Kittel mit dem Emblem der Supermarktkette, darunter hatte er jedoch eine lederne Kniehose an und ein beiges Trachtenhemd mit einer Schleife anstelle einer Krawatte. Er bemühte sich, angenehm zu erscheinen, doch Christine empfand ihn als schmierig. Der Mann war ihr so unsympathisch, dass sie sich fragte, weshalb die Horngacherin von Kreiental ihn so fasziniert anstarrte.
»Es ist schon ein Segen Gottes, dass Sie diesen Laden aufgemacht haben, Herr Gotthelf. Ich wüsst net, was wir ohne Sie machen täten.«
Christine musste ein paar böse Worte hinunterschlucken, denn sie konnte sich erinnern, wie oft die Bäuerin zu ihrer Tante zum Einkaufen gekommen war und dabei den Laden nie vor Ablauf einer Stunde verlassen hatte, so viel hatten sie immer zu reden gehabt.
Gotthelf antwortete mit einer vor Selbstzufriedenheit triefenden Floskel, entdeckte dann Christine und eilte auf sie zu.
»Schöne Frau, kann ich Ihnen behilflich sein?«
Christine musterte ihn mit zusammengekniffenen Augenlidern und wollte schon Nein sagen. Da kam ihr eine Idee.
»Ich bräuchte eine Kittelschürze, so wie diese Frau dort sie trägt.« Sie zeigte dabei auf eine ältere Frau, die gerade den Laden betrat und so ein Kleidungsstück und Pantoffeln trug.
Der Mann sah hin und schluckte erst einmal. Als er antwortete, zeigte sein Gesicht einen Ausdruck tiefsten Bedauerns.
»Es tut mir leid, aber wir führen keine Bekleidung. Da müssen Sie schon nach Schliersee oder nach Miesbach fahren.«
»Oder nach Kreiental zur Mergentheim Daniela. Die hat nämlich solche Sachen, und die meiste andere Ware, die Sie da herinnen haben, auch.« Damit war der Fehdehandschuh geworfen.
Christine wusste nicht, was sie zu dieser harschen Antwort getrieben hatte, doch als sie Gotthelfs entgeisterte Miene sah, bedauerte sie es nicht.
Auch die Horngacherin war bei der Erwähnung der Kreientaler Krämerin zusammengezuckt und starrte Christine durchdringend an.
»Ja sag, bist du es wirklich?«
»Im Ganzen und in eigener Person. Grüß dich, Horngacherin. Wie geht’s dir denn so?«
»Wie’s einer alten Frau halt so geht. Da zwickt’s einmal da und dann wieder dort. Aber das wirst du auch noch erfahren, wenn du einmal in mein Alter kommst. Jetzt bist du noch jung und solltest das genießen. Du willst wohl nach Kreiental, um deine Tante zu besuchen?«
»Ja, und um die Kunden zurückzuholen, die ihr der da abgeschwatzt hat.«
Christine bemerkte einen gewissen Ausdruck der Schuld bei der Bäuerin und war sich sicher, dass diese das nächste Mal wieder bei ihrer Tante einkaufen würde. Es war zwar nur ein kleiner, aber für ihr Selbstbewusstsein wichtiger Erfolg. Die Horngacherin stellte nun auch das Brühpech, das Gotthelf ihr herausgesucht hatte, ins Regal zurück und sah etwas hilflos auf die anderen Waren in ihrem Einkaufswagen. Bevor sie die auch noch zurückstellen konnte, griff Gotthelf ein.
»Aber, Frau Horngacher. Sie werden doch net wieder in diesen Museumsladen gehen wollen? Wer weiß, wie alt das Zeug dort ist. Das meiste ist doch bereits abgelaufen und nicht mehr genießbar. Außerdem ist alles sündteuer. Bei uns hingegen ist alles frisch, und billig sind wir überdies auch.«
Christine baute sich vor ihm auf und blitzte ihn kriegerisch an.
»Sie wissen wohl net, dass man wegen übler Nachrede und Verleumdung belangt werden kann?«
»Aber hören Sie, das ist doch alles allgemein bekannt.« Gotthelf versuchte sich überlegen zu geben, kam aber gegen Christine nicht an.
»Ich warne Sie! Wenn ich noch einmal höre, dass Sie meine Tante und ihren Laden schlechtmachen, lernen Sie mich kennen. Haben Sie mich verstanden?«
Statt einer Antwort wandte Gotthelf sich ab und stiefelte davon.
Die Horngacherin sah ihm nach und schüttelte den Kopf.
»Also, so hätt er wirklich net von der Daniela reden müssen. Bei der hat man allweil einwandfreie Ware gekriegt.«
Mit diesen Worten wanderten weitere Sachen aus ihrem Einkaufswagen in ein Regal zurück, in das sie eigentlich nicht gehörten.
»Also, wegen einem oder zwei Cent muss ich wirklich net extra von Kreiental nach Holzmatting fahren. Was ich dich fragen will, bleibst du länger bei uns? Du warst schon eine ganze Weile nimmer da.«
»Seit mein Vater nach Hassfurt versetzt worden ist. Da bin ich an freien Tagen halt immer zu meinen Eltern gefahren. Aber jetzt hab ich mir denkt, ich nutz meinen Urlaub aus, um meine Tante zu besuchen.«
Obwohl sie in der Stadt meistens Schriftdeutsch gesprochen hatte, fiel Christine fast automatisch wieder in den hier gebräuchlichen Dialekt zurück, den sie während ihrer Kindheit erlernt hatte.
Die Horngacherin nickte zufrieden.
»Mei, da wird sich die Daniela aber freuen. Du weißt ja, sie lebt ganz allein und hat eigentlich niemand mehr außer dir. Da ist es schon richtig, dass du diesmal länger zu ihr kommst.«
»Das hab ich vor, Bäuerin. Wie steht’s eigentlich bei euch daheim? Ich hoff doch, gut.« Christine fragte eigentlich mehr, um der Horngacherin eine Freude zu machen als aus wirklicher Neugier.
Die Bäuerin legte auch sofort los, und so erfuhr Christine, dass der Hans, ihr Ältester, langsam ans Heiraten dachte.
»Zeit wird’s auch«, setzte die Horngacherin hinzu. »Er ist im letzten Jahr dreißig geworden. Da muss ein Mann sich tummeln. Jetzt muss bloß noch der Tobias eine Hochzeiterin finden, dann kann’s der Hans angehen.«
Nun erinnerte sich Christine auch wieder an die Söhne der Horngacherin. Hans war sechs Jahre älter als sie und hatte in ihrer Jugendzeit fast schon einer anderen Generation angehört. Ihr war er immer irgendwie langweilig vorgekommen, aber auch sehr von sich überzeugt.
Tobias hingegen war etwa so alt wie sie und ein ganz anderer Charakter. Damals hatte es keinen Streich gegeben, an dem er nicht maßgeblich beteiligt gewesen war.
Auch sie blieb davon nicht verschont und konnte sich gut daran erinnern, dass sie zuletzt im hellen Zorn von ihm geschieden war.
Ein Funke dieses Zorns glühte immer noch in ihr und loderte bei der bloßen Erwähnung seines Namens wieder hell auf.
»Sag schöne Grüß daheim, Horngacherin.«
Christine nickte der Bäuerin noch einmal zu und verließ den Laden, sonst hätte sie wohl ein paar böse Worte über Tobias verloren.
Er war gewiss niemand, auf den sie sich freute.
Mit diesem Gedanken stieg sie in ihr Auto und legte rasch die letzten Kilometer nach Kreiental zurück.
3
Das Tal, das dem Ort den Namen gab, wurde von der Kreiener Ache durchflossen, einem Flüsschen, das aus Tirol herüberkam und weiter talabwärts von einem anderen Gewässer aufgenommen wurde, welches in den Tegernsee mündete. Zur Gemeinde selbst zählten der Hauptort, mehrere kleine Weiler und ein paar Einödhöfe, die sich zwischen den Bergen an der Tiroler Grenze und einem Höhenzug im Norden angesiedelt hatten. Die Flanken der Berge waren mit Wald bedeckt, der zur einen Hälfte den einheimischen Bauern und zur anderen dem Staat gehörte, der auch den Förster stellte. Das Tal bot mit seinen grünen, saftigen Wiesen und seinen Almen die besten Voraussetzungen für die Viehzucht.
Christine musste die Kreiener Ache zweimal überqueren, bevor sie in den Ort hineinfahren konnte, und sah als Erstes das alte Kirchlein, das auf einem Felssockel erbaut worden war, der mitten im Dorf stand. Daneben befand sich der Pfarrhof, der – so groß wie er war – früher wohl mehr Personen als den Dorfpfarrer und seine Haushälterin beherbergt hatte. Ein Stück links von der Straße entdeckte Christine den Gföllnerhof, eines der kleineren Anwesen im Ort.
Während sie noch auf das lang gestreckte Gebäude blickte, das Wohnhaus, Stall und Scheune in sich vereinigte, wurde sie zum ersten Mal überrascht. Die Straßenführung war nämlich anders als früher. Den Grund dafür sah sie gleich darauf. Neben dem alten Löschweiher, in dem sie als Kind im Sommer oft gebadet hatte, gab es jetzt einen weiteren großen Teich, der fast schon einem kleinen See glich. Die Straße führte nun zwischen den beiden Gewässern hindurch und bog dann scharf nach links.
Nur ein paar Meter weiter stand das Haus ihrer Tante, ein stattliches Gebäude, das vor weniger als zwanzig Jahren neu im Stil dieser Gegend erbaut worden war. Der Laden nahm den vorderen Teil ein, während im rückwärtigen Teil genug Platz für mindestens zwei Wohnungen war. Ihr Onkel hatte lange geschwankt, ob er einen Mieter ins Haus nehmen oder die Zimmer an Feriengäste vermieten sollte. Zu welcher Entscheidung er gekommen war, wusste Christine allerdings nicht.
Sie blieb auf dem Parkplatz stehen, der sechs Autos Platz bot, im Moment aber wie leer gefegt wirkte, und stieg aus. Sie hätte jetzt um das Gebäude herumgehen und den Hintereingang nehmen können. Stattdessen schritt sie auf die Ladentür zu und trat ein. Die Glocke bimmelte noch wie in alter Zeit, und sie stand in einem wohl gefüllten Laden, dessen Regale so vollgestopft waren, dass die Waren beinahe herausquollen. Hier gab es die Kittelschürzen, nach denen sie im Supermarkt gefragt hatte, dachte sie bei sich und sah sich diese näher an.
Im selben Moment kam die Ladeninhaberin durch die Verbindungstür und glaubte, eine Kundin zu entdecken, die sich für die Kittelschürzen interessierte. »Grüß Gott. Das sind schöne Schürzen, net wahr?« Ihre Stimme klang beinahe bettelnd, als hätte sie Angst, die vermeintliche Kundin könnte wieder gehen. Da drehte Christine sich zu ihr um. Daniela Mergentheim fiel fast der Kiefer hinab, als sie ihre Nichte erkannte.
»Christine, du!« Sie stürzte auf das Mädchen zu und schloss es in die Arme. »Was für eine Freud! Und ich hab schon Angst gehabt, du interessierst dich nimmer für mich, weil du mir net geantwortet hast.«
»Aber Tanterl, als wenn ich dich je im Stich lassen tät.« Christine erwiderte die Umarmung und strich der Tante über das dunkle, bereits leicht grau melierte Haar. »Übrigens hab ich deine Konkurrenz schon kennengelernt. Dieser Gotthelf ist wirklich ein unangenehmer Mensch. Was der betreibt, ist ja schierer Rufmord.«
Daniela Mergentheim nickte bedrückt. »Aber die Leut glauben seinen Sprüchen. Die meinen, weil der Supermarkt neu ist, muss dort alles besser sein als bei mir.«
»Kleiderschürzen hat er zum Beispiel keine. Er tät die Leut da direkt nach Miesbach schicken wollen. Das ist ja eine halbe Weltreise«, erklärte Christine ungeachtet der Tatsache, dass die Kreisstadt mit dem Auto in einer guten halben Stunde zu erreichen war. »Weißt du, Tanterl«, fuhr sie fort. »Wenn die Leut schon zwengs einer Kittelschürze in die Stadt fahren sollen, können sie dort auch gleich ganz einkaufen und bräuchten das net in Holzmatting tun.«
»Die sollen net in der Stadt und auch net in Holzmatting einkaufen, sondern bei mir.«
Tante Daniela schniefte beleidigt und bat dann Christine in den Wohnteil ihres Hauses. Auf dem Weg dorthin entdeckte Christine eine Menge voller Kartons mit verschiedensten Waren und schüttelte den Kopf.
»Hast du kein Lager mehr, Tanterl?«
»Doch, doch, aber das ist auch voll. Den Rest der Lieferung hab ich in der Wohnung aufstapeln müssen.«
Daniela Mergentheim sagte das, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt, solche Warenberge zu besitzen. Sie seufzte und hob mit einer entsagungsvollen Geste die Arme.
»Weil der neue Supermarkt doch so billig ist, hab ich mir denkt, ich kauf mehr ein, damit ich die Ware auch billiger abgeben kann. Aber das hat nichts geholfen. Die Leut kommen einfach nimmer, und jetzt hab ich das Zeug am Hals. Christine, ich weiß mir nimmer ein noch aus.«
Christines Kopfschütteln verstärkte sich, denn der Wert dieses Warenlagers musste enorm sein. Auf ihr Nachhaken erzählte ihre Tante dann, dass der Vertreter der Großhandelskette, von der sie ihre Waren bezog, ihr diese Menge aufgeschwatzt hatte, damit sie – wie er sagte – konkurrenzfähig blieb.
»Ich hoff, du hast die Sachen auf Kommission bekommen und kannst den größten Teil wieder zurückgeben.« Das Kopfschütteln der Tante erstickte Christines Hoffnungen im Keim.
»Nein, die hab ich alle bezahlen müssen. Ich hab dafür mein ganzes Konto geplündert und sogar ein wengerl Schulden gemacht.«
»Wie viel?«
Christine sah ihre Tante streng an. Die Antwort erschreckte sie. Wie es aussah, war die Tante von dem Vertreter ganz gewaltig über den Tisch gezogen worden. Selbst in normalen Zeiten hätte sie die Waren nicht in einem und auch nicht in zwei Jahren verkaufen können. Jetzt, wo ihr der Supermarkt schier die Luft zum Atmen abdrückte, würde sie wohl ebenso viele Jahrzehnte darauf sitzen bleiben.
»Tanterl, was hast du dir denn dabei bloß gedacht?«
Christine seufzte und musterte einen der Kartons genauer. Das aufgedruckte Haltbarkeitsdatum beruhigte sie für den Moment. Dann dachte sie daran, dass ihre Tante gewiss auch verderbliche Waren eingekauft hatte und fragte danach.
Daniela Mergentheim wand sich ein wenig.
»Ich hab halt alles, was man so braucht.«
»Red net um den heißen Brei herum. Dieser Gotthelf hat behauptet, bei dir gäb’s abgelaufene Ware.«
Christines Stimme klang nun strenger und brachte den gewünschten Erfolg. Die Tante hatte der Schneggin wirklich einmal ein Stück Butter mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum verkauft und war dafür von der Bäuerin zur Rede gestellt worden.
»Die Schneggin und ihren Sepp seh ich in meinem Laden gewiss nimmer«, setzte die Tante betrübt hinzu.
Christine wollte schon sagen, dass es um diese Bäuerin nicht schade wäre, hielt aber dann den Mund, um die Tante nicht noch mehr aufzuregen.
»Übrigens glaub ich, dass ich dir die Horngacherin wieder als Kundin gewonnen hab«, sagte sie stattdessen, ermahnte ihre Tante aber, dieser nur einwandfreie Ware zu verkaufen.
»Du tust ja direkt so, als wenn ich der Schneggin die abgelaufene Butter extra gegeben hätt. Es war ein unglücklicher Zufall.«
Die Tante schob beleidigt die Unterlippe vor, doch bevor das Gespräch weitergeführt werden konnte, schlug die Ladenglocke an.
»Das wird die Horngacherin sein«, mutmaßte Christine.
Ihre Tante eilte in den Laden, kehrte aber bald mit langem Gesicht zurück.
»Es war die Loitzl Sandra. Die hat bloß ein Pfund Salz gebraucht.«
»Ich hoff, du hast bei ihr freundlicher geschaut als jetzt. Mit dem Gesicht vertreibst du dir die letzten Kunden.«
Christine wusste, dass ihre Tante eher Trost als Kritik von ihr erwartete, doch damit kamen sie nicht weiter. Wenn das Geschäft wieder zum Laufen gebracht werden sollte, mussten sie in die Hände spucken und anpacken und nicht nur wehklagen. Das erklärte sie ihrer Tante auch recht deutlich und setzte hinzu, dass es nach ihrem Besuch im Supermarkt auch zu einer persönlichen Sache zwischen Gotthelf und ihr geworden sei.
»Der Kerl hat so blöd dahergeredet, dass wir uns das net gefallen lassen können.«
Christine sah ihre Tante aufmunternd an, obwohl sie nicht den geringsten Ansatz einer Idee hatte. Ihr Beispiel flößte der Tante jedoch Mut ein, und als kurze Zeit später die Horngacherin auftauchte, um einzukaufen, erschien Daniela Mergentheim der Himmel nicht mehr so grau wie noch vor ein paar Stunden.
4
Als Barbara Horngacher den heimischen Hof erreichte, stürzte ihr Ehemann Franz aus dem Stall und fing sie noch am Auto ab.
»Das hab ich ganz vergessen, dir zu sagen. Du sollst mir kein Brühpech vom Supermarkt mitbringen, das taugt nämlich nichts. Das von der Daniela war allweil besser.«
Die Bäuerin atmete auf, weil die Begegnung mit Christine sie dazu gebracht hatte, in Danielas Krämerei einzukaufen. Sie lächelte ihrem Mann zu und holte ein Päckchen aus ihrem Einkaufskorb.
»Da, schau her, und sag noch einmal, dass ich net mitdenkt hab!«
Franz Horngacher nahm das Brühpech, musterte die Aufschrift und nickte anerkennend.
»Ich hab nie was anderes gesagt. Dann können wir morgen die Sau schlachten. Ich sag schnell den Buben Bescheid, dass sie alles herrichten sollen.« Mit diesen Worten drehte er sich um und verschwand.
Seine Frau ging zufrieden ins Haus und stellte ihren Korb auf der Anrichte in der Küche ab. Während sie die Sachen im Kühlschrank und in der Vorratskammer verstaute, dachte sie, dass sich die paar Cent, die sie bei der Krämerin mehr ausgegeben hatte, gelohnt hatten. Ihr Mann und die Buben waren bei der letzten Hausschlachtung fuchsteufelswild geworden, weil das im Holzmattinger Supermarkt gekaufte Brühpech nicht ihren Anforderungen entsprochen hatte, und beinahe hätte sie denselben Zirkus wieder erlebt.
Kurze Zeit später schaute Hans, ihr Ältester, in die Küche.
»Grüß dich, Mama. Hast du meine Zigaretten dabei?«
Die Bäuerin stemmte die Fäuste in die Seiten und musterte ihn tadelnd.
»Du weißt, dass Rauchen ungesund ist.«
»Wenn’s danach ging, wär das ganze Leben eine ungesunde Sach. Denk doch bloß daran, was in der Luft alles für Schadstoffe sind, der Feinstaub zum Beispiel ...«
»Den’s vielleicht in München am Mittleren Ring gibt, aber gewiss net bei uns in Kreiental«, unterbrach die Mutter ihn ärgerlich.
»Ja, aber trotzdem ...«
»Nix trotzdem! Mir wär’s lieber, du tätest dir das Rauchen abgewöhnen. Was sagt eigentlich die Monika dazu?«
Hans begann zu grinsen.
»Ach, die hat nichts dagegen. Die sagt, Männer rauchen halt. Ihr Vater und ihre Brüder tun’s auch.«
Die Antwort hätt ich mir denken können, schoss es der Bäuerin durch den Kopf. Hans’ Verlobte war nun einmal nicht das Mädchen, das einem Mann etwas verbieten konnte.
Barbara Horngacher war nicht gerade glücklich mit der Wahl ihres Sohnes, doch vom Geld her passte es halt. Der Wirnsbergerhof zählte, ebenso wie der eigene und der vom Loitzl, zu den drei großen Höfen in Kreiental. Ihnen gehörte mehr Grund als allen anderen Bauern in der Gemeinde zusammen.
Für einen Augenblick dachte die Bäuerin daran, dass die drei Höfe bei den übrigen Kreientalern den Spitznamen die ›Heiligen Drei Könige‹ besaßen, manchmal auch die ›Scheinheiligen‹, weil sie so groß und bedeutend waren. In früheren Zeiten war dies noch stärker zum Ausdruck gekommen, denn damals hatten der Horngacher, der Loitzl und der Wirnsberger die Geschicke der Gemeinde fast nach Gutsherrenart bestimmen können. Inzwischen waren die Vettern Spörck, die Besitzer der beiden Gasthäuser im Ort, durch den Tourismus ebenso bedeutend geworden. Es hieß sogar, dass Martin Spörck, der ›Oberwirt‹, wie er genannt wurde, ein richtiges Hotel bauen wollte.
Während seine Mutter ihren Gedanken nachhing, durchsuchte Hans den Einkaufskorb, bis er auf die Zigaretten stieß. Grinsend nahm er die Stange an sich. Die Bäuerin krauste die Nase.
»Die müssen jetzt aber ein paar Wochen reichen.«
Ihr Sohn sah sie entsetzt an.
»Aber Mama. Ein paar Wochen? Das wär ja net einmal eine Schachtel am Tag.«
»Geht’s wieder einmal um Hans’ Sargnägel?«
Tobias Horngacher, der jüngere Sohn der Bäuerin, streckte feixend den Kopf zur Tür herein.
Während Hans eher nach der Mutter geraten war und eine leicht untersetzte Figur und ein breites Gesicht hatte, war Tobias das originalgetreue Ebenbild seines Vaters in jungen Jahren. Gut einsfünfundachtzig groß, überragte er seinen Bruder um einen halben Kopf. Sein schmales und rassiges Gesicht ließ die Herzen der Mädchen im weiten Umkreis schneller schlagen, und aus seinen bernsteinfarbenen Augen leuchtete zumeist der Übermut. Nur das dunkle Blond der Haare war den Brüdern gemeinsam, doch während sie bei Hans akkurat geschnitten waren, fiel bei Tobias eine vorwitzige Strähne in die Stirn.
»Geht’s dich was an, wenn ich rauch?« Hans hörte sich ganz und gar nicht brüderlich an.
Tobias winkte nur lachend ab.
»Solang du mir dein Gelumpe net ins Gesicht bläst, kannst du wegen mir rauchen, so viel du willst.«
»Als ob ich deine Erlaubnis dazu bräucht!« Hans’ Stimme war um keinen Deut freundlicher geworden.
Die Bäuerin sah es in Tobias’ Augen mutwillig aufblitzen und hielt es für geraten, sofort einzugreifen.
»Jetzt streitet euch doch net wegen ein paar Zigaretten.«
»Dem Hans geht’s doch gar net ums Rauchen«, wandte Tobias munter ein.
»Den sticht der Hafer zwengs dem Heiraten. Aber solang ich noch ledig auf dem Hof bin, darf er net, hat der Vater gesagt.«
»Du hättest dir schon längst eine Hochzeiterin suchen können. Gelegenheit dazu hättest du oft genug gehabt.« Hans klang säuerlich.
Auf die Erfolge seines Bruders bei der Damenwelt war er schon immer neidisch gewesen. Nicht, dass es an seinen eigenen Zukunftsplänen etwas geändert hätte. Für ihn war die Wirnsberger Monika stets die erste Wahl gewesen, doch als Älterem fiel es ihm schwer, im Schatten des Bruders zu stehen.
»Da muss ich dem Hans schon recht geben. Es hat etliche saubere Madln gegeben, die zu dir gepasst hätten.« Die Bäuerin erntete einen dankbaren Blick ihres Ältesten.
Tobias hingegen lachte nur.
»Von denen hat mir keine gut genug gefallen, um den Rest meines Lebens an sie gefesselt zu sein.«
»Und was ist mit der Loitzl Sandra? Die ist ein schmuckes Weib und erbt zudem den großen Hof. Oder stört’s dich, dass sie so jung Witwe geworden ist?« Barbara Horngacher beschloss, ein wenig auf den Busch zu klopfen.
Es war ihr Traum, den jüngeren Sohn als Jungbauern auf dem Nachbarhof zu sehen.
Tobias wiegte unschlüssig den Kopf.
»Dafür, dass ihr Mann nach drei Monaten Ehe an einer verschleppten Krankheit gestorben ist, kann die Sandra gewiss nichts. Mir passt bloß net, dass ich meinen Namen aufgeben und den ihren annehmen müsst, so wie’s schon bei ihrer ersten Ehe der Fall war.«
»Das ist doch eine Kleinigkeit«, wandte sein Bruder eifrig ein. »Es hat allweil einen Loitzl auf dem Loitzlhof gegeben, und dass soll auch so bleiben. Ich tät’s net anders halten wollen, wenn’s bei mir bloß eine Erbtochter geben tät.«
»Vielleicht überleg ich’s mir.« Tobias trat an die Anrichte, schaute auf den noch halb vollen Einkaufskorb hinab und fand auf Anhieb eine Tafel einer ganz speziellen Schokolade.
»Du hast heut wohl wieder bei der Daniela eingekauft, denn in dem komischen Supermarkt ihn Holzmatting gibt’s die net. Dabei mag ich die Sorte doch so gern.«
»Du, Schokolad ist fei auch net viel gesünder als das Rauchen.«
Hans versuchte, gegen seinen Bruder zu punkten, doch der Verbalangriff verpuffte.
Tobias grinste nur, brach sich ein Stückchen Schokolade ab und steckte es sich in den Mund. Er schnalzte dabei genießerisch mit der Zunge.
»Saugut, sag ich dir. Da kommen deine geschnitzelten Indianerblätter net mit.«
»Indianerblätter?« Hans’ Gesicht bildete ein einziges Fragezeichen.
»Du hast wohl noch nie gehört, dass der Tabak aus Amerika stammt und die alten Indianer schon geraucht haben, bevor der Kolumbus zu seiner Kreuzfahrt aufgebrochen ist?«, erklärte ihm Tobias.
»Du meinst Kreuzzug!«
»Nein, die sind in die andere Richtung gesegelt. Setzen, Horngacher Hans! Geschichte und Geografie sechs!« Tobias ahmte den Tonfall ihres früheren Klassenlehrers so gekonnt nach, dass seinem Bruder beinahe die Augen aus dem Kopf fielen.
Die Bäuerin sah die beiden an und sagte sich, dass es wirklich an der Zeit war, dass Tobias eine Braut fand. Wenn es noch lange dauerte, würde die Situation auf dem Hof unerträglich werden.
»Was habt ihr heut Abend eigentlich vor?« fragte sie, um die Spannung zu lindern.
»Ich geh auf alle Fäll zum Wirnsberger hinüber«, erklärte Hans.
Tobias zuckte dagegen mit den Schultern.
»Keine Ahnung. Vielleicht schau ich einmal beim Loitzl vorbei, um zu sehen, ob man mit der Sandra reden kann oder ob sie noch allweil wie eine Trauerweide herumläuft.«
»Wie kannst du bloß so was sagen? Es ist doch verständlich, dass sie net munter und fröhlich herumspringt, wenn ihr Mann gestorben ist«, wies Hans ihn zurecht.
Tobias winkte ab.
»Das ist zwei Jahr her, und da könnt man wirklich meinen, dass sie sich wieder dem Leben zuwendet. Aber wenn ich mir das so anschau, ist’s bei ihr allweil schlimmer geworden.«
»Umso wichtiger wär’s, wenn du dich um sie kümmern und ihr zeigen würdest, dass das Leben auch für sie wieder schön werden kann.«
Die Bäuerin wusste nicht, ob dieser Appell verfing, denn was Mädchen betraf, war Tobias immer ein wenig sprunghaft gewesen.
»Es wird wirklich Zeit, dass das anders wird!«
»Was?«
Erst Tobias’ Frage brachte sie darauf, dass sie ihren Gedanken laut ausgesprochen hatte. Sie antwortete jedoch nicht, sondern räumte ihre letzten Sachen fort, bevor auch noch ihr Mann kommen und etwas entführen konnte.
5
Während Hans mit strammen Schritten den Weg zum Wirnsbergerhof in Angriff nahm, wusste Tobias nicht so recht, was er tun sollte. Einesteils reizte ihn der stattliche Loitzlhof, und er wäre den Worten seiner Mutter zufolge gut vorsorgt, wenn er Sandra heiraten würde. Zum anderen war die junge Frau noch nie sein Typ gewesen. Für einen Augenblick wünschte er sich das Gemüt seines Bruders, der keine Sekunde gezögert hätte, Sandra den Hof zu machen. Er selbst fragte sich jedoch, ob sein Leben wirklich in so eingefahrenen Bahnen verlaufen musste.
Bei Sandra würde es keine Liebe geben, sondern ein eher geschäftsmäßiges Zusammenleben, bei dem die ehelichen Pflichten, wie sie so schön hießen, ihrem Namen Ehre machen würden. Allerdings besaß Sandra weder ein abschreckendes Gemüt noch ein abstoßendes Aussehen und war so betrachtet eine bessere Wahl als die meisten Mädchen, die er kannte.
Seufzend folgte er seinem Bruder, der den Loitzlhof auf seinem Weg zum Wirnsberger bereits passiert hatte, und traf kurz darauf bei dem mächtigen Dreifirsthof ein. Der alte Loitzl kam gerade aus dem Stall, in Gummistiefeln und einer blauen, umgeschlagenen Arbeitsschürze. Auch er wirkte düster, als müsse er über einen schweren Verlust trauern. Bei Tobias’ Anblick hellte sich sein Gesicht jedoch sofort auf.
»Ja, grüß dich, Tobias! Schön, dass du bei uns vorbeischaust.«
Loitzls Miene und der Klang seiner Stimme verrieten Tobias, dass er als Brautwerber mehr als willkommen war. Das machte ihm die Sache nicht leichter. Es gelang ihm aber, den Bauern freundlich zu grüßen und zu fragen, wie es ihm ginge.
»Man wird halt alt, Tobias«, antwortete Loitzl. »Es gehört ein junger Bauer auf den Hof. Hoffen wir, dass es bald dazu kommt. So kann’s nämlich net weitergehen.«
Das Letztgesagte untermauerte Loitzl mit einem tiefen Seufzer, dann musterte er Tobias mit einem hoffnungsvollen Blick.
»Ich hab schon mit deinem Vater am Stammtisch gesprochen, Tobias. Uns beiden wär’s sehr recht, wenn aus dir und der Sandra was werden könnt. Ihr tätet wirklich gut zusammenpassen. Du bist allweil ein fröhlicher Bursch gewesen und könntest sie aufheitern. Du weißt ja, sie nimmt sich alles so zu Herzen.«
Was als Aufmunterung gedacht war, verfehlte völlig seine Wirkung. Tobias kannte Sandra als weinerliches Mädchen, das seinen Jungenstreichen verständnislos gegenübergestanden war und ihn nicht nur einmal an den Lehrer oder seine Eltern verpetzt hatte. In der Zwischenzeit war sie zu einer durchaus ansehnlichen Frau herangewachsen, hatte aber immer noch arg nah am Wasser gebaut. Er fragte sich, ob er es ertragen könnte, mit einer Frau verheiratet zu sein, die bei jedem harschen Wort in Tränen ausbrach.
»Weißt du, Loitzl, der Mensch muss auch einmal herzhaft lachen, damit er gesund bleibt. Das ist das Wichtigste. Aber was ich fragen wollt: Ist die Sandra daheim?«
Der Bauer zeigte auf die Haustür.
»Sie ist in der Kuchl. Hoffentlich findest da drinnen noch einen Platz.«
Das zuletzt Gesagte klang ein wenig ärgerlich. Warum, wurde Tobias klar, als er ins Haus trat und die Türe der Küche öffnete.
Die alte Bäuerin und ihre Tochter standen am Herd, um das Abendessen zuzubereiten. Die Eckbank und die Stühle, die an beiden anderen Seiten des Tisches standen, waren von fünf jungen Burschen besetzt, die ihm wie Hühner auf einer Stange vorkamen. Bei seinem Eintreten wurden ihre Mienen ärgerlich, und Karl Wirnsberger, der jüngere Bruder von Hans’ Verlobter Monika, schnappte ihn sogar an.
»Was willst denn du da?«
Tobias bedachte den um ein Jahr Jüngeren mit einem nachsichtigen Blick.
»Sei froh, dass ich heut meinen guten Tag hab. Ich hab andere schon für weniger verdroschen.«
»Du willst dich wohl aufmandln, was?«
Karl Wirnsberger war für seinen Jähzorn bekannt und deshalb schon ein paar Mal mit Tobias aneinandergeraten. Zu einer ernsthaften Rauferei war es zwar noch nicht gekommen, doch es gab nicht wenige im Ort, die in absehbarer Zeit damit rechneten. Tobias hatte bei den Wirnsbergerleuten einen schlechten Stand, weil Hans und Monika seinetwegen noch nicht heiraten konnten. Und ihn als Konkurrenten auf dem Loitzlhof zu sehen war das Letzte, was Karl sich gewünscht hätte.
Tobias drehte sich gemütlich zu ihm um und verschränk-te die Arme vor der Brust.
»Bürscherl, wenn du dich so stark fühlst, geh schon einmal hinaus und lauf dich warm. Ich komm nach, wenn ich Zeit hab.« Mit diesen Worten wandte Tobias Karl den Rücken zu und sah die beiden Frauen an.
»Habe die Ehre, Loitzlin! Servus, Sandra! Einen schönen Gruß von meiner Mutter soll ich ausrichten.«
»Dankschön, Tobias. Wie geht’s ihr denn? Ich hoff doch, gut. Von mir selber kann ich das leider net sagen. Wir haben Föhn, und den spür ich halt meistens. Der Sandra geht’s genauso. Die hat direkt Kopfweh.«
Es war eine deutliche Aufforderung an die anderen Burschen, endlich zu gehen. Auf diesem Ohr waren Karl Wirnsberger und der Rest jedoch taub. Sie machten sich sogar noch breiter, sodass für Tobias kein Platz am Tisch blieb. Der dachte jedoch nicht daran, sich zu ihnen zu setzen, sondern trat neben Sandra, deren traurige Miene ihm Mitleid einflößte.
»Kopfweh ist schlimm, das sagt mir die Mama allweil. Da ist es das Beste, du gehst ins Bett und legst ein mit Kampferöl getränktes Tuch auf die Stirn. Zieh aber vorher die Vorhäng zu, damit’s dunkel ist. Das hilft ge-wiss.«
Die Bäuerin lächelte ihm dankbar zu.
»Du bist halt schon immer ein fürsorglicher Bub gewesen, Tobias. Andere Rammeln könnten sich da eine Scheibe von dir abschneiden.« Ein finsterer Blick streifte dabei die fünf am Tisch.
»Willst du ein Bier?«, fragte sie dann und zeigte deutlich, dass sie ihm eine Halbe weitaus mehr vergönnte als den anderen, von denen jeder bereits eine Bierflasche vor sich stehen hatte.
»Mir kannst du auch noch eine Halbe bringen, Loitzlin«, rief Sepp Schnegg, dessen Mutter einen der kleineren Höfe im Ort besaß.
Die Bäuerin drehte sich mit ärgerlicher Miene zu dem untersetzten Burschen um.
»Wir sind fei keine Wirtschaft. Wenn du saufen willst, musst du schon zum Wirt gehen!«
Der untersetzte Bursche wurde puterrot.
»Ich hab mir halt denkt ...«, stotterte er, um sofort von Karl Wirnsberger unterbrochen zu werden.
»Überlass das Denken deiner Mutter. Die hat’s bis jetzt auch für dich getan. Außerdem hat die Bäuerin recht. Eine Halbe, das ist der Brauch, und eine zweite, wenn sie gegeben wird. Aber gefordert wird keine! Ein Bauernhof ist kein Wirtshaus.«
Sepp Schnegg hatte an dieser harschen Zurechtweisung zu kauen. Karl hingegen war wieder obenauf. Da er gegen Tobias nicht angekommen war, hatte er sich auf diese Weise abreagiert. Außerdem erschienen ihm Sepp Schneggs Bemühungen, Sandra für sich zu gewinnen, einfach lächerlich.