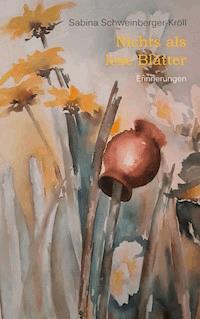
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sabina ist auf einem Bergbauernhof im österreichischen Neukirchen am Großvenediger geboren. Die Schulzeit begann mit dem Einzug des Hitlerregimes 1938. Das ohnehin harte Leben in diesen Regionen wurde für die Menschen in den Familien durch die fehlenden Männer, die zum Kriegsdienst eingezogen wurden, eine große Herausforderung. Doch das karge Dasein mit allen Unzulänglichkeiten bot auch etwas, wonach wir »Heutigen« uns immer mehr sehnen: die Wärme und die Geborgenheit eines mit allen Sinnen erfahrenen Lebens im Jahreskreislauf der Natur. Für die junge Sabina legten diese Lehrjahre und die anschließende Auslandszeit in einem Schweizer Unternehmerhaushalt den Grundstein für ihre spätere Selbstständigkeit als Bewirtschafterin der Zittauerhütte. Rund 80 Jahre lang hat Sabina ihre Gedanken und Erlebnisse in Schulheften, Kalendern und Zetteln in kurzen Notizen festgehalten, bis sie sich entschloss, ihre Erinnerungen zu einem Manuskript zusammenzufügen. Gewidmet hat sie das Buch nicht nur ihren Kindern, Enkelkindern und Geschwistern, sondern auch »all jenen, die am Leben vorbeieilen«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen Kindern und Enkelkindern, meinen Geschwistern und all jenen, die am Leben vorbeieilen.
Inhaltsverzeichnis
Nichts als lose Blätter
Kalender
Computer
Kindheits-Missgeschicke
Schulzeit und Schulwege
HJ und Schulwege
Frau Lenz
Krieg
Vom »Arbeits-Alltag« daheim
Gäste
Waschtag
Das elektrische Licht
Heiliger Abend
Nikolausabend
Maria Lichtmess
Ganz »privater« Schleichhandel
Arbeitsfolge im Haus
Wenn es Frühling wird
Großmutter erzählt
Noch ein Ferienerlebnis in Wien
Wiener Besuch
Landarbeiterin
Fahrt in die Schweiz
Wieder zu Hause
Peter und Paul – 1956
»Geißenrettung«
Wo ist die Lauge?
Der Badesee und ein prachtvoller Tag
Vierzig Jahre »Alpenverein«
Abschied vom Hüttenleben
»Hausfrau«? 1960 – ein kurzer Rückblick
Die Post, die neue Arbeitsstelle, ein Ganzjahresbetrieb
Arbeitsbeginn bei der Versicherung
Arbeitsbeginn bei der Versicherung
Geschwisterlicher Besuch
Wunschträume
Beschwerlichkeiten und Hundeleben
Erinnerungen an das Wandern im Virgental
Seniorenheim
Epilog
Nichts als lose Blätter
Dicht beschrieben häufen sie sich in der Schublade meines Schrankes, fast kommen sie mir vor wie das abgefallene Laub unterm Apfelbaum im Garten. Der Baum hat sich für den Winterschlaf gerüstet, und das prächtige Kleid, das ihn im Frühjahr und im Sommer in allen Grünschattierungen zierte, das im Herbst mit gelben und roten Farben spielte, hat er jetzt, spät im Jahr, einfach abgeworfen. Die Früchte sind längst verzehrt, den Rest haben im Spätsommer andere Inwohner gegessen. Das abgeworfene Blattwerk wird bald auf dem Komposthaufen auf einen neuen Frühling warten, um als wertvoller Humus wieder in die Erde zu fallen.
Meine beschriebenen Seiten werden sicherlich ein ähnliches Schicksal haben: Sie werden, gebündelt oder verstreut unter anderen Papierwaren, mit all meinen Gedanken auf einer Deponie ihrer Verwertung harren. Meine festgehaltenen Gedanken sind auf den Blättern, vielleicht sind sie belanglos für euch und manches auch nicht sehr gescheit – aus einer anderen Zeit halt. Doch ehe sie sich im Winde verlieren, will ich alles in ein Heft schreiben, sodass sie wenigstens gemeinsam ihre Einäscherung erwarten. Das macht mich nicht traurig, nein – nur vielleicht ein klein wenig erfahrener.
Kalender
Ob ich endlich begonnen hätte, alles aufzuschreiben und in einen Zusammenhang zu bringen, was auf den vielen abgerissenen Kalenderblättern steht?, fragen mich die Kinder.
Ja, ich habe es versucht, und ich komme damit nicht weiter. Du musst wissen, die ersten beschriebenen Blätter stammen aus einem Schulheft und wurden nach dem ersten Schuljahr 1939 bekritzelt – die Jahre danach sind noch einige andere Heftchen mit Erinnerungen dazugekommen. Die abgerissenen Kalenderblätter stammen aus dem Jahr 1956, da hat die Zettelwirtschaft mit meiner selbstständigen Tätigkeit, somit auch die Buchführung, begonnen. Weil so ein Stehkalender, griffbereit auf einem Regal, mit einem an einer Schnur hängenden Bleistift daneben, praktisch und für alles, was nicht vergessen werden darf, gut zum Aufschreiben ist – manchmal ist da auch der Vermerk am Abend, ob der Tag einer Erinnerung wert ist oder nicht.
Wichtige Termine und geschäftliche Dinge, möglicherweise auch ein paar buchhalterische Schlampigkeiten veranlassten mich dazu, diese Kalender zum jeweiligen Jahresabschluss meiner Buchführung beizulegen. Nach zehn Jahren selbstständiger Arbeitszeit blieb meine gesamte Rechenschaft den Behörden gegenüber noch einmal zehn Jahre fein säuberlich in Kartons verpackt im Abstellraum liegen, bis der Platz endlich für anderes Aufzubewahrendes freigemacht werden konnte.
Hätte mir jemand den Rat gegeben, nicht alles einzeln durchzublättern, hätte ich viel Zeit gespart, aber auch eine ganze Menge übersehen. Kalenderseiten begannen zu erzählen, dabei wurden Erinnerungen Gegenwart, eine vergangene Zeit noch einmal durchlebt. Bilder von Räumlichkeiten, von Menschen, die Begleiter waren, und solchen, die einem aus anderen Gründen in Erinnerung bleiben – Jahreszeiten und eine wunderbare Landschaft ziehen vor den inneren Augen wie ein Film vorüber.
Gute und weniger gute Tage werden noch einmal gegenwärtig. Ich brachte es nicht übers Herz, alles im Ofen zu verbrennen, also sind die Notizen, von den Kalendern abgerissen, in eine Schublade, dann in einen großen Schuhkarton gewandert, samt ein paar anderen vollgeschriebenen Heftchen aus der Schulzeit und vielen Briefen.
Der Schuhkarton mit diesen Erinnerungen steht in meinem Kleiderschrank ganz hinten links unten, mit dem besten Vorsatz, alles einmal zu ordnen und in Zusammenhang zu bringen. Er hat mich oft ermahnt: »Tue etwas!« Dass dafür Zeit notwendig ist, versteht sich von selbst. Immer gab es Wichtigeres. Inzwischen bin ich den Achtzigern weit näher als den Siebzigern. Die Zeit rinnt durch meine Finger. Der klägliche Versuch, Ordnung zu schaffen, scheitert immer wieder. Ich dachte schon ans Aufgeben und ganz schnell alles im Ofen zu verheizen.
Eines Tages setze ich mich doch an die Zettelwirtschaft, da kommen meine Kinder zu Besuch und überraschen mich bei der verrückten Arbeit, Zeit mit Datum und Geschriebenem in Einklang zu bringen.
Meine Tochter macht einen Blick in mein Schreibheft.
»Mutti, das wird schwierig.«
Ich weiß es – vor allem im Garten muss noch einiges winterfest gemacht werden, ehe es kalt wird und der erste Schnee zudeckt, was nicht säuberlich aufgeräumt ist. Die Gräber auf dem Friedhof müssen für Allerheiligen vorbereitet werden. Für die Wintergäste im Garten ist das Vogelhäuschen aufzustellen, ein Platz für den Laubhaufen beim Kompostsilo ist zu richten, damit der Igel, der jedes Jahr so fleißig die Engerlinge aus dem Rasen holt, sein Winterquartier findet.
Die Regentonnen und der Wasserschlauch in den Keller, bevor der Frost kommt. Es gibt genug zu tun. Dabei geht mir die Gartenarbeit, die ich ja liebend gerne mache, so gar nicht mehr von der Hand. Für alles brauche ich viel mehr Zeit als noch vor einigen Jahren.
»Das ist doch ganz normal, Mutti, du bist ja noch ganz rüstig für dein Alter«, höre ich die Meinen öfters sagen.
Ich bin nicht undankbar, aber die Zeit wird mir trotzdem zu kurz. Punkt!
Computer
Nach etwa drei Wochen kommen die beiden aus Südtirol wieder einmal zu uns. Dieses Mal bringen sie einen Computer mit, ein ziemlich betagtes Modell. Ich soll mich mit diesem Monstrum ein wenig anfreunden. Das sei im Grunde ja nur eine Schreibmaschine – ein wenig Übung und ich könne damit umgehen.
Der Bildschirm beansprucht den halben Schreibtisch, und die Zeit zerrinnt wie Schneeflocken auf einer warmen Hand, wenn ich mich damit beschäftige. Nach einigen Tagen Denksport bin ich endlich so weit, ein paar Sätze auf den Bildschirm zu zaubern; der erste Versuch, einen Absatz zu machen, zaubert das Ganze wieder weg. Was Hänschen nicht lernt …
Johanna meint: »Gib bitte nicht auf, Mutti, das klappt sicher!« In zwei Monaten bekomme ich ein besseres Gerät, sie tauschen ihren Computer, weil für die Stickerei Programm-Änderungen gemacht werden. Sie liefern mir ausführliche Erklärungen, die ich trotzdem nicht verstehe.
Aber irgendwann kapiere ich das für meine Arbeit notwendige System schließlich – die Ordnung in der Schuhschachtel ist auch hergestellt, und meine Gehirnzellen haben eine sinnvolle Aufgabe bekommen.
Das soll ja Vergesslichkeit und Alterserscheinungen hintanhalten. Also beginne ich mit einem Blick zurück in die Kinderzeit, zum Anfang der gebliebenen Erinnerungen.
Kindheits-Missgeschicke
Ein Ereignis, eigentlich war es ja ein Unglück, das mir im wahrsten Sinne des Wortes Schmerzen bereitet hat, ist mir fest in Erinnerung geblieben. Nicht nur ich, sondern alle haben darunter gelitten.
Es war ein schöner Tag. Die Sonne heizte vom Himmel herunter, und die Großmutter wollte im Küchengarten Kräuter pflücken und ich sollte ihr helfen. Die Kamillen blühten und dufteten, der Wermut, der Eibisch und die Minzen waren schon in den Leinensäcken auf dem Dachboden, der Kümmel hing, in ganzen Stauden in ein schleißiges (vom vielen Waschen fadenscheinig gewordenes) Leinentischtuch gebunden, auch dort. Daneben befand sich ein großes Wespennest. Den Wespen beim Ankommen und Wegfliegen zuzusehen war abenteuerliche Neugierde und Ängstlichkeit zugleich. Seit dem Mittagessen war ich bei der Großmutter im Garten und half ihr, Kamille zu pflücken. Auf meine Frage, warum wir alle Pflanzen heute pflücken müssten, erwiderte sie, ich solle in den Himmel hinaufschauen. »Da schwimmen die Fischlein und das bedeutet Föhn, da kann das Wetter ganz schnell umschlagen, wenn der Tauernwind auslässt. Das wäre doch schade um den guten Tee.« Föhnwolken sind mit ein wenig Fantasie Fischlein am blauen Himmel.
Ich hatte inzwischen einen Marienkäfer entdeckt und ließ ihn über meinen Handrücken laufen. Warum der kleine rote Käfer schwarze Punkte hatte, konnte sie mir auch nicht erklären.
Die Großmutter sagte, das seien Himmelskühe, und ich dürfe den Käfern und überhaupt den Tieren, die im Garten und auf der Wiese herumkriechen, hüpfen und fliegen, ja nichts zuleide tun! Wir bräuchten sie alle.
Ob wir wohl auch die Spinnen und den Mistkäfer brauchen?, hätte ich gerne gewusst. »Ja, ganz gewiss«, war die Antwort, »der liebe Gott hat allen Tieren und Pflanzen und auch uns Menschen das Seine zugeteilt.« Sie zog ein großes rotes Taschentuch aus ihrem Kittelsack und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Da bekam ich Durst.
Liebevoll, aber bestimmt sagte sie: »Beim Brunnen drunten ist ein Haferl, geh und trink.«
Nach nicht allzu langer Zeit war ich müde und Hunger bekam ich auch.
»Ach, Mädchen!« Ich glaubte, auch so was wie einen Seufzer zu hören. »Geh hinauf in den Krautgarten und suche dir eine schöne Rübe.«
Das ließ mich die Hitze und die Kamillen rasch vergessen. Der Krautgarten war ja auch ein paradiesischer Platz. Was es da alles gab: ein langes Beet mit großen, runden Krautköpfen, von denen wir, Markus, die Tante und ich, alle paar Tage die Krautwürmer abklauben mussten, in einen Eimer tun und in den Wald hinaustragen, für die jungen Vögel, damit diese kräftig würden für den langen Flug über die Tauern in das Winterquartier. Der Ronach (rote Rübe) war schon groß, und die Blätter glänzten. Ein Beet schwarzer Rettich und ein Fleckerl Mohn für den Scheiterhaufen (ein süßes Gericht) gab es ebenfalls, genauso wie zwei oder mehr Beete Runkelrüben für die Schweine, dann kam der »Rübenfleck«, gleich daneben standen die Bohnen (Saubohnen). Diese und das Beet mit den Früh-Erdäpfeln lieferten uns um diese Zeit reichlich Nahrung zum Abendessen.
Ich untersuchte das Rübenbeet gründlich, bis ich die größte fand. So eine frisch aus der Erde gezogene weiße Rübe war etwas ganz Gutes. Das Exemplar schleppte ich zur Großmutter.
»Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass du so lange weg gewesen bist. So eine große Rübe findet man nicht so schnell.« Sie nahm die Frucht ganz eng am Strunk und drehte die Blätter ab, dann wusch sie sie im Traufenwasser, das in einem Bottich aufgefangen wurde. Aus den unergründlichen Tiefen ihres Kittelsackes holte sie einen Veitl – ein Taschenmesser, das noch in der Steiermark in Handarbeit hergestellt wird. Dieser Veitl hatte Tradition, er war billig und erfüllte seinen Zweck, sogar Veitl-Clubs gab es – und schälte die Rübe so, dass sie aussah wie eine riesige Margerite, nur mit einem schneeweißen Kopf. Sie schnitt mir ein Stück von dieser Rübe ab.
Ehe sie sich versah, weinte ich lauthals: »Ich will die ganze, ich will die ganze!«
Vermutlich wurde es ihr zu viel, sie drückte mir das Stück von der Rübe in die Hand und sagte recht nachdrücklich: »Auf dem Balkon, wo deine Puppe schläft, ist jetzt Schatten, geh zu ihr, sie braucht dich auch.«
Dieser Ton duldete keinen Widerspruch, also ging ich auf den Balkon. Die Puppe lag in ihrem Bettchen und hatte die Augen zu, also schlief sie.
Oberhalb vom Haus, bei den zwei großen Kirschbäumen, mähte Markus Gras für die Heimkuh. Die Kuh nannte man so, weil das Tier alleine daheim im Stall war und die Familie mit ihrer Milch versorgte. Die anderen Rinder und Schafe waren alle auf der Alm.
Flugs hatte ich Großmutters Anordnung vergessen. Ich lief zu Markus hinauf, nahm den kleinen Rechen neben dem Korb und rief: »Ich reche das Gras zusammen!«
Und schon passierte es: Ich lief einfach in die Sense. Wie es genau geschah, wusste ich nicht, und Markus wusste es auch nicht. Blut floss aus meinem linken Bein oberhalb vom Knöchel. »Moid, Moid!«, schrie Markus ganz laut.
Ich erinnere mich nur noch an einen großen Mann mit einer weißen Schürze und an ganz helle Lampen.
Meine Mama, ihre älteste Schwester namens Moid, der taubstumme Knecht Mathias und Markus – ein etwas geistig behindertes Annehm-Kind, damals 13 Jahre alt –, sie alle brachten an diesem Tag Heu ein. Als sie fast fertig waren, schickten sie Markus einen Korb voll Gras mähen und diesen für die Heimkuh in den Stall bringen. Wie sich das Weitere an diesem verhängnisvollen Sommertag abspielte, erzählten mir später meine Mama, meine Großmutter und die Tante.
Mama trug mich in das Haus, legte mich in der Stube auf die Bank, lagerte das Bein ganz hoch und band es mit einem breiten Stück Stoff unterhalb vom Knie ab, sodass die Blutung ein wenig nachließ.
Die Tante lief nach Neukirchen, um den Doktor zu holen. Damals gab es nur einen Karrenweg zu uns auf den Berg. Es gab keine andere Möglichkeit, in das Tal, in den Ort oder von da zu uns heraufzukommen, als zu Fuß oder zu Pferd. Die Gehzeit beträgt – immer noch – eine Stunde!
Mama schickte Markus nach Rechtegg, um »die Göden und den Göden« zu holen. Das waren meine Taufpaten. Der Göden war Mamas Bruder.
In der Kammer schob sie ein Bett in die Mitte, legte Leintücher bereit und richtete alle Petroleumlampen, die im Hause waren.
Es ging schon gegen Abend zu, als der Doktor und die Tante zu Fuß auf Moosen ankamen.
Die Großmutter hatte heißes Wasser bereitet und betete ganz verzweifelt.
Da nie etwas stehen blieb und alles weiterging, vollendeten Markus und Mathias (»der Hiasl« genannt) die Arbeit für diesen Tag alleine. Wie Markus zumute sein musste, kann sich wohl keiner vorstellen. Die Kuh bekam trotzdem ihr Futter und wurde gemolken, die Hühner und Schweine versorgt.
Der Doktor nähte mein Bein, das oberhalb vom Knöchel bis auf den Knochen durchgeschnitten war, zusammen, alle Sehnen und Blutgefäße, so wie sie zusammengehören. Er vollbrachte ein wahres Kunststück unter so erschwerten Umständen, es gab keine Narkose und nur Petroleumlicht, der Operationstisch war ein Bett mit Strohsack und einem Leinentuch darüber.
Der Doktor meinte: »Wenn das Kind nicht die hohen Rindslederschuhe fest gebunden getragen hätte, wäre wohl auch der Knochen arg beschädigt gewesen. Da wüsste ich nicht, was ich getan hätte …« Diesem Doktor Fuchs verdanke ich, dass mein Bein ganz heil wurde und außer einer langen Narbe nichts zurückblieb. Dr. Fuchs war damals ein junger Gemeindearzt.
Selbst nach dem fünften Monat wollte die Wunde auf der Innenseite des Beines einfach nicht heilen, ganz dick und blau wurde es, und immer wieder kam Eiter heraus. Alle waren verzweifelt.
Mama fragte die Mitterhaus Theres, eine Tante und Salbenmacherin und überhaupt eine kräuterkundige Frau, um Rat. Diese meinte, da sei halt noch ein Faden drin.
Der Doktor stimmte dieser Diagnose zu und bat die Theres: »Probiere es mit deiner Salbe!« Drei Tage blieb die Theres bei uns und wechselte am Tag alle Stunde das Pflaster. Das Bein wurde ganz dünn, wie ausgeronnen.
Der Verdruss von Mama, Großmutter und Tante wurde immer größer.
›Wenn nur das Bein nicht abgenommen werden muss!‹, war die größte Sorge. Am dritten Tag kam aus der Wunde etwas Helles heraus, das sich nicht wegwischen ließ. Die Theres probierte mit den Fingern, daran zu ziehen. Ich sehe das heute noch vor mir, auf dem Küchentisch sitzend. Das ging so nicht. Kurzerhand holte die Theres ein Zangerl (eine kleine Zange, wie sie Feinmechaniker verwenden) aus der Tasche und zog damit einen Faden mit einem dicken Knopf daran heraus. Es hat höllisch wehgetan.
»Das war es«, erklärte sie, »weswegen so ein Kind zu guter Letzt noch um sein Füßl (Bein) gebracht worden wäre.« Nach einem guten halben Jahr kam der Doktor dann wegen mir und diesem Malheur das letzte Mal auf den Hof.
Ich saß auf Mamas Schoß, während ihr der Arzt Ratschläge zur Weiterbehandlung erteilte, und war sichtlich froh, dass es jetzt aufwärts ging und das Bein wieder ganz gesund werden würde. Im nächsten Jahr begann ja die Schule.
Danach gab er ihr noch einen Umschlag mit den Worten: »Es ist aber nicht eilig«, wünschte allen alles Gute und ging erleichtert zum nächsten Patienten.
Zu dieser Begebenheit sind mir noch zwei Erinnerungen gegenwärtig. Der Gruber Bauer Leonhard (Leal) brachte mir Stöcke, die er aus alten Regenschirmen gemacht hatte, damit mir das »wieder gehen lernen« leichter würde. Anfangs war das recht schmerzhaft und ich wollte deshalb auch nicht mit dem ganzen Fuß auftreten. Großmutter ermahnte mich ständig an das Üben, die Fußspitzen auf und ab zu bewegen, wie der Doktor geraten hatte. Mama hat manchmal auf der gegenüberliegenden Bank neben sich eine kleine Tafel Schokolade hingelegt – die bekäme ich, wenn ich die drei Meter von der Ofenbank zu ihr herüberginge und auch mit der Ferse, nicht nur mit den Zehen, den Boden berührte.
Ein anderes, wenn auch kleineres Malheur ereilte mich im Frühjahr 1938. Markus hatte auf dem kleinen Balkon vor dem Küchenfenster Späne gemacht zum Anheizen im Brotbackofen. Bei den Spanscheiten fanden sich zwei von alten Schuhen abgerissene Gummisohlen mit lauter kleinen Metallstiften. Auf der abgerissenen Seite sahen sie fast aus wie eine grobe Bürste. Markus drehte und wendete die Sohlen lange hin und her – ja, da mache er sich Sandalen draus. Damals war das ein unerfüllbarer Kindertraum. Er holte den Beschlagstock (ein Werkzeug, wie es der Schuhmacher hat) aus der Werkzeugkammer und begann, das Gerät zwischen die Beine geklemmt, auf einem Schemel sitzend die Sohlen zu glätten.
Mit der einen Hand hielt er die Sohle auf dem Eisen-Fuß, mit der anderen einen Hammer und versuchte die Metallstifte glatt zu klopfen. Mit jeder Hand etwas anderes zu bewerkstelligen, dazu den Beschlagstock mit den Beinen zu halten, gelang ihm nicht recht.
Deswegen sollte ich die Gummisohle zwischen dem rechten Daumen und dem Zeigefinger auf dem Beschlagstock halten, und er klopfte die Stifte glatt. Das ging ein paar Schläge gut, dann war meine Fingerspitze mitsamt dem Fingernagel ganz flach, blutete und schmerzte entsetzlich.
Unerreichbare Wünsche machen auch einfache Seelen erfinderisch – wenn dabei etwas schiefging, war es einfach Pech.
Die Aufregung war groß, kurzerhand holte Mama Honig und Verbandszeug, drückte mein Fingerspitzchen in seine Form und bettete es in den Bienenhonig, der auf ein Leinentüchlein geträufelt wurde. Sie machte einen ordentlichen Verband um die kleine Hand, belehrte Markus, dass er vorsichtiger sein müsse, und mich, dass ich aufpassen und nicht solche Dummheiten machen solle.
Bis zum Schulbeginn im Herbst war der Finger längst wieder heil, und es zierte mich ein weiteres Verletzungsmerkmal lebenslänglich – das sieht man besonders gut beim Halten von Bleistift und Griffel, der rechte Zeigefinger und der Fingernagel sind gut sichtbar verunstaltet.
Ob solcherart Unfälle vermeidbar wären, ist fraglich. Gewiss ist: Sie haben auch ihr Gutes – Kinder lernen vorsichtig werden. Die genaue Beschreibung dieser Unfälle deshalb, weil eine ärztliche Behandlung oder Wundversorgung heute so nicht mehr vorstellbar wäre.
Schulzeit und Schulwege
1938 begann meine Schulzeit, das Hitlerregime hielt Einzug.
Inzwischen sind viele Jahre vergangen und dennoch verblassen diese Erinnerungen nicht. Die »schreckliche Behandlung der Juden und die grausamen Morde«, von denen manchmal unter den Erwachsenen die Rede war, und von den Umständen, die dazu geführt haben, dass Hitler mit offenen Armen empfangen wurde: Das ist eine lange Geschichte …
Am Schulanfang, nach unseren ersten Sommerferien, wurden die Kreuze aus den Klassenzimmern entfernt und auf den gleichen Nagel das Bild des Führers gehängt.
Mein Schulbeginn kam gerade recht, um alle Veränderungen in der kleinen Dorfschule, weitab vom großen Geschehen, mitzuerleben, bis zum Kriegsende 1945. Die meisten Kinder waren Bergbauernkinder und hatten einen Schulweg von einer halben bis zu zwei Stunden.
Ich brauchte eine Stunde für meinen Schulweg, im Winter wesentlich länger, ein Karrenweg, der zu drei Viertel der Strecke durch einen ziemlich steilen Wald führte und nur, wenn Holz transportiert wurde, offen war. Das Wort »geräumt« im Zusammenhang mit Schneeräumung war uns damals noch kein Begriff. Die meisten Kinder gingen gerne in die Schule, ob die Sonne schien, ob es regnete, schneite oder gar stürmte; in die Schule zu gehen, war eine Pflicht ohne Ausnahme. Wenn es kalt war, freuten wir uns auf den warmen Ofen, den die Frau Oberlehrer schon um 6 Uhr geheizt hatte. Bei gutem Wetter tummelten wir uns gerne auf dem Platz vor der Schule, der zum Turnen und zum Spielen in den Pausen für alle Kinder der zweiklassigen Volksschule – in jeder Klasse zwei Schulstufen – zur Verfügung stand. In den zwei Klassen wurden vier Jahrgänge, also in jeder Klasse zwei Schulstufen, unterrichtet, eine dritte Schulklasse war im alten Messner-Haus untergebracht. Diese Schulklasse reichte für die letzten vier Schulstufen, es sind ja immer einige »sitzen geblieben«. Die zwei Bankreihen mit vier oder fünf Bänken reichten da, in jeder Bank gab es drei Sitze, drei Tintenfässchen und drei Ablagerillen für Feder und Bleistift, unterm Tisch eine Ablage für Schulhefte. Stehen konnte man nicht richtig, weil Bank und Sitz zu eng miteinander verbunden waren.
Am Ende des ersten Schuljahres musste der Herr Oberlehrer (heute wohl Direktor) mit seiner Frau wegziehen – warum, wusste niemand von uns Kindern. Ein Fräulein Lehrer und das Handarbeitsfräulein durften bleiben. Lehrer kamen und mussten wieder gehen, besonders bei männlichen Lehrern war ein ständiger Wechsel. Sie wurden eingezogen zum Kriegs- oder Arbeitsdienst. Im vierten Schuljahr bekamen wir eine ganz junge Lehrerin, gerade erst mit ihrer eigenen Ausbildung fertig, sie blieb dann bis zu unserer Entlassung. Wir verehrten sie, versuchten, »ordentlich« zu sein, und taten alles möglichst so, damit sie zufrieden mit uns war. Die drei Lausbuben in der Klasse waren Bergbauernbuben, bisher immer in der letzten Bankreihe auf die »Eselsbank« verbannt wegen schlechten Betragens und unruhigen Verhaltens bei den Stillarbeiten, während die Lehrerin die zweite Stufe unterrichtete. Das Schönschreiben, Zeichnen und die Hausaufgaben waren für sie überflüssig, für Letzteres hatten sie auch gar keine Zeit. Daheim wartete die Arbeit auf dem Hof und im Stall, auch wenn sie noch Kinder waren; die Mitarbeit war einfach notwendig, denn der Krieg hatte zu viele Männer gebraucht.
Dieses neue Fräulein Lehrer nahm gleich am Anfang eine krasse Änderung vor. Die drei Lausbuben mussten nach vorne in die erste Bankreihe, getrennt. Dem Fräulein entging dadurch auch nicht die geringste Schlampigkeit, und Fehler, die sie machten, schon gar nicht. Einer tat sich wirklich schwer, mit dem blieb sie nach dem Unterricht in der Klasse und machte mit ihm die Hausaufgaben. Dank dieser Hilfe erreichte der Bub einen guten Schulabschluss und einiges in seinem Leben.
Im Unterricht wurde uns auch über das Kriegsgesche-hen erzählt, über den erfolgreichen Polenfeldzug und die folgenden Siege (nach jedem Sieg wurden die Kirchenglocken geläutet) – dass sie immer schwerer erkämpft wurden, natürlich nicht. An des »Führers« Macht und Stärke gab es keinen Zweifel. Zweifeln wäre Verrat gewesen, wenn auch im vierten Kriegsjahr auf einem Bergbauernhof in unserer Gemeinde der dritte Gefallene zu beklagen war, zwei Söhne und der Schwiegersohn. Der harte Kern glaubte an einen »Sieg über alles«.
Im Frühjahr '44 gingen wir in der Turnstunde in das Wäldchen oberhalb der Schule, um Brombeeren, Himbeeren und Heidelbeerblätter zu sammeln. Daraus sollte Tee für die verwundeten Soldaten in den Lazaretten bereitet werden. In der Handarbeitsstunde lernten wir das Stricken, Socken und Fäustlinge aus gesponnener Schafwolle, die die Bauernkinder von zu Hause mitbringen konnten. Wenn die Stricksachen gut und brauchbar waren, wurden sie eingesammelt und vor Weihnachten an eine Sammelstelle (Winterhilfe) geschickt. »Ein Weihnachtsgeschenk für die Soldaten an der Front«, das hat uns auch die Mühsal des Strickens vergessen lassen. Am Samstag mussten die »BDM«-Mädchen (Bund Deutscher Mädchen) und die Hitlerjungen »zum Dienst« gehen: Sport bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter Hitlerjugend-Lieder singen. Wir hatten uns zum vereinbarten Zeitpunkt vor dem Messner-Haus einzufinden.
Bei schlechtem Wetter, im »Klassen-Dienst«, wenn Hans und Erna – unsere Jugend-Führer, sie waren etwa sechzehn und siebzehn Jahre alt – fanden, wir könnten nicht richtig singen, mussten wir schon öfter mit zum »Hitlergruß« erhobener Hand bis zu zwei Stunden singen, Lieder wie »Die Fahne hoch« usw. – stehend natürlich! Auch das Verhalten bei »Fliegeralarm« lernten wir. Sobald die Sirene heulte, hieß es, rasch die Sachen zusammenzupacken, am Zaun entlang schnell in das nahe Wäldchen zu laufen und dort ruhig zu verharren, bis die Entwarnung kam. Wie leicht es war, mit den Parteiabzeichen Macht zu bekommen und auszuüben, wurden wir gewahr – und es blieb uns auch im Gedächtnis. Wie schnell Menschen, die eher machtlos waren und den Brotgebern verpflichtet, dazu bereit sind, Macht auszuüben, wurde uns allen erst im Erwachsenenalter richtig bewusst.
Gelernt haben wir trotz aller widrigen Umstände so viel, dass wir uns eine Zukunft aufbauen konnten. Vorteile des Unterrichts waren sicher die, dass wir alles schreiben mussten, Buchstaben schön auf der Zeile, Sätze bilden. Laut lesen und richtig betonen, lange Gedichte fehlerfrei aufsagen. Die Zahlen ordentlich in die Kästchen eintragen, Rechnungen in Reih und Glied schreiben. (Das nur im Gegensatz zu heute, wo nur noch Fragebögen ausgefüllt werden und Rechnungen digital gelöst, sicher mit viel größeren Anforderungen als damals.)
Die Schule begann um 8 Uhr. Nach einer Mittagstunde, in der wir beim Bäcker die mitgebrachte, warm gemachte Milch und einen »Hitler« dazu (ein lebkuchenähnliches Gebäck in einer besonderen Form) verspeist hatten, ging der Unterricht bis 15 oder 16 Uhr weiter. Im Spätherbst dunkelte es schon, wenn wir daheim ankamen.
An einen Samstag im Frühsommer 1942 war die Heuernte voll im Gange. Tage zuvor war das Wetter schlecht gewesen, also musste man zusehen, dass die Ernte eingebracht wurde. Jede Hand wurde gebraucht.
Vater erklärte mir, ich könne heute nicht zum »Dienst« gehen, ich würde zum Heueinfahren dringend gebraucht.
In der nächsten Woche teilte mir die Lehrerin mit, ich müsse für mein Fernbleiben vom »Dienst« eine Entschuldigung mitbringen.
Meine Eltern schrieben die Entschuldigung, getrauten sich aber nicht, die Wahrheit, dass ich bei der Heuernte gebraucht wurde, zu schreiben. Meine Eltern schrieben, mein Fuß, den ich mir bei dem Unfall mit der Sense verletzt hatte, habe so geschmerzt, dass ich den Weg kein zweites Mal machen konnte.
Die HJ-Führerin, ein Mädchen aus dem Dorf, verlangte für diesen Grund ein ärztliches Zeugnis: Wenn das bis zum nächsten »Dienst« nicht mitgebracht werden würde, würde sie dafür sorgen, dass Vater einrücken müsste, statt im Hinterland zu tachinieren – was so viel heißt wie »sich’s zu Hause gut gehen lassen«.
Der Arzt im Dorf war in Vaters Alter und genauso voller Hoffnung auf das neue Regime wie Hunderttausende, und genauso enttäuscht. Die Sache wurde geregelt: Ich hatte am nächsten Samstag das Zeugnis.
HJ und Schulwege
Auf unserem Bauernhof waren meist zehn bis zwölf Personen zu versorgen. Mein Ziehvater – in weiterer Folge einfach »Vater«, der er auch für mich wurde –, Großmutter, Großtante Kathi, Tante Moid, mein Stiefbruder Fritz – der ledige Sohn meines Ziehvaters –, der Markus, ich, kleinere Kinder und manchmal auch Tagelöhnerinnen. (Mama hat erst sechs Jahre nach meiner Geburt geheiratet.)
Für die anfallenden Arbeiten gab es immer zu wenig kräftige Hände. Alle Arbeiten im Haus, auf dem Feld und im Wald wurden gänzlich ohne technische Hilfe verrichtet.
Als Zugtier hatten wir eine Kuh, falls sich das jemand, der es nicht erlebt hat, überhaupt vorstellen kann. Zwei-, dreimal im Jahr musste mit der Kuh, die vor einen Karren gespannt wurde, in das Dorf gefahren werden. Einen Sack weißes Mehl, einen Sack Viehsalz, ein paar Kilo Zucker und einen Kanister Petroleum für die Lampen und die Stall-Laternen galt es zu besorgen.
Manchmal musste auch ein beschädigtes Werkzeug zum Schmied oder Wagner gebracht oder von dort abgeholt werden. Öfter war die Fahrt in das Dorf nicht nötig. Die Bauern waren Selbstversorger und hatten nur für das Nötigste Geld. Zündhölzer, Germ, Kindergrieß und zu Weihnachten ein paar Kilo Zibeben, getrocknete Weinbeeren zum Backen für das Weihnachtsbrot, wurden meist am Sonntag nach der Kirche gekauft. Die Läden hatten natürlich offen. Das nur zu den damaligen Konsumgewohnheiten und dem Geldmangel, den hauptsächlichen Folgen aus der Weltwirtschaftskrise und der folgenden Arbeitslosigkeit.
Vater hatte damals große Hoffnungen auf den »Führer« gesetzt, dass sich die Lebensumstände nun bald bessern würden. »Arbeit und Brot« hatte er allen versprochen. Vater befürwortete ohne zu zögern diese Partei. Er wusste, wie es war, keine Arbeit zu haben und somit auch das Nötigste zum Leben nicht. Die Bauern erhielten auch bald ein wenig Hilfe: Hilfsmittel wie eine Seilwinde, einen Eisenpflug, eine Gliederegge, eine Gülleanlage wurden subventioniert; so waren diese Anschaffungen eine große leistbare Arbeitserleichterung. Neuigkeiten erfuhren wir aus einer Wochenzeitung.
Der Nachbar besaß schon ein Radio, als Parteimitglied und Orts-Bauernführer stand es ihm zu und bekam es zu einem erschwinglichen Preis.
1941 spitzte sich die Lage im Kriegsgeschehen zu, meine Eltern hörten beim Nachbar, der bereits am Regime zu zweifeln begann, so oft es ging den »Schwarzsender«.
Rundum auf den Höfen mussten die Männer in den Krieg ziehen, die Nachrichten von gefallenen Soldaten mehrten sich. Vater war aufgrund seines Alters und der Lebensumstände vom Krieg »zurückgestellt«.





























