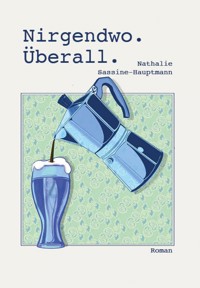
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Drei Generationen Frauen im Europa des letzten Jahrhunderts. Martha, die am Ende des 2. Weltkriegs vor den Russen fliehen muss. Lucia verlässt gleichzeitig das verarmte Sizilien, um sich ein Leben im Norden Italiens aufzubauen. Ihre jeweiligen Kinder Helmut und Sophia möchten in den späten Sechzigern dem Nachkriegsmief entkommen und die gewonnenen Freiheiten ausleben. In Paris, ihrer Wahlheimat, lernen sich kennen und verlieben sich ineinander. Ihre Tochter Mathilde wächst Ende des 20. Jahrhunderts ohne Wurzeln auf und findet in der Schweiz etwas ähnliches wie ein Zuhause. Drei Generationen, eine Familie. Allen fehlen Wurzeln, sie sind Flüchtlinge, Auswanderer, Einwanderer, Reisende. Vier Frauen-Schicksale, die am Ende die Frage aufwerfen: Was bedeutet Heimat? "Wo du herkommst ..." Für manche Menschen bedeutet das nirgends. Oder überall.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nirgendwo. Überall.
Für Oma Ruth, Nonna Pina, Opa Herbert, Nonno Nino, Mamma und Dad.
«Man ist, einmal gegangen, immer ein Gehender.»
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage
© 2024, Nathalie Sassine-Hauptmann
Lettenstrasse 8
8421 Dättlikon
Umschlaggestaltung: © Copyright by Patrick Sassine
Lektorat/Korrektorat: Miriam Seifert-Waibel
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Figuren
Kramer (Schieweck) / Deutschland (Ostpreussen und Bielefeld)
Bertha & Joseph Schieweck
Johanna Schieweck
Lieschen Schieweck
Martha Kramer, ehemals Schieweck
Hans Kramer
Leone (Torre) / Italien (Sizilien und Turin)
Lina Leone
Salvatore Leone
Lucia Leone, ehemals Torre
Gelsomina Leone
Calogero Torre
Kramer (Leone) / Paris, Schweiz
Sofia Kramer-Leone
Helmut Kramer
Mathilde Kramer
Kapitel 1 Martha, Januar 1945
Martha wollte nicht gehen. Sie stand vor ihrem halb gepackten Koffer, der offen auf ihrem ungemachten Bett lag. Es war das erste Mal, dass sie ihr Geschenk zum 18. Geburtstag im letzten Mai nutzte. Wo hätte sie auch hinreisen sollen, mitten im Krieg? Bis jetzt hatte sie zwei Wollkleider und die Strickjacke eingepackt. Letztere nahm sie wieder raus, schliesslich war es Winter und wenn sie die Jacke unter dem alten Mantel ihrer Grossmutter tragen würde, müsste sie weniger schleppen.
Martha schwitzte trotz der Kälte im Haus. Sie hatte schon lange nicht mehr gebadet, das Wasser im Brunnen war gefroren. Ihre dunklen Locken hingen ihr in die Stirn und ihr sommersprossiges Gesicht war gerötet. Sie kaute auf der Innenseite ihrer Wange, während sie versuchte, die aufsteigende Panik – und die damit einhergehenden Tränen – zu unterdrücken. Zwei dumme Angewohnheiten, weswegen ihre Mutter sie regelmässig rügte. Martha konnte vor Wut heulen, sie weinte, wenn sie traurig war, bekam feuchte Augen vor Glück und seit Neuestem tränten ihre Augen, wenn sie in Panik geriet. Der leichte Schmerz der Bisse lenkte sie ab. Manchmal blutete es auch. Sie atmete tief durch und versuchte, sich wieder auf das Packen zu konzentrieren.
Martha war nicht zierlich und schon gar nicht zimperlich. Sie gehörte zu den Frauen, die man in Ostpreussen «robust» und «tüchtig» nannte. Was nur bedeutete, dass die meiste Arbeit an ihr hängen blieb. Ausserdem konnte Martha «gut reden – wie ihr Vater», was auch immer das heissen sollte. Martha setzte sich erschöpft neben ihren Koffer. Wie immer war ihr Bett nicht gemacht, das Zimmer unaufgeräumt. Sie empfand diese Aufgaben als Zeitverschwendung. Ihre Mutter Bertha brachte diese Unordnung regelmässig zur Weissglut.
Marthas jüngste Schwester, Lieschen, war die Ordentliche der drei Schieweck-Mädchen. Ein hübsches, blondes Kind, aber nicht besonders praktisch veranlagt. Johanna hingegen – die Mittlere – konnte durchaus mitanpacken, aber nicht so, wie sie das gewollt hätte. Sie war als Kind an Polio erkrankt und hinkte seither, da das rechte Bein kürzer war. Dass sie die Krankheit überlebt hatte, grenzte an ein Wunder und entsprechend wurde sie von der Familie auch behandelt. Einen Mann würde sie wohl nie finden mit ihrer Behinderung, davon war Vater überzeugt. Martha vermutete, dass er insgeheim froh war, seine Johanna nicht hergeben zu müssen.
Martha ärgerte, dass ihre kluge Schwester mit denselben strahlenden blauen Augen und dicken dunklen Locken wie sie selbst als «Krüppel» abgetan wurde. Johanna war witzig, scharfzüngig und herzensgut. Martha konnte sich nicht vorstellen, dass es keinen Mann geben sollte, der sich eine solche Frau an seiner Seite wünschte. Aber Johanna war ja auch erst 16, da würde noch viel passieren. Gleichzeitig war sich Martha bewusst, dass von ihr selbst erwartet wurde, eine «gute Partie» zu machen.
Auch wenn sie keineswegs arm waren. Der Hof der Schiewecks in Prositten war kein Palast, aber er lief gut. Zumindest bis der Krieg nach Ostpreussen gekommen war. Marthas Vater, Joseph Schieweck, ein grosser, schlaksiger Mann, war im Dorf angesehen. Die Front war ihm diesmal erspart geblieben. Das unübersehbare Nachziehen seines linken Beines – eine Verletzung, die er sich im letzten Krieg zugezogen hatte – hatte ihn davor bewahrt, eingezogen zu werden. Bei der letzten Dorfversammlung hatte er allen Frauen, Kindern, Alten und Krüppeln dringend geraten, unverzüglich das Dorf zu verlassen und in Richtung Westen aufzubrechen. «Nur vorübergehend», hatte er den entsetzten Dorfbewohnern versichert. Die Guts- und Hofbesitzer, alles alte oder untaugliche Männer, sollten hierbleiben und den Russen abwehren. Der Gedanke liess sie erschauern. Der Russe, wie man die rote Armee hier nannte, stand schon so lange für den Feind, dass Martha diese Männer gar nicht mehr als einzelne Soldaten sah. Der Russe war eine Masse, undefinierbar gross, ein riesiger Klumpen, der sich bedrohlich auf sie zubewegte. Was wohl an den Gerüchten dran war, dass sie mordeten und verwüsteten?
Der Russe hatte die Grenze vor ein paar Wochen überschritten und was gestern noch als defätistisch gegolten hatte, klang jetzt wie ein Marschbefehl von Hitler persönlich: «Packt eure Sachen und haut schleunigst ab!» Alle Bewohner Ostpreussens waren angehalten, ihre Häuser und Höfe zu verlassen und in den Westen zu fliehen. Der Führer selbst war schon längst wieder in Berlin, nachdem er einige Monate in seiner Wolfsschanze bei Rastenburg verbracht und den Endsieg prophezeit hatte. Der regionale Gauleiter war ebenfalls verschwunden – wohin, das wusste niemand.
Martha zweifelte ernsthaft daran, dass die paar Männer, die im Dorf bleiben wollten, den Hauch einer Chance hatten, es zu verteidigen. Ihr Vater hatte seine Familie nach der Versammlung beruhigt: «Wir werden sie vielleicht gar nicht bekämpfen müssen. Die sind doch auch kriegsmüde. Und vielleicht sind es gar nicht so viele, wir liegen hier nicht auf ihrer Hauptachse. Macht euch keine Sorgen.» – «Aber wieso müssen wir dann weg? Wir sollten hier bei dir bleiben! Wieso solltest du ohne uns besser dran sein? Wer wird für dich sorgen, was wirst du essen?», hatte Martha gefragt. Sein Blick verfinsterte sich: «Die Russen sollen unsere Frauen gar nicht erst zu Gesicht bekommen.» Mehr sagte er dazu nicht. Martha wusste, was er meinte. Doch sie würde sich zu wehren wissen! Oder?
Ihre Mutter Bertha vermochte sie nicht darauf anzusprechen, die war so in sich gekehrt seit der angeordneten Flucht, dass man nichts mit ihr anfangen konnte. Ein Licht schien in ihr erloschen zu sein, als ahnte sie etwas, das den anderen verborgen blieb. Martha hatte sie früher zu ihrem Vater sagen hören: «Drei Mädchen. Womit haben wir das verdient?» Es gab keinen männlichen Erben auf dieser Seite der Familie. Die Schiewecks hatten «nur» drei Töchter in die Welt gesetzt, was Joseph öfter den einen oder anderen Witz in der Dorfkneipe beschert hatte. Heute fand das niemand mehr lustig, am allerwenigsten Bertha. Ihre einst resolute Art war einem in sich gekehrten Verhalten gewichen. Sie schien sich dauernd Sorgen zu machen, war in Gedanken versunken. Vor dem Krieg war es die Sorge um die Mitgift gewesen, die früher oder später fällig sein würde. Und jetzt die russischen Soldaten. «Das musste ja so kommen», murmelte sie manchmal vor sich hin.
Seit Hitler an der Macht war, kritisierte sie Martha fortwährend wegen ihres Führereifers: «Ich verstehe einfach nicht, wie man einem einzigen Mann so vollkommen bedingungslos folgen will!» – «Aber er tut doch so viel Gutes für uns, er baut Strassen, schafft Arbeitsplätze. Wir können wieder stolz auf unser Land sein. Stolz darauf, Deutsche zu sein!», argumentierte Martha hitzig. Mutter schüttelte nur resigniert den Kopf. «Hier, im Osten des Landes, hat der Führer nichts für die Leute getan, was wir nicht selbst zustande gebracht hätten.» Da hatte sie recht. Das musste Martha eingestehen. Die Menschen in Ostpreussen brauchten niemanden, sie waren stolze Arbeiter, die keine Mühen scheuten und ihr Leben meisterten.
«Auch wenn viele hier im Dorf was anderes behaupteten: Krieg bedeutet nie etwas Gutes.» Eines der seltenen Male, in denen Mutter aus ihrem Leben erzählte, erklärte sie Martha, dass der letzte Krieg schon zu viele Opfer gefordert hatte. Sie sassen in der Küche, Martha schälte Kartoffeln und Bertha machte Vorräte ein für den Winter. Rüben, Randen und Gurken. «Damals habe ich meinen Vater verloren. Nicht in einer Schlacht, sondern an den Wahnsinn, der ihn danach befiel.» Sie füllte die Gläser mit Gemüse, das Geräusch des schliessenden Deckels ploppte in der Stille. «Nach Kriegsende kehrte er zu uns zurück, war aber nie wieder der Alte. Er zitterte den ganzen Tag wie Espenlaub und nachts schrie er im Schlaf.» Mutter war den Tränen nahe gewesen, was Martha bei ihr noch nie erlebt hatte. Lauter fuhr sie fort: «Und jetzt? In diesem Krieg müssen sogar die Frauen ihre Heimat verlassen!» Daraufhin stapfte sie schnaubend aus der Küche in den Hof. Martha war betroffen sitzen geblieben, noch nie hatte sie ihre Mutter so aufgebracht gesehen.
Seit der Versammlung stritt Mutter immer wieder mit Vater, in der Hoffnung, dass er es sich anders überlegen und sie trotz allem nicht wegschicken würde. Joseph liess nicht mit sich reden, er war überzeugt, das Richtige zu tun – für sie, für die Mädchen, für seine Familie, für sein Land. Er wollte bleiben und sie sollten sich in Sicherheit bringen. «Punkt und Schluss!»
Martha schloss ihren Koffer, der jetzt prall gefüllt war, und stellte ihn hinter die Tür. Schwerfällig stieg sie die schmale Holztreppe hoch, in das kleine Zimmer, das sich Lieschen und Johanna teilten. Johanna sass auf ihrem Bett, rieb sich die Hüfte und verzog das Gesicht. «Schlimm?», fragte Martha. «Heute ja. Die Kälte, die Feuchtigkeit…» Johanna war mit ihrem Gebrechen gross geworden und beklagte sich nur selten. Das kürzere Bein verursachte ihr Schmerzen in der Hüfte, warme Kompressen und leichte Massagen halfen ihr über das Gröbste hinweg. Martha wollte sofort los eilen und ein Kirschkernkissen holen. «Lass mal, das geht schon. Hilf Lieschen lieber beim Packen.» Johanna schmunzelte und nickte in die andere Zimmerecke. Erst da sah Martha Lieschens offenen Koffer auf dem Bett – vollkommen leer bis auf ihr Tagebuch, dass die Eltern ihr vor einem Monat zu Weihnachten geschenkt hatten. «Lieschen, was machst du denn? Du hast ja noch gar nichts gepackt!» Martha schnaubte verärgert. Lieschen stand den Tränen nahe vor dem offenen Schrank.
Die Mädchen hatten in den letzten zwei Jahren kaum Neues zum Anziehen bekommen. Das 13-jährige Lieschen war diesen Winter in die Höhe geschossen und alle ihre Kleider waren ihr zu kurz. Mutter hatte sie schon einige Male ausgelassen, aber mehr ging nicht. Auch die Kleider ihrer grossen Schwestern sahen an Lieschen aus, als wären sie beim Waschen eingegangen. «Ich habe nichts zum Anziehen!», jammerte sie. «Himmelherrgott Lieschen, wenn das dein einziges Problem ist, dann geht es dir ja verdammt gut!», fauchte Martha. Lieschens Weinerlichkeit sorgte bei den Schiewecks immer wieder für Streit. Martha verstand nicht, warum Lieschen so verwöhnt und anspruchsvoll war. Zumal sie mehr Kleider hatten als die meisten im Dorf, da Mutter alles selbst nähte. Gleichzeitig tat ihr die Kleine leid. Sie war das Nesthäkchen und mit der Situation vollkommen überfordert.
Martha rollte die Augen und stürmte aus dem Zimmer, damit der Streit nicht ausartete. Sie polterte die Treppe runter, um kurz darauf wieder schnaufend raufzukommen. Sie hatte zwei Kleider über dem Arm: ein braunes, das andere dunkelgrün. Das eine war aus Wolle, das andere praktisch geschnitten und für wärmere Tage. In diesem Winter hatte Martha Zweifel, ob es solche je wieder geben würde. Der Januar hatte bisher nur Stürme, Schnee und Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt gebracht. Das machte Martha am meisten Sorgen, wenn sie an die bevorstehenden Wochen dachte. Wie sollten sie so lange und weit marschieren bei dieser Eiseskälte? Niemand konnte ihr aus eigener Erfahrung berichten, wie es war, zu fliehen. Kilometer um Kilometer hinter sich zu lassen, ohne das genaue Ziel zu kennen. Wo sollten sie schlafen? Was essen, wenn ihre Vorräte aufgebraucht wären? Und die Pferde? Martha wischte diese Gedanken weg, sie musste nach vorne schauen, sie war verantwortlich für ihre Schwestern, ihre Mutter. Und nicht zuletzt wollte sie ihren Vater stolz machen und in ein paar Monaten hoch erhobenen Hauptes zurückkommen. Nach Hause.
Lieschen sah sich die Kleider an und traute sich nicht noch einmal, die Nase zu rümpfen. «Danke dir … Martha? Wo gehen wir hin?» Jetzt schossen Lieschen die Tränen aus den Augen. Martha schluckte schwer, sie konnte Lieschen nicht in die Augen schauen. Johanna war aufgestanden, um Lieschen zu trösten, wie sie das immer tat. Auch sie blickte Martha fragend an. Wo würden sie hingehen?
Der Plan war, dem Flüchtlingsstrom zu folgen, der seit ein paar Wochen vor ihrer Haustür auf der Hauptstrasse entlangschlurfte. Ostpreussen war seit Anfang Januar 1945 von der russischen Armee umzingelt. Man konnte nicht mehr mit dem Zug in den Westen fahren wie noch im Herbst. Es blieb nur der Weg Richtung Norden an die Ostsee und die Hoffnung, auf ein Schiff in Richtung Lübeck zu kommen.
Der Menschenstrom machte Martha Angst. Sie hatte noch nie so viele Menschen gesehen, zu Fuss, auf Fuhrwerken. Jeden Tag passierten alte Männer, zahlreiche Kinder und Dutzende Frauen, teils mit frisch Geborenen im Arm, ihren Hof. Manchmal kamen kleine Gruppen zu ihnen und baten um Unterkunft und etwas zu essen. Die Schiewecks teilten mit ihnen, was sie hatten. Viel war es nicht. Joseph überliess den Vertriebenen die Scheune für die Nacht, während Bertha Suppe kochte. Sie schien jeweils wenig begeistert davon, Fremde auf dem Hof zu haben, aber ihre katholische Erziehung liess es nicht zu, diesen Menschen nicht zu helfen. Die Flüchtenden blieben jeweils für eine Nacht und marschierten am nächsten Tag weiter in Richtung Küste. Martha war noch nie am Meer gewesen, sie konnte sich kaum vorstellen, wie es da war. Für sie war das alles sehr weit weg, der Westen des Deutschen Reichs schien ihr unerreichbar.
Martha hatte schon immer reisen wollen. Ihr Vater erzählte nicht viel vom letzten Krieg, aber wenn, dann ging es immer um fremde Länder: Frankreich, Belgien, Italien … Das klang alles so exotisch und spannend. Wie wohl Feigen schmeckten? Das Brot in Frankreich nannten sie «Baguette» und in Belgien sprach man drei Sprachen! Martha ahnte, dass es so viel mehr auf dieser Welt gab als ihren Bauernhof, das Dorf und das Leben auf dem Land. Aber sie hätte nie gedacht, dass sie ihre erste Reise unter solchen Umständen antreten würde – mit den Schwestern und der Mutter im Schlepptau. Auf der Flucht vor bösen Männern. Bertha war schlicht zu alt, um auf dieser Reise ins Ungewisse die Führung zu übernehmen. Die Eltern hatten spät geheiratet, Bertha war erst mit knapp 30 zum ersten Mal Mutter geworden. Als Älteste musste Martha also die Verantwortung übernehmen, sie war eben die «Tüchtige», die «Fähige». Sie musste sich eingestehen, dass sie manchmal gerne getauscht hätte, gerne weniger fähig gewesen wäre. So mussten sich Männer fühlen. Von ihnen wurde erwartet, stark zu sein. Aber vielleicht wollten auch sie manchmal beschützt werden?
Martha verliess das Zimmer der Schwestern, ohne ihnen befriedigende Antworten auf ihre drängenden Fragen geben zu können. Sie wusste auch nicht mehr als die Mädchen. Morgen sollte es losgehen. Sie wollten bei Sonnenaufgang starten, um bereits am ersten Tag möglichst weit zu kommen. Martha hatte mit ihrem Vater die Karte studiert. Sie würden nordwestlich, Richtung Küste steuern, bis sie ans Frische Haff kämen. Von da aus müssten sie dann weiter schauen. Niemand wusste, wie die Lage da oben war. Bis Frauenburg waren es knapp 80 Kilometer. Martha war gut zu Fuss und hätte das sicherlich in vier Tagen geschafft. Mit Mutter und Johanna musste sie jedoch mindestens doppelt so viel Zeit einrechnen. Martha hoffte, unterwegs Bauernhöfe oder wenigstens Scheunen für die Übernachtung zu finden. Sonst müssten sie im Fuhrwagen schlafen. Marthas Kopfhaut zog sich zusammen bei dem Gedanken. Die Innenseite ihrer Wange blutete. Martha spürte, wie die zerbissene Stelle anschwoll. Im Kopf ging sie nochmals durch, was alles auf den Fuhrwagen gehörte – und schauderte. Wie war es so weit gekommen, dass sie sich überlegen musste, ob sie lieber Stroh oder Geschirr mitnehmen sollten? Ihre Wange pochte.
Sie hatte an dem Führer geglaubt! Als 14-Jährige war sie in den Bund Deutscher Mädel eingetreten, mit glänzenden Augen und erhobenen Hauptes. Wie stolz sie damals auf ihren Ausweis und ihre Uniform gewesen war! Ihre Zöpfe trug sie auf dem Ausweisfoto mit Stolz, Rock und Jacke sassen perfekt, der Stempel mit dem Hakenkreuz bewies, dass sie dazugehörte. Mutter war damals alles andere als begeistert gewesen. Martha war froh gewesen, dass der Bund Deutscher Mädel obligatorisch war, somit hatte Mutter sich damit abfinden müssen.
Martha liebte die sportlichen Aktivitäten, die Zeltlager im Freien und die Musikabende mit ihren Freundinnen. Sie war begeistert von den Liedern, bei denen ihr die Tränen kamen und sie das Gefühl hatte, etwas Grösserem, Erhabenen anzugehören. Sie würden endlich etwas verändern können! Einzig die Tatsache, dass es bei den Mädchen vor allem darum ging, später eine gute Mutter und Hausfrau zu sein, ärgerte sie. Sie wollte einen Beruf erlernen! Nur Kinder kriegen und dem Mann zu dienen, wie ihre Mutter und Grossmutter, konnte sie sich nicht vorstellen. Hatten die Frauen doch in den letzten Jahren bewiesen, dass sie genauso fähig waren, Berufe auszuüben, die sonst den Männern vorbehalten waren. Während die Männer an der Front waren, hatten die Frauen übernommen. Im Dorf fuhren die Bäuerinnen den Traktor und die Hausmägde kümmerten sich um die Pferde. Martha fragte sich manchmal, wie es gewesen wäre, hätte man auch ihren Vater eingezogen. Hätte Mutter übernommen? Oder wäre schon viel früher alles an Martha hängen geblieben? Ihre Mutter war hart, aber nicht zäh. Sie war tüchtig, aber nicht stark. Martha vermutete, dass Bertha sich verkrochen und über die Situation gejammert hätte. Und schämte sich sofort. Es war müssig, darüber nachzudenken. Der Krieg war verloren. Laut durfte man das natürlich nicht sagen, aber Gedanken dazu machte sich Martha täglich. Einerseits war sie darüber untröstlich, wofür hatten sie all die Jahre Entbehrungen erduldet? Andererseits wünschte sie sich nur noch, dass es endlich vorbei wäre.
Spätestens nach der Bombardierung von Königsberg und der Einberufung junger Burschen und vieler alter Männer für den «Volkssturm» war sie überzeugt gewesen, es müsse bald vorbei sein. Und das, obwohl die Schlacht von Tannenberg 1914 den Nationalsozialisten als Vorbild für den Endsieg galt. Damals hatte man den Russen erfolgreich abgewehrt und so sollte es auch diesmal geschehen. Ein Trugschluss, wie die letzten Monate zeigten. Wie man sich an Siegen festhalten konnte, die über 20 Jahre zurücklagen, war Martha ein Rätsel.
1933, als Hitler gewählt worden war, war Martha gerade mal sieben gewesen. Sie konnte sich kaum erinnern. Aber sie wusste aus der Schule, dass damals alles sehr vielversprechend geklungen hatte. Der neue Reichskanzler wollte den Deutschen wieder Arbeit geben. Wohlstand. Keiner sollte ihnen je wieder Wäsche von der Wäscheleine, Rüben aus dem Boden stehlen. Ob das nun die Juden waren oder nicht, war Martha vollkommen egal. Soviel sie wusste, kannte sie keine Juden, geschweige denn verstand sie, was mit diesen Leuten nicht in Ordnung sein sollte, ausser, dass sie nicht katholisch waren. Hitler behauptete, sie seien «Untermenschen», und er musste es ja wissen. Sie waren wohl dafür verantwortlich, dass es dem Land finanziell dreckig ging, aber davon verstand Martha nichts. Dennoch hatte auch sie Angst davor gehabt, dass die Armut bis zu ihnen nach Ostpreussen kommen könnte. Wenn der Führer das abzuwenden wusste, war das eine gute Sache!
Der Pfarrer sprach sonntags nicht darüber und sie wagte es nicht, ihn danach zu fragen. Aber irgendwas mussten diese Juden ja verbrochen haben, wenn sie von allen so sehr gehasst wurden. In der Schule war viel über sie gelästert worden, aber Martha mochte nicht mitreden. Nun gab es seit ein paar Monaten Gerüchte im Dorf, dass sie in Lagern gefangen gehalten wurden. Eines der Lager war wohl gerade eben von den Alliierten entdeckt worden. Aber Arbeitslager waren in einem Krieg ja normal, oder etwa nicht? Martha hatte gehört, dass auch die Russen deutsche Soldaten in Arbeitslager steckten. Nach dem Krieg würden alle bestimmt schnell nach Hause geschickt werden.
Martha ging über den Hof in den Stall, um nach den Pferden zu sehen. Ihre Nasenhaare froren sofort ein, sie wickelte sich ihren Wollschal um die Ohren, der Wind liess ihren Atem stocken. Es war bereits dunkel und sie musste aufpassen, wo sie hintrat, um nicht auszurutschen. Im Stall angekommen, zündete sie die Kerze in der Laterne an. Petrol für die Lampe gab es schon lange keines mehr. An den kleinen Fenstern entdeckte sie Eisblumen, die Pferde stiessen weisse Wolken aus. Sie waren ziemlich klapprig geworden in den letzten Monaten, so wie Martha und ihre Familie auch. Ihr Schützling Pinto schaute ihr müde entgegen. «Du kriegst nicht genug zu fressen», seufzte Martha und strich ihm über die samtweiche Haut um die Nüstern. Sie konnte nichts dagegen tun. Sie hatte eine Steckrübe für ihn aus der Küche gestohlen, wie immer, wenn sie ihn besuchte. «Schnell, bevor Mutter die Wruke{1} für ihre Suppe vermisst!» Martha gab ihm die Rübe, die er gierig zermalmte. «Bist du bereit für das grosse Abenteuer?» Sie versuchte, fröhlich zu klingen, wohl wissend, wie sensibel diese Tiere waren. Als ob er sie verstehen würde, nickte Pinto und seine Mähne wippte auf und ab. Martha musste lachen. Er stupste sie fordernd an die Schulter. «Tut mir leid, alter Junge, mehr habe ich heute nicht!» Sie klopfte ihm auf den Hals, sein Fell war matt und stoppelig, Martha griff zur Bürste und begann, es zu bearbeiten. Eine Tätigkeit, die sie immer zu beruhigen vermochte. Nebst Pinto waren ihnen noch zwei alte Trakehner{2} geblieben. Alle anderen Pferde waren eingezogen worden.
Rudolf, der alte Knecht, der jahrelang für die Schiewecks gearbeitet hatte, war vor ein paar Wochen in den «Volkssturm» eingezogen worden. Die drei Rösser waren seither praktisch auf sich allein gestellt. Und morgen würden sie mit zwei von ihnen den Hof verlassen. Die Stute würde nicht mitkommen können, sie war schlicht zu alt. Was wohl mit ihr passieren würde? Würde der Russe sie mitnehmen? Martha zwang sich, an etwas anderes zu denken, und sah sich im Stall um. Wie heruntergekommen er wirkte! Es gab keine zusätzlichen Decken mehr, die brauchten sie selbst. Die Sättel waren schon lange nicht mehr eingefettet worden. Wozu auch? Es war kalt und feucht. Rudolf hatte ein paar seiner Arbeitshosen an einen Haken gehängt. Martha nahm sie runter und drehte sie neugierig hin und her. Es musste schon viel bequemer sein, mit Hosen zu arbeiten. Ihre Kleider und Röcke fand Martha so unpraktisch, immer verfingen sie sich irgendwo und waren im Weg. Sie sah sich um, sie war allein. Fröstelnd zog sie sich die Stiefel aus, klemmte sich den Rocksaum unters Kinn und schlüpfte in Rudolfs Hose. Sie war ein wenig zu lang und natürlich zu weit, aber das war ihr egal. Sie brauchte einen Gürtel, den würde sie von Vater ausleihen müssen. Schnell zog sie ihre Stiefel wieder an und liess den Rock über die Hose gleiten. Sie tätschelte Pintos Hals zum Abschied und schlich zum Haus rüber. Martha war jetzt froh um die frühe Dunkelheit, so lief sie kaum Gefahr, von ihrer Mutter gesehen zu werden. Ihre Tochter mit Hose, das hätte Bertha gerade noch gefehlt!
«Ich habe dich überall gesucht!» Martha schrak zusammen, als sie in der Diele Johannas Stimme hörte. Sie versuchte, die hervorlugenden Hosen unter ihrem Rock zu verstecken. Zu spät. «Was hast du denn an?», rief Johanna aus, als sie Martha im schwach beleuchteten Windfang besser sehen konnte. «Psst, nicht so laut!» Martha hielt ihrer Schwester die Fingerspitzen auf den Mund. «Das ist Rudolfs Hose. Die werde ich morgen anziehen, das ist viel praktischer als die ollen Kleider!» Johanna sah Martha zweifelnd an. «Den Eltern wird das nicht gefallen.» – «Vater schickt uns alle weg. Was ich anhabe, sollte seine letzte Sorge sein», wandte Martha verärgert ein. Johanna zuckte mit den Schultern und humpelte Richtung Küche. «Komm jetzt, wir essen.» – «Gib mir eine Minute, ich bringe die Hose nach oben.» Kurz darauf kam Martha schnaufend wieder runter und blieb vor dem Esstisch stehen. «Wo warst du denn?» Joseph schaute von seinem Teller hoch. «Im Stall, ich wollte nach den Pferden sehen.» Joseph nickte und löffelte weiter seine Suppe. Eine dünne, wässerige Brühe aus Toffle{3} und Wruken, wie fast jeden Abend seit Weihnachten. Ausnahmsweise waren sie heute allein, die Flüchtenden waren bei den Nachbarn untergekommen.
«Wir brechen dann morgen auf, sobald es hell wird», unterbrach Martha das schweigende Schlürfen. Es ärgerte sie, dass Vater ihre Abreise mit keinem Wort erwähnte. Alle ausser ihm würden morgen in die Fremde ziehen. Sie wussten nicht, wann und ob sie sich wiedersehen würden, und er tat so, als wäre es ein normaler Abend wie jeder andere. Er nickte. Bertha wuselte in der Küche herum, betätigte sich am Holzofen und wischte sich die Hände immer wieder an der dreckigen Schürze ab. Sie sass immer seltener mit ihnen am Tisch. Martha war sich sicher, dass sie deshalb nie richtig ass, sofern man in diesen Zeiten überhaupt von «richtig» reden konnte.
Lieschen löffelte ihre Suppe, die sich durch ihre tropfenden Tränen noch mehr verdünnte. Sie stand Vater nicht besonders nahe, keine von ihnen tat das. Er war das Familienoberhaupt und in dieser Position ziemlich unnahbar. Aber Lieschen schien die Vorstellung, dass er hierbleiben würde, mehr zu beunruhigen, als jene, allein loszuziehen. Natürlich teilte Martha ihre Furcht. Ihre Schwestern hatten sie schon oft danach gefragt. «Was wird aus Vater?» Sie sah zu ihm, der über seinem Teller hing und gedankenverloren aufgehört hatte, zu essen. Er sah niemanden von ihnen an, stierte geradeaus ins Nichts. Seine blauen Augen leuchteten nicht wie üblich, der Schalk war aus seinem Blick gewichen. Martha glaubte, einen Anflug von Angst darin zu erkennen.
Johanna war heute Abend auch sehr still. Die trotz ihrer Behinderung immer fröhliche, schwatzhafte und lustige Schwester fand keine Worte mehr, um ihre Familie aufzumuntern. Ob sie Angst hatte, konnte Martha nicht sagen, Johanna wirkte immer aufgestellt und im Zuge ihres Gebrechens hatte sie schon vor langer Zeit allen bewiesen, wie tapfer und belastbar sie war.
Die bedrückte Stimmung dauerte das gesamte Abendessen hindurch an, Bertha liess sich kaum blicken, das Geplapper, das die Schieweck’schen Abendessen normalerweise begleitete, blieb heute aus. «Morgen wird ein langer Tag», waren Vaters Gute-Nacht-Worte an die Mädchen. Schwerfällig stand er auf und stapfte ins elterliche Schlafzimmer. Später hörte Martha, wie Mutter weinte und ihren Mann nochmal anflehte, mit ihnen zu kommen. Seine Stimme hörte sie nicht, wahrscheinlich hielt er sie im Arm und versuchte, unbeholfen und schweigend, sie zu trösten. Was hätte es auch noch zu sagen gegeben? Seine Entscheidung stand fest. Er würde seinen Hof nicht einfach so dem Russen überlassen.
Nachdem Joseph im grossen Krieg verwundet worden war, Monate im Lazarett verbracht hatte und endlich wieder in seiner Heimat angekommen war, hatte er etwas Sinnvolles tun wollen. Er war kein gebildeter Mann, aber er konnte auch hart arbeiten. Was er die nächsten Jahre auch tat, anfangs allein. Dann heirateten er und Bertha und kümmerten sich fortan gemeinsam um Haus und Land. 1939 wurde Joseph beauftragt, zusammen mit anderen Bauern den Nährstand des Dorfes zu erhalten, weshalb sie die Pferde hatten behalten dürfen. Die drei Töchter waren im Abstand von jeweils drei Jahren zur Welt gekommen. Dazwischen hatte es ein paar Fehlgeburten gegeben und eine weitere Tochter war im Kindsbett gestorben. Bertha und Joseph nahmen das mit Gleichmut. Das Leben war nun mal hart, das hatte man den beiden schon als Kinder beigebracht. Zeit zu trauern hatten sie nicht gehabt. Und jetzt sollte er alles aufgeben? Dem Russen sein Lebenswerk auf dem Tablett servieren? Das kam für Joseph nicht infrage, er würde bleiben und mit etwas Glück würden die feindlichen Truppen an seinem Hof vorbeiziehen. Wenn nicht, war er ein guter Schütze.
Nach dem Abendessen verzogen sich alle schweigend ins Bett. Martha betrat ihr kleines, eiskaltes Zimmer. Wann würde sie all das wiedersehen? Das Kreuz über ihrem Holzbett, die alte Truhe, die später ihre Mitgift hätte enthalten sollen? Martha zog ihr Nachthemd an und darüber die Wolljacke. Sie zog ihre Wollmütze tief in die Stirn, schloss die Augen und versuchte, tief durchzuatmen. Zum ersten Mal seit der Entscheidung vor ein paar Tagen gestand sie sich ein, dass sie eine Heidenangst hatte. Nicht vor den Russen, nicht vor der Kälte, nicht einmal vor den Bomben, die seit Kurzem auf Ostpreussen regneten. Martha fürchtete sich vor der Ungewissheit. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie es da aussah – am Meer. Würden sie ein Schiff nehmen müssen? Wohin? Was würden sie vorfinden? Sie waren weiss Gott nicht die einzigen Vertriebenen. Es gab Tausende wie sie. Gab es im Westen überhaupt Platz für all diese Menschen? Gab es da zu essen? Eine Unterkunft?
Wie jeden Abend kniete Martha sich hin, um zu beten. Ihr Gebete klangen immer noch wie jene, die sie als Kind gelernt hatte. «Lieber Gott, bitte steh’ uns morgen bei und hilf uns, den richtigen Weg zu finden. Ich weiss, dass du ein guter Gott bist und nur jene bestrafst, die wirklich böse sind. Ich werde alles tun, damit wir einen sicheren Ort finden, wo wir warten können, bis dieser Krieg endlich vorbei ist.»
Ihre beste Freundin Käthe war mit ihrer Mutter, Tante und zwei Cousinen schon vor Weihnachten geflohen. Sie hatte es Martha erst am Abend vor ihrer Abreise erzählt und sie schwören lassen, es für sich zu behalten. Käthes Familie hatte sich wochenlang heimlich auf die Flucht vorbereitet. Zu jenem Zeitpunkt hatte ihnen deswegen noch die Todesstrafe gedroht. Martha hatte die Leichen gesehen, die an den Bäumen hingen. «Volksverräter» hatten die Parteimitglieder geschimpft. Die anderen Dorfbewohner hatten geschwiegen. Genauso wie Mutter und Vater.
Käthe hatte Martha erzählt, dass sie fürchterliche Angst hatte. Mehr vor den deutschen Soldaten als vor den Russen, vor denen sie flüchteten. Sie habe ihre Mutter angefleht, hierzubleiben, sie wollte nicht am Baum hängen! Martha wollte jedoch nicht glauben, dass die Gehängten «nur» Flüchtlinge waren. Die hatten bestimmt noch anderes verbrochen, waren desertiert oder hatten gegen das Vaterland gehetzt. Es konnte doch nicht sein, dass sie umgebracht wurden, weil sie sich in Sicherheit bringen wollten! Auch Käthes Familie waren rechtschaffene Menschen, die dem Führer immer treu gewesen waren. Käthe war mit Martha vor fünf Jahren in den BDM eingetreten, wenngleich die Freundin nicht ganz so begeistert wie Martha gewesen war, die es später zur Gruppenführerin gebracht hatte. «Bei dem Mundwerk!», hatte Joseph gelacht und ihr auf die Schulter geklopft. Ihren Vater so stolz zu sehen, hatte sie beflügelt!
Martha verstand nicht, wieso der Führer sie nicht schon früher hatte gehen lassen. Der Russe stand praktisch vor der Tür! Und jetzt, da sie offiziell gehen durften, ja mussten, benahmen sich viele Erwachsene, als sei es schon zu spät. Gutsherren, die ihre Höfe nicht verlassen wollten. Bauern, die sich an die Hoffnung klammerten, nicht interessant genug für den Russen zu sein. «Was soll ich denn im Westen?» war eine Frage, die in allen Familien gestellt wurde. Die Arbeit eines oder – in vielen Fällen – mehrerer Leben aufzugeben, war für viele unvorstellbar. Nach allen Entbehrungen, die der Krieg bereits gefordert hatte, wollten die übrig gebliebenen Männer die Stellung halten. Koste es, was es wolle.
«Was soll ich denn im Westen?», das hatte auch Vater ausgerufen, als endlich klar gewesen war, dass es kaum einen anderen Ausweg gab. «Überleben?», hatte Mutter ihn verzweifelt angeschrien. «Du willst uns vier Frauen wirklich allein losziehen lassen? Nach allem, was man über die Russen hört? Wo sollen wir denn hin ohne dich? Ist dir dieser Hof wichtiger als dein eigenes Fleisch und Blut?» Bertha neigte dazu, dramatisch zu werden, aber dieser Vorwurf traf Vater tief, das sah Martha ihm an. Sie war selten einer Meinung mit ihrer Mutter, aber dieses Mal verstand sie sie. Und sagte das auch. «Vater, wir kommen bestimmt zurück. Der Hof geht ja nicht weg, aber wenn das stimmt, was man vom Russen hört, ist es einfach zu gefährlich, hierzubleiben!» Vater blieb stur. Und auch heute Abend würde ihre Mutter ihn nicht überreden können, da war sich Martha sicher.
Marthas Eltern hatten nie viel gestritten und schon gar nicht laut. Vater war eher der brummige Bär, der einem Streit lieber aus dem Weg ging. Das lag vor allem daran, dass Mutter sehr nachtragend war und er nicht in Teufels Küche kommen wollte. Sie konnte noch Jahre später ein Gespräch oder einen Streit detailliert wiedergeben – wer was in welchem Ton gesagt hatte. Vor allem, wenn sie damit zeigen wollte, dass sie recht gehabt hatte. So ging man bei den Schiewecks Konflikten lieber aus dem Weg, zumindest denen mit Bertha. Anders als bei diesem Krieg waren Martha bei ihren Eltern die Fronten klar: Mutter war die Böse, Vater der Gute.
Bertha war immer mürrisch, beschäftigt und müde. Auch jetzt hörte Martha ihre Mutter wieder in der Küche hantieren, das Holz für morgen früh aufschichten, den eingeweichten Kochtopf abwaschen und die Schuhe in der Diele in Reih und Glied stellen. Während Vater schon schlief und dröhnend schnarchte, übte Mutter die allabendlichen Handgriffe aus, das erkannte Martha an den gewohnten Geräuschen. So war es schon immer gewesen. Vater trug zwar nach aussen hin die Verantwortung, er arbeitete den ganzen Tag auf dem Feld und da kamen auch ihre Einnahmen her. Abends aber kam er nach getaner Arbeit nach Hause, setzte sich an den gemachten Tisch und verschlang das Abendessen, das Bertha für sie alle gekocht hatte.
Wenn Vater zur Ruhe kam, fing für Mutter die zweite Hälfte ihres Arbeitstages erst an. Sie machte alles, was neben der Feldarbeit übrigblieb. Und das war viel, sehr viel. Sie stand vor allen anderen auf, um das Frühstück vorzubereiten, Mittag- und Abendessen standen ebenfalls immer pünktlich auf dem Tisch. Sie putzte – mittlerweile mit der Hilfe ihrer Töchter –, sie nähte und flickte Kleider, eine Fingerfertigkeit, die sie vor allem Martha beigebracht hatte, die sich gar nicht so ungeschickt dabei anstellte. Mutter verwaltete die Einnahmen, beglich Schulden, bezahlte die polnischen Arbeiter, von denen einige viele Jahre bei ihnen lebten. Sogar der Stall war ihr Aufgabengebiet. Die Erziehung von Martha und ihren Schwestern sowieso. Vater mischte sich nur ein, wenn Mutter nicht weiterwusste und er den Stock holen musste. Oder wenn es um den Hof ging.
Um nicht wie Mutter zu enden, wollte Martha einen Beruf erlernen. Schneiderin wäre eine Möglichkeit. Sie mochte die Stoffe, die sich so unterschiedlich anfühlten. Manche waren seidig (wobei sie schon lange keine solchen mehr in der Hand gehabt hatte), andere waren robust und unverwüstlich. Die fussbetriebene Nähmaschine konnte aus einem Stück Tuch eine praktische Hose oder ein Ballkleid erschaffen. Das gefiel ihr. Aber sie hatte auch von jungen Frauen gehört, die in Berlin und anderen Grossstädten bei Zeitungen oder als Sekretärinnen arbeiteten. In Ostpreussen auf dem Land gab es solche Berufe nicht. Schon gar nicht für Frauen. Hier lebten alle noch wie ihre Grossmütter! Zwei Jahre vor ihrer Geburt hatte das Deutsche Reich immerhin das Stimmrecht auch für Frauen eingeführt. Aber das Sagen hatte immer noch der Mann. Frauen waren in Ostpreussen bessere Haushälterinnen. Sie gehörten zu Kind und Hof, so wollte es der liebe Gott. Und der Führer.
Natürlich wünschte sich Martha Kinder, irgendwann. Aber zuerst wollte sie etwas für sich tun. Arbeiten, Geld verdienen, etwas beitragen. Und dann einen Mann finden, der das auch wollte. Für sie. Und für sich selbst. Und solch einen Mann würde sie bestimmt nicht hier finden, bei diesen Bauern. Spätestens bei Fritz’ letztem Heimaturlaub hatte sie gemerkt, dass auch die jungen Bowkes{4} nicht anders dachten als ihre Väter und Grossväter. Fritz wollte Martha heiraten. Das heisst, es wurde erwartet, dass er sie heiratet. Von ihren Eltern. Von seinen auch. Nach dem Krieg. Martha kannte den schüchternen Bauernsohn mit Wuschelkopf, schwieligen Händen und hochgezogenen Schultern von klein auf. Sie waren zusammen aufgewachsen, besuchten die gleiche katholische Kirche. Die beiden Familien waren sich seit Jahren einig. Nach dem Krieg sollte es endlich so weit sein. Fritz würde als ältester Sohn den Hof seiner Eltern übernehmen, diese würden bei ihm und Martha wohnen, Martha würde eine Schar Kinder gebären und sie würden immer so weitermachen wie Generationen vor ihnen. So war es vorgesehen. Für Martha klang das nicht nach dem romantischen Glück, das sie in ihren Tagträumereien anstrebte.
«Wir könnten doch nach dem Krieg nach Berlin!», hatte Martha Fritz vorgeschlagen, ihre Augen hatten vor Aufregung geglänzt. «Vielleicht könnte ich eine Arbeit bei einer Zeitung bekommen, schliesslich sagt meine Lehrerin immer, ich könne gut schreiben!» Sie sah sich schon im adretten Kleid in ein grosses Büro spazieren und sich an ihren Platz setzen. Sie war so aufgeregt, ihre Stimme überschlug sich fast. «Was meinst du, Fritz? Das könnten wir doch tun!» Fritz sah sich verstohlen um. Das Gespräch hatte in der Dorfkneipe stattgefunden, auf der Hochzeit seiner Schwester. Martha hatte gespürt, wie peinlich ihm das war, wie er hoffte, dass seine Kumpels nichts von alldem gehört hatten. Welcher Mann wollte schon eine Frau, die bereits vor der Heirat solche neumodischen Vorstellungen hatte?
Martha seufzte und drehte sich zur Seite. Das Bett quietschte. Heute wünschte sie sich vor allem, Fritz überhaupt je wiederzusehen. Würde sie ihn vermissen? Sie würde ihre Heimat und den Hof vermissen, sicherlich. Den Geruch des Pferdestalls, die wilden Lupinen im Sommer, die saftigen Äpfel, deren Bäume hinter dem Haus im Frühling kleine weisse Blüten trugen, die bei jedem Windstoss wie Schnee an ihrem Fenster vorbeischwebten. Ihre Freundin Käthe vermisste sie jetzt schon und die Mädchen aus dem Bund. Würden sie sich je wiedersehen?
Kapitel 2Lucia, Mai 1945
Lucia rieb sich die Hände am Geschirrtuch trocken, als es an der Wohnungstür klopfte. Sie zupfte an ihren Haaren und fuhr sich mit dem Handrücken über die feuchte Stirn. Abwasch mit kaltem Wasser! Die Anstrengung des Schrubbens machte wenigstens warm, wenn schon keine Kohlen da waren, um zu heizen. Frühmmorgens war es trotz der Jahreszeit immer noch kühl in der Wohnung. Sie legte hastig ihre Küchenschürze auf die Stuhllehne und schaute sich nochmal kurz im Spiegel an. Sie sah schrecklich aus! Sie wusste nicht, wann sie das letzte Mal eine richtige messa in piega{5} gehabt hatte. Ihr dunkles Haar war zerzaust, es hätte längst wieder einen ordentlichen Schnitt vertragen. Doch daran war nicht mal zu denken in diesen Zeiten.
Das Klopfen wurde ungeduldiger. Wer konnte das sein, morgens um acht? Lucia war Frühaufsteherin und nicht gewohnt, um diese Uhrzeit bereits gestört zu werden. Sie hastete zur Tür, schaute durch den Spion und liess die Schultern hängen: ihre Schwiegermutter, Lina Leone, la strega{6}, wie Lucia sie insgeheim nannte. Ihr Blick blieb am Boden haften, als sie die Alte reinliess. Diese schaute sich wie immer pikiert um, als sei sie stets auf der Suche nach einem verirrten Staubkorn, das da nicht hingehörte. «Bist du allein?», fragte Lina, als sie in die Küche trat. «Ja, warum?» –«Ich muss mit dir reden, Lucia.» Lina stapfte zielsicher in die Küche und setzte sich. Das verhiess nichts Gutes.
«Caffé?», fragte Lucia ihrer Schwiegermutter höflich und hoffte auf eine ablehnende Antwort, da Lina sowieso immer etwas an ihrem Kaffee auszusetzen hatte. Zu dünn, zu schwach, zu viel Milch, zu wenig Zucker. Lina wollte keinen, Glück gehabt. Die Alte schien es eilig zu haben. «Ich bin hier, um die Möbel, die ich euch geschenkt habe, wieder mitzunehmen.» Lucia liess das Küchentuch sinken. «Wieso das denn?» – «Das weisst du genau. Salvatore wird nicht zurückkommen. Er ist jetzt seit zwei Jahren verschollen und nur Gott weiss, wo er in diesem verdammten Afrika geblieben ist!» Lina kamen Krokodilstränen, wie immer, wenn sie von Salvatore, ihrem verschollenen Sohn und Lucias Ehemann, sprach. «Aber es wurden schon viele Verschollene wiedergefunden! Vielleicht haben ihn die Deutschen festgenommen und nach Deutschland oder in den Norden Italiens gebracht! Vielleicht hat man einfach seine Personalien verloren!» Lucia konnte nicht fassen, dass Lina ihren Sohn aufgegeben hatte.
Und ärgerte sich gleichzeitig über ihre verzweifelte Stimme. Sie war sich sicher, dass Salvatore wieder nach Hause kommen würde. Wieso, wusste sie selbst nicht, sie spürte es einfach. Sie hatten gerade erst geheiratet, ihre Ehe war kurz vor seinem Verschwinden geschlossen worden. Es durfte nicht sein, dass er nicht mehr zurückkam. «Ich bin seine Mutter und spüre, dass er nicht mehr heimkehrt.» Schliesslich kenne ich meinen Sohn besser als du – das war der unausgesprochene Untertitel ihres dramatischen Auftritts in Lucias Küche. Lucia setzte sich auf einen der Stühle mit abgewetztem Bezug, eines der wenigen Möbelstücke, das sie selbst mit in die Ehe hatte bringen können. Nun wollte die strega «ihre» Möbel zurück, die hässliche cristalliera{7}, den Küchentisch und natürlich das Ehebett. Offenbar war ein Hochzeitsgeschenk nur so lange gültig, wie der Ehemann nicht als verschollen galt.
Wieso tat eine Mutter das? Warum konnte diese Frau nicht akzeptieren, dass Lucia ein Teil von Salvatores Leben war? Ob er nun zurückkam oder nicht, Lucia war seine Frau. Was war daran nicht zu verstehen? Konnte es sein, dass Lina wirklich so böse war, wie Lucias Bruder Calogero sie gewarnt hatte? Den Spitznamen la strega hatte ja nicht sie erfunden, so nannten sie viele Bewohner im Dorf hinter ihrem Rücken. Das lag nicht zuletzt an ihrer haarigen Warze am Kinn und den langen, mit grauen Strähnen durchzogenen Haaren, die sie zu einem straffen Knoten band. Aber vor allem lag es an ihrem Charakter. Immer gereizt, oft empört, rechthaberisch. Lucia konnte sich nicht erinnern, jemals ein Lächeln auf ihrem Gesicht gesehen zu haben. Die kleine, runde Frau war immer schlecht gelaunt und schuld daran waren immer die anderen.
Es klopfte schon wieder an der Tür. Lucia war erleichtert, als ihr Bruder Calogero in die Küche trat. Seine Narbe an der Schläfe wurde röter. Er hatte sich die Verletzung in den Alpen zugezogen und war deshalb gerade auf Fronturlaub. Überrascht schaute er von der einen Frau zur anderen. «Lina ist hier, um die Möbel mitzunehmen, die sie uns geschenkt hat», sprudelte es aus Lucia. Calogero wandte sich an Lina. «Wie bitte?», fragte er wütend. «Sie ist überzeugt, Salvatore werde nicht zurückkommen.» Lucia war jetzt nur noch traurig. «Ach ja?», blaffte Calogero Lina an. «Und wie willst du das machen – die ganzen Möbel mitnehmen? Auf dem Buckel?» Calogero schüttelte schnaubend den Kopf und setzte sich. So weit hatte Lucia gar nicht gedacht. Wie stellte sie sich das vor? Oder ging es Lina nur darum, ihr Leid zuzufügen?





























