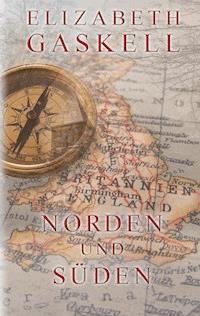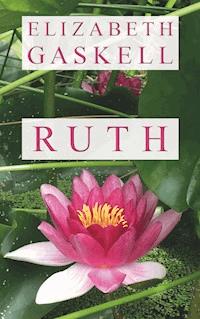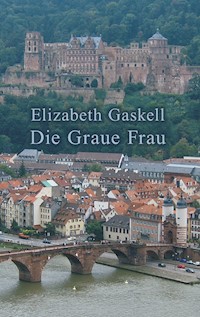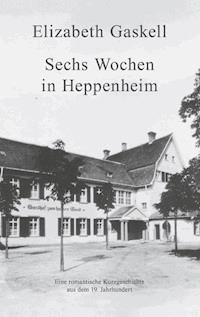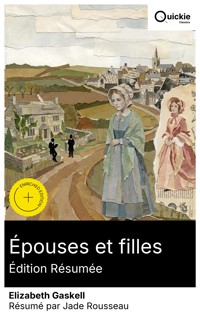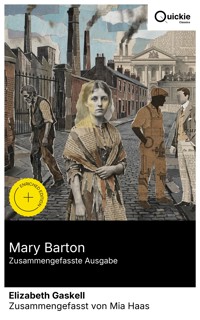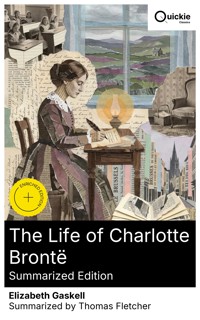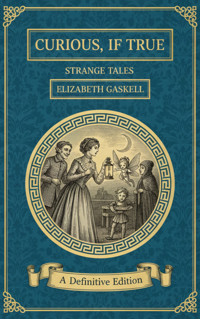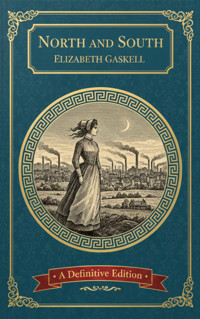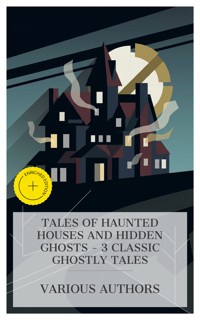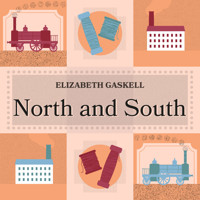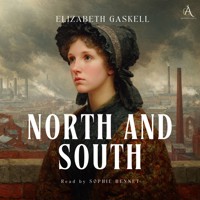Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: argon
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine ungewöhnliche Liebe in Zeiten des Umbruchs England, Mitte des 19. Jahrhunderts: Am liebsten möchte sie in den Wäldern des New Forest flanieren, doch seit Margaret Hale in eine nordenglische Metropole ziehen musste, liegt ihr altes Leben hinter dichten Fabriknebeln verborgen. Der Lärm der Stadt, die schroffen Gemüter und nicht zuletzt die Not der Arbeiter treffen sie zutiefst. Entschlossen setzt sie alles daran, den Menschen zu helfen. Der Fabrikant John Thornton wird für sie zum Inbegriff von Ausbeutung – bis eine Rebellion und ein familiäres Unglück ihre Welt aus den Angeln hebt und sie die tiefe Kluft zwischen ihnen überwinden muss. In ihrem zeitlosen Roman macht Elizabeth Gaskell die Bedeutung klassistischer Vorurteile und das Dilemma von Empathie und Markthörigkeit verstehbar und liefert ein bewegendes Plädoyer für soziale Verbundenheit.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elizabeth Gaskell
Norden und Süden
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
RECLAM Nr. 962447
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Coverabbildung: © Mary Wethey / Trevillion Images
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962447-1
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011547-3
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Vorbemerkung
Bei ihrer Erstveröffentlichung in ...
Band I
»Auf, auf, zur Hochzeit«
Rosen und Dornen
»Eile mit Weile«
Zweifel und Schwierigkeiten
Entscheidung
Adieu
Neue Eindrücke und neue Gesichter
Heimweh
Man zieht sich um für den Tee
Schmiedeeisen und Gold
Erste Eindrücke
Morgendliche Besuche
Ein frischer Wind an einem drückenden Ort
Die Meuterei
Herren und Knechte
Der Schatten des Todes
»Was ist ein Streik?«
Sympathie und Antipathie
Besuche eines Engels
Männer und Gentlemen
Die dunkle Nacht
Ein Schlag und seine Konsequenzen
Fehler
Irrtümer werden ausgeräumt
Frederick
Band II
Mutter und Sohn
Frucht-Stück
Trost in der Trauer
Ein Sonnenstrahl
Endlich daheim
»Nehmt Abschied Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr«
Missgeschicke
Frieden
Falsch und wahr
Erklärung
Zusammenhalt – nicht immer Stärke
Nach Süden blickend
Versprechen werden gehalten
Neue Freunde
Verstimmt
Das Ende der Reise
Allein! Allein!
Margaret macht sich aus dem Staub
Ruhe – kein Frieden
Nicht alles wie ein Traum
Einst und jetzt
Es fehlt etwas
»Niemals mehr gefunden«
Ruhe atmend
Veränderungen in Milton
Ein Wiedersehen
»Schieb alle Wolken weg«
Zu dieser Ausgabe
Nachwort
Vorbemerkung
Bei ihrer Erstveröffentlichung in Household Words musste diese Geschichte an die Bedingungen einer wöchentlichen Publikation angepasst werden und zugleich gewissen Grenzen genügen, um die Erwartungen der Öffentlichkeit zu erfüllen. Wenn diese Vorbedingungen auch so wenig einschränkend gehalten wurden wie nur irgend möglich, so war es der Autorin doch unmöglich, die Erzählung so zu entwickeln, wie sie es zunächst beabsichtigt hatte. Was noch schwerer wog, war die Tatsache, dass sie sich gezwungen sah, die Ereignisse mit einer unangemessenen Schnelligkeit zuende zu bringen. Um diesen augenscheinlichen Makel ein wenig auszugleichen, wurden im Nachhinein einige kurze Passagen und mehrere neue Kapitel eingefügt. Mit dieser kurzen Erklärung sei die Geschichte der Freundlichkeit des Lesers überantwortet:
»Mit Bitten voll Demut um Gnade und NachsichtVerzeihet nunmehr uns die holprige Machart.«1
Band I
Kapitel I
»Auf, auf, zur Hochzeit«
»Den Hof gemacht, geheiratet, und dann …«2
»Edith«, sagte Margaret leise, »Edith!«
Doch Edith war, wie Margaret schon fast befürchtet hatte, eingeschlafen. Sie hatte sich im hinteren Salon des Hauses in der Harley Street auf dem Sofa eingekuschelt und sah sehr schön aus in ihrem weißen Musselin-Kleid mit den blauen Schleifen. Wäre die Elfenkönigin Titania jemals in weißem Musselin mit blauen Schleifen auf einem karminroten Sofa im hinteren Salon eingeschlafen, hätte man Edith glatt mit dieser verwechseln können. Margaret staunte immer wieder darüber, wie schön ihre Cousine war. Sie waren von Kindheit an miteinander aufgewachsen, und all die Zeit über hatte jeder außer Margaret betont, wie hübsch Edith sei; doch Margaret hatte nie darüber nachgedacht, bis vor ein paar Tagen, als die Aussicht darauf, dass sie ihre Freundin verlieren würde, scheinbar jede ihrer guten Eigenschaften und ihren Charme hervorkehrte. Sie hatten sich über Hochzeitskleider und Hochzeitsfeiern unterhalten, über Captain Lennox und was er Edith über ihr zukünftiges Leben auf Korfu erzählt hatte, wo sein Regiment stationiert war, und darüber, wie schwer es werden würde, das Klavier richtig gestimmt zu halten (was Edith zufolge sicher das größte Problem wäre, das in ihrer Ehe auf sie zukäme). Sie hatten über die Kleider gesprochen, die Edith für die nach der Hochzeit geplante Reise nach Schottland brauchen würde, doch ihre leise Stimme war zuletzt immer schläfriger geworden, und nach einer Pause von einigen Minuten war auch Margaret nicht entgangen, dass ihre Cousine sich trotz des Stimmengewirrs im Nebenzimmer zu einer weichen Kugel aus Musselin, Schleifen und seidigen Locken zusammengerollt hatte und sich einen friedlichen Schlaf nach dem Dinner erlaubte.
Eben hatte Margaret ihr noch von den Plänen und Vorhaben erzählen wollen, die sie sich selbst für ihr künftiges Leben in dem Pfarrhaus auf dem Lande zurechtgelegt hatte, wo ihr Vater und ihre Mutter lebten und sie immer wunderbare Ferien verbracht hatte, während das Haus ihrer Tante Shaw in den vergangenen zehn Jahren ihr eigentliches Zuhause gewesen war. Da ihr allerdings niemand zuhörte, musste sie nun wie immer im Stillen über die Umbrüche in ihrem Leben nachdenken. Sie empfand eine tiefe Freude, auch wenn sich diese mit einem gewissen Bedauern darüber mischte, auf unbestimmte Zeit von ihrer immer so verständnisvollen Tante und ihrer lieben Cousine getrennt zu sein. Während sie so darüber nachdachte, wie schön es werden würde, die wichtige Rolle der einzigen Tochter in dem Pfarrhaus in Helstone einzunehmen, drangen Gesprächsfetzen aus dem Nebenzimmer an ihr Ohr. Ihre Tante Shaw unterhielt sich mit den fünf oder sechs Damen, die sie zum Essen eingeladen hatte und deren Ehegatten sich noch immer im Esszimmer aufhielten. Es waren die altvertrauten Bekannten des Shaw-Haushalts: Nachbarn, die Mrs Shaw Freunde nannte, da man öfter miteinander speiste als mit anderen Leuten und keine Bedenken hatte, sich gegenseitig noch vor dem Lunch einen Besuch abzustatten, wenn man ein Anliegen hatte. Als Freunde, die sie also waren, hatte man diese Damen und ihre Gatten zu einem Abschiedsdinner anlässlich von Ediths Hochzeit eingeladen. Edith war damit gar nicht einverstanden gewesen, da man genau am heutigen Abend Captain Lennox mit einem späten Zug erwartete, aber wenn sie auch ein verwöhntes Kind war, so war sie doch zu achtlos und träge, als dass sie einen wirklich starken Willen gehabt hätte. Sie hatte nachgegeben, als sie von den saisonalen Delikatessen erfuhr, die ihre Mutter geordert hatte und die angeblich immer so gut gegen die entsetzliche Trauer bei Abschiedsessen halfen. Sie begnügte sich damit, sich in ihrem Stuhl zurückzulehnen, mit ihrem Essen auf dem Teller herumzuspielen und ernst und abwesend dreinzuschauen, während sich alle um sie herum über die Bonmots von Mr Grey amüsierten, eines Gentleman, der bei Mrs Shaws Abendessen immer am Tischende saß und Edith stets bat, ihnen im Salon etwas vorzuspielen. Mr Grey war bei diesem Abschiedsessen besonders unterhaltend, und so hatten sich die Herren länger als gewöhnlich zurückgezogen. Es war auch wirklich gut, dass sie das taten – den Gesprächsfetzen nach zu schließen, die Margaret aufschnappte.
»Ich selbst habe einfach zu sehr gelitten. Nicht dass ich nicht vollkommen glücklich mit dem guten armen General gewesen wäre, aber der Altersunterschied ist nun einmal ein Problem, und dieses Problem, beschloss ich, sollte meiner Tochter Edith erspart bleiben. Mir war natürlich klar, und zwar ganz ohne mütterliche Voreingenommenheit, dass das liebe Kind früh heiraten würde. Wie oft sagte ich schon, sie würde sicherlich verheiratet sein, bevor sie neunzehn wäre. Ich hatte ein regelrecht prophetisches Gefühl, als Captain Lennox« – hier begann sie zu flüstern, aber Margaret konnte das Nötige mit Leichtigkeit ergänzen. Ediths Liebesgeschichte hatte sich erstaunlich reibungslos entwickelt. Mrs Shaw hatte ihrer Vorahnung nachgegeben, wie sie es ausdrückte, und zu der Heirat geraten, obwohl sie hinter den Erwartungen zurückblieb, die viele von Ediths Bekannten für die junge, hübsche Erbin gehabt hatten. Doch ihr einziges Kind sollte aus Liebe heiraten, sagte Mrs Shaw – dabei seufzte sie mit Nachdruck, als sei Liebe nicht das Motiv gewesen, dessentwegen sie den General geheiratet hatte. Mrs Shaw genoss Ediths Verlobung tatsächlich mehr als ihre Tochter. Nicht, dass Edith nicht gründlich verliebt gewesen wäre, so wie es sich gehörte. Dennoch hätte sie ein schönes Haus in Belgravia dem pittoresken Leben auf Korfu, das ihr Captain Lennox beschrieb, sicherlich vorgezogen. Genau bei den Teilen seiner Erzählungen, die Margaret besonders spannend fand, tat Edith so, als müsse sie furchtbar schaudern, zum einen weil es so schön war, sich von ihrem völlig vernarrten Liebsten ihre Abneigung ausreden zu lassen, zum anderen, weil alles, was im Leben irgendwie unbürgerlich war oder etwas von Notbehelf hatte, ihr wirklich zuwider war. Doch hätte jemand mit einem prachtvollen Haus und einem prachtvollen Anwesen um sie geworben, am Ende gar noch mit einem prachtvollen Titel, Edith hätte Captain Lennox nicht aufgegeben, solange sie in ihn verliebt gewesen wäre. Danach jedoch hätte sie sich möglicherweise durchaus nicht gescheut, ihr Bedauern ganz unverhüllt zum Ausdruck zu bringen, dass Captain Lennox in seiner Person nicht alle Elemente vereinen konnte, die nun einmal wünschenswert waren. Darin war sie ganz das Kind ihrer Mutter, die, nachdem sie General Shaw eher aus einem Gefühl von Respekt vor seinem Charakter und seiner Stellung geheiratet hatte, ständig, wenn auch dezent, über ihr schweres Los klagte, eine Verbindung mit jemandem eingegangen zu sein, den sie nicht lieben konnte.
»Ich habe wirklich keine Kosten für ihre Aussteuer gescheut«, waren die nächsten Worte, die Margaret verstand. »Sie bekommt all die schönen Tücher und Schals, die der General mir geschenkt hat, die ich aber nicht mehr tragen werde.«
»Da hat sie großes Glück gehabt«, erwiderte eine andere Stimme, die Mrs Gibson gehörte, einer Dame, die die Unterhaltung mit besonderem Interesse verfolgte, weil eine ihrer Töchter vor wenigen Wochen geheiratet hatte. »Helen hätte so gern ein indisches Umhängetuch gehabt, aber als ich herausfand, was für extravagante Preise man dafür verlangt, musste ich ihr das leider versagen. Sie wird richtig neidisch werden, wenn sie von Ediths Tüchern erfährt. Was sind es denn für welche? Aus Delhi? Mit den hübschen kleinen Umrandungen?«
Margaret hörte wieder die Stimme ihrer Tante, aber dieses Mal klang es, als hätte sie sich von ihrer halb liegenden Position erhoben und würde in den schwach beleuchteten hinteren Salon schauen. »Edith! Edith!«, rief sie, verstummte jedoch kurz darauf, als sei sie ermüdet von dieser Anstrengung. Margaret trat in den anderen Raum.
»Edith ist eingeschlafen, Tante Shaw. Kann ich irgendetwas tun?«
»Ach, das arme Kind!«, riefen alle Damen, als sie diese Besorgnis erregende Neuigkeit hörten, und der winzige Schoßhund in Mrs Shaws Armen fing an zu bellen, als habe ihn dieser Mitleidsausbruch in Erregung versetzt.
»Pst, Tiny! Du böses kleines Mädchen! Du wirst dein Frauchen noch wecken. Ich wollte Edith nur fragen, ob Newton ihre indischen Tücher herunterbringen könnte; magst du vielleicht gehen, Margaret, meine Liebe?«
Margaret ging hinauf in die alte Kinderstube im obersten Stock, wo Newton eifrig damit beschäftigt war, die Kleider für die Hochzeit zurechtzulegen. Während Newton sich (nicht ohne ein leises Murren) daranmachte, die Tücher wieder auszupacken, die an diesem Tag schon vier, fünf Mal vorgezeigt worden waren, schaute sich Margaret in der Kinderstube um, dem ersten Zimmer im Haus, mit dem sie sich vor neun Jahren vertraut gemacht hatte. Damals war sie als rechter Wildfang hierhergekommen, um das Heim, die Spiele und die Schulstunden mit ihrer Cousine Edith zu teilen. Sie erinnerte sich noch daran, wie dunkel und trüb ihr die Londoner Kinderstube vorgekommen war, die unter der Aufsicht eines sehr strengen und auf Etikette bedachten Kindermädchens stand, das es mit sauberen Händen und zerrissenen Kleidern schrecklich genau nahm. Sie erinnerte sich auch an das erste Abendessen dort – ohne ihren Vater und ihre Tante, die irgendwo am Ende einer endlos langen Treppe ihr Essen einnahmen, denn wenn es nicht gerade im Himmel gelandet war (dachte das Kind), so mussten sie sich tief, tief unten in den Eingeweiden der Erde befinden. In ihrem Zuhause – bevor sie in die Harley Street gekommen war, um dort zu leben – war das Ankleidezimmer ihrer Mutter ihr Kinderzimmer gewesen, und da sie in dem Pfarrhaus auf dem Lande immer früh aßen, hatte Margaret ihre Mahlzeiten mit ihrem Vater und ihrer Mutter eingenommen. Oh, wie gut sich sie sich noch als Mädchen von stattlichen achtzehn Jahren an die Tränen erinnerte, die das Kind von damals mit neun Jahren in dieser ersten Nacht unter der Bettdecke in wilder, leidenschaftlicher Trauer vergossen hatte. Wie das Kindermädchen sie gebeten hatte, nicht zu weinen, um MissEdith nicht zu stören, und wie sie genauso bitterlich weiter geweint hatte, nur leiser, bis ihre vornehme, hübsche Tante, die sie gerade erst kennengelernt hatte, leise mit Mr Haleheraufgekommen war, um ihm seine schlafende Tochter zu zeigen. Da hatte die kleine Margaret ihre Schluchzer unterdrückt und versucht, so ruhig zu liegen, als würde sie schlafen, weil sie Angst hatte, ihr Vater könne über ihre Traurigkeit unglücklich sein, die sie ohnehin vor ihrer Tante nicht zu zeigen wagte und die sie auch als falsch empfand, nach all dem Hoffen und Planen, nach den ausgeklügelten Überlegungen, die sie daheim angestellt hatten, bis man ihre Garderobe endlich den vornehmeren Verhältnissen angepasst hatte und Papa seine Gemeinde verlassen konnte, um sie nach London zu begleiten, wenn auch nur für ein paar Tage.
Mittlerweile hatte sie die alte Kinderstube sehr ins Herz geschlossen, obwohl sie nun schon halb leer geräumt war; bei der Vorstellung, sie schon in drei Tagen für immer zu verlassen, ließ sie ihren Blick durch den Raum streifen, begleitet von einer Art katzenhaftem Bedauern.
»Ach, Newton«, sagte sie, »ich denke, wir werden alle ganz schön traurig sein, dass wir dieses liebe alte Zimmer verlassen müssen.«
»Also, Miss, was mich betrifft, ist das nicht so. Meine Augen sind nicht mehr so gut wie früher, und das Licht hier ist so schlecht, dass ich gar nicht genug sehen kann, um die Spitzenstoffe zu reparieren, bloß am Fenster da, wo’s immer so furchtbar zieht – ich werd mir da noch den Tod holen bei der Kälte.«
»Na, ich denke, Sie werden beides haben in Neapel, gutes Licht und reichlich Wärme. Sie müssen möglichst viel von Ihrer Stopfarbeit bis dahin aufbewahren. Dankeschön, Newton, ich kann sie selbst mit nach unten nehmen – Sie haben genug zu tun.«
Und so ging Margaret mit einem Stapel indischer Tücher im Arm, die nach exotischen Gewürzen dufteten, wieder herunter. Da Edith noch schlief, bat ihre Tante sie, als eine Art Schaufensterpuppe herzuhalten, an der die Tücher präsentiert werden konnten. Niemandem fiel es so recht auf, wie wunderbar Margarets hochgewachsene, wohl proportionierte Gestalt in dem schwarzen Seidenkleid, das sie wegen eines Trauerfalls in der entfernten Familie ihres Vaters trug, die herrlichen Tücher zur Geltung brachte, deren großzügiger Faltenwurf Edith nur erdrückt hätte. Margaret stand genau unter dem Kronleuchter, ganz still und passiv, während ihre Tante die Tücher um sie drapierte. Bisweilen erhaschte sie, wenn sie gedreht wurde, einen Blick auf sich selbst im Spiegel über dem Kaminsims und lächelte über ihre Erscheinung: ihre vertrauten Züge in der Kleidung einer Prinzessin. Sie strich über die Tücher, die sie umhüllten, und es gefiel ihr, wie weich sie sich anfühlten und wie strahlend ihre Farben waren; sie mochte es durchaus, so prächtig gekleidet zu sein. Sie genoss es wie ein Kind, mit einem stillen vergnügten Lächeln auf den Lippen. Gerade in diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und Mr Henry Lennox wurde plötzlich angekündigt. Einige Damen erschraken ein wenig, als schämten sie sich für ihr weibliches Interesse an Kleidungsstücken. Mrs Shaw gab dem Neuankömmling die Hand, Margaret stand vollkommen still da, vielleicht würde man sie noch als Kleiderständer brauchen, und lächelte Mr Lennox amüsiert an, als sei sie davon überzeugt, dass ihm das Lächerliche an der Situation, in der man sie überrascht hatte, nicht entgangen war.
Ihre Tante war so damit beschäftigt, Mr Henry Lennox – der nicht zum Dinner hatte kommen können – alle möglichen Fragen über seinen Bruder, den Bräutigam, und seine Schwester, die Brautjungfer, zu stellen (sie würde mit Captain Lennox aus Schottland zu dem großen Ereignis kommen) und sich nach verschiedenen anderen Mitgliedern der Lennox-Familie zu erkundigen, dass Margaret nicht weiter als Schalträgerin gebraucht wurde. Also kümmerte sie sich um die anderen Gäste, die ihre Tante für den Moment vergessen hatte. Nahezu im selben Moment trat Edith aus dem hinteren Salon blinzelnd ans helle Licht, warf ihre ein wenig zerdrückten Locken zurück und sah aus wie Dornröschen, das man aus seinen Träumen aufgeschreckt hatte. Sogar im Schlaf hatte sie instinktiv gefühlt, dass ein Lennox erschienen war, für den es sich aufzustehen lohnte; und nun stellte sie zahllose Fragen über Janet, ihre zukünftige, bisher ungesehene Schwägerin, über die sie in so hohen Tönen sprach, dass Margaret, wenn sie nicht zu stolz gewesen wäre, beinahe eifersüchtig auf diese unbekannte Rivalin geworden wäre. Als Margaret sich ein wenig zurückzog, da ihre Tante sich in die Unterhaltung einmischte, sah sie, dass Henry Lennox einen leeren Platz neben ihr in Augenschein nahm, den er bestimmt einnehmen würde, sobald Edith ihn von ihren vielen Fragen erlöst hatte. Sie war sich nicht ganz sicher gewesen, ob er heute kommen würde, weil ihre Tante recht wirr von seinen Verpflichtungen berichtet hatte. Es war beinahe eine Überraschung, ihn zu sehen, und jetzt war sie sich sicher, dass der Abend vergnüglich werden würde. Sie hatten einen sehr ähnlichen Geschmack. Eine ehrliche, offene Fröhlichkeit überkam Margarets Züge, und nach einer Weile ging er tatsächlich zu ihr. Sie empfing ihn mit einem Lächeln, das nicht auch nur einen Hauch von Schüchternheit oder Befangenheit enthielt.
»Na, ich nehme mal an, alle werden hier schwer von Geschäften umgetrieben – Geschäften für Damen, meine ich. Recht verschieden von meinen Geschäften, bei denen es um wirkliche Rechtsfragen geht. Mit indischen Tüchern herumzuspielen, ist schon eine andere Arbeit, als juristische Verträge aufzusetzen.«
»Ich wusste, dass Sie sich darüber amüsieren würden, dass wir hier alle so damit beschäftigt sind, Ediths Putz zu bewundern. Aber diese indischen Tücher sind in ihrer Art doch wirklich etwas Wunderbares.«
»Das würde ich niemals anzweifeln. Zumal ihr Preis ohne Frage ebenfalls ans Wunderbare grenzt.«
Die Herren kamen nun einer nach dem anderen herein, und es mischten sich tiefere Töne in das Stimmengewirr.
»Das ist Ihr letztes Dinner, nicht wahr? Vor Donnerstag gibt es keine weiteren?«
»Nein. Ich denke, nach diesem Abend können wir ein wenig zur Ruhe kommen, was ich für mein Teil seit Wochen nicht mehr getan habe; zumindest zu der Art von Ruhe, bei der man nicht mehr alle Hände voll zu tun hat, weil alle Vorkehrungen für ein Ereignis, das Kopf und Herz so sehr einnimmt, getroffen wurden. Ich werde froh sein, wieder Zeit zu haben, meinen Gedanken nachzuhängen, und ich bin mir sicher, dass das auch für Edith gilt.«
»Was Edith angeht, bin ich mir da nicht so sicher, aber ich kann gut verstehen, dass Sie das sagen. Wann immer ich Sie in letzter Zeit gesehen habe, sind Sie von einem Wirbelwind durch die Gegend gejagt worden, den irgendeine andere Person verursacht hat.«
»Ja«, sagte Margaret ein wenig betrübt, als sie daran dachte, wieviel Aufhebens man seit Monaten um sinnlose Kleinigkeiten machte: »Ich weiß wirklich nicht, ob vor einer Hochzeit immer so etwas entstehen muss, was Sie einen Wirbelwind nennen, oder ob es in einigen Fällen nicht eine ruhige und friedliche Zeit davor geben kann.«
»Durchaus, zum Beispiel wenn Aschenputtels gute Fee erscheint, die Aussteuer und das Hochzeitsfrühstück bestellt und die Einladungen schreibt«, sagte Mr Henry Lennox lachend.
»Aber sind alle diese Dinge wirklich notwendig?« Margaret schaute ihn fragend an. Das bedrückende Gefühl unbeschreiblicher Müdigkeit überkam sie, das von all den Arrangements herrührte, die nur dazu dienten, eine hübsche Wirkung zu erzielen, und mit denen sich Edith als maßgebliche Autorität in den letzten sechs Wochen hatte auseinandersetzen müssen. Sie suchte wirklich jemanden, der ihr helfen würde, auch ein paar angenehme, friedvolle Vorstellungen zum Heiraten zu entwickeln.
»Oh, aber natürlich«, erwiderte er, wobei sein Ton wieder ernster wurde. »Es gibt nun einmal Formalitäten und Zeremonien, durch die man durch muss, nicht so sehr für die eigene Zufriedenheit, sondern um dem geschwätzigen Mäulern der Welt Einhalt zu bieten, denn sonst gäbe es überhaupt wenig Zufriedenheit. Aber wie würden Sie denn Ihre Hochzeit gern vorbereitet wissen?«
»Oh, daran habe ich noch gar nicht so recht gedacht; vielleicht würde es mir gefallen, wenn es ein herrlicher Sommermorgen wäre; durch den Schatten hoher Bäume zur Kirche zu gehen wäre schön; lieber nicht so viele Brautjungfern zu haben und kein Frühstück. Ich fürchte, ich spreche mich genau gegen die Dinge aus, die mir im Moment so viel Arbeit machen.«
»Nein, das denke ich nicht. Diese Vorstellung, die von so imponierender Einfachheit ist, passt gut zu Ihrem Charakter.«
Margaret gefielen diese Worte gar nicht. Sie schreckte umso mehr davor zurück, weil es nicht die erste Gelegenheit war, bei der er versucht hatte, sie in ein Gespräch über ihren Charakter und ihr Handeln zu verwickeln (um ihr dann Komplimente zu machen). Sie ließ ihn nicht weiterreden, sondern sagte:
»Es ist einfach ganz selbstverständlich für mich, dass ich an die Kirche von Helstone denke und den Weg dorthin, und nicht daran, auf einer gepflasterten Straße zu einer Londoner Kirche zu fahren.«
»Erzählen Sie mir doch von Helstone. Sie haben es mir noch nie genauer beschrieben. Ich würde mir den Ort gerne vorstellen, an dem Sie leben werden, wenn die Harley Street Nummer 96 schäbig und schmutzig und öde und ausgestorben sein wird. Ist Helstone überhaupt ein Dorf oder eher eine Stadt?«
»Ach, nur ein kleines Dörfchen; ich glaube, man könnte es nicht einmal ein Dorf nennen. Es gibt die Kirche und ein paar Häuser in der Nähe am Dorfanger – oder eher Cottages – voller Kletterrosen.«
»Und die das ganze Jahr über blühen, besonders zu Weihnachten – um ihr Bild zu vervollständigen«, sagte er.
»Nein«, erwiderte Margaret etwas verärgert. »Ich male hier gar keine Bilder. Ich versuche Helstone so zu beschreiben, wie es wirklich ist. Das sollten Sie nicht sagen.«
»Asche auf mein Haupt«, antwortete er. »Es klang nur wie ein Dorf aus einer Erzählung, nicht wie eines aus dem wahren Leben.«
»Und so ist es auch«, erwiderte Margaret eifrig. »Alle anderen Orte in England, die ich gesehen habe, sehen so schroff und prosaisch aus, wenn man aus dem New Forest kommt. Helstone ist wie ein Dorf aus einem Gedicht – einem Gedicht von Tennyson. Aber ich verzichte ab sofort darauf, es weiter zu beschreiben. Sie lachen mich ohnehin nur aus, wenn ich Ihnen beschreibe, was ich über meine Heimat denke – und wie sie wirklich ist.«
»Das würde ich ganz sicher nicht. Aber ich sehe schon, dass Sie sich nicht umstimmen lassen. Nun, dann sagen Sie mir doch, was ich noch viel lieber wissen möchte, nämlich wie das Pfarrhaus aussieht.«
»Oh, aber ich kann doch mein Zuhause nicht beschreiben. Es ist einfach Zuhause und ich kann seinen Zauber nicht in Worte fassen.«
»Ich gebe auf. Sie sind heute Abend aber auch wirklich streng mit mir, Margaret.«
»Tatsächlich?«, sagte sie und schaute ihn mit ihren großen, sanften Augen unverwandt an. »Ich habe das gar nicht so gemeint.«
»Nun, nur weil ich eine unglückliche Bemerkung gemacht habe, wollen Sie mir nicht von Helstone erzählen, und dann wollen Sie auch nichts über Ihr Zuhause sagen, obwohl ich so gerne etwas über beides erfahren würde, besonders natürlich über letzteres.«
»Aber es ist wirklich so, ich kann Ihnen einfach nichts zu meinem Zuhause sagen. Ich finde nicht, dass es etwas ist, worüber ich mit Ihnen reden kann, es sei denn, Sie würden es kennen.«
»Na dann« – hier hielt er einen Augenblick lang inne – »erzählen Sie doch, was Sie dort tun. Hier lesen Sie oder haben Unterricht oder tun irgendetwas anderes für Ihre Bildung bis etwa zum Mittag. Dann machen Sie einen Spaziergang bis zum Lunch, danach fahren Sie mit Ihrer Tante aus und haben irgendeine Verpflichtung für den Abend. So, nun, wie sieht Ihr Tag in Helstone aus? Reiten Sie dort, fahren oder laufen Sie?«
»Ich laufe selbstverständlich. Wir haben gar kein Pferd, nicht einmal Papa. Er läuft auch bis an die äußersten Grenzen seines Pfarrbezirks. Die Wege dort sind so wunderschön, es wäre viel zu schade, sie zu fahren – sogar zu schade, sie reitend zurückzulegen.«
»Werden Sie viel gärtnern? Das ist doch, glaube ich, eine angemessene Beschäftigung für junge Damen auf dem Lande.«
»Ich weiß nicht so recht. Ich fürchte, ich mag so harte Arbeit nicht so sehr.«
»Eher Partys mit Bogenschützen-Wettbewerben, Picknicks, Bälle nach einem Pferderennen oder der Jagd?«
»Oh, nein!«, rief sie lachend. »Papas Einkünfte sind sehr gering, und selbst wenn wir so etwas in der Nähe hätten, bezweifle ich sehr, dass ich zu solchen Veranstaltungen gehen würde.«
»Ich sehe schon, Sie wollen mir einfach nichts erzählen. Sie sagen mir bloß immer, dass Sie dieses und jenes nicht tun werden. Bevor die Ferien zuende sind, werde ich Ihnen wohl einen Besuch abstatten müssen, um herauszufinden, womit Sie sich nun wirklich beschäftigen.«
»Ich hoffe sehr, dass Sie das tun werden. Dann werden Sie selbst sehen, wie schön Helstone ist. Ich muss jetzt gehen. Edith möchte etwas vorspielen, und ich weiß gerade genug über Musik, um die Noten für sie umblättern zu können. Außerdem wird meine Tante Shaw es nicht gern sehen, dass wir uns unterhalten.«
Ediths Spiel war brillant. Mitten im Stück öffnete sich die Tür halb, und Edith sah Captain Lennox, der zögerte, weil er nicht wusste, ob er hereinkommen durfte. Sie ließ alles stehen und liegen und stürmte aus dem Zimmer, so dass eine verwirrte, errötende Margaret den erstaunten Gästen erklären musste, was Edith dazu veranlasst hatte, so plötzlich die Flucht zu ergreifen. Captain Lennox musste wohl eher gekommen sein als erwartet, oder war es wirklich schon so spät? Sie schauten auf ihre Uhren, waren, wie es sich gehörte, ganz entsetzt und verabschiedeten sich.
Dann kam Edith freudestrahlend zurück und führte ein wenig schüchtern, ein wenig stolz ihren großen, gutaussehenden Captain herein. Sein Bruder schüttelte ihm die Hand, und Mrs Shaw begrüßte ihn in ihrer sanften freundlichen Art, die immer etwas klagend wirkte, weil sie sich mit der Zeit angewöhnt hatte, sich als Opfer einer unglücklichen Ehe zu sehen. Jetzt, da der General nicht mehr war und sie über alles erdenklich Gute im Leben verfügte und so wenig Probleme hatte wie nur irgend möglich, hatte es sie Mühe gekostet, einen neuen Grund zur Sorge, wenn nicht gar zur Trauer zu finden. Sie war jedoch neuerdings bei ihrer eigenen Gesundheit fündig geworden, um die sie sich nun ängstlich sorgte. Wann immer sie daran dachte, konstatierte sie einen nervösen kleinen Husten, und ein wohlwollender Arzt hatte ihr genau das verschrieben, was sie sich gewünscht hatte – den Winter in Italien zu verbringen. Mrs Shaw hatte genauso starke Sehnsüchte wie die meisten Menschen, aber sie wollte nicht aus einem offen und klar formulierten Wunsch oder gar um ihres eigenen Vergnügen willens handeln, sie zog es vor, das für sie gefälliger zu regeln und sich von dem Befehl oder dem Begehren einer anderen Person nötigen zu lassen. Es gelang ihr tatsächlich, sich selbst davon zu überzeugen, sich einer harten äußeren Notwendigkeit zu unterwerfen, und deswegen konnte sie nach Herzenslust auf ihre sanfte Art jammern und klagen, während sie in Wahrheit genau das tat, was sie wollte.
Das war also die Art und Weise, in der sie von ihrer eigenen Reise zu Captain Lennox zu erzählen begann, der, wie es sich gehörte, allem, was seine zukünftige Schwiegermutter sagte, zustimmte, während er seinen Blick Edith folgen ließ, die eifrig damit beschäftigt war, den Tisch neu einzudecken und lauter gute Dinge heraufbringen zu lassen, obwohl er ihr versichert hatte, dass er erst vor zwei Stunden gegessen habe.
Mr Henry Lennox stand an den Kaminsims gelehnt ganz in der Nähe seines attraktiven Bruders und amüsierte sich über die Familienszene; er selbst war der Unscheinbare in einer ungewöhnlich gutaussehenden Familie, aber sein Gesicht wirkte intelligent, scharfsinnig und ausdrucksstark, und dann und wann, wenn er nichts sagte, aber mit leicht sarkastischem Interesse alles beobachtete, was sie und Edith taten, fragte sich Margaret, worüber er wohl gerade nachdachte. Diesmal bezog sich der Sarkasmus auf Mrs Shaws Gespräch mit seinem Bruder, sein Interesse hingegen galt dem, was er sah. Die beiden Cousinen boten einen hübschen Anblick, wie sie so geschäftig um den Tisch herumliefen. Edith wollte das meiste selbst erledigen, um ihrem Liebsten zu beweisen, wie gut sie als Soldatengattin taugte. Da das Wasser im Teespender kalt geworden war, ließ sie den großen Teekessel bringen, was nur dazu führte, dass sie, als sie ihn an der Tür entgegennehmen und tragen wollte, merkte, dass er zu schwer für sie war. Schmollend trat sie herein mit einem schwarzen Fleck auf ihrem Musselin-Kleid. Der Griff des Kessels hatte einen tiefen Abdruck an ihrer rundlichen kleinen Hand hinterlassen, die sie Captain Lennox zeigte, als wäre sie ein verletztes Kind, und die Heilmethode war natürlich in beiden Fällen die gleiche. Am effizientesten bei dem ganzen Geschäft war Margaret, die die Brennlampe unter dem Teespender schnell wieder anzündete, was allerdings nichts von dem nomadischen Lagercharme hatte, den Edith in manchen ihrer Launen für das hielt, was dem Leben in der Kaserne am nächsten kommen würde.
Nach diesem Abend folgte ein ständiges reges Treiben, bis die Hochzeit vorüber war.
Kapitel II
Rosen und Dornen
»Im grünen Licht im Waldeshain
Auf weichem Moos ein Kind zu sein,
Voll Liebe bei dem holden Baum
Zu seh’n des Himmels Sommertraum.«
Mrs Hemans3
Margaret trug wieder ihre übliche Tageskleidung und fuhr in aller Ruhe mit ihrem Vater nach Hause, der nach London gekommen war, um bei der Hochzeit zu helfen. Ihre Mutter war zuhause geblieben, aus einer ganzen Reihe von merkwürdigen Gründen, die niemand außer Mr Hale verstand, der genau wusste, dass all seine Argumente für ein Satinkleid, das sich auf einer Skala von Alt bis Neu irgendwo in der Mitte befand, sie nicht hatten überzeugen können. Da er nicht über die Mittel verfügte, seine Frau von Kopf bis Fuß neu einzukleiden, wollte sie sich nun einmal bei der Hochzeit des einzigen Kindes ihrer einzigen Schwester nicht zeigen. Hätte Mrs Shaw den wahren Grund erraten, warum Mrs Hale ihren Gatten nicht zu der Hochzeit begleitete, hätte die Schwester sie mit Kleidern überschüttet, aber es war nun fast zwanzig Jahre her, dass Mrs Shaw die arme hübsche MissBeresford gewesen war, und sie hatte tatsächlich alle damaligen Misslichkeiten vergessen, mit Ausnahme ihres Unglücks wegen des Altersunterschieds in ihrer Ehe, worüber sie sich stundenlang auslassen konnte. Ihre liebe Schwester Maria hatte ja den Mann ihres Herzens geheiratet, der nur acht Jahre älter war, das sanfteste Gemüt hatte, das man sich nur vorstellen konnte, und das blau-schwarze Haar, das man so selten sieht. Mr Hale war einer der wunderbarsten Prediger, die sie je gehört hatte, und geradezu das Vorzeigemodell eines Gemeindepfarrers. Vielleicht war es bei diesen Prämissen nicht eben eine logische Schlussfolgerung, doch wenn sie an das Schicksal ihrer Schwester dachte, war Mrs Shaw stets der Meinung: »Sie hat doch aus Liebe geheiratet, was um alles in der Welt will die gute Maria denn noch?« Wäre Mrs Hale ehrlich gewesen, hätte sie eine lange Liste angeführt: »Ein silbergraues Glacé-Seidenkleid, einen weißen Strohhut, ach, dutzende von Dingen für die Hochzeit und hunderte für das Haus.«
Margaret wusste nur, dass es ihrer Mutter nicht genehm gewesen war zu kommen, und sie fand es alles andere als schlimm, dass sie sich erst im Pfarrhaus von Helstone würden wiedersehen können und nicht in dem Chaos der letzten zwei, drei Tage in dem Haus in der Harley Street, wo sie die Rolle des Figaro aus der Mozartoper hatte einnehmen müssen und überall zur selben Zeit gebraucht worden war. Ihr Kopf und ihr Körper schmerzten noch immer, wenn sie daran dachte, was sie in den vergangenen 48 Stunden getan und gesagt hatte. Dass sie unter anderem denen hatte Adieu sagen müssen, mit denen sie so lange gelebt hatte, ließ sie in vergangenen Zeiten schwelgen. Ganz egal, wie diese Zeiten tatsächlich gewesen waren, sie würden niemals wiederkommen. Margaret hätte es nie für möglich gehalten, so schweren Herzens in ihr geliebtes Zuhause zurückzukehren, an den Ort und in das Leben, nach dem sie sich seit Jahren gesehnt hatte – besonders zu jener Tageszeit, wenn die Sehnsucht und das Verlangen am stärksten waren, gerade bevor die Sinne ihre scharfen Konturen verlieren und man einschläft. Sie riss sich von der Erinnerung an die Vergangenheit los, um sich voller Hoffnung der hellen, heiteren Betrachtung ihrer Zukunft zuzuwenden. Jetzt richtete sie ihren Blick nicht auf das, was einmal gewesen war, sondern sah, was sie tatsächlich umgab: Da war ihr Vater, der sich schlafend im Eisenbahnabteil zurückgelehnt hatte. Seine blau-schwarzen Haare waren ergraut und lagen in dünnen Strähnen über seiner Stirn. Seine Wangenknochen traten deutlich hervor – zu deutlich, um als schön zu gelten, wenn seine Gesichtszüge nicht so fein gewesen wären. Sie verfügten über eine ganz eigene Anmut und Schönheit. Sein Gesicht drückte Ruhe aus, doch es war eher die Ruhe nach großer Ermüdung als die heitere Ruhe eines Menschen, der ein behagliches, zufriedenes Leben führte. Margaret war schmerzlich berührt von dem erschöpften, besorgten Ausdruck und sie dachte über die ihr gut bekannten Umstände im Leben ihres Vaters nach, um den Grund für diese Linien zu finden, die so eindeutig auf Betrübnis und Niedergeschlagenheit verwiesen.
»Armer Frederick!«, dachte sie seufzend. »Oh, wenn Frederick doch auch in den Kirchendienst gegangen wäre und nicht zur Marine, wodurch wir ihn jetzt ganz und gar verloren haben! Ich wünschte, ich würde die ganze Geschichte kennen. Ich habe das alles gar nicht richtig verstanden, als mir meine Tante davon erzählt hat. Eigentlich weiß ich nur, dass er wegen dieser schrecklichen Angelegenheit nicht zurück nach England kommen darf. Armer lieber Papa, wie traurig er aussieht! Zum Glück bin ich auf dem Weg nach Hause, wo ich ihn und Mama trösten kann.«
Als er erwachte, lächelte sie ihren Vater strahlend und ohne auch nur eine Spur von Müdigkeit an. Er lächelte zurück, aber nur sehr verhalten, als koste es ihn ungewöhnliche Anstrengung. Dann nahmen seine Züge wieder den üblichen besorgten Ausdruck an. Er hatte die Angewohnheit, den Mund halb zu öffnen, als wolle er sprechen, was die Form seiner Lippen ständig veränderte und ihn unentschlossen wirken ließ. Aber er hatte auch die gleichen großen, sanften Augen wie seine Tochter – Augen, mit denen er alles langsam und fast schon würdevoll betrachtete und die von zarten weißen Augenlidern verschleiert wurden. Margaret ähnelte ihm mehr als ihrer Mutter. Manchmal wunderten sich die Leute, wie so gutaussehende Eltern eine Tochter bekommen konnten, die überhaupt nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprach, oder, wie bisweilen gesagt wurde, überhaupt nicht schön war. Ihr Mund war groß, kein Kirschmund, den sie nur gerade weit genug öffnen konnte, um ein zartes »Ja« oder »Nein« oder »Aber natürlich doch, Sir« zu hauchen. Und dennoch hatte ihr großer Mund sanft geschwungene, volle Lippen von tiefem Rot, und Margarets Haut war zwar nicht weiß und hell, jedoch von elfenbeinerner Weichheit und Zartheit. Wenn ihr Gesichtsausdruck auch ungewöhnlich würdevoll und reserviert war für ein so junges Mädchen, war er doch jetzt, da sie mit ihrem Vater sprach, so klar wie der Morgen – mit Grübchen und einem Blick, in dem kindliche Freude und eine unbändige Hoffnung auf die Zukunft lagen.
Es war bereits Ende Juli, als Margaret heimkam. Die Bäume im Wald waren alle in ein dunkles, sattes, dämmriges Grün getaucht; die Farne darunter fingen die schräg einfallenden Sonnenstrahlen auf; im schwülen Wetter bewegte sich kein Lüftchen. Margaret gefiel es, an der Seite ihres Vaters zu spazieren und mit kruder Freude den Farn niederzutrampeln, ihn unter ihrem leichtfüßigen Schritt nachgeben zu spüren und den ihm eigenen Duft zu riechen, den er verströmte – und nach draußen zu treten ins warme wohlriechende Freie, wo sie unzähligen Wildtieren begegnete, sich an der Sonne und an all den Kräutern und Blumen erfreute, die sie wachsen ließ. Dieses Leben – oder zumindest diese Spaziergänge – ließen all ihre Hoffnungen Wirklichkeit werden. Sie war stolz auf ihren Wald und ihr Dorf. Wer hier lebte, gehörte zu ihr. Sie schloss innige Freundschaften mit den Dorfbewohnern, lernte und erfreute sich an den Ausdrücken, die sie verwendeten, sie genoss ihre Freiheit, wenn sie bei ihnen war, kümmerte sich um die Kleinen, sprach langsam und deutlich mit den Alten oder las ihnen vor, brachte den Kranken kleine Speisen und beschloss ganz bald, in der Schule zu unterrichten, in der ihr Vater jeden Tag seinen Pflichten nachging; doch sie ließ sich immer wieder davon ablenken, um ihre Freunde – Männer, Frauen oder Kinder – in einem der Cottages in dem grünen Schatten des Waldes zu besuchen. Das Leben war perfekt, wenn sie draußen war. Das Leben im Haus dagegen hatte seine Schattenseiten. Mit der gesunden Scham eines Kindes machte sie sich Vorwürfe, dass sie mit ihrer Scharfsichtigkeit erkannte, dass nicht alles so war, wie es sein sollte. Ihre Mutter – die doch immer so gütig und zartfühlend zu ihr war – schien dann und wann furchtbar unzufrieden mit der Situation zu sein. Sie war der Meinung, der Bischof komme seinen Verpflichtungen sonderbarerweise nicht nach, da er Mr Hale kein besseres Einkommen gab, und machte ihrem Gatten fast schon Vorwürfe, dass er sich nicht dazu entschließen konnte, seine Gemeinde zu verlassen und die Leitung einer größeren zu übernehmen. Er seufzte dann laut und erwiderte, er sei dankbar, das, wozu er bestimmt war, im kleinen Helstone verrichten zu können, aber jeden Tag bedrückte ihn die Situation mehr, und die Welt wurde ihm immer fremder. Je mehr ihn seine Frau bedrängte, dass er sich doch um eine Beförderung bemühen solle, desto mehr zog er sich zurück, das sah Margaret, und sie versuchte dann immer, ihre Mutter mit Helstone zu versöhnen. Mrs Hale behauptete, die vielen Bäume hier schadeten ihrer Gesundheit, und Margaret versuchte daraufhin, sie ins Freie herauszulocken, auf den schönen, breiten, hoch gelegenen, mal sonnendurchfluteten, mal wolkenverhangenen Gemeindeanger; denn sie war überzeugt, dass sich ihre Mutter zu sehr an das Leben im Hause gewöhnt hatte. Ihre Spaziergänge führten sie selten weiter als zur Kirche, zur Schule oder zu den Cottages in der Nachbarschaft. Zunächst tat ihr das Leben an der frischen Luft auch gut, aber als der Herbst voranrückte und das Wetter wechselhafter wurde, verstärkte sich die Vorstellung ihrer Mutter, der Ort sei ungesund, und sie klagte immer öfter darüber, dass ihr Gatte, der doch viel gelehrter war als Mr Hume und ein besserer Gemeindepfarrer als Mr Houldsworth, keine Beförderung erhalten hatte wie diese beiden früheren Nachbarn der Familie.
Dass der häusliche Friede unter der Unzufriedenheit ihrer Mutter derart litt, darauf war Margaret nicht vorbereitet gewesen. Sie wusste, hatte sich sogar darauf gefreut, so manchen Luxus, der sie in der Harley Street im Grunde nur in ihrer Freiheit eingeschränkt hatte, aufgeben zu müssen. Ihre ausgesprochene Freude an jedem sinnlichen Vergnügen wurde stets ausbalanciert, wenn nicht gar übertrumpft, von der stolzen Erkenntnis, dass sie, wenn nötig, auch ohne all das auskommen konnte. Aber dunkle Wolken ziehen nie dort auf, wo wir es erwarten. Es hatte schon in früheren Zeiten, wenn Margaret ihre Ferien im Dorf verbracht hatte, gewisse Klagen und dann und wann Bedauern von Seiten ihrer Mutter gegeben, wegen der ein oder anderen Kleinigkeit in Helstone und der Stellung ihres Vaters dort; doch in ihrer Erinnerung an diese glücklichen Zeit waren all die kleinen Details, die nicht so angenehm waren, völlig vergessen.
Mitte September setzten die regnerischen Herbststürme ein, und Margaret musste wohl oder übel mehr im Haus bleiben, als sie es bisher getan hatte. Helstone befand sich in einiger Entfernung von den nächsten Nachbarn mit ähnlicher gesellschaftlicher Stellung.
»Es ist einfach einer der abgelegensten Orte Englands«, sagte Mrs Hale, als sie wieder in einer ihrer düsteren Stimmungen gefangen war. »Ich kann nun mal nicht anders, ich finde es sehr bedauerlich, dass Papa hier niemanden hat, mit dem er Umgang pflegen kann. Helstone wird ihm einfach nicht gerecht, er trifft hier ja über Wochen nur Bauern und Arbeiter. Wenn wir wenigstens am anderen Ende der Gemeinde lebten, das wäre immerhin etwas; dann wären zumindest die Stanfields beinahe und die Gormans auf jeden Fall fußläufig erreichbar.«
»Die Gormans«, sagte Margaret. »Sind das die Gormans, die ihr Vermögen durch ein Handelshaus in Southampton gemacht haben? Oh! Ich bin ganz froh, dass wir die nicht besuchen. Ich mag diese Kaufmannsleute nicht. Mit den Bewohnern der Cottages und den Arbeitern fahren wir sehr viel besser als mit diesen prätentiösen Familien.«
»Du solltest nicht so anspruchsvoll sein, Margaret, mein Liebes!«, sagte ihre Mutter, wobei sie heimlich an den jungen, gutaussehenden Mr Gorman dachte, den sie einmal bei Mr Hume getroffen hatte.
»Aber nein! Ich bin anderen gegenüber aufgeschlossen. Ich mag Leute jeder Art, die auf dem Land arbeiten. Und ich mag Soldaten und Matrosen und die drei gelehrten Berufe, wie man so schön sagt. Du willst doch sicher nicht von mir verlangen, dass ich jeden Metzger, Bäcker und Kaufmann bewundere, oder, Mama?«
»Aber die Gormans waren doch keine Metzger oder Bäcker, sondern sehr respektable Kutschenmacher.«
»Alles schön und gut. Kutschenmacher ist aber auch ein Handelsberuf und meiner Meinung nach ein viel nutzloserer als der des Metzgers oder des Bäckers. Oh, wie war ich die ewigen Fahrten in Tante Shaws Kutsche leid, und wie habe ich mir gewünscht, ich dürfte laufen!«
Und laufen, das tat Margaret trotz des schlechten Wetters. Sie war so glücklich draußen an der Seite ihres Vaters, dass sie beinahe tanzte, und mit der sanften Kraft des Westwinds im Rücken schien sie, wenn sie über die Heide ging, geradezu davongetragen zu werden, so leicht und mühelos wie ein herabgefallenes Blatt, das von einer herbstlichen Brise dahingeweht wurde. Die Abende angenehm zu füllen war hingegen sehr viel schwerer. Gleich nach dem Essen zog sich ihr Vater in seine kleine Bibliothek zurück, und sie war mit ihrer Mutter allein. Mrs Hale hatte sich nie sehr für Bücher interessiert und ihren Gatten schon recht früh in ihrer Ehe davon abgebracht, ihr laut vorzulesen, während sie arbeitete. Sie hatten es eine Zeitlang mit Backgammon versucht. Doch während Mr Hale sich zunehmend für seine Schule und Gemeinde interessierte, musste er feststellen, dass seine Frau die Störungen, die sich aus diesen Pflichten ergaben, als Zumutung und nicht als notwendigen Teil seines Berufes verstand und versuchte, dagegen anzukämpfen, als sie immer umfangreicher wurden. Also zog er sich, als die Kinder noch klein waren, in seine Bibliothek zurück, um seine Abende (wenn er denn zu Hause war) dort zu verbringen und die philosophischen und theologischen Bücher zu lesen, die seine ganze Freude waren.
Wenn Margaret früher zu Besuch gekommen war, hatte sie eine große Kiste mit Büchern mitgebracht, die ihre Lehrer oder Lehrerinnen ihr empfohlen hatten, die Sommertage waren ihr immer zu kurz vorgekommen, um den ganzen Lesestoff zu bewältigen, bevor sie wieder in die Stadt zurückkehren musste. Jetzt gab es nur noch die schön gebundenen, kaum gelesenen englischen Klassiker, die aus der Bibliothek ihres Vaters aussortiert worden waren, um die schmalen Bücherregale im Wohnzimmer zu füllen. Die Jahreszeiten von James Thomson, William Hayleys Biographie des Dichters William Cowper und Conyers Middletons Das Leben Ciceros waren mit Abstand die leichtesten, neuesten und interessantesten unter ihnen. Die Bücherregale gaben also nicht viel her. Margaret erzählte ihrer Mutter jede noch so kleine Kleinigkeit über ihr Leben in London, und die Mutter hörte ihr gespannt zu, manchmal amüsiert, manchmal etwas kritisch, dann wieder fing sie an, die angenehmen und komfortablen Lebensumstände ihrer Schwester mit den bescheidenen Mitteln zu vergleichen, die das Pfarrhaus in Helstone zu bieten hatte. An solchen Abenden neigte Margaret dazu, ihre Unterhaltung zu unterbrechen und lieber dem Klang der Regentropfen auf dem Vorsprung des kleinen Erkers zu lauschen. Ein, zwei Mal fragte sich Margaret, während sie mechanisch die sich immer wiederholenden monotonen Geräusche zählte, ob sie es wohl wagen könnte, ein Thema anzusprechen, das ihr sehr zu Herzen ging. Die Frage, wo Frederick jetzt war und was er machte, wie lange es her war, dass sie von ihm gehört hatten. Aber das Wissen, dass die angeschlagene Gesundheit ihrer Mutter und ihre augenscheinliche Abneigung gegen Helstone seit der Zeit bestanden, zu der Frederick an der Meuterei teilgenommen hatte, ließ sie innehalten. Margaret hatte nie die ganze Geschichte gehört, doch sie schien nun begraben und in traurige Vergessenheit geraten zu sein. Deswegen vermied sie das Thema jedes Mal, wenn sie überlegte, es anzusprechen. Wenn sie bei ihrer Mutter war, schien ihr Vater der bessere Ansprechpartner zu sein, und wenn sie bei ihm war, dachte sie, sie könne leichter mit ihrer Mutter darüber reden. Wahrscheinlich gab es gar nicht viel Neues zu erfahren. In einem der Briefe, die sie erhalten hatte, bevor sie die Harley Street verlassen hatte, hatte ihr Vater ihr geschrieben, dass sie von Frederick gehört hatten; er sei noch immer in Rio, es gehe ihm gesundheitlich sehr gut, und er lasse sie herzlich grüßen; was wenig aufschlussreich war und ihr nicht die Informationen lieferte, die sie gerne erfahren hätte. Frederick wurde in den seltenen Fällen, in denen er überhaupt zur Sprache kam, immer nur als »der arme Frederick« tituliert. Sein Zimmer war noch genau so, wie er es verlassen hatte, und wurde regelmäßig von Dixon, Mrs Hales Zofe, abgestaubt und in Ordnung gehalten. Dixon, die ansonsten keine Hausarbeit verrichtete, erinnerte sich noch immer gerne an den Tag, an dem sie von Lady Beresford als Zofe für Sir Johns Mündel eingestellt worden war, die hübschen Misses Beresford, die bekanntesten Schönheiten der ganzen Grafschaft. Dixon hatte Mr Hale immer als denjenigen angesehen, der die schönen Zukunftsaussichten ihrer jungen Lady zerstört hatte. Hätte MissBeresford nicht Hals über Kopf diesen armen Landpfarrer geheiratet, was hätte aus ihr nicht alles werden können. Aber Dixon war zu loyal, als dass sie ihre Herrin in ihrem Elend und ihrem Niedergang (also ihrer Ehe) im Stich gelassen hätte. Sie blieb bei ihr und war ihr treu ergeben. Sie sah sich in der Rolle der guten und beschützenden Fee, deren Pflicht es war, die üblen Pläne des bösen Riesen, Mr Hale, zu durchkreuzen. Mr Frederick war ihr Liebling und ihr ganzer Stolz gewesen, und ihre strenge Würde wich immer einem weicheren Gesichtsausdruck, wenn sie sich einmal in der Woche der Aufgabe stellte, sein Zimmer so sorgfältig zurechtzumachen, als würde er an eben diesem Abend heimkommen.
Margaret konnte nicht umhin zu glauben, dass es eine neue Nachricht von Frederick gewesen sein musste, die ihren Vater so ängstlich und sorgenvoll machte und von der ihre Mutter nichts wusste. Mrs Hale schien keine Veränderung im Aussehen und Verhalten ihres Gatten wahrzunehmen. Er war wie immer zartfühlend und sanft und offen für jeden Hinweis, in dem es um das Wohlergehen anderer Menschen ging. Er konnte tagelang niedergeschlagen sein, wenn er an einem Sterbebett gesessen oder von einem Verbrechen gehört hatte. Aber jetzt fiel Margaret eine gewisse Geistesabwesenheit auf, als sei er in Gedanken mit einem Thema beschäftigt, das nicht eigenmächtig aus der Welt geschafft werden konnte, nicht indem er Hinterbliebene tröstete oder in der Schule unterrichtete, um die Boshaftigkeiten nachfolgender Generationen hoffentlich ein wenig zu mildern. Mr Hale ging auch nicht so oft wie früher zu seinen Gemeindemitgliedern. Er schloss sich häufig in seinem Arbeitszimmer ein und wartete voller Sorge auf den Dorf-Postboten, der sich mit einem Klopfen gegen die Klappläden der hinteren Küchentür anmeldete – mit einem Signal, das in früheren Zeiten oft wiederholt werden musste, bevor irgendjemand aus dem Haushalt begriff, worum es ging, und entsprechend reagierte. Nun wandelte Mr Hale im Garten, wenn das Wetter morgens schön war, und wenn das nicht der Fall war, stand er mit verträumtem Blick am Fenster seines Arbeitszimmers, bis der Postbote sich meldete oder den kleinen Weg entlanglief und dem Pfarrer halb respektvoll, halb vertraulich mit einem Kopfschütteln zu verstehen gab, dass er keine Post hatte für den Mann, der ihm daraufhin hinterherschaute, wie er hinter der Feldrosenhecke und dem großen Erdbeerbaum verschwand, um dann schweren Herzens und gedankenverloren sein Tagwerk zu beginnen.
Doch Margaret war in einem Alter, in dem ein strahlender Sommertag oder irgendein äußerer Umstand genügte, um jede Sorge, die nicht auf Fakten gründete, zumindest zeitweilig zu vertreiben. Und als der Oktober mit zwei Wochen herrlichem Wetter aufwartete, waren ihre Sorgen mit einer Leichtigkeit verflogen, als wären sie nichts als Distelwolle, und sie dachte nur noch an die Wunder des Waldes. Das Farnkraut war geerntet worden, und nun, da der Regen aufgehört hatte, war so manche verborgene Lichtung zugänglich, zu der Margaret im Juli und August noch keinen Zugang gehabt hatte. Sie hatte mit Edith das Zeichnen erlernt und es während der trüben Schlechtwetterperiode so sehr bedauert, dass sie, als das Wetter noch gut gewesen war, die Schönheit des Waldes nur untätig bewundert hatte, dass sie nun fest entschlossen war, in Zeichnungen festzuhalten, was sie nur eben konnte, bevor der Winter die Herrschaft übernahm. Und so war sie eines Morgens eben dabei, ihr Zeichenbrett vorzubereiten, als Sarah, das Hausmädchen, die Tür des Wohnzimmers öffnete und Mr Henry Lennox ankündigte.
Kapitel III
»Eile mit Weile«
»Lerne einer Frau Vertrauen
Wie ein wahrhaft edel Ding
Zu erwerben; lass sie bauen –
Auf dein’ Treu, dein Ernst ihr sing.
Führ sie von dem Feierort
Zeig ihr, wie die Stern’ sich reihen
Schütz sie durch dein wahres Wort
Vor den reinen Schmeicheleien.«
Mrs Browning4
»Mr Henry Lennox.« Margaret hatte sich noch eben an ihn und seine Frage erinnert, womit sie sich daheim wohl beschäftigen würde. Es war ein Moment des parler du soleil et l’on voit les rayons5, und das helle Strahlen der Sonne glitt auch über Margarets Gesicht, als sie ihr Zeichenbrett hinlegte, um ihm zur Begrüßung die Hand zu geben. »Gib Mama Bescheid, Sarah«, sagte sie. »Mama und ich wollen Ihnen so viele Fragen zu Edith stellen; ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie gekommen sind.«
»Hatte ich nicht gesagt, dass ich das tun würde?«, fragte er in einem viel leiseren Ton als sie.
»Aber ich habe gehört, Sie würden sich weit entfernt in den Highlands aufhalten, sodass ich nie gedacht hätte, Hampshire könnte auf Ihrem Weg liegen.«
»Nun ja«, sagte er in leichterem Ton, »unser junges Paar hat allerhand angestellt, die beiden haben kein Risiko ausgelassen; erst mussten sie unbedingt diesen einen Berg besteigen, dann unbedingt auf diesem einen See segeln, bis selbst ich irgendwann dachte, es bräuchte einen Mentor, der ein wenig auf die beiden aufpasst. Und das war auch so. Mein armer Onkel hatte sie überhaupt nicht im Griff, und der alte Herr war fast durchgängig in einem Zustand der Panik. Nachdem ich erkannt hatte, dass man sie nicht sich selbst überlassen durfte, sah ich es tatsächlich als meine Pflicht an, sie nicht allein zu lassen, bis sie sich sicher in Plymouth eingeschifft hatten.«
»Sie sind in Plymouth gewesen? Ach! Das hat Edith gar nicht erwähnt. Sie hat allerdings in letzter Zeit immer in großer Eile geschrieben. Sind sie wirklich am Dienstag abgefahren?«
»Ja, wirklich abgefahren, und haben mich endlich so mancher Verantwortung enthoben. Edith hat mir alle möglichen Botschaften an Sie mitgegeben. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo ein winzig kleines Kärtchen von ihr; ah, ja, da ist es ja.«
»Oh, vielen Dank«, rief Margaret, und dann entschuldigte sie sich unter dem Vorwand, ihrer Mutter noch einmal Bescheid geben zu müssen, dass Mr Henry Lennox da sei (Sarah musste da wohl irgendwie etwas falsch gemacht haben), um den Brief unbeobachtet lesen zu können.
Als sie das Zimmer verließ, sah er sich mit prüfendem Blick um. Das kleine Wohnzimmer zeigte sich im hellen Licht der Morgensonne von seiner besten Seite. Das mittlere Erkerfenster war geöffnet, und Rosen und Geißblatt lugten am äußersten Rand herein. Der Rasen war herrlich anzusehen, Eisenkraut und Geranien leuchteten in allen erdenklichen Farben. Aber gerade durch die satten Farben des Gartens wirkten die Räumlichkeiten etwas dürftig und blass. Der Teppich war alles andere als neu, die Chintzbezüge waren oft gewaschen worden, die ganze Behausung war kleiner und schäbiger, als er es erwartet hatte, zumal als Hintergrund und Rahmen für Margarets königliche Erscheinung. Er nahm eines der Bücher, die auf dem Tisch lagen, zur Hand, es war Dantes Paradies, in der schönen alten, italienischen Ausgabe in weißem Pergament und Gold. Daneben lagen ein Wörterbuch und ein paar Worte, die Margaret herausgeschrieben hatte. Die Liste war nicht interessant, aber irgendwie schaute er sie gerne an. Seufzend legte er sie wieder auf den Tisch.
»Sein Einkommen ist ganz offensichtlich so klein, wie sie es gesagt hat. Das ist merkwürdig, denn die Beresfords kommen doch aus einer guten Familie.«
Währenddessen hatte Margaret ihre Mutter gefunden. Es war einer von Mrs Hales schlechten Tagen, an denen ihr alles kompliziert und mühsam vorkam, und auch Mr Lennox’ Erscheinen wurde ihr zu viel, wenn sie es insgeheim auch als ein Kompliment ansah, dass er einen Besuch bei ihnen für lohnenswert hielt.
»Es ist aber auch so ein Pech! Das Abendessen ist heute früher geplant, und wir haben nichts als kaltes Fleisch, damit die Dienstboten mit dem Bügeln fertig werden, andererseits müssen wir ihn ja zum Essen einladen – er ist schließlich Ediths Schwager und all das. Und dein Papa ist heute Morgen wegen irgendetwas so niedergeschlagen – ich weiß gar nicht weswegen. Ich bin gerade in sein Arbeitszimmer gegangen, und er hatte die Hände vor das Gesicht geschlagen und den Kopf auf den Tisch gelegt. Ich habe ihm gesagt, ich sei mir ganz sicher, dass die Luft in Helstone ihm einfach nicht bekommt, genau wie mir, und da hob er plötzlich den Kopf und bat mich, nicht mehr ein einziges Wort gegen Helstone zu sagen, er könne es einfach nicht ertragen. Wenn es einen Ort in dieser Welt gebe, den er liebe, so sei das Helstone. Ich weiß aber trotz allem, dass es an der feuchten und drückenden Luft liegen muss.«
Margaret hatte das Gefühl, als habe sich eine dünne kalte Wolke zwischen sie und die Sonne geschoben. Sie hatte geduldig zugehört, in der Hoffnung, ihre Mutter möge ein wenig Erleichterung dabei finden, wenn sie ihr ihre Sorgen anvertraute, aber jetzt war es an der Zeit, sie wieder an Mr Lennox zu erinnern.
»Papa mag Mr Lennox, sie sind bestens miteinander ausgekommen beim Hochzeitsfrühstück. Ich wage zu hoffen, sein Besuch wird Papa guttun. Und das mit dem Abendessen ist doch egal, liebe Mama. Kaltes Fleisch passt hervorragend zum Lunch, denn Mr Lennox wird ein Dinner um zwei Uhr sicher als Lunch ansehen.«
»Aber was stellen wir denn mit ihm an bis dahin? Es ist ja erst halb elf?«
»Ich schlage ihm vor, mit mir nach draußen zu gehen, um ein paar Skizzen anzufertigen. Ich weiß, dass er selbst zeichnet, und das wird ihn dir aus dem Weg räumen. Nur komm doch jetzt bitte mit, er wird es so sonderbar finden, wenn du das nicht tust.«
Mrs Hale nahm ihre schwarze Seidenschürze ab und entspannte ihre Gesichtszüge. Sie sah sehr hübsch und damenhaft aus, als sie Mr Lennox mit der ganzen Herzlichkeit begrüßte, die jemandem, der beinahe ein Verwandter war, zukam. Er erwartete offensichtlich, dass man ihn bitten würde, zu bleiben, und nahm die Einladung so bereitwillig an, dass Mrs Hale wünschte, sie könne noch etwas anderes zum kalten Fleisch anbieten. Er war mit allem sehr einverstanden und freute sich über Margarets Idee, miteinander zum Zeichnen nach draußen zu gehen. Mr Hale wollte er bloß nicht stören, man würde sich ja bald beim Essen sehen. Margaret brachte ihr Zeichenmaterial herbei, damit er sich davon etwas aussuchen konnte, und nachdem Papier und Pinsel ausgewählt worden waren, machten sich die beiden in bester Stimmung auf den Weg.
»Ach bitte, bleiben Sie doch hier ein, zwei Minuten stehen«, sagte Margaret. »Dies sind die Cottages, die mir während der vergangenen zwei Wochen, in denen es dauernd geregnet hat, nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind. Ich habe mir wirklich Vorwürfe gemacht, dass ich sie nicht gezeichnet habe.«
»Bevor sie vollkommen verfallen und gar nicht mehr zu sehen sind. Es stimmt schon, wenn sie denn gezeichnet werden sollen – und sie sind ja wirklich pittoresk – so sollten wir das wahrlich nicht auf das nächste Jahr verschieben. Aber wo können wir uns denn hinsetzen?«
»Oje, wie Sie so reden, könnten Sie direkt aus ihrem Londoner Büro angereist sein, statt zwei Monate in den Highlands verbracht zu haben! Schauen Sie doch, da ist ein schöner Baumstamm, den die Holzfäller übriggelassen haben, genau an der richtigen Stelle, das Licht ist dort gut. Ich lege mein Plaid darüber und wir haben dann einen richtigen Waldthron.«
»Mit Ihren Füßen in der Pfütze als königlichem Fußbänkchen! Moment, ich werde ein wenig zur Seite rücken, und dann können Sie sich näher setzen. Wer lebt denn in diesen Cottages?«
»Sie sind vor fünfzig, sechzig Jahren von Siedlern gebaut worden. Eines ist unbewohnt. Die Waldarbeiter werden beide abreisen, sobald der alte Mann, der in dem anderen lebt, gestorben ist, der Arme. Da – sehen Sie – da ist er – ich muss einmal zu ihm hingehen und mit ihm sprechen. Er ist so taub, dass Sie alle unsere Geheimnisse hören werden.«
Der alte Mann stand barhäuptig in der Sonne und lehnte sich vor dem Cottage auf seinen Stock. Seine steifen Gesichtszüge entspannten sich zu einem bedächtigen Lächeln, als Margaret zu ihm ging und ihn ansprach. Mr Lennox übernahm die beiden Gestalten hastig in seine Zeichnung und vollendete dann die Landschaft, die nur als Hintergrund diente – wie Margaret erkannte, als die Zeit kam, aufzustehen, das Wasser wegzuschütten, das Papier wegzuräumen und sich gegenseitig ihre Skizzen zu zeigen. Sie lachte und errötete, und Mr Lennox beobachtete sie dabei.
»Also, das nenne ich ungerecht«, sagte sie. »Ich hätte ja nicht gedacht, dass Sie eine Zeichnung von dem alten Isaac und mir machen würden, als Sie mich gebeten haben, ihn nach der Geschichte dieser Cottages zu fragen.«
»Es war unwiderstehlich. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie stark die Versuchung war. Ich traue mich gar nicht, Ihnen zu sagen, wie sehr mir diese Zeichnung gefällt.«
Er war sich nicht ganz sicher, ob sie seinen letzten Satz gehört hatte, bevor sie zum Bach ging, um ihre Palette auszuwaschen. Ihre Wangen waren recht rosig, als sie zurückkam, doch sie sah dabei ganz unschuldig und nichtsahnend aus. Er war froh darüber, denn die Worte waren ihm unversehens herausgerutscht – was für einen Mann, der sich seine Handlungen immer so gut überlegte wie Henry Lennox, eine echte Seltenheit war.
Zuhause war alles in bester Ordnung, als sie ankamen. Die dunklen Wolken, die über dem Kopf ihrer Mutter hingen, hatten sich verzogen, nachdem ein Nachbar zufälligerweise ein Paar Karpfen vorbeigebracht hatte. Und Mr Hale war soeben von seiner Morgenrunde zurückgekommen und wartete auf seinen Besucher vor dem Eingangstor, das in den Garten führte. Trotz seines etwas abgenutzen Mantels und seines viel getragenen Huts sah er wie ein vollendeter Gentleman aus. Margaret erfüllte es immer wieder von Neuem mit zärtlichem Stolz und Genugtuung zu sehen, wie beeindruckend ihr Vater auf Fremde wirkte. Dennoch warf sie einen schnellen Blick auf sein Gesicht, und ihr aufmerksames Auge fand dort Spuren einer ungewöhnlichen Verstörung, die nur überdeckt und noch nicht verschwunden waren.
Mr Hale bat, die Zeichnungen sehen zu dürfen.
»Ich glaube, die Färbung auf dem Reetdach ist dir zu dunkel geraten, oder?«, meinte er, als er Margaret ihre Skizze zurückgab und die Hand nach der Zeichnung von Mr Lennox austreckte, die ihm für einen kurzen Moment – nicht länger – vorenthalten wurde.
»Nein, Papa! Das finde ich nicht. Der Hauswurz und die Fetthenne sind wegen des Regens so viel dunkler geworden. Ist das nicht gut getroffen, Papa?«, sagte sie und sah ihm über die Schulter, als er sich die Figuren in Mr Lennox’ Zeichnung anschaute.
»Ja, sehr gelungen. Die Zeichnung von dir, und wie du dich hältst, ist hervorragend. Und das ist genau die steife Art, auf die der arme alte Isaac seinen langen rheumatischen Rücken immer vorbeugt. Was hängt denn da von dem Ast? Das ist doch sicherlich kein Vogelnest?«
»Aber nein! Das ist meine Haube. Ich kann immer nicht zeichnen, wenn ich meine Haube aufhabe, dann wird mein Kopf so heiß. Ich frage mich, ob ich auch wohl Menschen zeichnen könnte. Es gibt so viele Leute hier, die ich gerne in einer Zeichnung festhalten würde.«
»Ich würde sagen, wenn Sie wirklich eine Abbildung von jemandem machen wollten, dann würde Ihnen das bestimmt gelingen«, sagte Mr Lennox. »Ich traue Ihrer Willenskraft eine ganze Menge zu. Ich finde, mir ist das Bild von Ihnen auch sehr gut gelungen.« Mr Hale war ihnen ins Haus vorangegangen, während Margaret noch zurückgeblieben war, um ein paar Rosen zu pflücken, mit denen sie ihre Tageskleidung für das Essen schmücken wollte.
»Ein echtes Londoner Mädchen würde die versteckte Bedeutung dieser Worte verstehen«, dachte Mr Lennox