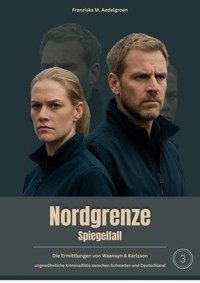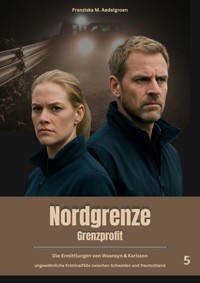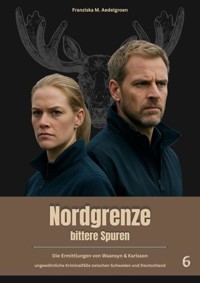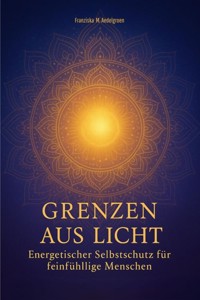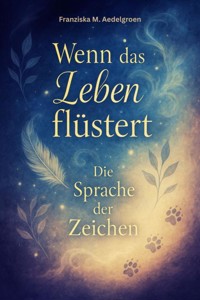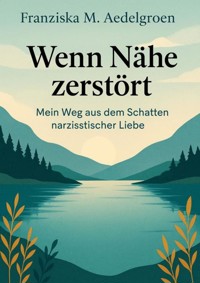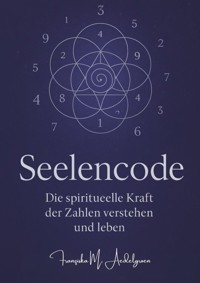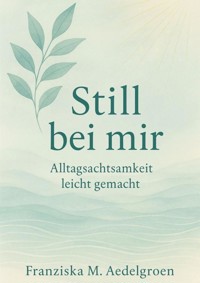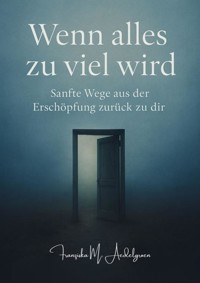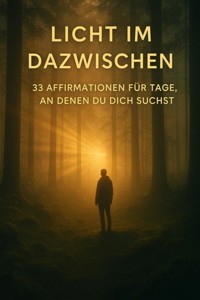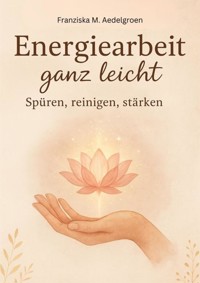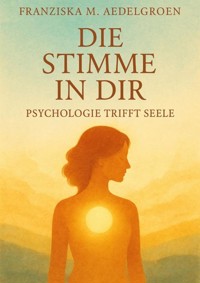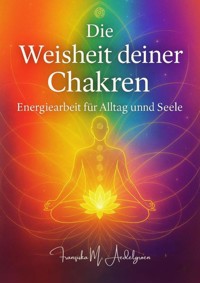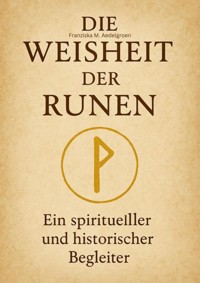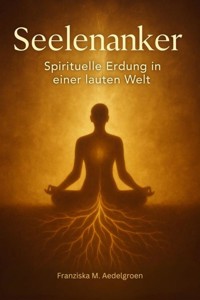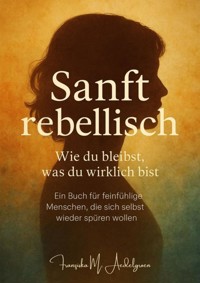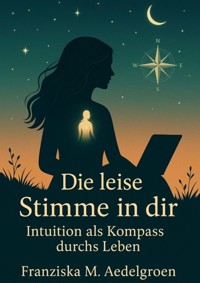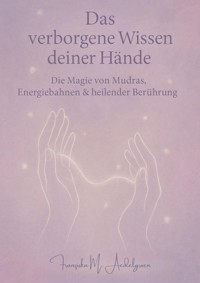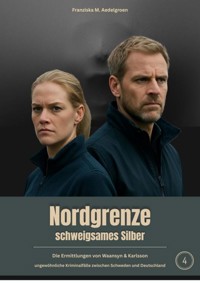
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein fesselnder Kriminalroman zwischen Deutschland und Schweden – atmosphärisch, psychologisch und hochspannend. Als ein Mann in Südschweden tot aufgefunden wird, führt die Spur tief in die Vergangenheit – in vergessene DDR-Heime, verschwundene Kinderschicksale und ein Schweigen, das tödlich wurde. Die deutsch-schwedischen Ermittler Hella Waansyn und Lasse Karlsson stoßen auf ein Netz aus alten Schuldstrukturen, gebrochenen Biografien und einer Wahrheit, die niemand hören will. Ein Krimi ohne Kitsch, ohne Esoterik – dafür mit realistischer Polizeiarbeit, psychologischer Tiefe und einem Fall, der bleibt. Für Leserinnen und Leser von skandinavischen Krimis, True-Crime-Literatur und atmosphärischen Thrillern mit gesellschaftlichem Tiefgang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NORDGRENZE - schweigsames Silber
Teil 4
von Franziska M. Aedelgroen
Ein Mord in Schweden. Ein Täter ohne Vergangenheit. Eine Wahrheit, die tödlich ist.
Der Boden war weich vom Regen, der über Nacht gefallen war. Die Luft roch nach altem Laub, nassem Stein und Eisen. Hella Waansyn blieb stehen, noch bevor sie das verfallene Gutshaus erreichte. Der Bauleiter hatte gesagt, sie hätten etwas gefunden. Etwas, das nicht zum üblichen Bauschutt passte. Kein Knochen, kein Blindgänger. Etwas, das jemand versteckt hatte. Sorgfältig.
Lasse Karlsson trat neben sie. „Sie haben es in einer Mauer entdeckt. Ein Hohlraum, sauber verfugt. Das geht nicht zufällig.“
„Zeig’s mir.“
Sie gingen über den matschigen Hof. Der Gutshof bei Ljungbyholm war kaum mehr als eine Ansammlung von Trümmern – eingestürzte Dächer, morsche Balken, zersprungene Fenster. Aber der Keller war noch intakt. Unten, im Halbdunkel, lag ein Beutel auf einer Plane. Grobes Leinen, verschlossen mit gewachster Kordel, durchzogen von dunklen Flecken, die wie eingetrocknete Tinte wirkten. Oder etwas anderes.
„Wir haben ihn nicht angerührt“, sagte der Bauleiter. „Der Kram war in Zeitungspapier eingewickelt. Alt. Deutsch. 1962.“
Hella zog Einweghandschuhe über und kniete sich hin. Das Papier zerfiel fast beim Aufrollen. Auf einer vergilbten Seite: ein Prozessbericht – Rostock, Devisenvergehen, drei Angeklagte, einer davon „verschwunden“. Die Zeile hatte jemand unterstrichen. Im Innern: Schmuck. Nicht viel, aber auffällig. Ein Kreuz aus Weißgold mit einer Gravur auf der Rückseite: Für die Zeit danach. Ein Rubinring, angelaufen, schwer. Und ein Medaillon, oval, Silber, Emailleeinlage in tiefem Blau. Innen: zwei verblasste Gesichter. Eine junge Frau, ernst. Ein Junge, kaum älter als zwölf.
„Sieht aus wie ein Archiv“, murmelte Hella. „Nicht wie ein Versteck.“
Lasse hielt das Medaillon gegen das Licht. „Wer sowas vergräbt, hat einen Grund. Einen ernsten.“
„Oder ein Geheimnis.“
Sie machten Fotos, sicherten jedes Stück, nummerierten alles. Als Hella den Beutel wieder verschloss, spürte sie das alte Ziehen in der Magengegend. Kein Instinkt. Kein Zufall. Sondern die Ahnung, dass hier etwas lag, das jemand nicht wiederfinden wollte – oder genau darauf gewartet hatte, gefunden zu werden.
Die Fahrt nach Kalmar war ruhig. Felder, leere Haltestellen, bleigrauer Himmel. Hella mochte diese Abschnitte zwischen Fund und Analyse. Noch war alles offen. Noch ließ sich das Puzzle in jede Richtung drehen. Im Amt für Kulturgutverbleib roch es nach Putzmittel und Thermopapier. Der zuständige Mitarbeiter war um die sechzig, trug eine Nickelbrille und sprach, als würde er jeden Satz vorher im Kopf auf Korrektheit prüfen.
„Der Schmuck unterliegt potenziell dem schwedischen Kulturerbegesetz“, sagte er, während er das Medaillon mit einer Pinzette betrachtete. „Aber was Sie da haben, sieht nicht nach Wikinger oder Mittelalter aus. Wenn ich raten müsste – fünfziger oder sechziger Jahre. Westdeutsch. Privatbesitz. Vielleicht auch Schwarzmarktware. Illegale Lagerung ist jedenfalls nicht ausgeschlossen.“
„Wir suchen nicht nach Eigentumsfragen“, entgegnete Hella. „Sondern nach Herkunft. Wer das vergraben hat, wollte etwas sichern. Oder verstecken.“
Der Mann schob seine Brille hoch und lehnte sich zurück. „Die Emailleeinlage im Medaillon könnte aus einer Werkstatt in Hannover stammen. Damals gab es mehrere, die mit Restbeständen aus der Kriegszeit gearbeitet haben. Einige von denen hatten Kontakte in den Osten. Schmuggelwege, Materialtausch. Nicht offiziell natürlich. Ich gebe Ihnen einen Namen.“
Er kritzelte eine Adresse auf einen Zettel – ein pensionierter Restaurator, heute in Malmö. Lasse steckte ihn wortlos ein. Als sie später in einem kleinen Gästehaus am Flussufer ihre Funde sichteten, lag der Geruch von feuchtem Holz in der Luft. Hella legte die Stücke vorsichtig auf ein weißes Handtuch. Das Kreuz, der Ring, das Medaillon – nichts davon passte stilistisch zusammen. Und doch war offensichtlich, dass sie gemeinsam verborgen worden waren. Systematisch. Als Ensemble.
„Der Junge im Medaillon“, sagte Lasse leise. „Der Blick. Das ist kein Erinnerungsstück. Eher ein Warnzeichen. Oder ein Mahnmal.“
Hella sah auf das Kreuz. Die Gravur war nicht kunstvoll, sondern hastig eingeritzt. Für die Zeit danach. Kein Widmungsstil. Eher die Handschrift eines Fluchthelfer-Notizblocks.
„Der Prozessbericht in der Zeitung – Rostock 1962“, sagte sie. „Drei Angeklagte, einer verschwunden. Wenn wir den verschwundenen Namen finden, haben wir vielleicht den ersten realen Anker.“
Sie gaben den Schmuck und die Fotografien in die Datenbank von Interpol ein. Standardprozedur. In 98 Prozent der Fälle: kein Treffer. Doch diesmal kam eine Rückmeldung. Eine deutsche Anfrage. Die Beschreibung des Kreuzes passte zu einem offenen Vermisstenfall – Hamburg, 1991. Frau mit Kind verschwunden. Verdacht auf Menschenhandel. Fall nie geklärt.
„Zwei Zeiträume, drei Dekaden auseinander, ein Schmuckstück“, sagte Lasse. „Wie wahrscheinlich ist das?“
Hella sah auf das Foto der Frau im Medaillon. „Oder jemand hat es genau so geplant. Zwei Spuren, die sich nicht treffen sollten – es sei denn, jemand will, dass man sie zusammenlegt.“
Die Kripo Hamburg empfing sie in einem Betonbau mit vergitterten Fenstern. Innen Neonlicht, außen Novemberregen. Die Ermittlerin war Mitte fünfzig, strenge Frisur, klare Stimme.
„1991 verschwand Edith Roth mit ihrem Sohn. Kein Abschiedsbrief, keine Beweise für ein Verbrechen. Nur Indizien. Die Frau hatte kurz zuvor ein Schließfach in der Schweiz aufgelöst. Darin: Bargeld, ein altes Tonband, ein versiegelter Brief. Alles ist weg. Das Kind: sechs Jahre alt. Name: unbekannt.“
„Und der Vater?“, fragte Hella.
„Wurde nie identifiziert. Es gibt Hinweise, dass sie in den Jahren davor in der DDR gelebt hat. Unter einem anderen Namen.“
Lasse legte das Foto des Medaillons auf den Tisch. Die Ermittlerin beugte sich vor, blinzelte. Dann wurde ihre Stimme flacher.
„Das ist sie. Das ist das Kreuz. Ich erinnere mich.“
„Was war mit dem Tonband?“, fragte Hella.
„Nie gefunden. Nur ein Vermerk: 'Nicht abspielbar – beschädigt.' Die Spur endete damals bei einem Fahrzeug mit Diplomatenkennzeichen – gesehen von einer Nachbarin. Zwei Tage später stand der Wagen leer in Flensburg. Keine Fingerabdrücke. Keine Kameras. Keine Zeugen.“
Lasse schüttelte den Kopf. „Und trotzdem kein politischer Fall?“
„War es nie offiziell. Vielleicht sollte es das nie sein.“
Im Hotel zogen sie die Funde noch einmal hervor. Das Kreuz, das Medaillon, die Zeitung. Die Verbindung zu Edith war mehr als plausibel. Aber noch fehlte der zweite Strang – der Junge, das Motiv, das Netzwerk.
„Was, wenn jemand bewusst diese Lücke gelassen hat?“, überlegte Hella. „Nicht, um etwas zu verbergen. Sondern, um jemanden auf eine Spur zu setzen.“
„Jemand wie uns.“
Sie schwiegen. Draußen rauschte der Regen. Drinnen lag eine Geschichte auf dem Tisch, die darauf wartete, entschlüsselt zu werden – Satz für Satz. Fragment für Fragment. Und vielleicht war das erst der Anfang. - Der Mann hieß Vilhelm Jansen, war Anfang achtzig und lebte zurückgezogen in einer roten Holzhütte am Stadtrand von Malmö. Früher Restaurator. Spezialisiert auf historische Emaillearbeiten. Seine Adresse hatte ihnen das Amt für Kulturgutverbleib gegeben.
„Werkstatt? Nein, längst aufgelöst“, sagte Jansen, während er ihnen Kaffee in blasse Porzellantassen goss. „Aber ich erinnere mich an bestimmte Stücke. Vor allem, wenn sie nicht aus dem Museum kommen.“
Hella legte das Foto des Medaillons auf den Tisch. Jansen zog die Brille hoch, beugte sich vor.
„Ja. Das stammt nicht von mir. Aber ich kenne die Technik. Diese Einlagen, das Silber – das war damals eine Nische. Nach dem Krieg haben viele kleinere Werkstätten mit überschüssigem Material gearbeitet. Teilweise aus Militärbeständen.“
„Aus welchem Umfeld kamen die Kunden?“, fragte Lasse.
„Gemischt. Beamte, Geschäftsleute, manche mit Beziehungen zur DDR. Einer sprach immer von ‘neutralem Schmuck’ – tragbar in Ost und West. Ohne Symbolik. Unauffällig, aber wertvoll.“
Hella zeigte ihm auch ein Bild der Gravur: 18. Juni 1954.
Jansen nickte langsam. „Manche haben sich persönliche Daten eingravieren lassen. Erinnerungen, Botschaften. Manche... Codes. Es gab eine Werkstatt in Lübeck – ‘Kurtz & Wessel’. Die machten oft Stücke mit doppeltem Boden.“
„Im wörtlichen Sinn?“
„Versteckte Fächer, geheime Verschlüsse. Man sagte, die hatten Verbindungen zu Leuten, die Informationen über die Grenze trugen. Ob das stimmte, weiß keiner.“
Auf der Rückfahrt sagte Lasse: „Wir sollten nach Lübeck. Wenn die Werkstatt noch Akten hat, könnten wir herausfinden, wer dieses Medaillon beauftragt hat.“
Hella schüttelte den Kopf. „Oder wir stoßen wieder auf Schweigen. Wer 1954 einen anonymen Schmuckauftrag gegeben hat, hatte einen Grund, nicht gefunden zu werden.“
„Trotzdem – es ist ein Faden. Und wir haben nicht viele.“
Sie erreichten Lübeck am nächsten Tag. Die Werkstatt „Kurtz & Wessel“ existierte nicht mehr, aber im Archiv der Handwerkskammer fanden sie einen Eintrag – zuletzt aktiv 1966, dann aufgelöst, Inhaber verstorben. Hella kopierte den Firmennachlass: Rechnungsbücher, Materiallisten, handschriftliche Bestellungen. In einem der Kladden: eine Skizze, die dem gefundenen Medaillon verdächtig ähnelte. „Auftraggeber: V. L.“ stand darunter. Keine Adresse, kein Nachweis der Zahlung.
„Viktor Lovgren?“, fragte Lasse leise.
Hella nickte. Der Name war in der Akte von Hamburg aufgetaucht – ein Phantom. Kein Nachweis, kein Eintrag. Nur erwähnt von Edith Roth, damals, kurz vor ihrem Verschwinden. Sie suchten den Namen in alten Datenbanken, in Stasi-Unterlagen, West- und Ostarchiven. Kein direkter Treffer. Doch in einem Entwurf zu einem BGS-Bericht von 1979 tauchte die Notiz auf: „V.L. – vermuteter Mittelsmann bei Grenztransporten. Kein Zugriff. Interner Beobachtungsvermerk.“
„Es gab also Ermittlungen“, sagte Hella. „Aber nie Anklage. Nie Presse. Nur Hinweise.“
„Oder jemand hat sie rausgehalten.“
Der Name tauchte in Verbindung mit drei Orten auf: Flensburg, Berlin – und einem Bahnhof nahe der dänischen Grenze: Fröslev. Sie fuhren am nächsten Morgen los. Der alte Bahnhof war längst stillgelegt. Zwischen wildem Gestrüpp und verrosteten Schienen stand noch das Hauptgebäude – eingeschlagene Fenster, Graffiti, ein zerfallener Fahrplan an der Wand. Aber das Gemäuer war intakt. Im Keller entdeckten sie alte Gepäckfächer. Aus Holz, teils herausgerissen, verwittert. Nur eines war vollständig. Auf der Messingplatte: die Nummer 34. Hella erinnerte sich an den Schlüssel aus der Hamburger Akte. Eine Seriennummer: 34-09-91. Sie zog ihn aus der Tasche. Der Bart passte. Das Fach öffnete sich mit einem trockenen Knacken. Darin: ein Pappkarton, sorgfältig verschnürt. Und eine kleine, dunkle Kassette aus Metall. Kein Schloss. Nur ein Streifen Isolierband. Innen: ein Tonband, ein Medaillon – identisch mit dem ersten – und ein Umschlag.
„Absender?“, fragte Lasse.
Hella drehte ihn um. Eine dänische Briefmarke, kein Empfänger. Auf der Rückseite: ein einziges Wort. Handschriftlich, verwaschen. Bliv væk. – Bleib weg.
„Warnung oder Drohung?“, murmelte Lasse.
„Oder der letzte Versuch, jemanden aufzuhalten.“
Zurück in Deutschland fand Hella in Flensburg ein Technikmuseum mit einer Abteilung für analoge Medien. Der Kurator war ein Bastler, der sich für alte Bandmaschinen begeisterte. Sie durften bei der Wiedergabe dabei sein. Das Band kratzte, zischte, dann kam eine Stimme. Weiblich. Unruhig, aber klar.
„Mein Name ist Edith. Wenn Sie das hören, bin ich wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, zu reden. Vielleicht lebe ich noch. Vielleicht nicht. Aber ich muss erzählen.“ Stille. Dann weiter. „Er war kein schlechter Mensch. Aber er war Teil von etwas, das ihn verschluckt hat. Viktor. Er trug Dinge über die Grenze, Informationen, Werte – immer mit dem Satz: ‘Für den Tag danach’. Ich weiß bis heute nicht, ob er glaubte, damit etwas Gutes zu tun.“
Lange Pause. Man hörte das Ticken eines Uhrwerks im Hintergrund.
„Ich habe den Schmuck genommen. Nicht alles. Nur das, was Bedeutung hatte. Der Ring. Das Kreuz. Das Medaillon. Ich konnte nicht mehr mitmachen. Ich wollte, dass es endet. Oder wenigstens, dass jemand versteht.“
Dann brach die Stimme ab. Die letzten Worte waren undeutlich, dann nur noch Rauschen. Lasse legte die Kassette beiseite.
„Wenn das kein Geständnis ist, dann wenigstens ein Versuch.“
Hella sah ihn an. „Oder eine Übergabe. An uns.“