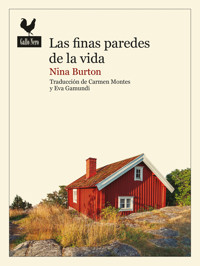4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Renovierung eines alten schwedischen Sommerhauses wird zu einer wunderbaren Erkundung der Natur, des Lebens und der Philosophie.
»Ich machte einen Spaziergang durch den Garten. Eine Kohlmeise trällerte über einem Beet mit Huflattich. Ich hatte das Gefühl, dass tausend Entdeckungen auf mich warteten…«
»Notizen aus dem Sommerhaus« von Nina Burton ist ein wunderschön geschriebenes Memoir über die Zeit, die die schwedische Schriftstellerin und Essayistin Nina Burton mit der Renovierung eines alten Sommerhauses dem Land verbrachte, und über die Tiere, denen sie während ihres Aufenthalts begegnete.
Überall im Haus und im umliegenden Garten trifft sie eine Vielzahl von Tieren: Ameisen, Bienen, Füchse, Eichhörnchen, Amseln, Dachse, Tauben, Rehe und viele mehr. Sie alle haben das Sommerhaus und den Garten zu ihrem Zuhause gemacht und regen Nina zum Nachdenken über ihre Rolle in unserer Welt an.
Wussten Sie, dass es insgesamt mehr Ameisen gibt als die Anzahl von Sekunden, die seit dem Urknall verstrichen sind? Und dass ihre Ameisenstädte übertragen auf menschliche Verhältnisse größer sein können als London oder New York? Oder dass der Wanderinstinkt von Zugvögeln so stark ist, dass ein verletzter Storch, der seiner Gefangenschaft entkam, sechs Wochen später gefunden wurde, nachdem er 150 Kilometer weit gelaufen war und zu Fuß dem Wanderweg seines Schwarmes gefolgt war?
Was mit der Renovierung eines alten Sommerhauses beginnt, entwickelt sich zu einer wunderbaren Erkundung der Natur, des Lebens und der Philosophie, in der Nina Burton das Innenleben und die bisher unbekannten Gewohnheiten der Tiere enthüllt, mit denen sie zusammenlebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
Wussten Sie, dass es insgesamt mehr Ameisen gibt als die Anzahl von Sekunden, die seit dem Urknall verstrichen sind? Und dass ihre Ameisenstädte übertragen auf menschliche Verhältnisse größer sein können als London oder New York? Oder dass der Wanderinstinkt von Zugvögeln so stark ist, dass ein verletzter Storch, der seiner Gefangenschaft entkam, sechs Wochen später gefunden wurde, nachdem er einhundertfünfzig Kilometer weit gelaufen war und zu Fuß dem Wanderweg seines Schwarms gefolgt war?
Was mit der Renovierung eines alten Sommerhauses beginnt, entwickelt sich zu einer wunderbaren Erkundung der Natur, des Lebens und der Philosophie, in der die schwedische Schriftstellerin und Essayistin Nina Burton das Innenleben und die bisher unbekannten Gewohnheiten der Tiere enthüllt, mit denen sie zusammenlebt.
Überall im Haus und im umliegenden Garten trifft sie eine Vielzahl von Tieren: Ameisen, Bienen, Füchse, Eichhörnchen, Amseln, Dachse, Tauben, Rehe und viele mehr. Sie alle haben das Sommerhaus und den Garten zu ihrem Zuhause gemacht und regen Nina zum Nachdenken über ihre Rolle in unserer Welt an.
Zur Autorin
NINABURTON, Jahrgang 1946, ist Dichterin und Essayistin und bekannt für ihren einzigartigen Stil, in dem sie lyrische Sprache mit Naturwissenschaften vereint. Nina Burtons Werk wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem renommierten August-Preis in der Kategorie Sachbuch, dem Essaypreis der Schwedischen Akademie, dem wichtigsten schwedischen Sachbuchpreis Stora Fackbokspriset und dem Övralidspriset. Nina Burton ist Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften.
Nina Burton
Notizen aus dem Sommerhaus
Vom Leben im Freien
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Livets tunna väggar« bei Albert Bonniers Förlag, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2020 by Nina Burton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published in the German language by arrangement with Bonnier Rights, Stockholm, Sweden
Covergestaltung: semper smile, München,
nach einem Entwurf von Harper Collins UK
unter Verwendung einer Coverillustration von Tom Haugomat
Autorinnenfoto: © Caroline Andersson Renaud
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27941-7V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Inhalt
In die Natur
Das blaue Dach
Flügelsurren an der Tür
Die Ameisenwand
Verandablick zum Wasser
Die Kraft der Wildnis
Der Hofbaum
Literatur
In die Natur
Unsichtbar und prächtig, kämpfend und liebend – alles Leben dieser Erde pulsierte um mich herum. Schon als Kind hatte ich mich mit Namen, Adresse und diesem Zusatz »Erde« ins Dasein eingeschrieben. Ich war es, die sich im Zentrum von allem befand. Ich war es, der alle Wege offenstanden. Problematisch wurde es, als ich erkannte, dass auch alle anderen sich als Mittelpunkt der Welt empfanden. Und als wäre das noch nicht genug, galt das nicht nur für Menschen – sondern für die ganze Natur um mich herum.
Und was war die Natur? Es hieß, es ginge in ihrem Fall um eine Umwelt oder ein Draußen, es ginge um Veranlagungen, mit denen wir geboren würden, aber gleichzeitig schien es sich um ein endloses Werden zu handeln, denn »Natur« ist nicht ohne Grund verwandt mit »Nativität«. Kurz gesagt gab es ein fortwährendes Leben mit Milliarden verschiedener Zentren darin, brodelnd vor lauter Bedeutungen. Sie alle bewegten sich mit ihren jeweils eigenen Zeitrhythmen und Perspektiven, so dass sie nie als Ganzes und Gleichzeitiges erfasst werden konnten.
Im sprachlichen Zweig des Gymnasiums belegte ich Biologie als zusätzliches Wahlfach und erkannte, dass wir ein Teil der Natur waren, weil Linné und Darwin uns den Tieren zugeordnet hatten. An der Universität studierte ich anschließend Literatur und Philosophie in dem Glauben, diese Kombination würde mir Antworten über das Leben geben können. In der Literatur ging es jedoch meist um einzelne Menschen, und die Philosophie kreiste mittlerweile hauptsächlich um abstrakte Konstrukte. Ich sehnte mich zurück zu den alten Denkern Griechenlands, die Fragen zur Natur gestellt hatten. Demokrit schrieb über Atome und Sterne, Thales wusste alles über das Wasser, Anaximander vermutete anhand von Fossilien, dass wir entfernt mit den Fischen verwandt seien, und Heraklit sah, dass alles die veränderliche Natur von Flüssen besaß.
Auf sie folgte Aristoteles, der sich mit allen Bereichen des Lebens beschäftigte, von Physik und Meteorologie bis hin zu Sprache und Poesie. Seine Interessen vereinigten sich in zwei griechischen Worten: bios für Leben und logos für Wort oder Vernunft. Beide konnten mit anderen kombiniert werden, so etwa, wenn sie in »Biologie« vereinigt wurden. Weil Aristoteles nicht nur umgeben von Theorien leben wollte, zog er sich für ein Jahr auf die Insel Lesbos zurück, um die Natur konkreter zu erforschen. Während sein Schüler Theophrast die Beziehung der Pflanzen zur Umwelt untersuchte, widmete er sich den Tieren und erforschte ihre Anatomie und Entwicklung so genau, dass er nicht nur zum Begründer der Zoologie wurde. In vielen Fällen sollten seine Schlussfolgerungen sogar bis in unsere Zeit Bestand haben.
Nachdem er mit »dem Tier, das wir am besten kennen« begonnen hatte, also dem Menschen, ging er zu anderen Arten über, denn unsere Bedeutung sollte die der übrigen Tiere nicht kleiner machen. Er studierte Singvögel und Tauben, Krähen und Spechte, Ameisen und Bienen, Tintenfische und Wale, Füchse und andere vierpfotige Tiere, beschrieb den Lebenszyklus der Zikade und sah, wie sich Schlangen paarten, indem sie sich umeinanderwickelten. Er sezierte befruchtete Eier, in denen die Embryonen bereits Augen, Adern und pochende Herzen besaßen. Er machte sich Gedanken über Vererbung und glaubte, dass sie mit etwas zusammenhing, das er eidos nannte, das griechische Wort für Form. In seinen Augen glich es der Anordnung von Buchstaben in einem Wort, womit er einer Erklärung für die DNA des Erbguts erstaunlich nahe kam.
Was war die treibende Kraft hinter all diesem Leben? Aristoteles glaubte, dass jedes Lebewesen, solange es lebte, eine Art Seele besaß, von der die Materie angeregt wurde und von der die Nährstoffe durch den Körper gelenkt wurden. Die Natur verfügte in seinen Augen über die einzigartige Fähigkeit, immer komplexere Organismen zu formen, und weil sich alle an ihre Umwelt anpassen mussten, war es letztlich die Natur selbst, die bestimmte. Das Ganze glich einem Haushalt, in dem man sich zwar streiten konnte, aber dennoch zusammenarbeitete. Genau wie die Sonne und der Mond und die Sterne hatte jedes Teil seinen Platz im Haus, der nicht verlassen werden sollte. Gemeinsam ergab alles ein zusammenhängendes Gefüge mit festgelegten Proportionen, ähnlich wie die Wände in einem Haus. Aus dem griechischen Wort für Haus, oikos, leitete sich dann später das Wort Ökologie ab.
* * *
Die Natur war mir nicht fremd, obwohl ich ein Stadtkind war. Wir hatten nie ein eigenes Sommerhaus, aber in den Sommerferien mietete meine Mutter immer Ferienhäuser auf dem Land, und später setzte sich die Tradition fort, als meine Schwester sich im Ausland verheiratete. Sie kurierte ihr Heimweh fortan damit, schwedische Sommerhäuser zu mieten, die ich mir dann mit ihr und den Kindern teilte, bis ihr Mann kam, um seinen Urlaub anzutreten.
Ich selbst bin dreißig Jahre lang mit Männern liiert gewesen, die auf dem Land lebten. Meine Interessen deckten sich immer auch mit ihren: Einer wusste als Schriftsteller, wie Worte die Welt zu erweitern vermögen, und einer als Biologe um die Zusammenhänge in der Natur. Wie Doktor Dolittle genoss er das Vertrauen der Tiere und schaffte es sogar, einen Auerhahn zu streicheln, der Gefallen an seiner Veranda gefunden hatte. Ich selbst begegnete Tieren eher in der umfangreichen Bibliothek des Biologen.
Ich war also oft zu Gast in der Natur gewesen. Doch erst nach dem Tod meiner Mutter wurde daraus mehr, denn danach tauschten wir ihre Wohnung gegen ein Sommerhaus ein. Es war wie das Leben selbst: Es war ein Erbe, das etwas Neues bereithielt, und genau wie das Leben beinhaltete es verschiedene Dinge. Für meine Schwester bedeutete es Urlaub mit Kindern und Enkelkindern, und für mich würde es möglicherweise zu einem Ort werden können, an den ich mich mit meinen Manuskripten zurückzog. Schließlich wollte ich über die Natur und das Leben schreiben. Würde das in dem Häuschen gehen?
Das große, naturbelassene Grundstück war voller Leben. An der Südseite kletterte zwischen Kiefern und Eichen ein kleiner, bemooster Hügel empor, und im Westen erahnte man geheimnisvolle Pfade im Blaubeerkraut. An der Nordseite grenzte das Grundstück steil an eine Gemeindewiese mit einem glitzernden Sund im Hintergrund. Es gab keine umzäunten Grenzen, so dass alles abgeschieden und zugleich offen war.
Während das Grundstück groß erschien, wirkte das Häuschen umso kleiner. Es bestand aus einem einzigen Zimmer, das, wie so oft bei solchen Sommerhäusern, auf die Schnelle zusammengeschustert und entsprechend erweitert worden war. Die Verglasung einer Veranda war durch Wände ersetzt worden, um anschließend zwei Etagenbetten Platz zu geben, und in einem kleinen Anbau kamen später Küche und Badezimmer hinzu. Danach verhinderte die Topographie weitere Vergrößerungen.
Stattdessen standen in jeder Ecke des Grundstücks Schuppen. In einem lag das frühere stille Örtchen, verwandelt in einen Geräteschuppen, und wieder in einem anderen gab es eine Schreinerwerkstatt mit einem nach vorn offenen, überdachten Lagerraum. In einer dritten Ecke war eine Hütte Spielzimmer gewesen, und in der vierten lag eine Schlafhütte, die ich insgeheim zu meiner Schreibstube ernannte.
Mit Mängeln am Haus war zu rechnen gewesen, denn beim Kauf war eine Haftungsausschlussklausel in den Vertrag aufgenommen worden. Der Schreiner, der gerufen wurde, murmelte sogar, ein Neubau wäre besser. Das empörte mich. Sah er nicht, wie idyllisch es war? Beziehungsweise: Was sah er?
Jedenfalls waren offenbar einige Reparaturen erforderlich. Ich freute mich regelrecht darauf, mich um die Handwerker zu kümmern, denn ich empfinde das Schreiben meiner Bücher so ähnlich wie das Bauen von Häusern. Da die Planskizzen jedes Mal neu sind, muss ich vieles ausprobieren, und es ist eine knifflige Aufgabe, die richtigen Proportionen zwischen all den unterschiedlichen Materialien zu finden. Auf diese Weise sehe ich mich an meinem Schreibtisch täglich mit handwerklichen Problemen konfrontiert.
Nun mussten noch zwei Buchprojekte abgeschlossen werden, ehe ich mich dem Leben und der Natur widmen konnte. Bei dem einen ging es um die Art und Weise von Flüssen, sich über Gebiete mit sowohl Natur als auch Kultur zu erstrecken, während das zweite von der Vereinigung von Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften im Humanismus der Renaissance handelte. Mein Held war Erasmus von Rotterdam, der das Genre des Essays wiederbelebt hatte, aber mich faszinierte auch Conrad Gessner, der große Enzyklopädiker des sechzehnten Jahrhunderts. Wie Aristoteles hatte auch Gessner eine Vielzahl unterschiedlicher Themen im Blick, von der Zoologie bis zur Sprachwissenschaft. Er schrieb über tausende Pflanzen und tausende Schriftsteller, und die Beziehungen zwischen den Tierarten inspirierten ihn dazu, die Verwandtschaft von etwa hundert Sprachen zu untersuchen.
Die Idee der Enzyklopädie ist mir immer sympathisch gewesen. Sie gibt Großem und Kleinem das gleiche Gewicht, da es in ihr keine Hauptpersonen gibt, stattdessen kann die Welt von verschiedenen Seiten aus beleuchtet werden. In meinen Augen reflektierte Gessners Perspektive die Spannweite des Lebens. In meinem Renaissancebuch konnte ich ihm nur ein Kapitel widmen, aber mir gefiel seine Art, Tiere und Sprachen, Pflanzen und Literatur, zu vereinen.
Die Bandbreite seiner siebzig Bücher würde in der kleinen Schreibstube des Grundstücks natürlich niemals Platz finden, und um sie herum gab es wahrscheinlich auch nicht so viele Arten. Und würde ich ihre Kommunikation überhaupt wahrnehmen? Was ich über das Leben auf der Erde wusste, war ja mit Hilfe eines menschlichen Alphabets vermittelt worden. Die Wesen, die um mich herum flogen und schlichen, kletterten und schwammen, mussten eigene Sprachen besitzen, die zur Natur passten. Sie konnten buchstäblich erdnah oder flügelleicht sein, wenn sie sich nicht tastend einen Weg suchten wie Wurzeln. Wie sollte ich also die Tiere und ihre Sprachen finden, die vor dem Alphabet kamen? Unterschiede errichten meist Mauern zwischen verschiedenen Welten.
Aber wie so oft sollte das Leben seine eigene Lösung für die Probleme finden.
Das blaue Dach
Man könnte sagen, dass ich das Haus von oben nach unten kennenlernte. Das Dach war das Erste, was den Handwerkern ins Auge fiel, denn die Dachpappe musste ausgetauscht und die Isolierung verstärkt werden. Als sie im Hausinneren eine Wärmekamera nach oben richteten, wurde das Bild lavendelblau wie eine Februarnacht, was auf massiv eindringende Kälte hindeutete. An manchen Stellen sah man zudem kleine gelbe Wolkenformationen im Blau, und weil Gelb für Wärme stand, gab es dort wahrscheinlich Reste von Isolierung. Die Bilder stimmten mich nachdenklich. Rund um das Haus lagen wie aus kleinen Wolken gefallen hier und da Isolierungsbüschel. Wie waren sie dort gelandet? Sie konnten ja wohl kaum hinausgeweht worden sein?
Die Handwerker würden Ende März wiederkommen, und um mich da draußen mit ihnen treffen zu können, übernachtete ich schließlich, als es so weit war, im Haus. Es sollte das erste Mal sein, und als ich ankam, war es noch winterlich kühl. Während sich die Heizkörper erwärmten, machte ich deshalb einen Abstecher in die nähere Umgebung. Das Licht verlieh jedem noch so kleinen Kieskörnchen Kontur und Schatten im kahlen Erdboden, in dem alles bereitlag, um mit Leben bekleidet zu werden. Eine Kohlmeise flötete über einigen Huflattichen, und vieles andere war mit Sicherheit dabei, sich in Knospen und samengefüllte Zapfen zu formen. Es schien mir, als würden mich tausend Entdeckungen erwarten.
Zurück im Haus heizte ich es zusätzlich, indem ich den Herd anstellte. Während das Nudelwasser kochte, wühlte ich in ein paar Umzugskartons aus Mutters Wohnung. Es blieb noch einiges zu räumen, aber ich hatte vor, mir einen ruhigen Abend zu gönnen und zu lesen. Die Stille war erholsam und passte zu dem Buch, das ich mitgenommen hatte. Es ging darin um den Weltraum.
Da draußen waren die Bestandteile des Lebens ja einst aus einem Kosmos geboren worden, der nicht größer war als eine geballte Faust. Für eine unerhörte Sekunde schloss sie sich fest um zukünftige Galaxien und eine grenzenlose Zukunft. Dann brach das unendliche Crescendo los. Aus einem greifbaren Anfang entstand eine vollgekritzelte Weite aus Sternen, die im Laufe einiger Milliarden Jahre Kohle und Sauerstoff, Silber und Gold und alle anderen Bestandteile produzierten, die das Leben benötigte. Auch die Protonen und Elektronen meines eigenen Körpers waren einst Materie oder Strahlung im Weltraum gewesen. Im Grunde konnte man mich also ein Abfallprodukt toter Sterne nennen, oder vielleicht eher eine Ansammlung von Sternenrohstoffen. Davon gab es reichlich, denn noch immer kommen Millionen Tonnen kosmischer Materie zur Erde.
Ich schloss die Augen und dachte nach. Aus der Perspektive des Buchs war die Erde Teil eines unermesslichen Kreislaufs aus Elementarpartikeln, die zu Bergen, Wasser, Pflanzen oder Tieren kombiniert werden konnten. Und während unsere flüchtigen Formen vorüberflimmerten, drehte unser Sonnensystem einmal mehr eine Runde um das Zentrum der Milchstraße. Diese Umrundung dauerte zweihundert Millionen Jahre und wurde ein kosmisches Jahr genannt.
Draußen bewegten sich Sterne und Planeten wie die Teile eines gewaltigen Uhrwerks. Wie alle Zeitmesser wurde es gelegentlich reguliert, so dass der Mond sich sachte von uns entfernte. Momentan änderte sich dadurch nicht viel, da es nur um vier Zentimeter pro Jahr ging.
Als nach und nach die Proportionen justiert wurden, weitete das Weltall die Wände des Hauses. Für den Astronomen des Buchs trug noch das Kleinste zur großen Perspektive bei. Hielt man beispielsweise eine Einkronenmünze einen Meter vor die Augen, fanden dahinter hunderttausende Galaxien Platz, und jede Galaxie bestand wiederum aus Milliarden Sternen. In unserer Milchstraße lagen sie über einen derart gewaltigen Raum verteilt, dass das Licht einige Millionen Jahre unterwegs war. In dieser Zeit waren die Sterne selbst bereits gestorben, aber ihr Licht lebte weiter, ähnlich wie alte Plattenaufnahmen die Musik toter Musiker enthielten.
Wohin war das Licht unterwegs? Im Weltraum gab es kein Zentrum. In jeder Richtung schien es ähnlich auszusehen. Wehmütig dachte ich an die Weltraumsonde, die man mit einem Bild von zwei Menschen losgeschickt hatte. War es nicht etwas vermessen, das als die wichtigste Information über die Erde zu betrachten? Und wenn es überhaupt Sprachen im Weltall gab, hatten sie mit Sicherheit einen völlig anderen Charakter als unsere. Es war eine Welt, der man sich eher mit Mathematik als mit Worten näherte.
Eine bessere Visitenkarte hätte die Aufnahme der NASA von der elektromagnetischen Vibration der Erde sein können. Sie ist zudem in Klänge umgewandelt worden, und als ich diese brausende Harmonie ohne Anfang oder Ende hörte, berührte sie mich auf eigentümliche Weise. Hatte man sich so die Musik der Sphären vorgestellt? Kepler glaubte in seinen Spekulationen, dass Saturn und Jupiter Bässe waren, während Erde und Venus Altstimmen hatten, Mars ein Tenor war und Merkur die Diskantstimme hielt. Wie sie in der Wirklichkeit klangen, wusste ich nicht, aber in der Version der NASA vermittelte der Gesang der Erde mir ein Gefühl von den schönen und zugleich fragilen Lebensvariationen des Planeten.
* * *
Waren draußen Sterne zu sehen? Ich legte das Buch zur Seite und stellte mich mit der Jacke auf den Schultern vor die Haustür. Dem Buch zufolge, in dem ich las, können neunzig Prozent der westeuropäischen Bevölkerung keinen richtigen Sternenhimmel mehr sehen, da der Himmel von unserem künstlichen Licht verdunkelt wird. Sicher, das Weltall wird von Dunkelheit dominiert, aber wenn wir schon aus Sternenstaub bestanden, würde es schon Spaß machen, die Sterne auch zu sehen. Nur der Polarstern war durch die Atmosphäre schwach blinkend zu erkennen.
Dagegen tauchte flüchtig etwas Näheres in den Augenwinkeln auf. Strich da nicht hastig ein Schatten vorbei? Gab es Fledermäuse auf dem Grundstück? Ich hatte ein zwiespältiges Verhältnis zu ihnen. Sie sind die einzigen Säugetiere, die es geschafft haben, die Lüfte zu beherrschen. Im Gegensatz zu Vögeln haben sie keine Federn, sondern Flügel aus nackter Haut, aufgespannt zwischen dem Daumen und den vier Fingern ihrer Hände. Sie zieht sich darüber hinaus bis zum Fußknochen hinunter, um eine große Spannweite zu bieten. Und die ist nicht nur riesig. Ihre geflügelten Hände manövrieren außerdem schneller in der Luft, als sich meine Finger auf einer Computertastatur bewegen können.
Sie kommunizieren mit blitzschnellen Ultraschalllauten, die das Dunkel ausloten, in dem sich die Nachtfalter verbergen. Der eher private Kontakt ist dagegen sowohl körpernah als auch schnatternd. So hat man beispielsweise ein Fledermausweibchen dabei beobachtet, wie sie einer gebärenden Verwandten handgreiflich assistierte, indem sie ihr zunächst zeigte, wie der Körper gedreht werden musste, damit das Junge leichter herauskommen konnte, und indem sie es anschließend selbst in Empfang nahm. Es glich einer menschlichen Entbindung. Und warum empfindet man diese zotteligen, warmen Fledermäuse dann als fremd? Weil wir sie mit der Nacht verknüpfen, in der wir uns zurückziehen und unsere Sinne schlafen?
Nach einer Weile ging ich hinein und legte mich in eines der Etagenbetten. Obwohl es eng war, fühlte ich mich geborgen; fast so, als läge ein anderer im oberen Bett. Warme Körper schützen einen vor der verlassenen Weite und Stille des Weltraums.
Plötzlich hörte ich jedoch ganz in der Nähe ein Geräusch. Bewegte sich jemand über mir in der Decke? Ich glaubte eher nicht, dass es eine Fledermaus war, aber was war es dann? Weil es zu dunkel war, um draußen etwas sehen zu können, versuchte ich einzuschlafen, sehnte mich aber nach dem Morgenlicht.
Und als es hereinschien, erwachte nicht nur ich. Jetzt waren die Geräusche von der Decke erneut als leichte Schritte zu hören. Konnte das ein Vogel sein? Als ich mich hinausschlich und nachsah, war das Dach leer. Dafür entdeckte ich etwas auf der Rückseite des Hauses. In dem Netz zwischen Dach und Wand war ein großes Loch. Es glich einem Eingang.
Danach beschäftigte dieser Eingang meine Fantasie, während ich versuchte, die Umzugskartons mit Küchenutensilien auszuräumen. Gegen Mittag drehte ich eine Runde um das Haus und bekam das unbekannte Deckenwesen endlich zu Gesicht. Ausgestreckt auf dem Netzstreifen zwischen Wand und Decke lag es da und döste in einem Zustand, der an eine Siesta erinnerte. Die Zähne zeigten, dass es ein Nager war, und auf den ersten Blick hätte man es wohl auch für eine Ratte halten können, aber der buschige Schwanz sagte etwas anderes.
Auf einmal passte alles zusammen. Dieses Eichhörnchen hatte die Dachisolierung hinausbefördert, um mehr Raum für sich selbst zu bekommen, was ihm wahrlich gelungen war. Wenn man das Bild der Wärmebildkamera bedachte, musste es da oben eine großzügig bemessene Eichhörnchenwohnung geben.
Meine Gefühle gerieten völlig durcheinander. Da lag ein Eindringling, der mit meinem Haus sehr eigenmächtig umgegangen war. Andererseits habe ich Eichhörnchen immer gemocht und hatte einiges über sie gelesen, und nun konnte ich sowohl die Tasthaare der Handgelenke als auch die rudimentären Daumen sehen, die ihre Vorderpfoten so sehr wie Hände aussehen lassen. Ich betrachtete den buschigen Schwanz, der bei den Sprüngen zwischen den Bäumen zu einem Steuer und nachts zu einer Decke werden kann. Er hatte eine Weichheit, die einen auch ohne Berührung berührte.
Dem Geschlecht unter dem Schwanz nach zu urteilen, handelte es sich um ein Weibchen, und das Leben einzelgängerischer Eichhörnchenweibchen kann hart sein. Nach der frühjährlichen Paarungsjagd in den Bäumen vertreiben sie die Männchen aus ihrem Revier und müssen sich anschließend allein um alle Jungen kümmern. Wie stressig das manchmal ist, hatte ich begriffen, als mein Freund, der Biologe, ein Eichhörnchenjunges gefunden hatte, das aus dem Nest gefallen war. Schnell las ich nach, was Eichhörnchenmütter tun müssen, und das war so einiges. Alle drei Stunden mussten die Jungtiere gefüttert werden, und hinterher sollten ihre kleinen Bäuche geleckt oder massiert werden, um die Verdauung anzuregen. Danach mussten alle nacheinander eine Weile außerhalb des Nests gehalten werden, damit es nicht zu einer Toilette wurde. Das klang nach einem Vollzeitjob, und umso erleichterter war ich, als die Eichhörnchenmutter ihr Junges fand. Vielleicht war es aus dem Nest gefallen, als sie versuchte, sich zwischen ihren vielen Pflichten selbst etwas Essbares zu beschaffen. Es würde für sie bestimmt nicht leichter werden, wenn die Jungtiere anfingen, als leichte Beute für Habichte und Katzen herumzulaufen, aber Eichhörnchenweibchen sind so verantwortungsbewusst, dass sie sich sogar elternloser Jungtiere annehmen, wenn sie mit ihnen verwandt sind.
Mein Mitgefühl war geweckt. Eichhörnchen waren in fast allen Epochen gejagt worden. Sie wurden bei germanischen Frühlingsfesten und beim Mittwinterritual geopfert, und mit ihren kleinen Körpern lieferten sie armen Menschen sowohl Nahrung als auch Einnahmen durch ihre Felle. Im sechzehnten Jahrhundert wurden von Stockholm aus in einem einzigen Jahr dreißigtausend Eichhörnchenfelle exportiert, und die Stadt war nur einer von vielen Stapelplätzen. In letzter Zeit hatten die roten Eichhörnchen Europas außerdem Konkurrenz von ihren grauen Verwandten bekommen, die im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts aus den USA hierhergebracht worden waren. Die grauen tragen ein Virus in sich, gegen das nur sie immun sind, und können darüber hinaus ziemlich dreiste kleine Gangs bilden, die sogar schon Hunde und Kinder gebissen haben.
Das rote Kerlchen auf dem Netz hatte es sicherlich verdient, geschützt zu werden. Vorsichtig schlich ich mich davon, und als ich irgendwann hineinging, saß ich ganz still und las.
* * *
Es fiel mir schwer, mich auf mein Buch zu konzentrieren, denn die Gedanken wollten um meinen Nachbarn im Dachstuhl kreisen. Wie war es, mit Eichhörnchen zusammenzuleben? In früheren Zeiten hatte man das tatsächlich getan. In der Antike und der Renaissance hielten Damen sie gern als dekorative Haustiere. Am aristokratischen Gesellschaftsleben nahmen sie wohl eher nicht teil, aber im achtzehnten Jahrhundert prahlte ein englischer Gentleman mit der Musikalität seiner zahmen Eichhörnchen. Vokalmusik interessierte sie nicht, aber zu Kammermusik stampften sie in ihren Käfigen energisch den Takt. Ein Eichhörnchen hatte zehn Minuten lang einen Allegrorhythmus gehalten, um nach einer Pause zu einem anderen Takt überzugehen. Ansonsten war ihr inhäusiges Leben wohl weniger stimulierend, wenn man die Hamsterräder bedachte, die man in ihre Käfige setzte.
Schließlich wurde es wieder Abend, und nun kam ich wirklich nicht umhin, an das Eichhörnchen zu denken, denn es bewegte sich unablässig im Dachstuhl. Zunächst staunte ich darüber, dass es nur durch ein paar Bretter von mir getrennt war. Seine Bewegungen zu hören, vermittelte mir ein Gefühl von Nähe, und ich begriff, wie Fledermäuse Dinge erleben können, ohne zu sehen.
Nach einer Weile bedeutete die Tatsache, dass es da oben zu hören war, jedoch, dass ich mich gestört fühlte. Als ich gerade eingeschlafen war, legte es wieder los. Offensichtlich konnte es nicht schlafen, was nun auch für mich galt. Als hätte man ein schwieriges Kind im Zimmer. Jede Bewegung gab eindeutig Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung oder es vielleicht zu warm war. »Schlaf jetzt!«, zischte ich, während es da oben lärmte. Eichhörnchen stehen nicht gerade in dem Ruf, in ihren Nestern großes Einrichtungstalent zu beweisen, aber dieses hier war vielleicht mit dem wenigen Isolierungsmaterial beschäftigt, das noch übrig war. Hatte es sich darauf gebettet, war es ihm jetzt garantiert zu warm. Eichhörnchennester werden in der Regel mit Gras und Moos gepolstert, Mineralwolle konnte da sicherlich die Atemwege reizen. War sie nicht regelrecht ungesund?
Das Eichhörnchen kratzte sich lautstark. Vermutlich wurde es auch von Flöhen gestört. In Eichhörnchennestern lebt ja immer recht viel Ungeziefer. Mit so etwas hatte ich schlechte Erfahrungen gemacht, denn in meiner Wohnung verbreiteten sich einmal über die Lüftung über meinem Bett Vogelflöhe. Sie kamen von Tauben auf dem Dachboden, und mit Eichhörnchenflöhen konnte wahrscheinlich etwas Ähnliches passieren. Jetzt trabte es da oben wieder herum. Eichhörnchen markieren ihr Revier, indem sie durch ihren eigenen Urin trippeln, um anschließend mit nassen Pfoten die Reviergrenze zu stempeln. Ging da oben etwas in der Art vor? Und klang das nicht, als würde es an etwas knabbern? Wie andere Nager müssen auch Eichhörnchen täglich ihre nachwachsenden Schneidezähne nutzen.
Nach unruhigem Schlaf hörte ich gegen sieben Uhr von der Decke ein Rascheln. Aha, das Eichhörnchen war aufgewacht. Als ich in die Küche ging, sah ich es zum Fenster hineinschauen, wahrscheinlich war es auf dem Weg zu seinem Frühstück.
Während ich meinen Kaffee trank, suchte ich aus den Umzugskartons ein Fernglas heraus, um ihm aus der Distanz Gesellschaft zu leisten. Dies von Nahem zu tun, war unmöglich, denn jetzt begann eine Zirkusvorstellung. Während ihm die kängurugleichen Beine große Sprungkraft verliehen, bündelte es wie ein Sonnenreflex alle Richtungen, sprang hierhin und dorthin und auf und ab. Meine Augen folgten ihm mit einem Anflug von Schwindel. Es ist schon vorgekommen, dass Eichhörnchen fünf Meter weit springen, und es ist auch vorgekommen, dass sie herunterfallen. Aber in seinen Sätzen gab es weder Furcht noch Kühnheit. Sie wurden ansatzlos in einem einzigen beweglichen Jetzt gemacht.
Schließlich verweilte es in einer Fichte, auf die ich das Fernglas scharf stellen konnte. Es hatte einen Frühstückszapfen gefunden. Während die Pfoten ihn in Spiralen drehten, wurde er so systematisch geschält, dass alle vier Sekunden eine Samenschuppe zur Erde fiel. Für den ganzen Zapfen benötigte es nicht mehr als sieben Minuten.
Danach verschwand es für eine Weile außer Sichtweite, während ich mich anzog und aufräumte. Als unsere Wege sich später an der Hausecke kreuzten, grüßte es mich mit einem gereizten Schwanzrucken. Ich war ein wenig verletzt, immerhin hatte ich Rücksicht auf es genommen, aber es hatte sich offensichtlich daran gewöhnt, völlig ungestört zu sein. Das würde es jedoch nicht mehr lange sein. In der Nacht hatte ich beschlossen, ein lästiger Nachbar zu werden. Das Weibchen musste wie alle Eichhörnchen mehrere Nester haben, und nun würde ich es zwingen, ein anderes zu wählen. Als ich es das nächste Mal im Haus über mir hörte, hämmerte ich fest gegen die Decke. Daraufhin wurde es über mir still, wahrscheinlich hatte es meinen Wink verstanden.
* * *
Letztlich wollte ich dem Leben der Natur natürlich nicht im Haus begegnen. Bei einer Runde auf dem Grundstück hatte ich das Trommeln eines Spechts gehört, und das klang vielversprechend. Man sagt, dass Spechte sich in Wäldern mit biologischer Vielfalt wohlfühlen.
Nicht, dass ich auf irgendwelche Raritäten aus war. Bemerkenswertes gibt es sogar an einer singenden Kohlmeise. Sie bloß als einen süßen kleinen Piepmatz zu sehen, ist heute unmöglich, denn seit sich herausgestellt hat, dass Kohlmeisen sowohl Werkzeuge benutzen als auch Pläne schmieden, hat man ihre Intelligenz auf eine Stufe mit der von Schimpansen gestellt. Mit Hilfe von Tannennadeln, die sie im Schnabel halten, kratzen sie Larven aus den Spalten der Bäume, und sie achten genau darauf, wo andere Vögel Futter verstecken, um es anschließend stehlen zu können. Manchmal warnen sie bewusst falsch vor Raubvögeln, um Konkurrenten von Vogelhäuschen zu vertreiben, und wenn sie richtig hungrig sind, können sie sogar andere kleine Vögel oder schlafende Fledermäuse töten. Aber es gibt natürlich auch friedliebende Exemplare, so dass die Kohlmeise wohl nicht nur durch ihre Verschlagenheit zu einem der weitverbreitetsten Vögel Schwedens geworden ist.
Aber dann erklang ein eher unerwarteter Laut. War das hier draußen möglich? Ja, in der Tat, zu hören war der Vogel, von dem es mehr als genug auf der Welt gab, dreimal so viele, wie Menschen auf der Erde leben. Ich hatte soeben einen krähenden Hahn gehört, irgendjemand in der Nachbarschaft musste also freilaufende Hühner halten. Das kam mir fast schon bilderbuchidyllisch behaglich vor.
Schließlich leben die meisten Hühner heute weit entfernt von der Natur. Die Eier legenden Industriehühner werden für sich gehalten, während diejenigen, die in Maschinen ausgebrütet werden, mit fünfzigtausend anderen Küken zusammengepfercht sind und vorsichtshalber mit Antibiotika gefüttert werden. Tief im Inneren der südostasiatischen Dschungel streifen ihre wilden Vorfahren noch in scheuen, kleinen Schwärmen umher, so sensibel, dass sie manchmal vor Schreck sterben, wenn sie gefangen werden, genau wie es tatsächlich Hunderttausenden von Industriehühnern auf ihrem Weg zur Schlachtung ergeht.
Dschungelhühner waren in Indien schon seit Langem domestiziert worden, als Alexander der Große auf seinen Kriegszügen eine Reihe von ihnen von dort mitnahm. Für ihn waren sie praktischer Proviant im Feld, da sie nicht nur Eier und Fleisch lieferten, sondern sich auch vermehrten. In Griechenland und Rom wurden Hühner dagegen vor allem für Weissagungen genutzt, weil man in ihrer Art zu fressen und aufzufliegen Zeichen zu erkennen meinte, die sich deuten ließen. Die Hähne wurden wiederum ganz anders gesehen. Setzte man zwei aggressive Exemplare in eine sogenannte Arena, in der sich keiner von ihnen zurückziehen konnte, waren sie gezwungen, sich einen Kampf auf Leben und Tod zu liefern. Solche populären Hahnenkämpfe fanden in England bis weit in das neunzehnte Jahrhundert hinein statt, und die Artnamen der Hähne lebten danach im Boxsport in Begriffen wie »Bantamgewicht« weiter.
Auch Hühner konnten außerhalb der Legebatterien imposant sein. Das hatte ich in jenem Sommer gesehen, in dem ich eine Schreibstube neben einem Hühnerhaus gemietet hatte, denn tagsüber stolzierten dessen Bewohner frei umher. Während ich darauf achtete, nicht in ihre brötchengroßen Mistkleckse zu treten, begriff ich nach und nach ihr hierarchisches Gefüge – vom größten Tier bis zu dem, auf dem alle herumhackten. Das Muster kam einem durchaus bekannt vor. Später begriff ich, dass ihr Gackern annähernd dreißig verschiedene Laute umfasste, zu denen unter anderem unterschiedliche Warnrufe für Bedrohungen aus der Luft und vom Erdboden gehörten.
Es waren riesige Hühner, die sogar den Angriff eines Fuchses überlebten, obwohl der Hahn dabei umkam. Danach schaffte man einen jungen Hahn für sie an, der anfangs panische Angst vor seinem ausufernden Harem zu haben schien. Auch der jüngste Sohn der Besitzer fürchtete sich vor den Hühnern, denn er hatte gehört, dass Vögel von den Dinosauriern abstammen. Durchaus verständlich angesichts dieser Riesenhühner.
Als Erster geahnt hatte es der Biologe Thomas Henry Huxley. Während er 1868 an einem Dinosaurierskelett arbeitete, wurde ihm eines Abends ein Truthahnbraten aufgetischt, woraufhin ihm die Ähnlichkeit zwischen dem Schenkelknochen auf seinem Teller und den Knochen im Labor auffiel. Genetische Analysen haben ihm später recht gegeben. Hühner und Truthähne sind tatsächlich die engsten Verwandten der Dinosaurier. Möglicherweise begann die Verwandlung, als sich kleingewachsene Dinosaurier in die Bäume hinaufbegaben, um größeren Raubtieren zu entfliehen. Hühner wollen ja bis heute auf eine Stange fliegen, wenn es Nacht wird.
* * *
Der krähende Hahn verstummte bald, und danach hörte man nur eine Taube von der unterhalb gelegenen Gemeindewiese und eine Krähe in einem Fichtenwipfel. Ich muss gestehen, dass ich von keinem dieser Vögel eine allzu hohe Meinung gehabt habe. Tauben sind zu einem Emblem für Frieden und Liebe und den Heiligen Geist geworden, aber in Wirklichkeit vermitteln sie nicht selten einen anderen Eindruck. Schließlich hatten sie einst die Vogelflöhe bei mir verbreitet. Und wie steht es eigentlich um ihr Verhältnis zum Heiligen Geist? Es heißt, sie seien verwandt mit der ausgestorbenen Dronte, die auf Portugiesisch doudo genannt wurde, was dumm bedeutet, denn ein kleiner Kopf auf einem üppigen Körper machte eher keinen geistreichen Eindruck. Das gilt auch für Tauben, die selbst die Eier in ihren zusammengeschluderten Nestern kaum wahrzunehmen scheinen. Mein Bild hat sich jedoch durch neue Forschungsergebnisse verändert. So hat etwa Jennifer Ackerman eine umfangreiche Dokumentation über geflügelte Intelligenz zusammengestellt.
Wie die Hühner haben auch Tauben länger als andere Vögel in der Nähe des Menschen gelebt, und durch uns haben sie sich verbreitet. Zarte Jungtauben sind eine Delikatesse, so dass Felsentauben schon vor zehntausend Jahren domestiziert wurden, ungefähr zur selben Zeit wie die Dschungelhühner. Weil man wollte, dass sie sich schnell vermehrten, züchtete man Männchen, die ständig paarungsbereit waren, und Weibchen, die viele Küken bekamen. Sie hatten keine Probleme, in der Nähe von Menschen zu leben, und Städte waren ideal für sie, weil Gesimse und Balkone den Felsabsätzen in ihrem ursprünglichen Lebensraum ähnelten.
Im sechzehnten Jahrhundert besaß der indische Großmogul Akbar der Große über zwanzigtausend Tauben, die er kreuzte, um bevorzugte Eigenschaften zu verstärken. Diese Art der Zucht wurde später an verschiedenen Orten in Europa betrieben und inspirierte darüber hinaus Darwins Evolutionstheorie. Wenn die Genetik so anpassungsfähig war, dass man bei Tauben verschiedene Züge heranzüchten konnte, sollte auch die Natur insgesamt zum Gleichen fähig sein.
Den Taubenbesitzern im neunzehnten Jahrhundert ging es dann nicht mehr um das Fleisch der Vögel, sondern um ihr phänomenales Orientierungsvermögen. Schon im alten Ägypten und in Rom hatte es sie zu Briefträgern gemacht, und sie durften ihre Übermittlung von Nachrichten weiterführen, bis der Telegraph entwickelt wurde. Netzwerke aus Taubenschlägen gab es nicht nur bei den ganz Großen wie Reuters Nachrichtenagentur und Rothschilds Bank. Tauben durften auch im kleineren Maßstab Aktuelles weiterbefördern, so wurden die Ergebnisse der schwedischen Segelregatten im neunzehnten Jahrhundert dadurch übermittelt, dass eine Brieftaube sie zur Druckerei der Zeitung Stockholms Dagblad flog, wo sie in einem Fenster ausgehängt wurden.
Man vertraute Tauben auch bedeutsamere Informationen an. Entdecker, Spione und das Militär übertrugen ihnen Aufgaben, aus denen spannende Romane mit geflügelten Helden hätten werden können. So legte 1850 eine Taube viertausend Kilometer zurück, um eine Botschaft von einer Polarexpedition zu überbringen, aber die Nachricht verschwand unglücklicherweise unterwegs. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg nutzten alle kämpfenden Parteien Brieftauben, und da man sie in den Krieg hineingezogen hatte, erhielten manche von ihnen sogar Tapferkeitsmedaillen. Eine englische Taube führte stoisch ihren Auftrag aus, obwohl ihr ein Stück des Flügels abgeschossen worden war. Deutschen Brieftauben erging es auch nicht besser, denn sie wurden mit Gewehren und Wanderfalken bekämpft.
Tauben können aber nicht nur mutig sein, sie sind auch schnell und aufmerksam. Mit einer Geschwindigkeit von achtzig Stundenkilometern haben sie Tausende Kilometer über unbekannten Landschaften zurückgelegt und ihren Weg gefunden, und als Beobachter sind sie unübertroffen. Als man Tauben eine Reihe von nacheinander aufgenommenen Landschafsfotos zeigte, bemerkten sie auch Unterschiede, die den Menschen entgangen waren. Die amerikanische Küstenwache richtete sie deshalb darauf ab, Punkte in der Farbe zu suchen, die Schwimmwesten normalerweise haben, woraufhin Hubschrauber sie über Gebiete mit gekenterten Booten flogen. Es gelang ihnen daraufhin, Menschen auch inmitten hoher Wellen ausfindig zu machen.
Ihr visuelles Talent war in eher künstlerisch orientierten Experimenten genauso offensichtlich. Mit etwas Übung hielten sie Werke von Picasso und Monet auseinander und waren außerdem in der Lage, Kubisten wie Braque von Impressionisten wie Renoir zu unterscheiden. Durch Signale für Farbe, Muster und Textur brachte man sie dazu, Gemälde als schön oder hässlich einzustufen.
Die Liste ihrer Fertigkeiten war damit nicht beendet. Es stellte sich nämlich heraus, dass sie wirklich gut mit Zahlen umgehen und Bilder mit neun Gegenständen in der richtigen Reihenfolge platzieren konnten. Auch ihr Gedächtnis war so außerordentlich, dass sie fähig waren, sich in einem Jahr tausend Bilder zu merken, wobei die Tauben sie sogar erkannten, wenn es Negative von ihnen waren oder sie auf dem Kopf standen.
Nach diesem Tableau über eine geflügelte Intelligenz fand ich es beschämend, Tauben zu verachten. Schließlich war es unsere Schuld, dass sie sich so schnell vermehrten und so sehr zu uns hingezogen fühlten, denn das waren Züge, die wir ihnen angezüchtet hatten. Und man merkte deutlich, dass sie lange in unserer Nähe gelebt hatten. Sie erkannten nicht nur Individuen in ihrem eigenen Schwarm – es stellte sich heraus, dass sie auch Menschen unterscheiden und auf Fotos emotionale Gesichtsausdrücke wie Wut und Trauer identifizieren konnten.
Die Erklärung dafür lag wohl nicht so sehr in ihrer Fähigkeit zur Empathie. Es scheint vielmehr einen Überlebenswert zu haben, Gefühle lesen zu können. Vögel sind dadurch sowohl in der Lage, drohende Angriffe zu erahnen, als auch mit fast unmerklichen Zeichen Kontakt zueinander herzustellen. Ein Blick, eine Körperhaltung oder eine bestimmte Art, sich aufzuplustern, reicht. Auch wir lesen unbewusst andere, weil Tonfall und Gesichtsausdruck ehrlicher sein können als Worte, außerdem heißt es, dass die Worte nur für etwa sieben Prozent von allem stehen, was wir vermitteln. Ist die Kunst, zwischen den Zeilen zu lesen, dann vielleicht die Basis für jede Kommunikation?
* * *
Darin sah ich natürlich auch ein Problem. Es ist leicht, Gefühle in andere hineinzulesen oder sie zu Schablonen zu machen. So haben die Tauben zum Beispiel ausschließlich Milde symbolisieren dürfen, während die scharfen Augen den Falken vorbehalten blieben. Die krächzende Krähe ist wiederum zum Gegenpol der gurrenden Taube geworden, und als Ted Hughes sie endlich in ein Gedicht aufnahm, wurde sie zum Antihelden. Wo die Schwalbe durch den Duft des Veilchens flog, verschlang die Krähe inmitten von Strandabfall ein weggeworfenes Eis am Stiel.
Denn wie sollen kreischende Krähen jemanden zu Lyrik inspirieren können? Dass sie der gleichen Ordnung wie die Singvögel angehören, erschien mir ebenso schwer verständlich wie die Tatsache, dass dies mit der Form ihrer Füße zusammenhängt. Ihre Verwandtschaft mit Paradiesvögeln war weniger rätselhaft. Dieses schwarzgraue Jackett hätte einem Bestatter gut zu Gesicht gestanden, und ihr Krächzen war auch nicht sonderlich aufmunternd.
Aber solche Eindrücke können wie gesagt trügerisch sein. Die Römer verstanden sich auf die Schönheiten des Krähengesangs, denn sie deuteten ihr »kra kra« als cras, was auf Latein »morgen« bedeutet. In ihren Augen drückte das Krähen also eine ewige Hoffnung aus. Und ich selbst wusste, dass Krähen im Grunde nicht besonders finster sind.
Ich durfte einmal mit einer kleinen Segelyacht über das Wochenende in die äußeren Schären vor Stockholm hinausfahren. Ich nahm meine beiden Neffen mit, und die Skipperin der Yacht nahm ihre zahme Krähe mit. Sie hatte sich vorher erkundigt, ob wir uns vor Krähen fürchteten, weil sie es offenbar gewohnt war, dass die Leute ihnen misstrauten.
Während des Segeltörns stand die Krähe die meiste Zeit auf Deck, stabil breitbeinig wie ein Seemann. Während die Skipperin die Yacht steuerte, schien die Krähe es als ihre Aufgabe zu betrachten, die Passagiere zu überwachen, wenngleich auf die diskrete Art von Spionen. Meine Neffen waren damals Raucher, und weil sie ständig mit ihren Zigaretten beschäftigt waren, zogen sie das Interesse der Krähe auf sich.
An der Insel, auf der wir übernachten wollten, durften wir uns die Unterkunft aussuchen. Die eine Alternative lautete, uns ein Häuschen mit der Skipperin und der Krähe zu teilen, die andere bestand darin, es uns in den Kojen der Yacht gemütlich zu machen. Wir entschieden uns für die Yacht, um uns von den Wellen wiegen zu lassen, außerdem hatten wir wenig Routine darin, in Gesellschaft einer Krähe zu schlafen. Offenbar pflegte sie die Nacht auf einer offenen Tür hockend zu verbringen, um alles im Auge behalten zu können.
Nach einer Nacht ohne ihre Aufsicht ging einer meiner Neffen an Deck, um seine erste Zigarette zu rauchen. Er war jedoch kaum dort angekommen, als die Krähe auch schon wie ein geölter Blitz vom Haus heranschoss. Sie landete mit einem Plumps auf seiner Schulter, um ihn eingehend beim Rauchen zu beobachten, das inzwischen zu einer ernsteren Angelegenheit geworden war, da beiden Neffen allmählich die Zigaretten ausgingen.
Gegen Mittag verlosten die Raucher brüderlich die letzte Zigarette und zündeten sie andächtig an. Da tauchte auf einmal wie aus dem Nichts erneut die Krähe auf. Sie kam direkt auf uns zu und schaffte es in einem akrobatischen Manöver, sich die Zigarette zu schnappen, mit der sie auf das Dach des Häuschens flog. Dort saß sie anschließend neckisch mit dem begehrten Glimmstängel im Schnabel. Eins war klar. Sie war kein Unglücksrabe, sie war ein Spaßvogel.
Später hatte ich zahlreiche Berichte über die Einfälle von Krähen gelesen. Untereinander spielten sie Verstecken und mit Hunden Fangen. Sie ärgerten Katzen. Sie fingen Stöckchen in der Luft. Sie fuhren auf verschneiten Hausdächern auf Konservendeckeln Schlitten, und wenn sie unten angekommen waren, nahmen sie den Deckel in den Schnabel, um sich wieder nach oben zu begeben und gleich noch mal zu rutschen.
Verspieltheit kann die Schwester der Kreativität sein, und die Krähen gaben ihr Bestes, um es unter Beweis zu stellen. Äsop erzählt in einer seiner alten Fabeln, wie es einer durstigen Krähe gelang, an das Wasser auf dem Boden eines Krugs zu gelangen. Sie ließ einfach kleine Steinchen hineinfallen, die den Wasserspiegel anhoben. Genauso verhielten sich Krähen in Experimenten, in denen sie auch eine Reihe anderer Probleme lösten, die Werkzeuge erforderten.
Tatsächlich scheinen Krähen viele der Eigenschaften zu besitzen, die man mit Intelligenz verknüpft. Sie haben offensichtlich Humor, sie können planen, sie sind neugierig und anpassungsfähig und gleichzeitig individualistisch. Schon in der Antike zog es sie zu den vielfältigen Möglichkeiten der Städte, aber ohne sich domestizieren zu lassen. Es heißt zudem, Intelligenz werde von einer langen Kindheit mit lehrenden Eltern und einem ausgeprägten Sozialleben gefördert. Auch das haben Krähen. Aristoteles fiel auf, dass sie ihre Jungen länger umsorgten als andere Vögel und anschließend Kontakt zu den Familienmitgliedern hielten. Heute weiß man, dass sie mit Hilfe zahlreicher Laute kommunizieren, die nicht nur Arten, sondern auch Individuen unterscheiden können. Alle scheinen außerdem eigene Identitätslaute zu besitzen, die von den anderen in der Gruppe erkannt werden. Auch menschliche Körpersprache verstehen sie, denn wenn man irgendwohin zeigt, schauen sie in die richtige Richtung. Schimpansen können das nicht.
Wie Elstern versammeln sie sich häufig um tote Verwandte, wenngleich man nicht weiß, ob es nur geschieht, um den Tod zu bezeugen oder um ihre Trauer zu zeigen. Jedenfalls haben sie ein gutes Gedächtnis. Lässt man sie Memory spielen, legen sie elegant identische Bilder zusammen. Ihr Blick für menschliche Gesichter ist so sicher, dass die amerikanische Armee versucht hat, sie in die Jagd auf Osama bin Laden einzubinden. Besonders gut erkennen sie Personen, von denen sie schlecht behandelt worden sind, und bringen auch anderen Krähen bei, diese Schurken von Weitem zu erkennen. Überhaupt behalten sie alles im Auge, was um sie herum geschieht, wenn also jemand wusste, was auf meinem Grundstück vorging, dann sie.
* * *
Es war mir ein wenig peinlich, dass die scharfäugigen Wesen so viel mehr von mir wahrnahmen als ich von ihnen. Aber so war es wohl gedacht. In den Bäumen konnten sie mit der Natur verschmelzen.