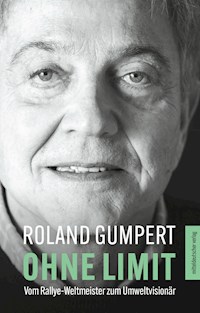
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Roland Gumpert gilt weltweit als Ikone der Automobilentwicklung. Für Audi entwickelte er unter anderem den Audi 50, den unter dem Namen „quattro“ bekannt gewordenen permanenten Allradantrieb und den Audi quattro S1. In den 1980er Jahren gewann er als Teamchef für Audi vier Rallye-Weltmeisterschaftstitel und 24 Weltmeisterschaftsläufe. Seit 2018 steht Gumpert durch die Entwicklung eines emissionsfreien Methanolantriebs, der eine Lösung für eines der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit bereitstellt, einmal mehr in den Schlagzeilen. Auch mit fast achtzig Jahren ist Gumpert noch lange nicht am Limit. In seiner spannenden Autobiografie erzählt er von Erfolgen wie vom Scheitern, von Liebe und enger Familienverbundenheit, von zielorientierter Entwicklungsarbeit, wilden Abenteuern auf allen Kontinenten und visionärer Begeisterung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roland Gumpert, geb. 1944, studierte in Graz/Österreich Maschinenbau (Abschluss: Maschinenbauingenieur). Von 1969 bis 2002 war er in verschiedenen Funktionen bei Audi tätig. Nach seinem Ausstieg bei Audi entwickelte er in seiner Manufaktur mehrere Supersportwagen. Mit dem neuesten Projekt, dem Sportwagen Nathalie, stellt er der Öffentlichkeit einen bisher einmaligen emissionsfreien Antrieb auf Methanolbasis vor.
Matthias Thiele, geb. 1972, studierte Psychologie (Dipl.). Er ist Autor mehrerer Sachbücher und Romane.
Umschlagfotos: vorn: Roland Gumpert, 2022 (Foto: Thomas Naumann, www.unser-fotograf.de); hinten: Roland Gumpert mit Jörg Bensinger (links) vor dem ausgebrannten Prototyp des Audi quattro in der Sahara, ca. 1978 (Foto: Archiv Roland Gumpert)
Abbildungen im Buch: Archiv Roland Gumpert/Harald Schlegel, außer: Unternehmensarchiv der AUDI AG: Nr. 15, 29 (Foto: Ferdi Kräling), 30, 31 (Foto: Ferdi Kräling), 32
Verlag und Autoren haben sich bemüht, alle Rechteinhaber von Abbildungen ausfindig zu machen; sollten dennoch bestehende Rechte nicht berücksichtigt worden sein, so bitten wir um Kontaktaufnahme.
Alle Rechte vorbehalten.Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Freigrenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage© 2022 mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)www.mitteldeutscherverlag.de
Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
ISBN 978-3-96311-730-5
INHALT
Prolog
Kapitel 1: Die ersten Jahre
Neuanfänge in der jungen Bundesrepublik
Heimliche Rendezvous
Studentenleben
Kapitel 2: Ingenieurshandwerk
Ein Kindheitstraum wird wahr
Betreuung bis zur Serienreife – der Audi 50
VW ist kein Fahrradhändler!
Mit Piëch durch die Sahara
Wüstenfuchs
Kapitel 3: Rallye Paris–Dakar
Ein Geländewagen für die Bundeswehr – der VW Iltis
Heimspiel in Algerien
Wer ist hier der Wüstenfuchs?
Kapitel 4: Audi quattro
Eine folgenreiche Idee wird geboren
Bitte kein Parfümname!
Eine elegante Lösung – das dritte Differential
Kapitel 5: Und die ganze Welt schaut zu – die Rallyezeit
Im Astronautenanzug durch Griechenland
Zeitreise im Ur-quattro
Erste Siege
Der „Schwarze Vulkan“ gewinnt Sanremo
Mit Hannu Mikkola überm Abgrund
Durch die Wolken des Mount Kenia
Tränen unterm Vollmond
Kein Fairplay
Stallorder sind nichts für wilde Jungs
„Siegen Sie!“ – der Sport quattro S1
Monsterklasse
Letzter Ausweg Mittelmotor
Verflixte Bremsen
Kapitel 6: Auf fernen Kontinenten
Rätsel im Outback
Wir bringen Audi nach Fernost
Wie China zum Auto fand – Joint Venture Audi/China
Aufbruch ins Reich der Mitte
Kapitel 7: Der erste GUMPERT
Ein Supersportwagen aus eigener Manufaktur
Das Auto, das an der Decke fahren kann
Märchenhochzeit in Katar
Falsche Schrauben
Softwareschrank auf vier Rädern
Kämpfe vor Gericht
Neuer Mut
Kapitel 8: NATHALIE
Auftrag für einen Elektrosportwagen
Geburt eines Zaubermobils
Grünes Licht für Methanol-Brennstoffzellen
Elektrisch und ganz ohne Ladesäulen – die Gumpert Power Cell
Kapitel 9: Zeiten des Umbruchs – das Jahr 2020
Große Hoffnungen
Coronaschock
Der Smart des Ministers
Für globale Probleme gibt es nur globale Lösungen
Der tägliche Kampf eines freien Autokonstrukteurs
Methanol – Rohstoff der Zukunft
Im hohen Norden – mit der Nathalie auf Pellworm
Ein Blick in die neue Zeit
Epilog
Testfahrt mit einem Methanol-Lkw
PROLOG
— 2018, Peking
Frühling in Peking, es ist sonnig draußen. In den riesigen Hallen der Peking Motor Show herrscht taghelles Kunstlicht, unterbrochen von bunten Farben an den Ständen mit den modernsten Autos der besten Hersteller der Welt. Blitzlicht, Presse.
Die Auto China ist neben dem Genfer Autosalon und der IAA in Frankfurt eine der bedeutendsten Automessen der Welt. Jährlich wechselt sie zwischen Shanghai und Peking. Von Mercedes über VW bis Bentley und Lamborghini zeigen die großen Autofirmen ihre neuen Modelle, zu einem großen Teil Elektroautos, keiner will den Trend versäumen. Inmitten all dieser Giganten der Stand einer Ingolstädter Manufaktur namens Gumpert Aiways.
Mir ist der Trubel solcher Messen aus meinen Zeiten als Entwicklungsingenieur für Audi und durch die Vorführungen der Sportwagen aus eigener Manufaktur mehr als vertraut. Dieses Mal jedoch präsentieren wir das wahrscheinlich aufregendste Projekt meiner Karriere.
Nur neun Monate ist es erst her, als wir begannen, einen Sportwagen zu entwickeln, mit dessen Antrieb wir auf fossile Brennstoffe vollständig verzichten, aber auch die bisherigen Nachteile des reinen Elektroantriebs vermeiden konnten. Das Prinzip ist erstaunlich einfach: Um nicht vom Stromnetz abhängig zu sein, produziert das Auto während der Fahrt seinen eigenen Strom. Dazu wird es in nur drei Minuten mit Methanol betankt, einem Alkohol, der in großen Mengen grün, also ohne fossile Rohstoffe, hergestellt werden kann und überdies preiswerter als die herkömmlichen Brennstoffe ist. Der Antrieb ist das Herzstück unseres Projekts, verpackt in einen eleganten allradbetriebenen Sportwagen mit bis zu 600 kW, über 300 km/h Höchstgeschwindigkeit und einer Reichweite bis zu 850 Kilometern – wir können uns sehen lassen.
Die Konkurrenz ist riesig geworden. Vor allem chinesische Autofirmen sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Während wir in Deutschland und Europa ein gutes Dutzend erfolgreiche Marken kennen, sind es in China mittlerweile mehr als hundert. Während meiner Rundgänge über die Messe entdecke ich Automarken, von denen ich noch nie gehört habe. Und doch sind sich die meisten Modelle zum Verwechseln ähnlich. SUVs, natürlich elektrisch, die sich im Wesentlichen nur durch das Markenlogo unterscheiden.
Ich kann ein Lächeln nicht unterdrücken, als ich an meinen ersten Arbeitseinsatz in China denke, damals noch für Audi. 1986 begann die Kommunistische Partei Chinas sich dem west-lichen Markt zu öffnen. Ihr ehrgeiziges Ziel war es, eine eigene Autoindustrie aufzubauen, und sie griff dafür auf das Know-how amerikanischer und deutscher Firmen zurück. In den wenigen Fabriken wurden damals Limousinen für hohe Funktionäre gebaut, die Bevölkerung hingegen fuhr Fahrrad. Wir bauten im Rahmen eines Joint Venture Fabriken und konstruierten eine Variante des Audi 100 für den chinesischen Markt. Nun, das ist lange her. Heute gibt es wohl kein Land, das über mehr Autofirmen verfügt als China. Vielleicht ist Audi nicht ganz unschuldig daran.
Der große Moment. Meine beiden zauberhaften Töchter Magdalena und Nathalie ziehen unter dem Blitzlichtgewitter von Presse und Publikum das glänzende Tuch von unserem Supersportwagen, der nach meiner älteren Tochter den Namen Nathalie trägt. Die Themen der Generationen verbinden sich. Die technologische Erfahrung eines altgedienten Ingenieurs und das Engagement der Jugend für Umweltschutz werden zu einem innerfamiliären Joint Venture der besonderen Art. Die Probleme kennen wir – uns geht es um die Lösungen. Nathalie hält eine kurze Rede auf Englisch, in der sie das Prinzip des umweltfreundlichen Methanolantriebs erläutert. Ich bin nicht minder aufgeregt als sie. Wir werfen uns ein erleichtertes Lächeln zu, als sie fertig ist, und stellen uns den neugierigen Fragen der Journalisten und Besucher. Nach der Show liegen wir uns in den Armen. Unsere Idee ist in der Welt, wir haben große Pläne.
— 1952, Eutin/Schleswig-Holstein
Gibt es Ereignisse, die bereits in der Kindheit vorwegnehmen, was einmal Lebenssinn und Aufgabe sein wird? Ich glaube schon.
Meine Augen müssen vor Freude geleuchtet haben, als ich zu Weihnachten 1952 ein großes rotes Feuerwehrauto geschenkt bekam.
Die Familie war arm, und die heute übliche Geschenkeflut kannten meine drei Brüder und ich nicht. Vor Weihnachten schrieben wir unsere Wunschzettel, und meine Mutter führte akribisch Buch, wer was und wann bekommen hatte, um Gerechtigkeit walten zu lassen, was angesichts der vier wilden Jungs wahrscheinlich notwendig war.
Dieses Jahr also war ich mit einem größeren Geschenk an der Reihe. Neben dem unvermeidlichen Teller mit Nüssen, Keksen und einer Orange stand dieser Schatz. Ein in meinen kindlichen Augen riesiges Feuerwehrauto, ganz aus Blech, mit Doppelachse hinten und mit einer Leiter, die man hochfahren konnte. Der entsprechende Mechanismus war allerdings unter dem Blech versteckt.
Anfangs spielte ich mit dem Auto, wie man es üblicherweise von Kindern erwartete, schob es also hin und her, fuhr die Leiter aus, um ein imaginäres Feuer in der Schublade einer Kommode zu löschen. Der Reiz des stupiden Hin- und Herschiebens verflog allerdings recht bald. Die brennendere Frage war, was sich unter dem Blech verbarg. Wie funktionierte der in den Augen eines Achtjährigen geheimnisvolle Mechanismus, der es erlaubte, die Leiter auszufahren? Kaum fühlte ich mich unbeobachtet, drehte ich das Auto um – eine Hebebühne stand mir damals noch nicht zur Verfügung – und untersuchte den Unterboden. Ich entdeckte fingernagelgroße Laschen aus Metall, die alle paar Zentimeter durch einen Schlitz mit dem oberen Teil der Karosse verbunden waren. Ich holte aus der Werkzeugkiste meines Vaters einen Schraubenzieher und bog die Laschen auf. Fasziniert entdeckte ich im Inneren des Autos Seilwinden, Zahnstangen und Zahnräder, mit denen man die Leiter über eine Kurbel hoch- und ausfahren konnte. Öffnete man die Fahrertür, war es sogar möglich, das Lenkrad zu bedienen, und mit der Befriedigung eines künftigen Ingenieurs erkundete ich den einfachen Mechanismus, der über eine Lenkstange und ein Zahnrad die Lenkbewegung, fast wie bei einem richtigen Auto, auf die vorderen Räder übertrug. Ich hatte ihm sein Geheimnis entrissen.
Das Zusammenbauen erwies sich allerdings als ungleich schwieriger. In einer wahren Sisyphosarbeit fügte ich die aufgebogenen Laschen wieder in die dafür vorgesehenen Schlitze und bog sie behutsam um, bis sie hielten. Das Auto war wieder ganz. Pro forma schob ich es ein bisschen hin und her, kurbelte die Leiter nach oben und wieder nach unten. Wie langweilig.
Material ist mir immer Einladung und Aufforderung gewesen, mit ihm zu arbeiten, ob nun als Kind aus spielerischer Neugier oder später als Versuchsingenieur und Autokonstrukteur. Es dauerte daher nicht lange, bis ich den Unterboden wieder ablöste, im Inneren des Autos neue Untersuchungen durchführte und auf bewährte Weise anschließend alles wieder zusammenfügte. Nur hatte ich nicht mit der Materialermüdung gerechnet. Man kann dünne Metallösen nicht unzählige Male umbiegen, ohne dass sie irgendwann brechen. Ich war erschrocken, die Mutter würde sicher schimpfen. Ich versuchte, die Laschen sogar zu löten, aber dadurch verbanden sie sich mit dem umliegenden Metall, und ich musste sie mühselig freikratzen und mit einer Feile bearbeiten. Und irgendwann war das Auto kaputt. Die Mutter schimpfte, und nichts war mir schrecklicher als der Umstand, dass ich meine geliebte Mutter traurig machte.
„Ich dachte, du spielst damit!“, sagte sie vorwurfsvoll.
„Aber ich spiele doch damit, Mutti, das ist mein Spiel!“
— 2020, Ingolstadt
Rückblickend erkenne ich in dieser kleinen Episode die erste Skizze dessen, wie und womit ich mein Leben verbringen würde. Ein erfülltes Leben ist vielleicht eines, das genau jene Interessen fortsetzt, die sich bereits im frühen Kindesalter zeigen. Im Grunde war der Tisch, auf dem ich das Feuerwehrauto auseinandernahm und wieder zusammenbaute, meine erste Werkstatt. Mein ganzes Leben habe ich nichts anderes getan, als das Prinzip „Werkstatt“ weiterzuführen.
Fünfundsechzig Jahre später, auf der Pekinger Automesse 2018 und etwas später auf dem Genfer Autosalon stelle ich den weltweit ersten methanolbetriebenen Sportwagen aus eigener Manufaktur der Weltöffentlichkeit vor. Vor dem Publikum steht in Form dieses Autos die Lösung für eines der drängendsten Probleme unserer Zeit, die Umweltbelastung durch Emissionen. Die Lösung kann nicht darin bestehen, auf die individuelle Mobilität des Autofahrens generell zu verzichten, sondern vielmehr praktikable Technologien zu entwickeln, die es uns gestatten, weitgehend emissionsfrei Spaß am Autofahren haben zu dürfen.
Über mein gesamtes Leben spannt sich dieser Bogen, von dem blechernen Feuerwehrauto bis zum 800 PS starken Supersportwagen, indem ich meinem Traum und meinen Idealen folgte.
Ich schreibe dieses Buch im Jahr 2020, in jenem Jahr, in dem Corona die Welt in Atem hält. Während des Frühjahr-Lockdowns ist die ganze Familie zu Hause – meine Frau Lia, die beiden großen Töchter Nathalie und Magdalena und unser Nesthäkchen Lucrezia, das in diesem Jahr ins Gymnasium eingeschult wird. Die Schulen aber sind vorerst geschlossen, die Universitäten setzen auf Online-Kurse. Nathalie und Magdalena fahren nur selten zur Universität, und die kleine Lucrezia freut sich über die unverhoffte freie Zeit.
In der Manufaktur ist es ungewohnt still. Die meisten Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Manchmal schaut jemand vorbei, wenn es um unaufschiebbare Dinge geht. Martin, ein Mitarbeiter, kommt, um die Reifen seines Privatautos zu wechseln. Das darf man nur zu zweit, so ist die Vorschrift. Aber ich bin ja da. Ich habe nichts dagegen, wenn meine Leute die Hebebühne für ihre privaten Zwecke nutzen, zumal die Produktion im Moment sowieso ruht.
Corona hat all unsere Pläne gründlich durcheinandergebracht. Für mich als Geschäftsführer gibt es natürlich nicht die Möglichkeit einer sogenannten Kurzarbeit. Und ich habe alle Hände voll zu tun. Unten in der Manufaktur stehen mehrere Prototypen der „Nathalie“, eines Elektrosportwagens mit einer Wasserstoffbrennstoffzelle, betrieben mit Methanol als Träger für den ansonsten kreuzgefährlichen Wasserstoff, zu hundert Prozent emissionsfrei. Ein Auto, das während der Fahrt seinen eigenen Strom produziert und seine Batterie auflädt. Mit einer eigens für Automobile modifizierten Brennstoffzelle, der Gumpert Power Cell. Mit einem Reformer, klein und handlich, nicht größer als ein Auspufftopf, ein Problem, an dem Mercedes noch vor zwanzig Jahren scheiterte und dann das Projekt entnervt aufgab. Nein, man sollte nicht aufgeben, wenn es um lohnenswerte Projekte geht, und vor allem nicht, wenn wir dringend technologische Lösungen für die globalen Herausforderungen unserer Zeit benötigen.
Es gibt viel zu tun, trotz des Lockdowns. Ich treffe mich mit Investoren, habe Pressetermine. Fernsehbeiträge für deutsche und internationale Sender stehen an.
Wir müssen in diesen Zeiten improvisieren, wir müssen auf Sicht fahren und neue Möglichkeiten eruieren. Nicht selten kommt es vor, so meine Erfahrung, dass genau diese Improvisationen brauchbare Lösungen hervorbringen und den Entwicklungen unerwartet gute und neue Wendungen zu geben vermögen.
Dieses Buch zeichnet meinen Weg nach, vom jungen Ingenieur, der sich in den wilden Siebzigern seine ersten Sporen verdient hat, über der Entwicklung des Allradantriebs für den Audi quattro und die Erfolge der Rallyezeit mit vier Weltmeisterschaftstiteln bis zur Gründung einer eigenen Manufaktur und der Entwicklung von Supersportwagen und einem zukunftsweisenden Antriebssystem.
Mögen Sie die Leidenschaft, die mich Zeit meines Lebens antrieb, in den Zeilen spüren, und mögen Sie Freude beim Lesen dieses Buches haben. Und sollten Sie Laie in Fragen der Ingenieurskunst sein – seien Sie ganz unbesorgt, Sie benötigen für die Lektüre keinerlei Vorkenntnisse. Mir ist es wichtiger, von den aufregenden und bisweilen absurden Begebenheiten zu berichten, die mein Leben begleiteten, als ein staubtrockenes Fachbuch zu verfassen. Dieses Buch soll Ihnen, wie auch mir beim Verfassen, Spaß bereiten.
Das wichtigste Anliegen dieses Buches aber wäre erfüllt, wenn es Sie, liebe Leserinnen und Leser, darin ermutigt, Ihren Träumen zu folgen und angesichts heutiger Probleme nicht zu kapitulieren, sondern neue Wege zu finden, sei es in technologischen, sei es in sozialen oder gesellschaftlichen Bereichen. Wir leben in einer Welt, die sich innerhalb kurzer Zeit stark verändert hat. Damit stehen wir vor globalen Problemen, die man nur bewältigen kann, wenn man mit Zuversicht und mit den vorhandenen Möglichkeiten brauchbare Lösungen entwickelt. Ich möchte zeigen, dass Gewinnen und Scheitern nicht darüber entscheiden sollten, ob man seinen Werten und Träumen treu bleibt, sondern dass es für alles eine Lösung geben kann, wenn man nur daran glaubt und beharrlich an dieser arbeitet.
KAPITEL 1
DIE ERSTEN JAHRE
Neuanfänge in der jungen Bundesrepublik
Ich war das jüngste Kind einer Vertriebenenfamilie und „zu Hause“ war ich dort, wo wir gerade wohnten. Die eigentliche Heimat verlor ich, bevor ich sie bewusst zur Kenntnis nehmen konnte. Eine wirklich tiefe Verwurzelung mit einem Ort, den ich Heimat nennen könnte, kenne ich bis heute nicht. Heimat ist für mich dort, wo meine Familie ist, meine Kinder und meine geliebte Frau, und wo ich gut arbeiten kann.
1944 wurde ich in der kleinen Stadt Ziegenhals, die heute nicht weit von Breslau in Polen liegt, geboren. Kaum ein halbes Jahr später rückte die Rote Armee ein. Die Friedensverhandlungen der Alliierten zerschnitten die Länder, und die Einflusssphären der Nachkriegszeit wurden mit schnellen Federstrichen festgelegt. Kein Volk wurde dabei gefragt, die Deutschen und Österreicher aus naheliegenden Gründen ohnehin nicht, aber auch nicht die Polen, Tschechen, Slowaken, Ungarn oder Ukrainer. Es war eine Zeit der Brüche. Nach dem Krieg wurde die deutsche Bevölkerung vertrieben, und stattdessen wurde der Ort besiedelt mit Ostpolen, deren Gebiete wiederum an die Sowjetunion gefallen waren. Alles und alle waren in Bewegung. Die Welt ordnete sich neu. Die Familie Gumpert wurde in den reißenden Fluss dieser Veränderungen geworfen, und insofern ist mein Leben auch ein Spiegel dieser historischen Ereignisse.
Als Säugling bekam ich von all dem natürlich nichts mit. Nur langsam verdichteten sich im Laufe der späteren Jahre die Szenen, die ich während des Abendessens aus den Gesprächen der Eltern mitbekam oder die mir erzählt wurden, zu einem ganzheitlichen Bild. Insofern war meine Kindheit eine behütete und weitgehend sorgenfreie. Ja, wir lebten nach der Vertreibung aus Schlesien in Armut, aber ich war ein kleines Kind, das nichts anderes kannte.
So erfuhr ich erst später, dass der Vater eine Papierfabrik in Ziegenhals besessen hatte, die, wie auch all der andere Besitz meiner Familie, von der sowjetischen Armee konfisziert worden war. Mit dem, was man tragen konnte, teilten die Gumperts das Schicksal von Millionen anderen Familien und begaben sich auf einen langen Weg Richtung Westen.
Über die nordrhein-westfälischen Städte Dorsten und Wuppertal landeten wir in dem kleinen Städtchen Eutin in Schleswig-Holstein. Meine Eltern folgten den Möglichkeiten, Geld zu verdienen und für sich und die vier Söhne eine bezahlbare Wohnung zu finden. Es war die entbehrungsreiche Nachkriegszeit, in der überall Armut und Mangel herrschte. Gleichzeitig aber war es die Zeit der jungen Bundesrepublik mit all den vielen Möglichkeiten, die große gesellschaftliche Umbrüche mit sich bringen.
Ich erfuhr erst Jahre später von einem ältesten Bruder, Dieter, der kurz vor Kriegsende, als wir noch im inzwischen polnisch besetzten Ziegenhals wohnten, an Tuberkulose erkrankte und in ein Tuberkuloseheim in der Nähe eingeliefert wurde. Die Wirren des Krieges zogen über das Land, und Dieter wurde ohne das Wissen meiner Eltern nach Berlin in ein Krankenhaus überwiesen. Zwei Jahre lang wussten die Eltern nicht, wo Dieter war und lebten in allergrößter Sorge um ihn.
Eines Tages bekamen die Eltern eine Postkarte von einer Cousine des Vaters aus Berlin. Sie schrieb, dass ein Pastor eine Annonce aufgegeben hätte, in der ein Dieter Gumpert nach seinen Eltern suchte. Meine Mutter beschloss sofort, nach Berlin zu reisen, was sich als schwierig herausstellte. Sie ging zum polnischen Konsulat und bat um die Erlaubnis, ausreisen zu dürfen. Der Konsul lehnte ab. Mutter fragte ihn, was er denn tun würde, wenn sein Kind krank und allein in der Fremde in einem Krankenhaus liegen würde. Der Konsul gab ihr daraufhin dezent zu verstehen, dass es ja auch eine grüne Grenze gebe. Mutter machte sich also auf einen abenteuerlichen Weg nach Berlin, immer auf der Hut vor den Russen, die gemeinsam mit den Polen die Gegend kontrollierten.
Sie fand das Krankenhaus, in dem Dieter lag, und die Wiedersehensfreude war natürlich riesig. Sie konnte leider nicht ewig in Berlin bleiben, man brauchte damals Aufenthaltsgenehmigungen, und außerdem hatte sie noch vier Söhne in Schlesien, die ihre Mutter brauchten. Der Abschied musste ihr das Herz zerrissen haben.
Auf ähnlich abenteuerliche Weise, über Kornfelder und durch Grenzflüsse watend, aber auch durch die Hilfsbereitschaft der Menschen sowohl in Deutschland als auch in Polen schaffte sie es wieder nach Hause. Etwas später bekamen wir die Nachricht, dass Dieter gestorben war.
Ich selbst hatte ihn nie kennengelernt, meine Brüder aber schon. Ich spürte die Trauer der Familie auf jene diffuse Weise kleiner Kinder, die über feine Antennen für die Stimmungen in der Familie verfügen.
Ich hörte auch davon, dass Vater einmal von den Polen verhaftet worden war, und dass seine Buchhalter ebenfalls in Gefangenschaft gerieten und man später von ihnen nichts mehr hörte.
Aber all das sind Geschichten, die mich selbst nicht direkt betrafen. Die Gnade der späten Geburt.
Meine ersten halbwegs zuverlässigen Erinnerungen sind die Gerüche einer Nerzfarm, die sich in unserer Nachbarschaft in Eutin befand. Nerze stinken, sie sind Raubtiere und fressen jede Menge Fleisch. Das sollten die Damen, die gern Nerzmäntel tragen, vielleicht wissen.
Am Ufer des Eutiner Sees, im Schilfgürtel, lernte ich mit fünf Jahren schwimmen und wenig später auf einem viel zu großen Fahrrad das Radeln. Meine Beine waren noch zu kurz, ich kam schlicht nicht an die Pedale. Mein Ehrgeiz und Trotz aber waren geweckt, ich wollte es unbedingt können. Ich steckte ein Bein durch den Rahmen und hielt das Fahrrad schief. So schien es zu gehen, aber ich fiel natürlich ständig hin. Regelmäßig kam ich mit aufgeschürften Knien und blauen Flecken nach Hause. Ich verstehe nicht, warum heute die Kinder von solchen Erfahrungen ferngehalten werden. Wird man durch diese Überbehütung gut auf das Leben vorbereitet? Auf kleinere und größere Rückschläge? Kleine Unfälle dieser Art verhindern doch die Wahrscheinlichkeit größerer und gefährlicherer Unfälle. Lieber ein paar Mal aufgeschürfte Handflächen und Knie, als einmal eine schwere Kopfverletzung, weil man es nicht gelernt hat, beim Fallen die Hände zu gebrauchen.
Dank der Disziplin der Eltern, ein geregeltes, wenn auch spartanisches Familienleben aufrechtzuerhalten, litt ich unter der Kargheit unseres Haushalts nicht sonderlich. Sparsamkeit durchzog auf allen Ebenen meine gesamte Kindheit. Ich kann mich erinnern, in der dünnen Suppe nach den wenigen Fleischstückchen gesucht zu haben, die sich unter den Fettaugen verbargen. Und entdeckte ich eines, war ich glücklich wie ein Schatzsucher.
Auch Süßigkeiten waren ein rares Gut. Einmal naschte ich mit einem Teelöffel ein bisschen Zucker. Ich wähnte mich auf der sicheren Seite, ich hatte aufgepasst, nichts zu verschütten, und die paar Krümel, die ich naschte, würden nicht auffallen. Und dennoch waren mir wohl ein paar Körner auf den Boden gefallen, und die scharfen Ohren meiner Mutter vernahmen das verräterische Knirschen unter ihren Schuhen. Mein Leugnen blieb ergebnislos, die Beweislast war zu erdrückend, und ich musste die entsprechende Standpauke über mich ergehen lassen.
Rückblickend sehe ich vor allem die Vorteile für meine Entwicklung, die der Mangel an Spielzeug und, wie man heute sagt, Konsumgütern mit sich brachte. Ein Kind, das wenig Spielzeug sein eigen nennt, muss sich etwas einfallen lassen. Es wird kreativ. Obendrein war mein Vater handwerklich außerordentlich geschickt, und er kannte alle möglichen Tricks und Kniffe, aus dem einfachsten Material etwas Spannendes herzustellen.
Es gab damals diese hölzernen Garnspulen, die auf die Nähmaschine gesteckt wurden, und waren diese aufgebraucht, wurden sie zu begehrten Objekten für uns Kinder. An den Enden waren sie dicker, so dass sie für uns zu den zwei Rädern eines Autos wurden. Mit einem Schnipsgummi und einem Streichholz verbunden, konnte man die Konstruktion dann aufdrehen, und die Garnspule sauste los wie ein echtes Auto. Riss ein Gummi, standen wir vor einem Problem. Heute bekommt man eine Tüte mit fünfhundert Schnipsgummis für ein paar Cent, damals aber war alles rar. Wir bettelten die Mutter an, „Mutti, wir brauchen einen neuen Gummi“, und sie sagte nur, wir sollten den alten erst einmal wieder zusammenknoten und wiederverwenden.
Weggeworfen wurde nahezu nichts, und diese Angewohnheit habe ich bis heute beibehalten. Man vergisst schnell, dass allein schon das Vorhandensein von Material einen Einladungscharakter zu bisher ungedachten Ideen haben kann. Selbst heute, wenn im Haushalt etwas kaputt geht, eine Lampe oder ein Küchengerät, und meine Frau mich auffordert, das zu reparieren – nicht zu Unrecht, wie ich finde, denn wer Supersportwagen konstruiert, sollte auch eine Lampe reparieren können, oder? –, gehe ich in meine Kellerwerkstatt mit unzähligen Regalen und Schubkästen, schaue mich um und frage mich, welche Gegenstände mir jetzt helfen könnten. Fast immer finde ich eine Möglichkeit, das entsprechende Teil zu reparieren. Ich komme auf Ideen, die mir im Traum nicht eingefallen wären, wäre ich am Ort des Geschehens, etwa im Flur, bei der kaputten Lampe geblieben. Nach dem gleichen Prinzip entwickelte ich als junger Versuchsingenieur beispielsweise den Geländewagen Iltis von Audi, oder das leider nie in Serie gegangene und bisher einzige Motorrad, das Audi je konstruiert hat, und das heute im Museum steht.
Natürlich war auch meine Stellung als jüngstes Kind einer Reihe von vier wilden Jungen ausschlaggebend für meine Entwicklung. Mit Bodo, dem nächstälteren Bruder, raufte ich oft, und so wurde ich stark und lernte mich durchzusetzen. Manchmal gewann ich sogar einen Ringkampf gegen ihn. Unser Haushalt war durch uns vier Rabauken ziemlich testosterongeschwängert. Die Mutter versuchte mit preußischem Gerechtigkeitssinn das Gleichgewicht zu bewahren. Vier wilde Brüder zu bändigen, war keine leichte Aufgabe, und meine Mutter meisterte diese mit Bravour. Ohne eine gewisse Strenge war das natürlich nicht möglich. Und Gelegenheiten, in denen wir unsere Lausbubenstreiche durchführen konnten, ohne dass ihr wachsames Auge uns daran zu hindern vermochte, gab es zur Genüge.
Ich liebte meine Mutter abgöttisch. Für sie tat ich fast alles, sogar für die Schule lernen. In Wirklichkeit hasste ich dieses stupide Lernen. Stundenlang in einem Klassenzimmer zu sitzen, während draußen die Sonne lachte, schien mir eine unverzeihliche Zeitverschwendung, zumal man stattdessen durchaus sinnvolle Dinge hätte tun können. Etwa mit Pfeil und Bogen durch den Wald zu streifen und Tiere zu erlegen, obwohl man die ja nie erwischt hat. Aber man konnte so tun, als ob.
Brachte ich eine schlechte Note nach Hause, sah ich, wie traurig Mutter darüber wurde, und ich nahm mir vor, fortan mehr für die Schule zu tun. Ich glaube, den Satz „Du lernst doch nicht für die Schule, sondern für das Leben“ hat wohl ein jeder meiner Generation oft genug gehört. In Wahrheit habe ich weder für die Schule noch für das Leben, sondern ausschließlich für meine Mutter gelernt.
Mein Vater war evangelisch, meine Mutter hingegen katholisch gewesen, aber er beharrte darauf, evangelisch zu heiraten. Ihm war der, wie er es nannte, katholische Schnickschnack zuwider. Vermutlich fühlte er sich durch das verborgene Heidentum all der Heiligen und Madonnen und die pompöse Bilderflut in seiner Intelligenz beleidigt. Vater war außerordentlich klug. Man konnte ihn fragen, was man wollte, man bekam Antwort. Er kannte sich nicht nur in der Ingenieurskunst aus, sein Geist war vielfältig, und sein Interesse galt schlicht allem, egal ob es sich um medizinische, biologische, philosophische oder politische Dinge handelte. Von ihm lernte ich viele grundlegende handwerkliche Fähigkeiten. Er zeigte mir und meinen Brüdern kleine Tricks, wie man aus irgendwelchem Material Spielzeug herstellen konnte. Ich glaube, ein gehöriger Teil meiner Konstruktionsleidenschaft ist auf seinen Einfluss zurückzuführen.
In Vater und Mutter verkörperte sich im besten Sinne der alte preußische Geist. Auch vor meiner Zeit, in Ziegenhals, hielt die Mutter zum Beispiel Hühner; sie war sich nicht zu fein, als Frau des Fabrikdirektors solch bodenständige Tätigkeiten wie das Ausmisten der Ställe oder das Füttern der Tiere selbst durchzuführen. Genügsamkeit und Fleiß galten in der Familie als Tugend. Und doch vermochten es meine Eltern, die Balance aus Disziplin und Liebe im täglichen Umgang zu halten. Ich bin davon überzeugt, dass ein solches Wertesystem für Heranwachsende eher von Vorteil ist. Später, etwa in den Rallyezeiten, war es für mich selbstverständlich, an vorderster Front zu sein und mit Hand anzulegen, Reifen zu wechseln oder ein Getriebe aus- und wieder einzubauen. Schmutzflecken auf meiner Kleidung empfand ich nie als Makel, egal wie meine offizielle Position gewesen sein mochte.
Tatsächlich habe ich meine späteren Teams nicht viel anders geführt, als es meine Eltern mit uns Brüdern getan hatten. Ich kümmerte mich darum, dass es allen gut ging, half, wo es nur möglich war, hatte für alle ein offenes Ohr, motivierte, erzeugte ein Gefühl des Familiären. Im Gegenzug erwartete ich, dass jeder sein Bestes gab. Ich denke, dass dieses Konzept aufging. Sicher könnte man kurzfristige Erfolge auch mit eiserner Strenge erzielen, nie aber auf lange Sicht. Die Kunst ist es vielmehr, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erzeugen und zu pflegen, und das ist nur durch echte und erfahrbare Zuwendung möglich.
Die einprägsamsten Erlebnisse der Schulzeit, an die ich mich erinnere, hatten mit dem Unterrichtsstoff nichts zu tun. Das heißt nicht, dass man in der Schule nichts lernen würde, aber es ist eben nicht der Lehrplan, der die wirklich wichtigen Lehren für das Leben bereitstellt, sondern vielmehr die Begleiterscheinungen, etwa die Notwendigkeit, sich durchzusetzen oder mit unmöglichen Personen in Machtpositionen zurechtkommen zu müssen.
Da ich evangelisch war, genoss ich eine Freistunde mit anderen Kindern der gleichen Konfession, wenn der katholische Religionsunterricht stattfand. Der Hausmeister kam auf die Idee, mich und die vier oder fünf anderen Schüler in dieser Zeit den Schulhof fegen zu lassen. Ich sah das aber nicht ein. Es war ja unsere Freistunde, warum sollten wir in dieser Zeit den Job des Hausmeisters erledigen. In dieser Situation erwachte mein Widerspruchsgeist. Ich weigerte mich. Der Hausmeister versuchte, seine zweifelhafte Autorität auszuleben, stieß aber bei mir gegen eine Mauer aus steinerner Dickköpfigkeit. Er tobte und schimpfte, alles umsonst. Da veranlasste er, dass ich zum Direktor beordert wurde. Mir schlackerten auf dem Weg zum Direktorenbüro so sehr die Knie, dass ich kaum laufen konnte, und mein Herz sank mir bis zum Hosenboden. Aber ich blieb standhaft. Der Direktor hörte sich meine Argumentation ruhig an, und letztlich wurde der Missbrauch des Hausmeisters sogar eingestellt. Die anderen Protestanten hatten sich wortlos den Befehlen des Hausmeisters gefügt. Meine Dickköpfigkeit aber hatte für uns alle Erfolg gebracht.
Ich lernte bereits frühzeitig, mich in bereits bestehende Hierarchien und Gruppen einzufügen. Was blieb mir auch anderes übrig? Wir zogen oft um, ich verließ also meine Klassenkameraden, an die ich mich über einige wenige Jahre gewöhnt hatte, kam in eine neue Stadt, in neue Schulen, in neue Klassenverbände. Niemand kannte mich, ich kannte niemanden. Bisweilen musste ich im Inneren die Zähne zusammenbeißen, wenn ich in der Fremde die alten Freunde vermisste. Anfangs schrieben wir uns noch Briefe, doch irgendwann kam keine Antwort mehr. Verständlich, denn die zurückgelassenen Freunde konnten auf ihre Freundeskreise und Klassenkameraden zurückgreifen, Kinder leben im Augenblick. Und doch fühlte es sich bitter und enttäuschend an. Mit jedem Umzug fing ich wieder bei null an, Freunde zu gewinnen und mir Respekt und Achtung zu erarbeiten.
Ich war für mein Alter ziemlich groß und auch recht kräftig; die vielen Trainingsstunden mit meinen älteren Brüdern hatten sich bezahlt gemacht. Als wir von Alfeld an der Leine nach Jülich zogen, zu Beginn des Gymnasiums, stand ich also wieder vor fremden Jungs, die sich kannten, die ihre Hackordnungen bereits ausgehandelt hatten, und die sich fragten, wer denn dieser Neue war und was er wohl draufhaben mochte. Der Stärkste der Klasse forderte mich zum Zweikampf. Es gelang mir, diesem eine Woche lang aus dem Weg zu gehen, aber die anderen aus der Klasse waren auch neugierig, und ich wusste, ab einem bestimmten Punkt würde mir meine Verweigerung nicht mehr als gelassene Friedfertigkeit, sondern als Feigheit ausgelegt werden. Es kam zum Kampf, und ich gewann. Ab diesem Zeitpunkt war ich akzeptiert und in die den Erwachsenen oft unverständliche Jungengemeinschaft aufgenommen.
Noch schwieriger war es für mich, als wir nach Österreich zogen. Ich hatte den Vater über all die Jahre oft erschöpft von der Arbeit kommen sehen. Er, der studierte Ingenieur, der in Schlesien eine große Fabrik besessen und geleitet hatte, verdingte sich in den ersten Nachkriegsjahren als Schlosser, später als Tischler oder nahm andere Tätigkeiten an, um das nötige Geld für die Familie zusammenzubekommen. Seine Beharrlichkeit aber zahlte sich aus, als ich etwa sechzehn Jahre alt war. Er, der alles verloren hatte, schaffte es, wieder Direktor einer Fabrik, wenn auch in einem kleinen österreichischen Ort, Niklasdorf, in der Nähe von Leoben in der Steiermark, zu werden. Natürlich stand nicht infrage, dass wir für diese Stellung Deutschland verlassen würden.
In Leoben besuchte ich nun das Gymnasium, und einmal mehr stand ich vor fremden Kindern, nunmehr Jugendlichen von sechzehn Jahren, und diesmal war ich der Piefke. Für die Österreicher der Steiermark waren alle Deutschen Piefkes. Erstmals hatte ich nun auch mit einer Sprachbarriere zu kämpfen. Ich verstand den harten Dialekt einfach nicht. Machte jemand einen Witz, lachte ich erst eine Minute später, wenn ich das Kauderwelsch übersetzt und den Witz verstanden hatte. Daraufhin lachten sie mich aus und meinten, ich stünde auf der Leitung und sei wohl ein bisschen blöd. Im Grunde aber war es ein gutmütiges Hänseln. Irgendwann standen alle siebzehn Mann um mich herum, drückten mich in eine Ecke, schubsten mich, nicht derb, aber immerhin, und ich musste gute Miene zum bösen Spiel machen und lachte mit, wenn sie lachten. Mit dem Kräftigsten allerdings maß ich mich dann im Armdrücken, konnte mich mit einem Unentschieden gegen ihn behaupten, und die Hänseleien hörten auf. Man muss nicht immer der Sieger sein, um den Respekt der anderen zu gewinnen. Oft reicht dafür auch der Mut, den man beweist, indem man sich einer Herausforderung stellt.
Ich hätte auch zum Lehrer gehen und mich beschweren können: „Die sagen immer Piefke zu mir.“ Aber was hätte es gebracht? Ich wäre unwiederbringlich als Feigling deklassiert worden.
Man lernt als Fremder zwei Dinge: Man darf nicht zu empfindlich sein und sich nicht gleich beleidigt fühlen. Man muss verstehen, dass man als Fremder in eine bereits bestehende Ordnung hinzukommt und dass man, indem man sich dort einfügen möchte, diese Ordnung in gewisser Weise stört. Man zwingt die Mitglieder einer Gemeinschaft, sich zugunsten der Integration des Neuen neu zu justieren. Diese Veränderung vonseiten der Gemeinschaft ist nicht selbstverständlich, und so lernt man – das ist der zweite Punkt – sich zu beweisen und auf diese Weise Achtung zu erwerben. Niemand hat ein grundsätzliches Recht darauf, irgendwo aufgenommen zu werden, ohne dass er dabei eine gewisse Vorleistung erbringen muss. Man selbst muss als Neuankömmling den anderen zeigen, wer man ist, was man kann und auf welche Weise man Achtung und Respekt verdient, und nicht umgekehrt.
Es gibt natürlich einen grundlegenden Unterschied zwischen dem, was ich erfuhr und was ich als legitime und sogar nötige Tests verstand, und dem, was man heute Mobbing nennt.
Meine Tochter Nathalie ist durch ihre Mutter halbe Italienerin. Einige idiotische Nachbarn waren der Meinung, sie „Spaghettifresserin“ nennen zu müssen. Die Kinder warfen ihr immer wieder einen schweren Medizinball in den Rücken, riefen „Italiener raus!“, aber da die Situation im katholischen Unterricht stattfand, konnte sie sich nicht angemessen wehren. Natürlich intervenierte ich in diesem Fall, besuchte die Eltern der Kinder, sprach mit ihnen und klärte das.
Im Allgemeinen aber, wenn Kinder sich wehren können, sollten sie lernen, sich durchzusetzen und ihre Probleme weitgehend selbst zu klären. Nur so lernt man das Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen, das man im späteren Leben braucht.
Wenn man bereit ist, sich selbst zu beweisen, etwas einstecken und hinreichend Verständnis für die Mitmenschen aufbringen kann, sollte es meiner Meinung nach jedem gelingen, auch in der Fremde erfolgreich Fuß zu fassen.
Heimliche Rendezvous
Zwei Jahre vor dem Abitur lernte ich Sylvia kennen. Sie war die Tochter des Poliers in der Fabrik meines Vaters, vor allem aber war sie die schönste unter allen Mädchen in der Schule. Leider hatte sie einen Freund. Gunther war, da er in der Volksschule eine Klasse wiederholen musste und zudem aus gesundheitlichen Gründen zwei Jahre ausgesetzt hatte, etwa drei oder vier Jahre älter als wir alle, recht charismatisch, aber auch jähzornig, wild und herrschsüchtig. Er war Teil eines Dreiergespanns, und als ich neu in die Klasse kam, gefielen die drei mir am besten. Es dauerte nicht lange, und ich war in diesem Bund der vierte. Ich kam mit Gunther trotz seiner Unbeherrschtheit recht gut zurecht, aber als ich seine Freundin kennenlernte, kühlte sich unser Verhältnis für eine Weile recht schnell ab. Mir gefiel nicht, wie er mit ihr umging. Sie stand sichtbar unter seiner Fuchtel.
Sylvia wohnte wie ich in Niklasdorf, sieben Kilometer von Leoben entfernt, und so nahmen wir gemeinsam morgens den Bus. Später, als ich mit dem Motorrad zur Schule fuhr, nahm ich sie oft mit.
Ich sprach Gunther auf sein Verhalten gegenüber Sylvia an, sagte ihm, auf diese Art ginge man nicht mit so einem feinen Mädchen um, das gehöre sich nicht. Was mich das anginge, gab er zurück. Die beiden verstrickten sich immer wieder in Streitereien. Ich jedoch verliebte mich immer mehr in Sylvia. Rücksicht auf die schon zerrüttete Beziehung der beiden konnte und wollte ich nicht nehmen, und so warb ich um sie.
Ich verabredete mich mit ihr zu einem ersten Rendezvous auf einer verschwiegenen Halbinsel am Ufer des kleinen Flüsschens Mur. Meiner Mutter sagte ich, ich mache Hausaufgaben, oben in meinem Zimmer in der Dachmansarde. Wir wohnten damals auf dem Fabrikgelände in einem schönen Herrschaftshaus, aber es gab nur zwei Zugänge zu dem Grundstück, und beide wurden von Pförtnern mit Argusaugen bewacht. Ich hatte aber schon vor einiger Zeit aus dem Zaun um den weitläufigen Obstgarten einige Schrauben entfernt, so dass ich die Zaunlatten zur Seite schieben und so unerkannt hinausschlüpfen konnte, wann es mir beliebte. Diesen kleinen Privatausgang nutzte ich auch diesmal. Es sollte ja niemand wissen, dass mein Herz in Flammen für die schöne Tochter des Vorarbeiters meines Vaters stand. Die Eltern wünschten sich eine gute Partie für mich, vielleicht die Tochter des Bürgermeisters oder eines Arztes, aber diese Überlegungen ließen mich kalt. Nur durfte man uns eben nicht erwischen. Die Pförtner hätten mich gefragt, wohin ich ginge, oder hätten die Eltern von meinen Ausflügen unterrichtet. Ich schlich also hinaus, nicht ohne Herzklopfen, brachte einen Strauß Blumen mit, lud Sylvia ein, sich zu mir setzen, auf das Gras der Halbinsel, und es gelang mir, ihr einen Kuss zu geben, ohne dass ich eine Ohrfeige bekam.
Recht bald überwarf sie sich mit Gunther. Er roch natürlich Lunte und warf mir vor, ihm die Freundin ausgespannt zu haben. Ich entgegnete, dass er sie halt besser behandeln hätte sollen. Wenn er in seiner Unbeherrschtheit handgreiflich werden würde, dürfe er sich nicht wundern, dass sie ihm davonliefe. Es dauerte nicht lange, bis er sich ins Unvermeidliche gefügt und die neue Situation akzeptiert hatte.
Ganz anders meine Eltern. Sie ahnten zwar, dass zwischen Sylvia und mir etwas lief, aber sie wussten nichts Genaues.
Eines Tages gingen sie aus, fuhren nach Leoben zum Tanz, und ich wusste aus Erfahrung, dass sie nicht vor vier Uhr morgens zurückkommen würden. Ich hatte bereits eine Strategie entwickelt, um meine Mutter zu täuschen, wenn ich selbst abends heimlich ausging. Ich ließ meine Zimmertür unversperrt und drapierte das Bett so, dass sie in der Dunkelheit, wenn sie nach dem Rechten schauen wollte, annehmen musste, dass ich da läge und schliefe.
Ich lud Sylvia an dem betreffenden Abend ein, zu mir zu kommen. Sie hielt sich an meine Instruktionen, schlich sich durch den Gartenzaun aufs Grundstück und zu mir auf mein Zimmer. Unerwartet aber kamen meine Eltern viel zu früh heim. Vielleicht hatten wir auch die Zeit vergessen. Ich hörte die Türklinke, hatte aber dieses Mal abgeschlossen, ich war ja nicht allein. Die Mutter pochte gegen die Tür.
„Roland, mach auf!“
„Moment“, rief ich, „Moment, ich bin noch nackt.“
Hastig bedeutete ich Sylvia, sich anzuziehen. Das dauerte eine Weile und die Mutter hatte bereits den Vater gerufen.
„Roland, im Ernst, mach sofort die Tür auf!“
„Ja, ja, gleich …“
Ich wartete, bis Sylvia endlich angekleidet war, dann öffnete ich und bemerkte zu spät, dass ich selbst noch halbnackt war.
Mutter starrte mich an, der Vater legte die Stirn in Zornesfalten, es gab einen Riesenkrach.
In den folgenden Wochen erwies sich diese Situation als eine Machtprobe. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben wirklich sauer auf meine Eltern. Ich weigerte mich, mit ihnen zu reden, blieb wortkarg und ging ihnen aus dem Weg. Die Mutter weinte darüber, aber ich blieb hart. Sylvia war mein Mädchen, und niemand, auch meine Eltern nicht, hatte darüber zu bestimmen, wen ich liebte und wen nicht. Ich suchte mir mein Mädchen und meine spätere Frau selbst aus.
Rückblickend hatten mich der preußische Geist, die Disziplin und Sittenstrenge der Eltern auf zweierlei Weise beeinflusst. Einerseits, denke ich heute, sind Disziplin und Konsequenz unerlässlich, wenn man ein erfülltes Leben anstrebt, und meine Eltern lebten diese Eigenschaften vorbildlich vor. Sie zeigten mir, wie die Balance zwischen echter familiärer Liebe und konsequenter Erziehung erfolgreich gelebt werden kann – ein für mein späteres eigenes Familienleben und sogar für meinen beruflichen Werdegang unschätzbares Erbe. Andererseits bot mir ihre Sittenstrenge die Chance zu erkennen, was ich für mich wirklich wollte, und ich lernte mit genau jener Konsequenz, die meine Eltern mir mitgaben, mich gegen sie durchzusetzen, wenn ich eine Entscheidung für mein Leben gefällt hatte. Und die Beziehung mit Sylvia war eine solche Lebensentscheidung, die ich gegen alle Widerstände abschirmte.
Ein weiterer wichtiger Entschluss war es, möglichst schnell finanziell unabhängig zu werden. Die Eltern waren zwar bereit, nach dem Abitur mein Studium zu finanzieren, aber mir war das unangenehm, nicht zuletzt wegen der Auseinandersetzungen bezüglich meiner Freundin. Ich sagte ihnen, dass ich nun erwachsen sei und mein Geld selbst verdienen könne. Tatsächlich waren es wohl mein Stolz und das Wissen darum, dass sie mir künftig nicht mehr in meine Angelegenheiten hineinreden würden, wenn ich bewies, dass ich für meinen Unterhalt selbst sorgen konnte.
Nachdem wir unser Abitur in der Tasche hatten, beschlossen Sylvia und ich, zum Studium nach Graz zu ziehen. Bevor sie etwas später nachkam, wohnte ich in einem Kellerloch, in dem die Ratten ein- und ausgingen, es war feucht und modrig, und das konnte kein Dauerzustand bleiben.
In der Maigasse fanden dann Sylvia und ich eine bezahlbare Wohnung, zwar mit nur einem Zimmer, dieses aber war groß und bot Platz genug für uns beide. Meine Mutter muss Höllenqualen gelitten haben. Ihr Sohn zog in wilder Ehe mit einem Mädchen in eine kleine Wohnung. Unvorstellbar. Wir versuchten daraufhin eine Lösung zu finden, um den familiären Frieden, der noch etwas wacklig war, nicht weiter zu strapazieren, und beschlossen, eine Trennwand einzuziehen. Sylvias Vater half uns, indem er uns mit Sperrholzplatten aus der Fabrik versorgte. Wir verbauten sie zu Wänden, die das Zimmer so teilten, dass jede Kammer über ein Fenster verfügte. Improvisierte Türen mit Magnetschloss erzeugten so den Eindruck von Anstand und Sittlichkeit. Meine Mutter konnte nun ihren Freundinnen, ohne allzu rot zu werden, erzählen, dass ihr Roland mit seiner Freundin zwar in einer Wohnung, aber natürlich in getrennten Zimmern wohnte.
Studentenleben
Es stand nicht infrage, was ich studieren würde. Schon immer gab es nur zwei Alternativen, zu denen es mich zog: Arzt oder Ingenieur. Die Entscheidung für Ingenieurstechnik fiel ein paar Jahre zuvor, als ich Zeuge eines schweren Motorradunfalls in der Nähe von Niklasdorf wurde. Das Gehirn des Fahrers lag auf der Straße verteilt, die frische Leiche daneben, alles war abgesperrt und blutig, und ich dachte, ich werde wohl doch lieber Ingenieur. Sylvia hingegen schrieb sich für ein Studium der Betriebswirtschaft ein.
Bereits mit siebzehn Jahren, bevor ich meinen Führerschein machte, kaufte ich für ein paar hundert Schilling meines ersparten Taschengeldes ein gebrauchtes Motorrad aus den Beständen der Fabrik meines Vaters. In den fünfziger Jahren fuhr die österreichische Polizei noch die Puch 250, eine Zweitaktermaschine mit Doppelhubkolbenmotor, und als diese ausgemustert wurden, erwarb mein Vater für die Fabrik einige dieser Motorräder für Kurierdienste. Ich zerlegte das restaurationsbedürftige Motorrad wie damals das Feuerwehrauto, richtete es wieder her, strich es komplett blau und fuhr auf dem Fabrikgelände Probe. Währenddessen machte ich schon den Führerschein für Auto, Lkw und Motorrad, und als ich achtzehn wurde, holte ich das Papier sofort ab.
Um das Problem der Finanzierung meines Studiums zu lösen, nahm ich verschiedene Ferienjobs an. In Jülich etwa, meiner alten Heimat, verdingte ich mich bei einer Gärtnerei, die Autobahnböschungen mit Grasballen auslegte. Es war kein Spaß, in der Hitze des Sommers den ganzen Tag auf den Schrägen am Rande der Autobahn zu stehen und Grasballen auszurollen.
Einige Male nahm ich Sylvia auf dem Motorrad mit. Es war eine ziemlich weite Strecke, und erschrocken fühlte ich während einer dieser ermüdenden Fahrten, wie sich Sylvias Arme um meinen Bauch lösten. Sie war eingenickt und wäre fast vom Motorrad gefallen. Schnell hielt ich an und schnürte uns kurzerhand mit einem Gummiband aneinander.
Bald konnte ich mir sogar ein Auto leisten. Nun ja, es war ein alter Puch 500 (ein damaliger Lizenzbau des Fiat 500) mit einem Zwei-Zylinder-Boxermotor, den ich mühevoll wieder herrichtete.
Kurz darauf ergab sich eine ungleich lukrativere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Meine Brüder arbeiteten gelegentlich in den Ferien in einer Papierfabrik in Schweden, in der Nähe von Stockholm, und sie verdienten viel mehr als ich in der Gärtnerei. Ein verdammt weiter Weg war es dorthin, aber ich hatte ja nun ein Auto. Die Sommer in Schweden waren kurz, und in dieser Zeit arbeiteten dort viele Studenten, auch aus Deutschland und Österreich.





























