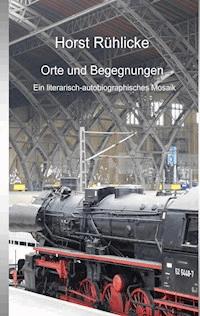
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In seinem autobiographisch angelegten Werk erzählt Horst Rühlicke Geschichten und Episoden aus acht Jahrzehnten, die in die Tiefenstruktur dreier unterschiedlicher politischer, ökonomischer und sozial-kultureller Systeme hineinreichen. Der Rahmen für seine Lebenserinnerungen wird geographisch aufgespannt, es sind Erlebnisberichte aus Städten von A bis Z. Jenseits des persönlichen Bezuges sind diese von allgemeiner Erinnerungswürdigkeit, stellen sie doch in ihrer mosaikhaften Zusammenstellung ein Zeugnis für Lebensformen im Ostteil Deutschlands dar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen beiden Töchtern
FRAU SIEGLINDE HOFFMANNund FRAU PROF. DR. FRIEDRUN QUAAS
danke ich herzlich für die geduldige Unterstützung, die sie mir bei der Umsetzung dieses Buchprojektes gewährt haben.
INHALTSVERZEICHNIS
Zum Geleit
Begegnungen in Orten mit dem Initial
A
AACHEN
AHLBECK
ALTENBURG
ANNABERG-BUCHHOLZ
ANNABURG
APOLDA
ARENDSEE
ARNSDORF
ARNSTADT
ASCHERSLEBEN
ASELEBEN
Begegnungen in Orten mit dem Initial
B
BAD BENTHEIM
BAD DÜBEN
BADEN-BADEN
BAD LIEBENWERDA
BAD SCHMIEDEBERG
BALLENSTEDT
BART
BAUTZEN
BEBRA
BELGERN
BERLIN
BERNBURG
BITTERFELD
BLANKENBURG
BRANDENBURG
BRATISLAVA
BRAUNSCHWEIG
BUCKOW (MÄRKISCHE SCHWEIZ)
BUDAPEST
BURGAS
Begegnungen in Orten mit dem Initial
C
CALBE
CHEMNITZ
CORDOBANG
COSWIG
COTTBUS
Begegnungen in Orten mit dem Initial
D
DELITZSCH
DESSAU
DOBERLUG-KIRCHHAIN
DOMMITZSCH
DRESDEN
DÜREN
Begegnungen in Orten mit dem Initial
E
EILENBURG
ELBINGERODE
ELSTERWERDA
ENGELSDORF
ERFURT
Begegnungen in Orten mit dem Initial
F
FALKENBERG (ELSTER)
FRANKFURT (ODER)
FREIBERG
FREITAL
FÜRSTENWALDE (SPREE)
Begegnungen in Orten mit dem Initial
G
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
GERA
GÖRLITZ
GOTHA
GÖTTINGEN
GRÄFENHAINICHEN
GRAINAU
GREUDNITZ
GÜSTROW
Begegnungen in Orten mit dem Initial
H
HALBERSTADT
HALLE (SAALE)
HAMBURG
HANNOVER
HARZGERODE
HEILIGENSTADT
HELMSTEDT
HERZBERG
HOHNSTEIN
HOYERSWERDA
Begegnungen in Orten mit dem Initial
I
INGOLSTADT
INNSBRUCK
Begegnungen in Orten mit dem Initial
J
JESSEN
JÜTERBOG
Begegnungen in Orten mit dem Initial K
KEMBERG
KEMPTEN
KIEW
KLINGENTHAL
KOBLENZ
KÖNIGSEE
KÖNIGSTEIN
KÖNIGS WUSTERHAUSEN
KÖTHEN
KUFSTEIN
Begegnungen in Orten mit dem Initial
L
LANGENSELBOLD
LAUCHHAMMER
LEINEFELDE
LEIPZIG
LINDAU
LÜBECK
LUCKENWALDE
LUDWIGSFELDE
LUDWIGSLUST
LUTHERSTADT EISLEBEN
LUTHERSTADT WITTENBERG
Begegnungen in Orten mit dem Initial
M
MAASTRICHT
MAGDEBURG
MANNHEIM
MANSFELD
MARKTOBERDORF
MEERSBURG
MEISSEN
MELLRICHSTADT
MITTENWALD
MITTENWALDE
MOSKAU
MÜHLHAUSEN
MÜHLTROFF
MÜNCHEN
MÜNDEN
Begegnungen in Orten mit dem Initial
N
NAUMBURG
NESSEBAR
NEUDIETENDORF
NEUSÄSS
NIEMEGK
NIENBURG
Begegnungen in Orten mit dem Initial
O
OBERHOF
OBERWEISSBACH
OEDERAN
Begegnungen in Orten mit dem Initial
P
PERLEBERG
PIRNA
POTSDAM
PRAG
PRETTIN
PRETZSCH
PUTBUS
Begegnungen in Orten mit dem Initial
Q
QUEDLINBURG
Begegnungen in Orten mit dem Initial
R
RIQUEWIHR
RÖBLINGEN AM SEE
Begegnungen in Orten mit dem Initial
S
SALZBURG
SALZWEDEL
SANGERHAUSEN
SCHIRGISWALDE
SCHMALKALDEN
SCHÖNEBECK
SCHWABECK
SEIFHENNERSDORF
SEYDA
SOCHAUX
SOSOPOL
STASSFURT
STAVENHAGEN
STEIN AM RHEIN
STEINBACH - HALLENBERG
STERZING
STRALSUND
STRUTH / STRUTH-HELMERSHOF
Begegnungen in Orten mit dem Initial
T
THALE
TORGAU
TREUENBRIETZEN
Begegnungen in Orten mit dem Initial
U
UDER
USEDOM
Begegnungen in Orten mit dem Initial
V
VACHA
VADUZ
Begegnungen in Orten mit dem Initial
W
WANDERSLEBEN
WEIMAR
WEISSENFELS
WERBEN
WERNIGERODE
WIEN
WINNINGEN
WITTENBERGE
WITTICHENAU
WURZEN
Begegnungen in Orten mit dem Initial
Z
ZAHNA
ZEITZ
ZERBST
ZOSSEN
ZWICKAU
Zu Autor und Inhalt
ZUM GELEIT
„Alle meine Städte“ – das war der Arbeitstitel für diese, meine Erinnerungen.
Die Betonung liegt selbstverständlich nicht auf dem Possessivpronomen. Gemeint sind jene Städte, in denen ich etwas aus meiner Sicht Erzählenswertes erlebt habe, in denen sich erinnerungswürdige Begegnungen vollzogen. Städte von A bis Z, von Aachen bis Zwickau. Städte, denen – wo angebracht – auch kurze kultur- und zeitgeschichtliche Betrachtungen gewidmet sind.
„Alle meine Dörfer?“ – Walter Kollo lässt einen seiner Operettenhelden „Ich habe die Welt und hundert Dörfer gesehen…“ schmettern. Das mit der Welt ist maßlos übertrieben, und hundert Dörfer, pah, da habe ich weitaus mehr kennengelernt. Wer aber nimmt in einer Zeit, in der kaum noch von Gemeinden schlechthin, sondern zumeist nur von Einheits- und Verbandsgemeinden die Rede ist, in der Eingemeindungen großmannssüchtig und auf Teufel komm raus vorangetrieben werden, wer nimmt da das Wort Dorf überhaupt noch in den Mund?
Allzu viel erlebt habe ich in dörflichen Gefilden nicht, doch einiges davon sollte dem Vergessen nicht anheimfallen. Geboren wurde ich schließlich in keiner Stadt, sondern habe mein Dasein in Trebitz, Kreis Wittenberg (nunmehr Stadtteil der Einheitsgemeinde Bad Schmiedeberg) begonnen.
Die bahndienstliche Bezeichnung Trebitz (Elbe) ist ein wenig irreführend. Der Strom fließt nämlich in einer Entfernung von vier Kilometern am Ort vorbei. Immerhin jedoch blinkt, nähergelegen, vom satten Wiesengrün der Elbaue umgeben, ein ruhendes Wasser der alten Elbe, das dem Wanderer deren Verlauf vor dem Durchstich eines Mäanderbogens im 19. Jahrhundert anzeigt. Mit etwas gutem Willen lässt sich Trebitz sogar in die Reihe meiner Städte fügen, war der Ort doch einst Sitz eines Amtes des Kurkreises, besaß ein eigenes Maß, eben das Trebitzer Maß, und wurde in alten Urkunden sogar gelegentlich als Städtlein bezeichnet.
Gegründet wurde Trebitz in sehr früher Zeit, im neunten oder gar bereits im achten Jahrhundert von Wenden des Stammes der Nizici.
Die erste schriftliche Erwähnung findet sich in der Auflistung einer Kaiserurkunde vom 11. April 965, die besagt, dass benannte Burgwarde, darunter auch Triebaz, den Zehnten ihres gesamten Honigweines an ein Kloster in Magdeburg abführen mussten. Jahrhunderte später wurde der Honig erneut für Trebitz bedeutsam. Sehr erfolgreich wirkte hier der Vater der sächsischen Bienenzucht, Pastor Spitzner, in dessen Obhut sich mehr als zweihundert Bienenstöcke befanden.
Der kleinstädtische Charakter, den Trebitz einmal besessen haben mochte, dürfte sich erst sehr lange Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg entfaltet haben; denn entsprechend dem zeitgenössischen Bericht einer kurfürstlichen Kommission über die wirtschaftlichen Zustände nach dem Abzug der befeindeten Armeen aus der Region – die Schweden hielten bis ins Jahr 1637 ihr Feldlager bei Torgau, die Kaiserlichen bei Pretzsch und östlich der Elbe bei Clöden – ergab sich für Trebitz das folgende erschütternde Bild:
Anzahl der Bauerngüter vor 1638:
68
Landwirtschaftliche Güter im Jahr 1638:
8
Aussaat in Scheffeln vor 1638:
751
Aussaat in Scheffeln im Jahr 1638:
0
Da war es ein Segen für Land und Leute, als um 1760 ein aus Dresden zugezogenes Lehrerehepaar die Kunst des Strohhutflechtens ins verarmte Dorf brachte. Im Jahr 1789 waren es rund vierhundert Personen, die sich in Trebitz mit der Herstellung von Strohhüten befassten. Der Überlieferung zufolge sind Trebitzer Strohhüte bis zur Leipziger Messe, bis ins Brandenburgische und bis nach Niedersachsen geliefert worden.
Warum es meinen Großvater mütterlicherseits, der aus Anhalt stammte, der im reifen Mannesalter über Jahre hin als Betriebsleiter einer Ziegelei mit dem gewichtigen Namen „Maxhütte“ in Greudnitz wirkte, warum es ihn ins elf Kilometer entfernte Trebitz verschlug, weiß ich mit Bestimmtheit nicht zu sagen. Wahrscheinlich war es eine Wohnungsfrage nach Beendigung seiner beruflichen Tätigkeit infolge Invalidität.
Ich wurde halt am 10. Juni 1932 in Trebitz geboren, wurde aber doch kein richtiger Trebitzer, weil meine Eltern ein Vierteljahr später – Vater war ein echter Lutherstädter – eine Wohnung in Wittenberg fanden. Meinen Geburtsort besucht aber habe ich in den Kinderjahren sehr oft. Zum einen wohnten die Großeltern noch etliche Jahre dort, zum anderen behielten ein Bruder und eine Schwester meiner Mutter mit ihren Familien Wohnung im Haus, in dem einst die ersten Schreie von mir hallten.
Der Bruder, das war Onkel Franz, ein Spaßvogel und cleverer Bursche. Tag und Stunde weiß ich nicht genau zu sagen, doch gewiss war es im April des Jahres 1932, in dem die Nationalsozialisten sowohl bei der Reichspräsidenten- als auch bei der Landtagswahl in Preußen große Triumphe feierten. Eines Morgens wehte die Hakenkreuzfahne auf dem Trebitzer Kirchturm, doch das war nicht von langer Dauer. Auf Geheiß seines Vaters holte Onkel Franz sie herunter.
Mutters Schwester, die in Trebitz verblieb, Tante Lotte, heiratete einen Musiker, den Onkel Heinz. Unvergessliche Szene für mich, als er eines Tages, an dem wohl der Haussegen ein wenig schief hing, in meinem Beisein seine fünf „großen“ Töchter – die sechste war noch zu klein – am Klavier postierte, wie er in die Tasten hieb und meine fünf Cousinen aus voller Brust schmetterten: „Liebe Lotte, liebe Lotte, du bist ’ne tolle Motte…“
Unvergesslich aber auch, bald danach zu sehen, wie Onkel Heinz, der im Krieg schwere gesundheitliche Schäden davongetragen hatte, körperlich immer mehr verfiel. Er starb im Frühjahr 1945. Seine Beerdigung fand nur angedeutet mit militärischen Ehren statt. Der Ortsgruppenleiter der NSDAP nahm noch in voller Montur, jedoch schweigend daran teil. Ich, der Pimpf aus Wittenberg, der, als es sie noch in Fülle gab, die Sondermeldungen aus dem Radio begierig in sich aufgesogen hatte, der die Bilder von Ritterkreuzträgern wie einen Schatz bewahrte, ahnte an diesem Tag zum ersten Male etwas vom Wahnsinn kriegerischer Auseinandersetzungen und von den Unwiederbringlichkeiten in ihrem Gefolge.
Mein Geburtshaus in Trebitz steht nicht mehr. An seiner Stelle befindet sich das Wohnheim der Volkssolidarität „Am Schloss“. Großeltern, Tanten und Onkel leben nicht mehr. Von meinen insgesamt sieben Trebitzer Cousinen ist keine im Heimatort geblieben, doch ich radele auch im vorgerückten Alter gelegentlich noch gern durch Trebitz, durch mein „Städtlein“.
BEGEGNUNGEN IN ORTEN MIT DEM INITIAL A
AACHEN
Aachen, das alte römische Aquae Granni, Residenz Karl des Großen, Krönungsstadt deutscher Könige, 458 Jahre lang freie Reichsstadt – einem geschichtsinteressierten Schüler sagte das schon etwas.
Aachen jedoch kennenzulernen, daran war in der Kindheit nicht zu denken, ergab sich in jungen Jahren nicht und war dann jahrzehntelang so gut wie ausgeschlossen.
Zu Beginn der 90er Jahre erst bot sich für mich die Möglichkeit eines kurzen Besuches der Stadt, der jedoch seiner Kürze wegen die Wahrnehmung ihrer kulturellen Vielfalt kaum einzuschließen vermochte.
Das Ensemble des Mitteldeutschen Landestheaters Wittenberg – der Extra-Chor inbegriffen – gastierte mit Karl Millöckers Operette „Der Bettelstudent“ in Maastricht. Übernachtet wurde aber in Aachen. Die Aufführung gestaltete sich alles andere als erfolgreich. Kurzfristig waren einige Umbesetzungen erforderlich geworden, die der Aufführung wahrlich keinen zusätzlichen Glanz verliehen, und das Sächsisch von Ollendorf und Enterich war in den Niederlanden sicher auch keine Garantie für eine begeisterte Aufnahme des Stückes.
Ein Stimmungshoch war deshalb bei den Sängern und Orchestermusikern nicht zu verzeichnen, als sie sich am nächsten Morgen vor dem Hotel zur Abfahrt einfanden. Doch immer wieder ist es erstaunlich, mit welch geringen Mitteln – gewollt oder ungewollt – man Menschen eine Freude bereiten kann.
Der Busfahrer begrüßte aufgekratzt und fröhlich die Künstlerschar, wünschte, sich inbegriffen, allen eine gute Reise, und dahin ist er mit uns gefahren.
Bis kurz vor Düren waren wir bereits gekommen, als er die zum größten Teil noch schläfrigen Insassen übers Bordmikrophon mit kernigen Worten, die sogleich schallendes Gelächter erzeugten, aufrüttelte: „Achtung! Achtung! Hier ist das Wort zum Sonntag. Ich wende jetzt, aber keine Angst! Wir fahren nur zurück nach Aachen. Mein Koffer steht noch in der Empfangshalle des Hotels!“
AHLBECK
Der Feriendienst des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes war eine feine Sache. Das hat nichts mit Verklärung der DDR zu tun. Es war so. Aller zwei bis drei Jahre stand jedem Gewerkschaftsmitglied ein Ferienplatz zu, und das aus heutiger Sicht zu einem Spottpreis. Bei der Bahnmeisterei Wittenberg hatte man sogar die Chance, jedes Jahr einen Platz zu bekommen, was daran lag, dass viele Kollegen aus den umliegenden Dörfern einen „Morgen Wind ums Haus“ besaßen und deshalb im Urlaub lieber zu Hause blieben. Anders freilich lag die Sache bei den Ostseeplätzen. Die waren begehrt, und man musste schon Dusel haben, einen zu erwischen. Zeichen und Wunder gibt es eben doch. Im Jahr 1979 fand sich bei der Bahnmeisterei in Wittenberg für Ahlbeck kein Bewerber. Nach wohlwollendem und dringlichem Zureden der BGL-Vorsitzenden der Dienststelle – Irma und ich wollten nach Urlaubsreisen in den vergangenen drei Jahren eigentlich pausieren – nahm ich dann den Platz.
Die Anreise zum altbekannten Seebad Ahlbeck war strapaziös. Gegen Mitternacht mit dem Schnellzug, der diesen Namen kaum verdiente, ab Lutherstadt Wittenberg. Am frühen Morgen Umsteigen in Züssow, von dort aus weiter bis Wolgast Hafen, auf dem Bahnsteig dieses winzigen Bahnhofs ein Riesengedränge und dann zu Fuß, die schweren Koffer schleppend, die Brücke über den Peenestrom hinüber auf die Insel zum Bahnhof Wolgast Fähre.
Die Fahrt bis Ahlbeck, weithin durch die vielgestaltige Usedomer Landschaft, war einigermaßen angenehm, leerte sich doch der anfangs überfüllte Zug von Station zu Station zusehends. In Ahlbeck hieß es wieder: Koffer schleppen! Und als wir kurz vor Mittag unser Quartier endlich gefunden hatten, stellte es sich heraus, dass wir besser schon in Heringsdorf hätten aussteigen sollen. Der Weg wäre kürzer gewesen.
Eine bescheidene Unterkunft, zuvor einmal die Waschküche des Hauses, erwartete uns. Wir nahmen es gelassen. Da gab es viel kargere Quartiere an der Ostsee, und unsere Wirtin, eine Witwe im vorgerücktem Alter, war eine ganz Liebe, die uns wohl auch mochte, denn sie ließ es sich nicht nehmen, am Ende unseres Aufenthaltes die Koffer mit dem Handwagen zum Heringsdorfer Bahnhof zu kutschieren. Und Tränen flossen zum Abschied auch.
Die Urlaubstage waren schlicht und einfach schön. Bilderbuchwetter, das nicht nur zum Schmoren am Strand einlud, herrschte durchweg.
Natürlich nutzte Irma den Strandkorb ausgiebig, gern auch spielte ich mit dem kleinen Jungen einer alleinstehenden jungen Frau, deren Strandkorb neben dem unsrigen stand. Vico hieß er, ein Bengel, dem es – igitt – die Quallen angetan hatten, und selbstverständlich tummelte auch ich mich gelegentlich im Wasser.
Land und Leute jedoch wollten wir auch beschnuppern. Nach Świnoujście, der alten pommerschen Kreis- und Hafenstadt, einst Swinemünde geheißen, pilgerten wir zu Fuß.
Nach Usedom fuhren wir mit dem Bus, zwischen Mellenthin und genannter Stadt durch eine reizvolle Landschaft, die sehr an die heimatliche Dübener Heide erinnerte.
Etwas Einmaliges für mich aber gab es im Urlaubsort daselbst. Im großen Kurhaussaal gab das Musikkorps der Nationalen Volksarmee, Standort Eggesin, ein Konzert, in dessen Verlauf ein Stück aus vielen musikalischen Themen zusammengesetzt, sozusagen ein Pasticcio der Unterhaltungsmusik, gespielt wurde. Die Anzahl dieser Themen sollte vom Publikum herausgehört beziehungsweise erraten werden. Dem Sieger dieser musikalischen Quizrunde winkte ein zuvor ungenannter Preis.
Ich zählte fleißig mit, kam, wenn ich mich recht erinnere bis zur Zahl 48 und gewann. Was aber war der Preis? Der Conférencier in Uniform machte es spannend, verkündete erst nach einigem Hin und Her, ich dürfe nun den Taktstock übernehmen und den Yorck’schen Marsch von Ludwig van Beethoven dirigieren.
Eine Kollegin von Irma, die, was wir nicht wussten, ebenfalls im Konzert saß, sagte zu ihrem Mann, als ich erfreut zur Bühne marschierte: „Das ist der Herr Rühlicke. Der kann das.“
Nun, ich konnte es wirklich, hatte diebischen Spaß dabei. Während der Beifall noch rauschte, trat der Kapellmeister von der Seitengasse her auf mich zu und flüsterte mir ins Ohr: „Das haben Sie doch nicht zum ersten Mal gemacht.“ Ob ich vielleicht doch hätte Musiker werden sollen?
Wenig später, am ersten Arbeitstag nach dem Urlaub erhielt ich den Anruf eines Kollegen von der Reichsbahndirektion Halle, der mich auf die Schippe nehmen wollte, indem er behauptete, er habe von meinem Dirigat im „Neuen Deutschland“ gelesen.
Na, dann Prost!
ALTENBURG
Im Jahr 1990, als die politischen Bezirke der Deutschen Demokratischen Republik in die sogenannten neuen Länder der Bundesrepublik Deutschland aufgingen, wunderte ich mich, Altenburg innerhalb der Grenzen des Freistaates Thüringen wiederzufinden.
Mit der Geschichte dieser Stadt hatte ich mich bis dahin kaum befasst, wusste aber sehr wohl von ihrer vormaligen Zugehörigkeit zum Bezirk Leipzig. Meine Aufenthalte in Altenburg waren recht einseitiger Natur geblieben. Neben vielen anderen, vor allem bedeutenderen kulturellen Einrichtungen, gab es in der ehemaligen Residenzstadt auch ein Kulturhaus der Eisenbahner, in dem hin und wieder auch die Kommission Kultur, Bildung und Sport der Bezirksgewerkschaftsleitung, der ich längere Zeit angehörte, ihre Arbeitsbesprechungen durchführte. Das Haus befand sich weit draußen im Nordosten der Stadt, und diese abseitige Lage dürfte seinem Spitznamen eher förderlich als abträglich gewesen sein. Als Kommissionsmitglied kam der mir nie zu Ohren. Eine echte Altenburgerin, die es in die Lutherstadt verschlagen hatte, verriet mir eines Tages treuherzig, die überwiegende Anzahl der Bürger spräche nur vom „Schaumhaus“. Inwieweit vielleicht auch Häme und Böswilligkeit zu solcher Bezeichnung geführt haben, vermag ich nicht einzuschätzen. Nach meinem Wissen und Dafürhalten ist im Kulturhaus der Eisenbahner Altenburg seinerzeit gute kulturelle Arbeit geleistet worden.
Einmal aber bin ich in Altenburg doch in die Stadt gelangt, habe das Spielkartenmuseum besucht, in dem Karten aus sechs Jahrhunderten in Originalen und Nachdrucken zu sehen sind, habe Schloss und Schlosskirche besichtigt, währenddessen zu meinem Bedauern die Barockorgel des bedeutenden Thüringer Orgelbaumeisters Heinrich Gottfried Trost allerdings nicht erklang.
Dass Altenburg im Jahr 1990 zu Thüringen wollte – jetzt weiß ich es –, das war so abwegig nicht. Kaiser Friedrich I. (Barbarossa) hatte einst Pfalz und Stadt Altenburg zum Mittelpunkt des Pleißenlandes erhoben, doch nach dem Aussterben der ersten Dynastie der Herzöge von Sachsen-Altenburg (1603–1672) wurde das Herzogtum mit dem von Sachsen-Gotha im Thüringischen vereinigt. Erst von 1826–1918 gab es wieder ein eigenständiges Herzogtum Sachsen-Altenburg, dessen Territorium danach aufs Neue an Thüringen fiel. Die 38jährige Zugehörigkeit zum sächsischen Bezirk Leipzig war für Altenburg gewiss nur eine politisch motivierte, ungewollte Episode.
ANNABERG-BUCHHOLZ
Im vorletzten DDR-Sommer führte die Chorreise der Wittenberger Kantorei hinauf ins Erzgebirge bis nach Annaberg-Buchholz. Einen Reisebus konnte der VEB Kraftverkehr nicht stellen, aber ein Gliederbus, im Volksmund „Schlenki“ genannt, tat es schließlich auch. Freilich, ein wenig abenteuerlich war das schon, und die erste Hudelei gab es bereits in der Gegend von Wurzen, wo eine Umleitung schlecht ausgeschildert war. Der Busfahrer verfranzte sich gründlich. Um überhaupt wieder auf eine richtige Straße zu gelangen, musste er mit seinem Ungetüm in einer großen Schleife über einen Stoppelacker hoppeln. Bis nach Wiesa, einem Nachbarort von Annaberg-Buchholz, der erster Anlaufpunkt war, kamen wir, nicht allzu flott, doch immerhin sicher. Dann passierte Ärgeres. Kurz vor der Anfahrt zur Kirche musste der Schlenki eine enge Rechtskurve nehmen. Das war zu viel. Ein backsteingemauerter Torpfosten stand im Weg. Ein tüchtiger Bums, ein heftiges Ratschen entlang der Stelle, wo ich in der Ecke allein auf der hinteren Bankreihe saß. Ich wurde nur ein wenig durchgeschüttelt. Den Bus aber zierte eine prächtige Schmarre. Der Pfosten stand nicht mehr. Was nun? Es war weniger tragisch als angenommen.
„Wenn ihr ihn wieder hochmauert, ist das kein Problem“, bedeutete man uns, „die LPG schafft das mindestens alle Vierteljahre ein Mal.“
In Wiesa bekamen nur einige Chormitglieder Quartier. Die anderen kutschierte der leicht lädierte Bus hinein in die Kreisstadt.
Sangesbruder Volkmar vom Bass und ich wohnten für zwei Tage in einem Pfarrhaus, wenn ich mich recht erinnere im Stadtteil Annaberg.
Die Städte Annaberg und Buchholz wurden erst im Jahr 1945 vereinigt. Gegründet worden waren sie beide zu gleicher Zeit anno 1497, Annaberg als Bergstadt, Buchholz als Bergbausiedlung.
Die heutige Doppelstadt mit den zwei Stadtwappen hat als kulturelles Zentrum des Osterzgebirges viel zu bieten. Da gibt es das Erzgebirgsmuseum mit seinen bedeutenden kulturhistorischen und naturkundlichen Exponaten. Da lädt das Eduardvon-Winterstein-Theater, welches auch in Zeiten der Sozialen Marktwirtschaft bislang überlebt hat, zum Besuch ein. Touristische Anziehungspunkte sind die Berg- und die berühmte spätgotische Hallenkirche St. Annen mit der „schönen Tür“ von Hans Witten.
Ihrem weltbekannten Bürger Adam Ries hat die Stadt ein Denkmal gesetzt, und nicht vergessen sei das Technische Museum Frohnauer Hammer, dessen Hammerwerk bereits 1620 in Betrieb genommen wurde, dessen jetzige Funktionstüchtigkeit, wie uns der Hammer-Hansel, heimatliche Gefühle in uns erweckend, erzählte, ein Eichenstamm aus dem Wittenberger Propsteiwald garantiert.
ANNABURG
Wie durch Pflege von Parodien Bedeutungen verwischt werden und Ursprünge in Vergessenheit geraten können, zeigt eine Sitte, die in meinen jüngeren Jahren noch weit verbreitet war, und die sicher auch heute noch hier und da, dann und wann gepflegt werden wird, die Sitte – oder doch besser die Unsitte – des Stiefeltrinkens.
Lauthalse Zecher lassen zu vorgerückter Stunden einen mehr oder minder mächtigen biergefüllten gläsernen Stiefel kreisen, artikulieren dazu den Singsang „Stiefel muss sterben, ist noch so jung, jung, jung“, und derjenige, der zwangsläufig den letzten Schluck nehmen muss, darf die nächste Füllung des Gefäßes berappen. Nein, mit einem geformten Seidel voller Gerstensaft hat dieser Spottvers nichts zu tun. Gemünzt wurde er von Wittenberger Studenten auf den Lochauer Pfarrer Michael Stifel, der in seiner Schrift „Ein Rechenbüchlein vom Endchrist, Apokalypsis in Apokalypsim“ den Tag des Jüngsten Gerichtes für Sonntag, den 19. Oktober 1533, acht Uhr, verkündet hatte, und der, als das vorherberechnete Geschehnis ausblieb, vor wütender Menschenmenge in Lochau geschützt werden musste, anschließend in Wittenberg zu seiner Sicherheit einen vierwöchigen Hausarrest verordnet bekam. Lochau, so hieß seinerzeit das heutige, im Kreis Wittenberg gelegene Städtchen Annaburg. Gewirkt hat dort nicht nur solch eine Geistesgröße wie Michael Stifel es war – er ist immerhin der bedeutendste deutsche Algebraiker des 16. Jahrhunderts und hatte in seinen letzten Lebensjahren an der Jenaer Universität den Lehrstuhl für Mathematik inne –, denn Lochau besaß und Annaburg besitzt noch heute ein Schloss.
Die erste urkundliche Erwähnung Lochaus entstammt einem Erlass des Askanier-Herzogs Rudolf I., den er im Jahr 1339 zur Zeit einer Hofhaltung im benachbarten Prettin ergehen ließ. Das Lochauer Schloss wurde im Jahr 1450 zum ersten Mal als solches bezeichnet. Der Wettiner Kurfürst Friedrich III. mit dem Zunamen der Weise ließ es grundlegend erneuern. Seine Jagdleidenschaft und Kulturliebe dürften dafür ausschlaggebend gewesen sein. Am 5. Mai 1525 verstarb er auf seinem Lieblingsschloss, der Lochau, das in den folgenden Jahren im Zusammenhang mit den Wirrnissen der Zeit zusehends verfiel.
Das sächsische Kurfürstenehepaar August I. und seine Gemahlin Anna, die Tochter des dänischen Königs Christian III., waren es dann, die den Abbruch des Schlosses veranlassten und an gleicher Stelle ein neues errichten ließen. Dieses wurde am 11. Januar 1573 erstmals Annaburg genannt. Im Laufe der Jahre übertrug sich dieser Name auch auf Lochau. Das Schloss hat – namentlich im Dreißigjährigen Krieg – manchen Sturm überdauert und bot, als im Jahr 1762 das „Versorgungswerk für arme Soldatenknaben“ von Dresden nach dorthin verlegt wurde, sicher keinen bestechenden Anblick. Sein Fortbestehen aber war mit dieser Übersiedlung gesichert. Menschen unterschiedlichster Herkunft und Nationalität hat es in der Folgezeit beherbergt.
Nach Liquidierung der Unteroffiziersschule am 10. März 1920 und der Auflösung des „Militär-Knaben-Erziehungs-Institutes“ im Jahr 1921 fanden Annaburger Familien Unterkunft im Schloss. Anno 1926 etablierte sich ein Landschulheim und ab 1936 nutzten Angehörige der Gruppe 144 des Reichsarbeitsdienstes Räumlichkeiten des Schlosses. Mancherlei – bis zur Gegenwart hin – bliebe aufzuzählen, nur ein Kapitel sei noch erwähnt.
Im Jahr 1942 wurde im Annaburger Schloss aus den Reihen dort untergebrachter Kriegsgefangener die „Indische Fremdenlegion“ gebildet. Angehörige dieser Legion bekamen dann in der Wittenberger Flak-Kaserne ihre Ausbildung, und ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie meine Brüder und ich dümmlich feixten, als wir sie in deutscher Uniform mit dem Turban auf dem Kopf, kehligen Lautes singend durch die Große Friedrichstraße marschieren sahen.
In späteren Jahren hätte ich wohl wissen wollen, was aus ihnen geworden ist, die in solch gegensätzlicher Weise von fremden Machthabern für deren Zwecke missbraucht wurden.
Mein erster Besuch Annaburgs liegt weit zurück. Er fand in frühen Kindheitstagen statt. Vorfreude und gespannte Erwartung bewegten mich da sicher sehr, denn die Reise führte in ein richtiges Schloss, dorthin, wo Tante Hedwig wohnte. Diese liebe Hedwig Wallner war keine richtige Tante, sondern eine Jugendfreundin meiner Mutter. Die Freundschaft der beiden hat bis zum Tod der einen, dem meiner Mutter, gehalten, und so weilte denn auch ich immer wieder einmal in Annaburg. An die erste Fahrt dahin nach dem Krieg habe ich später als Eisenbahner fast ungläubig denken müssen. Sie erfolgte wegen restloser Überfüllung des Zuges auf dem Trittbrett eines Wagens der Dritten Klasse und das bei einer Entfernung Wittenberg– Annaburg von 31 Kilometern.
In Mannesjahren war ich seltener in der Stadt. Einmal zu einem Chorkonzert der Wittenberger Kantorei, nach dessen Beendigung Kundigen die Jagdleidenschaft der Kurfürsten Friedrich und August in Erinnerung gekommen sein dürfte, denn der gesamte Chor wurde mit Hasenbraten bewirtet.
Zu weiteren Malen hatte ich dienstlich als Eisenbahner dort zu tun, zu Zeiten, in denen die Bahnmeisterei Annaburg unter ihrem letzten Leiter, Helmut Dreke, noch existierte.
Ja, und nach der Jahrtausendwende sind Irma und ich im Verlauf einer Spritztour nach Annaburg auf dem schönen weiten Schlosshof doch tatsächlich einem Schlossbewohner begegnet, der noch von Tante Hedwig zu erzählen wusste.
APOLDA
An der Eisenbahnstrecke Halle–Erfurt, gelegen zwischen Naumburg und Weimar, gibt es eine weitere Mittelstadt mit mehr als 20 000 Einwohnern. Das wusste ich schon in jungen Jahren als ein sich der Erdkunde emsig befleißigender Volksschüler. Meine Kenntnisse über Apolda, über eine Stadt, die immerhin schon 39 Jahre vor der ersten Erwähnung Wittenbergs als solche bezeichnet wurde, waren damit freilich bereits erschöpft. Anschaulich erweitert werden können hätte dieses magere Wissen in den 70er Jahren. Die Rückfahrt einer Chorreise der Wittenberger Kantorei nämlich wurde in der Kreisstadt am Ortsrand des Thüringer Beckens unterbrochen. Kurzfristig vorgesehen worden war ein Besuch des Museums für Glockenkunde. Bei der Absicht jedoch blieb es, musste es bleiben. Laut Kalender war Montag, ein Wochentag, an dem – für uns alle jedoch überraschend – kaum ein Museum in der DDR geöffnet hatte.
Kurze Zeit bin ich allein ein wenig durch die Stadt geschlendert. Zu einer wesentlichen Erweiterung meiner Apolda-Kenntnisse hat das aber nicht geführt.
ARENDSEE
„Auge der Altmark“ hat man ihn genannt, nennt man ihn gelegentlich noch heute. Er ist der größte natürliche See im Bundesland Sachsen-Anhalt, bedeckt eine Fläche von 5,42 km2 und ist mit 49,5 m der tiefste zwischen Rhein und Elbe. Sein Wasserspiegel liegt indes nur 29 m über Meereshöhe. Gespeist wird der See von klaren Quellen und kleinen Wasserläufen. Überflüssiges Wasser wird zur Jeetze abgeleitet, zu dem Flüsschen, das bei Hitzacker in die Elbe mündet.
Der Luftkurort, der sich schlank am süd-südöstlichen Ufer erstreckt, trägt in seinem Kern den Charakter eines Landstädtchens, was seinem Reiz durchaus keinen Abbruch tut. Den Namen Arendsee führen sowohl das Gewässer als auch die kleine Stadt mit ihren zirka 4 000 Einwohnern. In bescheidenem Maße kennengelernt habe ich beide – wie so viele Orte und manche Gegend – beim Kurzaufenthalt anlässlich eines Chorkonzertes. Der Name der Kirche, in der wir vor vielen Jahren an einem durch Prasselregen gesegneten Augustabend gesungen haben, ist mir allerdings längst entfallen.
Ein paar Stunden zur freien Verfügung hatten wir am noch trockenen Nachmittag jenes Tages. Bis ans Südufer sind wir gelangt, aber zu einem Rundgang um den See, an dessen nordöstlichem Ufer, wie uns ältere Gemeindemitglieder erzählten, um die Wende zum 20. Jahrhundert noch Bernstein gefunden wurde, konnte niemand von den Sängerinnen und Sängern sich aufraffen.
Und Spuren des radikalen Lebensreformers Gustav Nagel (28.3.1874–15.1.1952) zu suchen, der in Arendsee einst die Freikörperkulturanlage „Paradiesgarten“ schuf und mit der von ihm gegründeten und programmatisch auf den Mittelstand zielenden „deutsch-kristlichen folkspartei“ zu den Reichstagswahlen im Dezember 1924 und Mai 1928 antrat, insgesamt mehr als 6 000 Stimmen, aber kein Mandat erhielt – das war nicht jedermanns Sache und wäre in Anbetracht der kärglich bemessenen Zeit sicher ohnehin vergebene Liebesmüh gewesen.
Mag an dieser Stelle ein Zitat aus dem Programm seiner Partei an ihn erinnern und zu einem Besuch Arendsees verlocken:
Nichts ist das elektrische Licht
gegen der Sonne Licht;
menschliches Erbarmen ist eng begrenzt,
Kristi Erbarmen ist tiefer wie das Meer.
ARNSDORF
Arnsdorf im Lausitzer Bergland, an der Eisenbahnstrecke Dresden–Bautzen gelegen, nur einmal war ich dort. Mehr als ein halbes Menschenalter ist seitdem vergangen. Bildgetreu vorstellen kann ich mir indes noch die Schule sowie eine Gaststätte in der Nähe des Sportplatzes, auf dem – aber der Reihe nach.
Der Krieg ging ins sechste Jahr. Vater arbeitete in der Rüstungsindustrie bei der WASAG, Werk Reinsdorf, hatte sicher geglaubt, er könne die schlimmen Jahre als Zivilist überstehen. Vergebliche Hoffnung. Im Oktober 1944, kurz vor seinem 37. Geburtstag, flatterte der stumme Betroffenheit auslösende Einberufungsbefehl ins Haus. Gestellung in Sachsen.
Wochen später, sicher nach der Vereidigung auf Führer, Volk und Vaterland dürfte das gewesen sein, eine Nachricht, die Mutter in freudige Erregung versetzte. Vater schrieb, die Ehefrauen könnten nun ihre Männer am derzeitigen Standort in Wittichenau besuchen. Mutter besprach sich eilends mit Frau Mücke, einer unweit wohnenden Friedrichstädterin, deren Mann in der gleichen Einheit wie Vater war. Ergebnis: Mückes Hans, ein Klassenkamerad von meinem Bruder Dieter, und ich durften mit. Spannung erregend war dies für mich in zweierlei Hinsicht, zum einen Vater als Soldat zu sehen, zum anderen die lange Reise. Bislang war ich über Halle an der Saale nicht hinausgekommen, kannte ansonsten nur etliche Bahnkilometer in Wittenbergs weiterer Umgebung.
Die Reise verlief anfangs ohne Besonderheiten. Wälder, Felder und Wiesen in stetem Wechsel, doch ein Fensterplatz war allemal etwas wert. In Hoyerswerda umsteigen, noch wenige Kilometer bis Wittichenau und dann das Unfassbare: die Soldaten befanden sich nicht mehr in der kleinen Stadt am Oberlauf der Schwarzen Elster. Sie waren, wie uns gleich auf dem Bahnhof von einem Eisenbahner mitgeteilt wurde, in einer plötzlichen Nacht- und Nebelaktion nach Arnsdorf verlegt worden.
Was tun? Die Frage erübrigte sich. Eine stattliche Gruppe enttäuschter Soldatenfrauen mit etlichen Kindern – die Wittenberger waren nicht mehr allein – brach mit dem nächsten Zug in Richtung Arnsdorf auf.
In den späten Abendstunden kamen wir bis Bautzen, und mit dem letzten Zug des sich neigenden Tages gelangten wir in tiefer Nacht ans Ziel.
Was tun? Das war nun doch eine Frage. Auf dem Bahnhof durften wir nicht bleiben, der wurde abgeschlossen. Erregter Disput. Der Bahnbeamte zuckte lediglich mit den Schultern. Dann jählings eine Idee: Wir gehen zur Schule, in Klassenräumen ist genug Platz für provisorische Unterkunft. Es dauerte, bis der Hausmeister aus dem Schlaf getrommelt war. Ihn zu überzeugen dauerte nicht weniger lange. Am Ende stand der Erfolg. Wir brauchten die halbe Nacht nicht auf der Straße verbringen.
Am Morgen mussten wird die Schule zeitig verlassen. Wo die Soldaten ihre Unterkunft hatten, und in welcher Stunde ich Vater das erste Mal zu Gesicht bekam, weiß ich nicht mehr, wohl aber sind mir die inständigen Bitten der Ehefrauen, ihre Männer an diesem Tag vom Dienst zu befreien, noch im Gehör. Sie stießen auf taube Ohren. Nicht die geringste zeitliche Verkürzung gab es. Den ganzen Tag über wurde die Truppe auf dem Sportplatz gedrillt. Wir Kinder schauten zu. Von heldenhafter Begeisterung habe ich in Vaters Miene nichts entdecken können. Nur verbissener Trotz spiegelte sich unter dem Stahlhelm wider. Erst zu sehr später Stunde – wir hatten Übernachtungsmöglichkeit im Gasthaus gefunden – durften die Männer zu ihren Frauen.
Hans und ich wurden da verständlicherweise recht bald aufgefordert, unsere Schlafstätte, ein schmales Bett aufzusuchen, das in einer dürftigen Dachkammer stand und für uns beide ausersehen war. Geschlafen aber haben wir deshalb noch lange nicht. Gesungen, lauthals gesungen haben wir, konnten dies auch nach Bitte um Ruhe so schnell nicht lassen.
Vater habe ich an jenem Abend für lange Zeit zum letzten Mal gesehen. Er musste noch zweimal die Truppengattung wechseln, kam aus unerklärlichen Gründen nach Lauterbach auf Rügen zur Seepolizei (schrieb von dort in einem seiner letzten Briefe, er habe die schmucke Uniform infolge Erkrankung nicht ein einziges Mal tragen können) und wurde kurz vor dem endgültigen Zusammenbruch des Großdeutschen Reiches in Waffen-SS-Uniform an die Front geschickt, wo er in der Gegend von Peitz, nördlich von Cottbus, in Kriegsgefangenschaft geriet, aus der er erst im Juli 1947 zurückkehrte.
ARNSTADT
Städte, in denen Johann Sebastian Bach lebte, wirkte oder kurzzeitig nur weilte, tun sich alle darauf etwas zugute. Allen voran, und das mit Fug und Recht, stehen Leipzig, Köthen und Eisenach. Lüneburg, Weimar, Mühlhausen und das kleine Städtchen Ohrdruf zum Beispiel sind den Liebhabern Bach’scher Musik wohl bekannt, kommen einem aber nicht so flugs in den Sinn, wenn es um die größte der musikalischen Größen geht. Bachstädte sind sie allemal, und dazu gehört selbstverständlich auch Arnstadt, obwohl dies gelegentlich mit einer gelinden Überraschung wahrgenommen wird. Dabei trägt dieses mehr als 1 300 Jahre alte Gemeinwesen die Bezeichnung Bachstadt im erweiterten Sinn viel eher zu Recht als all die weiteren.
In Arnstadt sind 17 Bachs zur Welt gekommen, 25 haben sie dort wieder verlassen. Geboren wurden hier – um einige Namen zu nennen – die hervorragenden Komponisten Johann Christoph und Johann Michael Bach. Heinrich sowie Johann Ernst Bach wirkten als Organisten an der Oberkirche, und Christoph Bach, der Großvater von Johann Sebastian, kam im Jahr 1654 als Hofmusiker ans Schloss und war daneben als Stadtmusikus tätig.
Was den späteren Thomaskantor anbelangt – Arnstadt war nicht so unbedingt sein Fall. Auf meisterliche Art weiß Hans Franck in seiner Novelle „Die Pilgerfahrt nach Lübeck“ davon zu erzählen. Die ihnen gegenüber einst an den Tag gelegte Unbotmäßigkeit freilich hatten die Arnstädter dem Johann Sebastian längst verziehen, als sie ihm zum 300. Geburtstag mitten auf dem Markt ein Denkmal errichteten, geschaffen vom Hallenser Bildhauer Bernd Göbel.
Mit Bach und seiner kaum überschaubaren weitläufigen Verwandtschaft erschöpft sich Kultur in Arnstadt natürlich nicht. Da gibt es das liebenswert-eindrucksvolle, im Schlossmuseum aufgestellte Puppenhaus „Mon Plaisir“ der Fürstin Augusta Dorothea von Schwarzburg-Arnstadt, das wahrlich – ich gestehe es – nicht nur Kinder in helle Begeisterung zu versetzen vermag, und – immerhin – auch E. Marlitt, eigentlich Eugenie John (1825–1887), deren Unterhaltungsromane noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts viel gelesen wurden, war eine echte Arnstädter Tochter.
Was mir an der kleinen ehemaligen Residenzstadt ganz besonders gefällt, ist das nie erlahmte Bemühen seiner Bürger, ihr bereits im Jahr 1841 gegründetes Theater zu erhalten und damit kulturellem Leben stets aufs Neue Raum gegeben zu haben. Am 1. September 1995 wurde es nach siebenjähriger Pause und gründlicher Rekonstruktion wohl schöner denn je wiedereröffnet.
Auf der Bühne des „Theater im Schlossgarten“ habe ich in den folgenden Jahren als Extra-Chormitglied des Mitteldeutschen Landestheaters etliche Male singen und spielen dürfen. Gern entsinne ich mich einer Aufführung des Musicals „Hello, Dolly!“ von Jerry Herman, die am 2. Mai 1997 stattfand, bei der ich das schmucke Haus kennenlernte.
Eine Überraschung freilich erlebten damals die Altistin Barbara Schubart, Gattin des langjährigen Wittenberger Musikalischen Oberleiters Klaus Hofmann, der Tenor Hans Nikstat und ich, als wir feststellen mussten, dass die Arnstädter „Bretter“ eine erhebliche Neigung besaßen. In der Straßenparade-Szene hatten Hans und ich die auf einem fahrbaren hölzernen Podest stehende „Freiheitsstatue Barbara Schubart“ von Hand und dabei kräftig singend bis an die Rampe zu rollen.
Schreck, lass nach! Notgedrungen haben wir das Ganze kurz geprobt und hernach – toi, toi, toi – die Szene nicht geschmissen.
ASCHERSLEBEN
Die älteste in Sachsen-Anhalt sei sie, die Stadt am Flüsschen Eine, liest man gelegentlich. Dies ist nur bedingt richtig. Das Stadtrecht bekam Aschersleben erst im Jahre 1266, später als manch andere Kommune im Land. Wohl aber ist der Name Ascegeresleve bereits um 750 auf einer Schenkungsurkunde zu finden, und vor 827 wurde eine St. Stephanikirche gestiftet. Sollte Bausubstanz davon erhalten und in die gotische Stadtkirche St. Stephanie (1406–1506 errichtet) einbezogen worden sein, dann wissen das sicher die Experten.
Die geschichtsträchtige Altstadt von Aschersleben mit ihren zahlreichen Baudenkmälern und Sehenswürdigkeiten lernte ich nie so richtig kennen. Mit meinen Kollegen vom Bauzug 1201 habe ich 1963, als wir in Magdeburg abgestellt waren, zwischen Aschersleben und Frose Gleisbauarbeiten durchgeführt. Tagtäglich wurden wir mit dem Bus bis zum Ascherslebener Bahnhof transportiert. Für eine Stadtbesichtigung blieb da in der Regel keine Zeit. Nur einmal, das Arbeitspensum war überraschend schnell geschafft worden, wagte ich ein paar Schritte weg vom Reichsbahngelände, indes viele der Kollegen die Gelegenheit nutzten, in der Mitropa-Gaststätte ausgiebig ihren Durst zu löschen.
Während der Rückfahrt nach Magdeburg geriet einer der gewaltig Durstigen in eine Situation, die ich ihrer Kuriosität wegen nicht verschweigen möchte. Wie viele Biere mochte er getrunken haben? In der Gegend von Egeln kam er jedoch in arge Bedrängnis. Den Bus aber konnte er nicht zum Halten bringen. Wir saßen im Anhänger – so etwas gab es damals noch – und die Klingel zum Fahrer war defekt. Der Ärmste schwitzte Blut und Wasser. „Ich mach’ einen Knoten rein“, stöhnte er qualvoll, und da konnten es einige nicht mehr mit ansehen. Sie rissen die Tür auf, kräftige Arme hielten ihn von hinten umklammert, und er konnte sich während der Fahrt erleichtern. Das war im Herbst 1963.
Wieder nach Aschersleben gekommen bin ich erst viele Jahre später und da auch nur in die entlegenste Ecke der Stadt. Mit dem Ensemble des Wittenberger Theaters gastierte ich als Extra-Chor-Sänger sowohl vor als auch nach der politischen Wende auf der stattlichen Bühne der Polizeischule. Äußerlich verändert hatte sich dort für uns Anfang der 90er Jahre nicht viel. Die Uniformen sahen anders aus und wir gelangten rascher ins Objekt.
Leicht irritierend bei einem Bummel im benachbarten Wohngebiet die Feststellung: Straßennamen aus DDR-Zeiten, wie etwa Dr.-Richard-Sorge-Straße, die anderswo längst getilgt waren, prangten hier in alter Vertrautheit und Würde.
ASELEBEN
Das kleine Dorf Aseleben – nunmehr Ortsteil der Einheitsgemeinde Seegebiet Mansfelder Land – liegt zwischen Halle und Lutherstadt Eisleben unmittelbar am Südufer des sich fünf Kilometer in grob gesagt west-östlicher Richtung erstreckenden Süßen Sees, dessen Name im Grund irreführend ist. Sein Wasser ist nicht süß, sondern salzig, was durch seine Lage in einem Einsturzbecken des Buntsandsteins und der Auslaugung unterlagernder Zechsteinsalze bedingt ist. Der Salzgehalt des Süßen Sees war und ist nur nicht so stark wie der des ehemals benachbarten Salzigen Sees, dessen Wässer zu Ende des
19. Jahrhunderts in die Stollen des Mansfelder Kupferschieferbergbaues drangen, der deshalb im Jahr 1893 mit enormem Aufwand leergepumpt wurde, wonach in zwei kleinen tief gelegenen Senkungen nur der Kerrner- und der Bindersee verblieben. Neben der touristisch bedeutsamen Lage am See kann Aseleben auf eine weitere Besonderheit verweisen, auf das Naturschutzgebiet „Salzwiesen bei Aseleben“, wo neben anderen solche Pflanzen wie Salzschwaden und Salzastern gedeihen.
Im Frühjahr 1954 – ich arbeitete nach Abbruch des Theologiestudiums erneut auf dem Fortschrittschacht Eisleben als Fördermann vor Streb unter Tage – wurde unserer Brigade ein neuer Arbeitskollege zugeteilt. Er hießt Otto, war gelernter Frisör und wohnte in Aseleben. Wir fanden beide schnell zueinander, und eines Tages im Sommer lud er mich zu einem Besuch in Aseleben ein. Ich folgte der Einladung gern, lernte seine Gattin und das Töchterchen, lernte Aseleben und den Süßen See kennen.
Von der Klugheit, der Umsicht und dem Geschick des „Schewwern“ aus 900 Meter Tiefe zu Tage fördernden Frisörs konnte ich mich fast täglich überzeugen, doch zu sehen, was er ansonsten für Neigungen besaß, was er mit seinen zahlreichen Fertigkeiten zuwege bringen vermochte, das war umwerfend, war wohl anfass-, jedoch kaum fassbar.
Voller Stolz – weshalb auch nicht – führte er mich durchs gemeinsam mit seinem Vater Stein auf Stein errichtete schmucke Eigenheim. Die Möbel in den Wohnräumen hatte er zum überwiegenden Teil selbst getischlert, und farbenfrohe Ölgemälde an den Wänden natürlich selbst gemalt. Den Kuchen für die Kaffeetafel, nein, den hatte seine Frau gebacken, doch als wir nach dem Kaffeetrinken gemeinsam mit ihr ans Wasser spazierten, er auf ein strahlend weißes Segelboot weisend sagte: „Jetzt fahr’n wir übern See“, und ich es mir nicht verkneifen konnte zu entgegnen: „Und das stolze Flaggschiff dort hast du selbstverständlich auch allein gebaut“, da antwortete er nur knapp und treuherzig: „Ja, habe ich.“ Unnötig zu betonen, dass der vollmundige Hagebuttenwein, den Otto nach dem Segeltörn kredenzte, sein eigenes Produkt war.
Die Zeit verging in Aseleben wie im Fluge, und weil der letzte Bus plötzlich verpasst war, fuhr mein Gastgeber, der ja am nächsten Morgen auch zeitig aus den Federn musste, mich mit seinem Leichtmotorrad, das gar keinen Soziussitz besaß, wenigstens bis an die Eislebener Stadtgrenze.
Mit Beendigung meiner Tätigkeit im Kupferschieferbergbau nach einem Jahr brach auch unsere Verbindung ab. Eine Balladensammlung, die er sich von mir ausgeliehen hatte – war er doch auch literaturbeflissen –, die hat er mir noch treu und redlich nach Wittenberg zurückgesandt.
BEGEGNUNGEN IN ORTEN MIT DEM INITIAL B
BAD BENTHEIM
„Herrgott von Bentheim!“ – bis in süddeutsche Lande hin sollen diese Worte einst als Ausruf der Verwunderung gebräuchlich gewesen sein. Den Umweg über Mitteldeutschland haben sie dabei wohl nicht vollzogen, denn Bentheim, diesen Namen habe ich erstmals im jungen Mannesalter vernommen, als Freund Werner nach seinem Weggang aus Wittenberg und längerer Odyssee durch die Bundesrepublik in der kleinen Stadt des Landkreises Grafschaft Bentheim sesshaft geworden war.
Vom realen „Herrgott von Bentheim“, dem Sandsteinbildwerk aus dem 11. Jahrhundert, das auf dem Hof des Bentheimer Schlosses steht, habe ich da freilich noch immer nichts gewusst; doch dann kam die sogenannte Wende, und unsere erste Reise gen Westen führte im März des Jahres 1990 nach Bad Bentheim.
Sohn Raimund hatte vom Steinfurter Frühjahrsmarathon gelesen, wollte ihn gern laufen.
„Vater“, sagte er, „dieses Steinfurt liegt nicht weit von Bad Bentheim entfernt. Wohnt dort nicht dein Freund? Frag doch mal an, ob ich bei ihm übernachten kann.“
Nun, nicht nur er konnte, Schwiegertochter Birgit sowie Irma und ich konnten desgleichen. Werner und seine liebe Erika freuten sich auf unser Kommen.
Frühzeitig am Vortag des Rennens begann die Reise in Raimunds unverwüstlichem Trabant. Es folgte eine lange, Neues im Zeitraffer vermittelnde Tour. In welchem Tempo, nachdem wir Helmstedt passiert hatten, die gleißenden Westwagen an uns vorbeirauschten, das war schon beeindruckend, und eines wurde, je weiter wir uns von der DDR entfernten, immer augenscheinlicher: Die Anzahl der Trabis auf der Autobahn schrumpfte zusehends.
In Steinfurt dann, wo Raimund die Formalitäten für seinen Start am folgenden Tag erledigte, gab es einen gehörigen Schreck zu verkraften. Unweit von uns, die wir auf Raimund warteten, erhob sich eine Rauchwolke, und kurz darauf hieß es, ein Trabi sei in Brand gesteckt worden. Nein, Raimunds war es glücklicherweise nicht. Wir konnten die Fahrt fortsetzen.
Und dann, ich weiß nicht mehr zu sagen, ob es bereits in Ochtrup oder erst am Zielort war – Herrgott von Bentheim! –, stand da doch ein Trabi auf dem Dach eines Autohauses.
Den Marathonlauf übrigens bewältigte Raimund in einer recht ordentlichen Zeit. Bei seinem ersten Zieleinlauf in westlichen Gefilden war laut über eine große Zuschauermenge hin zu hören: „Raimund Rühlicke, BSG Grün-Weiß Piesteritz“ – das war schon einigermaßen bewegend.
BAD DÜBEN
Einem erklecklichen mitteldeutschen Gebiet hat die kleine Stadt ihren Namen gegeben, der Dübener Heide. Nierenförmig breitet sich diese sandige, reich bewaldete Endmoränen-Landschaft zwischen unterer Mulde und Elbaue aus, erreicht mit dem Hohen Gieck (193 Meter über NN) 13 Kilometer nördlich von Bad Düben ihre größte Höhe.
In den alten Bundesländern habe ich nach der deutschen Wiedervereinigung niemanden getroffen, der die Dübener Heide gekannt hätte. Vielleicht ist auch dies ein Ausdruck dessen, dass im BRD-Grundgesetz von der Wiedervereinigung die Rede war, im Alltag aber – sofern nicht verwandtschaftliche Bindungen bestanden – von der DDR nur wenig Notiz genommen wurde. Vielleicht aber hat zu dieser Unkenntnis im Lauf der Zeit auch schon eine Etikettierung beigetragen, die – seit Jahrzehnten natürlich längst überholt – für diese schöne mitteldeutsche Landschaft in Vorzeiten alles andere als eine Werbung gewesen war. Die Dübener Heide, so hieß es einst, sei „das deutsche Sibirien“, wo „die Leut’ den Kienäppelschnaps“ brennen.
Die erste urkundliche Erwähnung „Dybyns“ stammt aus dem Jahre 981, wohlgemerkt eine Erwähnung bereits als Stadt. Von den Wohnbauten der frühen Jahrhunderte ist nicht viel geblieben, sicher nur das Gasthaus „Zum Goldenen Löwen“ aus dem Jahre 1617. Was in den Wirren vorangegangener Kriege verschont blieb, fiel den verheerenden Bränden der Jahre 1710 und 1716 zum Opfer. Die jetzige, im klassizistischen Stil errichtete Kirche wurde zwischen 1816 und 1819 gebaut, nachdem ihre Vorgängerin im Jahr 1809 vom einstürzenden Turm stark beschädigt worden war.
Durchquert habe ich Bad Düben auf Fahrten nach Eilenburg oder Leipzig recht oft. Ein gewisser Eindruck blieb bei so vielen flüchtigen Begegnungen schon, aber halt doch nur ein oberflächlicher. Meine Füße habe ich in die Stadt nicht allzu oft gesetzt.
So führte uns unser mehrtägiges Klassentreffen zum 50. Jahrestag des Abiturs unerwartet auch nach Bad Düben. Dort geleitete uns Dieter, der sie als Geologe natürlich längst kannte, zu einer Stelle, an der Natur und menschliches Wirken eine einmalige, dauerhafte Symbiose eingegangen sind, die waldbewachsene Halde des ehemaligen Alaunbergwerkes mit ihrem steil zur Mulde abfallenden roten Ufer. Das Alaunwerk „Gott meine Hoffnung“ war von 1560–1883 in Betrieb. Die Halde mit ihrem farbenfrohen Steilabfall ist heute eine Attraktion der kleinen Kurstadt.
Weitere meiner Aufenthalte in Bad Düben haben etwas mit dem Militär zu tun, das dort nicht nur zu DDR-Zeiten präsent war. In der Stadt hatten einst Kürassiere, die Zietenhusaren, sowie von 1851–1882 drei Batterien des 3. Artillerieregimentes ihr Domizil, und in den Jahren 1915/16 waren es nicht deutsche, sondern kriegsgefangene russische Soldaten, die den in die Mulde mündenden Schwarzbach regulierten.
Ich war nie Soldat, aber vor Soldaten habe ich in Bad Düben mehrmals gesungen. Wenn ich mich recht erinnere, war das im Objekt der Unteroffiziersschule, wo sich eine große Bühne befand, die keine Tiefe hatte, dafür aber in der Breite wohl eine ganze Kompanie aufnehmen konnte. Dort passierte es, dass kurz vor einer Aufführung zahlreiche Kostüme nicht auffindbar waren. Wie sich schnell herausstellte, hatte man sie schlicht und einfach in Wittenberg vergessen.
Anfänglich schien das einer Katastrophe gleich, dann – oh Wunder – wurde die Stimmung immer gelöster, ja, geradezu heiter, als geduldig auf Hemd, Hose oder Rock Anderer gewartet werden musste und man nach blitzschnellem Umkleiden zum Auftritt stürmte. Ob die strammen Soldaten der Nationalen Volksarmee etwas davon gemerkt haben? Ich weiß es nicht.
Mein bislang letzter Aufenthalt in Bad Düben war alles andere als lustig. Nach ihrem Schlaganfall im Sommer des Jahres 2007 musste Irma für drei Wochen dorthin zur Reha, ich begleitete sie und wir weilten so an Stelle eines zeitgleich geplanten Urlaubs im bayerischen Reit im Winkl in der alten sorbischen Gründung Dybyn. In guter Erinnerung werden wir beide die Kurstadt an der Mulde behalten. Irma haben die medizinischen Behandlungen und Übungen dort sehr gutgetan, und mir, der ich zuvor daheim – bitte nicht lachen – aus dem Bett gefallen war und mit einer starken Prellung wochenlang nicht zu liegen vermochte, haben Ruhe und heilsame Atmosphäre im Reha-Zentrum Bad Düben auch geholfen.
BADEN-BADEN
Ach, die berühmte Stadt im Tal der Oos! Eine Tagestour mit dem Bus durch den Schwarzwald führte uns in den 90er Jahren von Menzenschwand aus für etwas länger als einen Augenblick dorthin. Vorm Kurhaus haben wir natürlich gestanden, und einen Stadtführer hatten wir auch. Der jedoch hätte besser Parkführer geheißen. Fast jeder zweite Baum war in seinen Augen ein besonderer, von dem es unaufhörlich zu erzählen galt. Und – von mir will ich da gar nicht reden – es befand sich doch kein einziger Dendrologe unter uns.
BAD LIEBENWERDA
Gelegen in der Niederung des Urstromtals der Schwarzen Elster, 6 500 Einwohner im Jahr 1988, Schloss aus dem 16. Jahrhundert mit gotischem Turm der ehemaligen Burg, die Nikolaikirche, das Rathaus von 1800, Eisenmoorbad, Bahnstation: das Wesentliche ist gesagt.
Viele Jahre lang gehörte Bad Liebenwerda zu den zahlreichen Abstecherorten des Elbe-Elster-Theaters, und das, obwohl die Voraussetzungen für eine Aufführung größerer Bühnenwerke in dem kleinen Kurort mehr als bescheiden waren. Die Choristinnen zum Beispiel konnten ihre Garderobe nur durch jene der männlichen Kollegen erreichen. Bei Auftritten von der rechten Bühnenseite her mussten sich die Akteure an einer aufgerollten Filmleinwand vorbeizwängen. Die Akustik war einzigartig, dies aber in negativem Sinn. Man hatte stets das Empfinden, in einen Sack hinein zu singen. All das jedoch war kein Hinderungsgrund dafür, auch solch choristisch reich bestückte Opern wie beispielshalber Albert Lortzings „Der Waffenschmied“ dort aufzuführen.
Am 11. November 1989 stand in Bad Liebenwerda „Wiener Blut“ auf dem Spielplan. Geprägt von den Ereignissen der vergangenen Tage, besonders der letzten 24 Stunden, herrschte auf der Hinfahrt zum Spielort im Bus eine merkwürdige undefinierte Atmosphäre. Die Gespräche kannten nur ein Thema, aber gespannte Erwartung mischte sich nicht mit lauthals geäußerter Freude, eher mit verhaltener Aufgekratztheit. Dann, als wir in Bad Liebenwerda einfuhren, kam uns eine Schar singender, Lampions schwingender Kinder entgegen: der Umzug am Martinstag. Er hatte wahrlich nichts mit den politischen Ereignissen zu tun, aber ein gedanklicher Übergang erfolgte blitzartig. Alle Dämme brachen. Hochstimmung wie auf Befehl, der sich keiner im Bus entziehen konnte. Meine allerdings bekam gar zu bald einen Dämpfer.
In der Strauß-Operette „Wiener Blut“ tritt der Chor erst nach der Pause auf, jeweils Gelegenheit für einen kleinen Bummel vor der Aufführung. Nach einem vollen Arbeitstag in der Bahnmeisterei und anschließendem Hasten zum Theater zur pünktlichen Abfahrt nach Bad Liebenwerda verspürte ich einen kräftigen Hunger und begab mich flugs zur nächst gelegenen Gaststätte. Volles Haus, Zigarettenqualm, wogendes Stimmengewirr. Nur einen freien Stuhl konnte ich nach gründlicher Musterung des Raumes ausmachen. Auf den steuerte ich zu. Ein fremdes Gesicht an solchem Tag! Aufdringlich, doch sich unverfänglich gebend, in Anorak und Baskenmütze! Das Gespräch am Tisch verstummte schlagartig. Keiner gab auf meine höfliche Frage, ob der Platz frei sei, eine rechte Antwort. Ich setzte mich halt, bestellte etwas Schnelles, würgte es, von eisigem Schweigen umgeben eilends hinunter.
Mein Abschiedsgruß wurde nicht erwidert, aber dann, als ich mich an der Tür noch einmal wendete, sah ich, wie meine kurzzeitigen Tischnachbarn eifrig tuschelnd die Köpfe zusammensteckten.
BAD SCHMIEDEBERG
Ein kleines Abzeichen halte ich in den Händen, eine schlichte Plakette aus goldgelbem Metall, mir seit frühester Kindheit vertraut. Vater hat sie am Sonntagsanzug getragen, doch Mutter hätte es eher zugestanden, sich mit ihr zu schmücken, denn nicht er, sondern sie ist in Greudnitz, unweit von Bad Schmiedeberg, aufgewachsen.
Aber ein Abzeichen mit Anstecknadel am Kleid? Das ist schwer vorstellbar, obwohl – Irma hat vor Jahren in der Wittenberger Bosse-Klinik eine Bettnachbarin erlebt, die demonstrativ sogar ihr SED-Parteiabzeichen ans Nachthemd geheftet hatte. Doch das gehört nicht hierher.
Vater also trug das Vereinsabzeichen der Landmannschaft Bad Schmiedeberg v. V. Wittenberg, aber ein wenig kürzer im Sprachgebrauch, das Abzeichen der Schmiedeberger Landsmannschaft. Achteckig ist es und zeigt innerhalb der Umschriftung das Schmiedeberger Stadtsiegel mit der Jahreszahl 1657, die weder mit der Vergabe der Stadtrechte noch mit der Gründung des Vereins etwas zu tun haben dürfte, sondern die ein Schmiedeberger Stempelmacher sehr wahrscheinlich als Herstellungsjahr eines von ihm gefertigten Siegels hinzugefügt hat. Der Ort ist wesentlich älter. Im 12. Jahrhundert von flämischen Siedlern gegründet, wird Smedebergensis bereits anno 1350 in einem Wittenberger Stadtbuch Civitas genannt.
Ein Zeitungsartikel von Barbara Faensen aus dem Jahre 1981 enthält folgende Zeilen:
Der Badegast, den sein Kurscheck in diese winzige Stadt verschlägt, hat schon am zweiten Tag nach seiner Ankunft einige Mühe noch etwas Bemerkenswertes zu entdecken. Binnen weniger Minuten ist er durch die Stadt gelaufen auf enger, doch alles andere als kurgemäß ruhiger Straße.
Was die Größe der Stadt und die Anzahl der Bedeutsamkeiten anbelangt, daran hat sich bis heute nicht allzu viel geändert. Die Einwohnerzahl pendelte zur Jahrtausendwende nach wie vor um 5 000, erhöhte sich erst durch Einvernahme sogar der Stadt Pretzsch.
Die Sehenswürdigkeiten sind schnell aufgezählt. Da ist das Au-Tor von 1490, letzter erhaltener Teil der Stadtbefestigung, die errichtet wurde, nachdem im Jahr 1429 Hussiten die Stadt zerstört hatten.
In der hochtürmigen Stadtkirche, einer spätgotischen Hallenkirche, hat 1528 Martin Luther gepredigt. Der Überlieferung zufolge soll er sich dabei in dem ungewöhnlich großen Gotteshaus „wie eine kleine Schwalbe“ gefühlt haben. Die Größe des Backsteinbaus steht sicher im Zusammenhang mit jener Bedeutung, die Schmiedeberg bereits im 14. Jahrhundert als Sitz eines Erzpriesters besaß. Dazu gehörten die Pfarreien Reinharz, Meuro, Ogkeln, Pretzsch, Trebitz, Globig sowie Bleddin, und in Anbetracht auch der zahlreichen Altäre in der Kirche, so unter anderem für Gilden und Bruderschaften, dürften bis zu zehn Priester amtiert haben. Infolge der Kriegswirren wurde 1813 die Wittenberger Universität nach Schmiedeberg verlegt, und so war die dortige Stadtkirche bis 1816 gleichzeitig Universitätskirche.
Was gibt es noch? Das schöne, 1570 erbaute, von den Schweden zerstörte und 1648 im Stil des frühen Barock wieder errichtete Rathaus, im Kurpark ein Denkmal, das an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Sportkameraden des Bundes Deutscher Radfahrer erinnert, und dann, natürlich, Bad Schmiedeberg ist ein Kurort. Das im Jahr 1906 erbaute Kurhaus präsentiert sich in echtem Jugendstil. Die Kureinrichtungen in ihrer Gesamtheit brauchen keinen Vergleich zu scheuen und geben der „winzigen“ Stadt heute ein weltoffenes, schmuckes Gepräge.
Anno 1937 war eine Reise nach Bad Schmiedeberg für mich schon im Vorhinein ein Ereignis, das sich in seinem Verlauf dann sogar in ungeahnter Weise noch vergrößerte. Die Steigerung freilich hatte weniger mit dem Städtchen in der Dübener Heide als vielmehr mit meiner körperlichen Unzulänglichkeit zu tun. Ein Tagesausflug der Schmiedeberger Landsmannschaft führte in Herkunftsgefilde. Ziel war der Schmiedeberger Aussichtsturm, erstes Teilstück die Eisenbahnfahrt von Wittenberg bis zur Kurstadt.
Bemerkenswert übrigens in diesem Zusammenhang: Die Eisenbahn war es gewesen, die bereits 1895 mit Inbetriebnahme der Strecke Pretzsch–Eilenburg der Station die Bezeichnung Bad Schmiedeberg gegeben hatte, und das war nur 17 Jahre nachdem mit dem Abzug der 6. Dragoner die Garnison aufgelöst worden war und kluge Leute die örtlichen Gegebenheiten für die Installierung eines Moorbadebetriebes ins Spiel brachten.
Mit der Eisenbahn fahren, das war nicht unbedingt etwas Sensationelles für mich, noch wohnten die Großeltern in Trebitz, aber für erregende Vorfreude und genießerische Schaulust während der Fahrt reichte es allemal. Das zweite Teilstück, die Wanderung durch Städtchen und Heide, das war etwas Neues. Doch meine Begeisterung war rasch dahin. Ich trug neue Schuhe und verspürte schon nach kurzer Wegstrecke, wie Blasen an den Hacken immer unleidlicher wurden. Bald hätte ich wohl nur barfuß weiterlaufen können, was ich als Stadtkind allerdings kaum gewöhnt war, aber Hilfe kam rechtzeitig.
Pietzner hieß der rettende Engel, Bruno Pietzner, Buchhalter der kleinen Wittenberger Seifenfabrik Faul, dessen Frau ein Seifengeschäft in der Wittenberger Jüdenstraße 29 führte, und der Vorsitzender, oder zumindest Vorstandmitglied der Schmiedeberger Landsmannschaft war. Pietzners besaßen ein Auto und fuhren selbstverständlich damit. Sie holten uns Bahnfahrer am Ausgang der Kurstadt ein und ließen den Lazarus einsteigen. Meine erste Autofahrt! Alle Blasen an den Füßen waren vergessen.
Mein zweiter Kurzaufenthalt in Bad Schmiedeberg war viel ernsterer Natur. Tief eingeprägt hat sich damaliges Geschehen, bei dem wiederum ein Auto beteiligt war.
April 1945. Die Beschießung Wittenbergs durch Truppen der Roten Armee hatte am 23. des Monats begonnen. Auf Drängen von Mutters älterer Schwester Martha hin flüchteten wir am 24. gemeinsam mit ihr per Fahrrad aus der umkämpften Stadt über die Elbe in den Südkreis nach Trebitz. Die Berichte über an der Zivilbevölkerung verübte Gräueltaten, die den Russen vorauseilten, gepaart mit der Sorge um die jüngste der drei Schwestern, die mit ihren sechs Mädels allein war, mögen den Ausschlag für die Flucht gegeben haben. Trebitz jedoch blieb nicht der Endpunkt. Im Schloss des Dorfes waren Zwangsarbeiter aus dem Osten, Polen und Russen, zusammengepfercht. Die Furcht vor eventuellen feindseligen Reaktionen dererseits nach ihrer bevorstehenden Befreiung veranlasste die drei Schwestern, mit ihrer Kinderschar auch Trebitz zu verlassen.
Am 26. April, an jenem Tag, an dem die sowjetischen Truppen Wittenberg einnahmen und die sich zurückziehenden deutschen Soldaten die Elbbrücke sprengten, gelangten wir nach Reinharz, einem kleinen Heidedorf in der Nähe von Bad Schmiedeberg. Drei Erwachsene, sechs Mädchen und drei Bengels, quartierten wir in der Gaststube der Dorfkneipe. Nahrungsbeschaffung war Sache der Jungen. Bruder Günther und ich klapperten die umliegenden Ortschaften ab, erkundeten, welcher Bäcker noch buk, harrten mit vielen anderen Hungrigen meist lange Zeit, um dann jeder backofenheiß einen Laib in Empfang zu nehmen.
An einem der letzten Apriltage standen wir in Bad Schmiedeberg Schlange vor einem Bäckerladen in der Nähe des Au-Tores, als plötzlich Motorenlärm die angespannte Stille auf der Straße durchbrach. Ein Ami-Jeep kam angebraust, und dann peitschte ein Schuss. Der Jeep bremste jäh, die Soldaten sprangen ab, jagten uns mit vorgehaltenen Maschinenpistolen in einen benachbarten Hausflur und durchkämmten die Gebäude. Lange dauerte es nicht, dann durften wir wieder auf die Straße, wo uns der Schütze, ein Jungvolk-Pimpf, präsentiert wurde. Die Amis hatten ihn auf den Kühler ihres Fahrzeugs gesetzt und fuhren mit ihm davon. Was aus dem Burschen, der kaum älter als ich gewesen sein dürfte, geworden ist, haben wir nicht erfahren.
Meine nächste kurze Bleibe in Bad Schmiedeberg ein Vierteljahr später war wiederum ungewöhnlich. Pioniere der Roten Armee, Eisenbahner und die Wittenberger Stahlbaufirma Gresse & Co. hatten die zerstörte Eisenbahnbrücke provisorisch rasch wiederhergerichtet. Bereits am 20. Juli 1945 konnte sie der erste Zug im Schritttempo befahren. Ich erinnere mich noch gut daran. Es war ein heißer Tag. Barfuß, nur mit Turnhose bekleidet, zog ich mit vielen Schaulustigen zum Brückenkopf, um dem Ereignis beizuwohnen. Eine sowjetische Militärkapelle spielte – kaum zu glauben – sogar den Marsch „Alte Kameraden“. Fahrten in den Südkreis waren fortan, wenn auch unter Schwierigkeiten und erheblichem Zeitaufwand wieder möglich.
Heidelbeeren reifen bis in den August hinein. Sie brauchen nur gepflückt zu werden. Mutter wollte gemeinsam mit einigen Frauen ihres Bekanntenkreises das Wagnis unternehmen, und ich musste mit. Der maßlos überfüllte Zug benötigte eine endlos lange Zeit für die 30 Kilometer von Wittenberg bis Bad Schmiedeberg; am Bahnhof aber war man noch nicht im Wald. Mit dem Pflücken wurde nicht mehr viel. Mutter kam auf die „brillante“ Idee, in Reinharz zu übernachten. Das ging natürlich nicht mehr in der Gaststube, doch auf dem Heuboden durften wir logieren. Am folgenden Tag wurde mühsam, doch fleißig im Wald geerntet, und als wir abends schwer beladen mit blauer Köstlichkeit am Schmiedeberger Bahnhof anlangten, da kam das dicke Ende. Es fuhr kein Zug mehr. Die Betroffenheit war groß. Sie wurde noch größer, als der Bahnhofsvorsteher andeutete, er wisse auch nicht, ob oder wann am kommenden Tag einer führe. Was nun, was tun? Eine Möglichkeit gäbe es, sagte der Mitleid fühlende Eisenbahner. Sie verstieße zwar gegen die Dienstvorschriften, aber in solcher Zeit… Auf dem Überholungsgleis stünde ein unbeladener offener Güterwagen, ein sogenannter O-Wagen, der am frühen Morgen nach Wittenberg umgesetzt werden würde. Wenn wir da hinein klettern wollten… Wir wollten, verbrachten fröstelnd eine Nacht im Wagen und doch unter freiem Himmel, wurden putzmunter, als in der Morgendämmerung die Lok anspannte und waren dann aber am frühen Vormittag wieder daheim.
In den vergangenen Jahrzehnten bin ich aus unterschiedlichstem Anlass immer wieder einmal in dem jetzt ansehnlichen Kurstädtchen gewesen, habe sogar mehrmals als Chorsänger mit dem Ensemble des Elbe-Elster-Theaters auf der winzigen Bühne des Kurhauses gestanden, die eindrücklichsten Aufenthalte aber sind die ersten drei geblieben.
BALLENSTEDT
Sie wird wieder gepflegt, die Historie in der kleinen Stadt am Nordrand des Unterharzes, im 13. Jahrhundert ein Dorf, im 15. Jahrhundert Marktort, im 16. Jahrhundert mit dem Stadtrecht versehen, Stammsitz der Askanier, von 1765–1863 Residenz der Herzöge von Anhalt-Bernburg. Zu Zeiten der „Diktatur des Proletariats“ war eine solche, dem Adel verpflichtete Pflege passé, denn immerhin hatte sich – so wurde es offiziell herausgestellt – Ballenstedt von einem Beamtenruhesitz zu einem modernen sozialistischen Industriestandort gewandelt, dem die im Schloss untergebrachte Parteischule der SED gut zu Gesicht stünde.
Zum sichtbaren Ausdruck des wiedergewonnenen Geschichtsbewusstseins wurde in den 90er Jahren die liebevolle Restaurierung des im Jahr 1788 erbauten Schlosstheaters, das, als wir Wittenberger zum ersten Mal dort anrückten, in hellem Glanz erstrahlte, indes die übrigen Gebäude auf dem Schlossberg dem Verfall preisgegeben schienen.
Nicht viel später hat sich das grundlegend zum Positiven hin verändert, und selbstverständlich ist auch die mehr als einen Kilometer lange Kastanienallee, die geradlinig vom Schlossberg zum Zentrum der Stadt führt, sorgsamer Pflege unterworfen. Wilhelm von Kügelgen, Hofmaler, Schriftsteller und Kammerherr des letzten Bernburger Herzogs, mag oft dort entlanggewandert sein, sinnend schöpferischen Gedanken nachhängend.
Einmal, bei einem der gern vollzogenen Abstecher nach Ballenstedt blieb auch mir genügend Zeit, mich auf diesem unvergleichlichen, einladenden Weg zu ergehen.
BART
Ein klein wenig wird meine Erinnerung an die wunderschönen Tage in Bart sur le Rupt getrübt. Gastgeber für Sangesbruder Volkmar Schumann und mich waren der handfeste, spaßige Bürgermeister der Gemeinde, der Bretone Jean Rocfort, und seine liebenswürdige Gattin. Jeden Wunsch lasen sie uns von den Augen ab, und sogar das Innerste der schmucken Mairie durften wir betreten und bewundern.
Aber am Samstagabend der Calvados! Gepeinigt von schlechtem Gewissen saß ich am folgenden Tag im benachbarten Saint-Suzanne in der Kirche. Meinen Chordienst als Angehöriger der Wittenberger Kantorei habe ich weder vordem noch hernach so schlecht wie dort versehen.
BAUTZEN
„Wenn der Wind nicht weiß, wohin, dann weht er halt in Budysin“, so, oder zumindest so ähnlich lautet jener Spruch, der die Vieltürmigkeit der Sorbenmetropole an der Spree charakterisiert.
Selbstverständlich habe ich im Sommer 1989, im Verlauf unseres Stadtbesuchs einen der Türme, den schiefen Turm von Bautzen, den Reichenturm erstiegen. Irma, derweil ihr Göttergatte von der 36 Meter hoch gelegenen Plattform aus zauberhafte Aussicht genoss, bummelte durch die umliegenden Geschäfte.
Apropos Geschäfte: Ein Erfolgserlebnis, das wir dann noch hatten, bleibt ebenso unvergesslich wie die bis dahin wahrgenommenen Reize der Stadt. Industriewaren wie auch Waren des täglichen Bedarfs wurden seinerzeit in der DDR immer





























