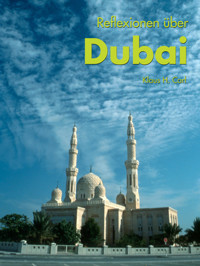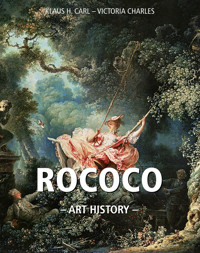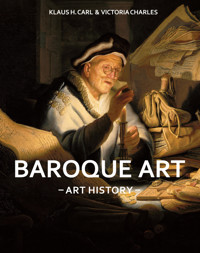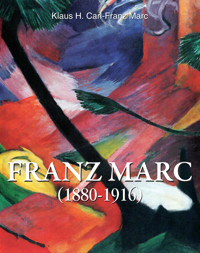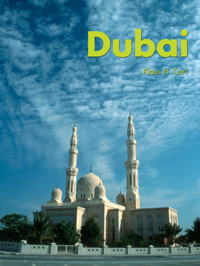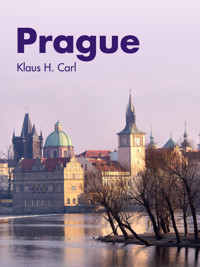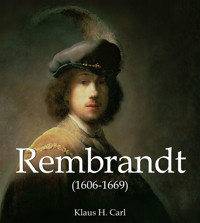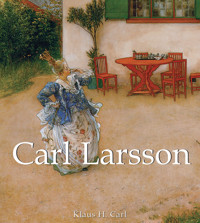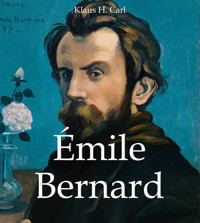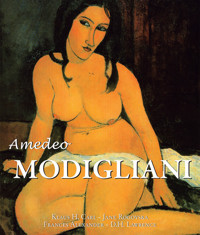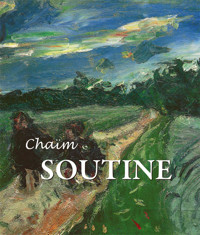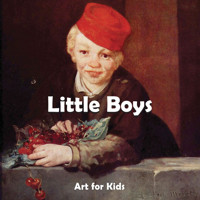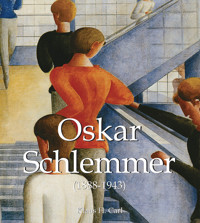
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Parkstone International
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Oskar Schlemmer (1888-1943) war ein deutscher Ballettmaler, Theatergestalter und Bühnenbildner. Nach Abschluss seiner Ausbildung als kunstgewerblicher Zeichner vervollständigte er sein Studium an der Stuttgarter Akademie für bildende Künste. In Stuttgart lernte er ein Tänzerehepaar kennen, das ihn für das Theater begeisterten. In 1914 machte Schlemmer die Bekanntschaft des späteren Bauhausgründers Walter Gropius, der auf Schlemmer aufmerksam wurde. Mit dessen Hilfe trat er dem Bauhaus von Weimar bei, wo er von 1920 bis 1929 unterrichtete. Zu dieser Zeit übernimmt er Bühnengestaltungen zu Werken der Komponisten Igor Strawinsky und Arnold Schönberg. Die politische Radikalisierung führte dazu, dass Schlemmer in 1937 von den Nazis zum "degenerierten Künstler" und “Kunstbolschewisten” erklärt wurde und Arbeitsverbot erhielt. Seine gemalten oder gemeißelten Arbeiten sind geprägt von geometrisch-choreografischer Strenge und Reinheit der Konturen, Lebendigkeit der Formen und Beweglichkeit des Raumes. Das Ergebnis ist eine Stilrichtung, die auf den Futurismus oder den Konstruktivismus in seinem analytischen Aspekt und auf den Surrealismus verweist. Seine Werke sind u. a. in New York, Frankfurt und Stuttgart ausgestellt, wo sich auch die Schlemmer-Archive befinden, die insbesondere alle seine Skizzen in zwei oder drei Dimensionen für sein Triade-Ballett (1922) enthalten. Schlemmer’s berühmtestes Werk ist sicherlich die Bauhaustreppe, in dem er die Interaktion zwischen dem Menschen und den ihn umgebenden Raum inszeniert, und dies hinsichtlich der Zukunftsperspektiven der Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Autor: Klaus H. Carl
Mit ausführlichen Textzitaten u. a. aus Oskar Schlemmer, Briefe und Tagebücher, herausgegeben von Tut Schlemmer, 1958.
Layout:
Baseline Co. Ltd
61A-63A Vo Van Tan Street
4. Etage
Distrikt 3, Ho Chi Minh City
Vietnam
© Confidential Concepts, worldwide, USA
© Parkstone Press International, New York, USA
Image-Barwww.image-bar.com
Weltweit alle Rechte vorbehalten.
Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen, den betreffenden Künstlern selbst oder ihren Rechtsnachfolgern. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.
ISBN: 978-1-68325-696-0
Klaus H. Carl
Oskar Schlemmer
(1888-1943)
Inhalt
Biografie
Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts – die Kaiserzeit
Oskar Schlemmer
DasBauhaus
Oskar Schlemmer amBauhausin Weimar
Das Triadische Ballett
Oskar Schlemmer amBauhausin Dessau
Der Folkwang-Zyklus
Das Ende in Dessau
Drei Jahre in Breslau
Die Jahre von 1939 bis 1943
Abbildungsverzeichnis
Männlicher Kopf 1, Selbstbildnis, 1912
Öl auf Leinwand, 45,4 x 33,8 cm. Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart.
Biografie
Jahr
Vita
Arbeiten (in Auswahl)
1888:
Oskar Schlemmer wird am 4. September als sechstes Kind in Stuttgart geboren.
1899 – 1903:
Übersiedlung nach Göppingen undBesuch der dortigen Realschule.
Teilnahme an Jugendausstellungen.
1903 – 1905:
Absolvierung einer Lehre als kunstgewerblicher Zeichner.
1904:
Nahezu parallel dazu besucht Schlemmer einen Unterricht in Stillehre und Figurenzeichnen.
1905:
Zeitweise Besuch derKunstgewerbeschulein Stuttgart.
1906 – 1909:
Mithilfe einesStipendiums erhälter die Zulassung zurAkademie der Bildenden Künstein Stuttgart.
Stillleben mit drei Kasperpuppen(1906).
1911 – 1912:
Aufenthalt in Berlin als freier Maler.
Jagdschloss im Grunewald(1911);
Selbstporträt(1912).
1913 – 1914:
Meisterschüler bei Adolf Hölzel.
Mädchenkopf mit Silber(1913);
Geometrisierte Figur(1913).
1914 – 1918:
Teilnahme am Ersten Weltkrieg, er erleidet zwei Verwundungen, nach dem Ende des Krieges Rückkehr nach Stuttgart zu Adolf Hölzel.
Komposition auf Rosa(1916), von dem es eine Rekonstruktion aus dem Jahr 1930 gibt.
1919:
Versuch der Ausbildungsmodernisierung der Stuttgarter Akademie. Gründung derÜecht-Gruppe mit Willi Baumeister und anderen.
Figurenplan, pl. 6(ausDie Schaffenden, IV;1919-1920);
Mann mit Fisch(1919).
1920:
Rückkehr nach Berlin und gemeinsame Ausstellung mit Baumeister; Heirat mit Helena Tutein und Berufung an das Bauhaus in Weimar. In Frankfurt lernt er Paul Hindemith kennen.
Erste Figurinen für das
Triadische Ballett.
1921 – 1928:
Leitung des KursesDer Mensch.
1922:
Uraufführung desTriadisches Ballettin Stuttgart.
Tänzerin(Die Geste; 1922-1923).
1925 – 1928:
DasBauhauszieht um nach Dessau,
Schlemmer übernimmt die Bauhausbühne.
Römisches(oder:Vier Figuren im Raum;1925);
Frauentreppe(1925).
1926:
Umzug der Familie nach Dessau und Bezug des neuen Wohnhauses.
Fünf Männer im Raum(1928);
Gelbrot I(1928).
1929 – 1932:
Wechsel und Beginn der Lehrtätigkeit an der Akademie in Breslau.
Blaue Frauen(1929);
Blaues Bild(1929).
1928 – 1930:
Drei Fassungen der Wandbilder für das Museum Folkwang in Essen.
Unterricht II(Fassung I der Folkwang-Bilder;1929).
1932:
Schließung der Akademie in Breslau. Übernahme einer Professur an den Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst in Berlin. Aufführung desTriadischen Ballettsin Paris.
Rote Mitte(1932);
Unterweisung(1932);
Bauhaustreppe(1932).
15. Januar 1933:
Todestag Otto Meyer-Amdens.
1933:
Entlassung aus dem Lehramt an der Vereinigten Staatsschulen für freie und angewandte Kunst.
1934:
Schlemmers Wandbilder im Museum Folkwang fallen dem Bildersturm der Nationalsozialisten zum Opfer. Bei einer Nachfolgeausschreibung wird er angeblich aus Altersgründen nicht mehr berücksichtigt. Die Familie zieht um nach Eichberg.
1937:
Beginn der Planungs- und Bauarbeiten für das Wohnhaus in Sehringen. Teilnahme an Ausstellungen in Berlin und London. In der AusstellungEntartete Kunstwerden auch Bilder Schlemmers gezeigt.
Graue Frauen(1936);
Rückenfigur sitzend(1936);
Drei Mädchen(1936).
1938 – 1940:
Schlemmer arbeitet bei einer Anstrichfirma in Stuttgart und wird nach Kriegsbeginn mit Tarnanstrichaufträgen an Gebäuden beschäftigt.
1940:
Oskar Schlemmer zieht um nach Wuppertal und arbeitet in der Firma des Lackfabrikanten Dr. Kurt Herberts.
1943:
Nach einigen Krankenhausaufenthalten erhält Schlemmer einen Kuraufenthalt in einem Sanatorium in Bühlerhöhe (Hochschwarzwald).
13. April 1943:
Todestag Oskar Schlemmers.
Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts – die Kaiserzeit
Deutschland hatte den Französisch-Preußischen Krieg von 1870-1871 gewonnen und wurde von Kaiser Wilhelm I. (1797-1888) regiert. Aus seiner Kronprinzenzeit, damit vor seiner Inthronisation als Kaiser von Deutschland und König von Preußen, trug er wegen seiner vermeintlichen Teilnahme an der Niederschlagung der Revolution von 1848-1849 noch den ihm vom später wegen „Kriegsverrats“ hingerichteten Johann Dortu (1826-1849) zugewiesenen, wenig schmeichelhaften Beinamen „Kartätschenprinz“.
Bei seinen Amtsgeschäften wurde Wilhelm I., der sich nur widerstrebend zum Deutschen Kaiser hatte wählen lassen, bis zu dessen Entlassung 1890 von Fürst Otto von Bismarck (1815-1898) unterstützt, der sich in seiner Kanzlerschaft ganz erheblich mit der Sozialistengesetzgebung („Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“) auseinanderzusetzen hatte und die schließlich der Anlass für seinen Abschied war. Der Kaiser hatte ihn fallen lassen. Die britische Satirezeitschrift Punch vom 29. März 1890 untertitelte die berühmte Karikatur mit „Dropping the Pilot“ und traf damit den Nagel auf den Kopf.
Die Frankfurter Zeitung vom 10. Oktober 1878 berichtete über eine Reichstagssitzung:
Die heutige Reichstagssitzung, in welcher die Debatte zweiter Lesung über das Sozialistengesetz ihren Anfang nahm, gestaltete sich zu einer der stürmischsten und erregtesten, deren Zeuge wir jemals in der Leipziger Straße gewesen. Man kann die heutige Sitzung als ein Duell Bismarck-Sonnemann bezeichnen. Wohl niemals ist einem Volksvertreter ein schwererer und ungerechtfertigterer, mehr bei den Haaren herbeigezogener Vorwurf ins Antlitz geschleudert worden, wie dies heute von Seiten des Reichskanzlers dem Abg. für Frankfurt von der Tribüne des Reichstags aus widerfahren ist – der, wenn auch verhüllte Vorwurf eines Verbrechens, des Landesverraths, welches nach dem Strafgesetzbuche mit Zuchthaus bestraft wird. […]
Trotz weitergehender hitziger Debatten wurde dieses Gesetz, das einem Parteienverbot der sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien entsprach, dann im Herbst 1878 doch verabschiedet und blieb bis 1890 in Kraft.
Als Gegengewicht und wirksames Beruhigungsmittel wurden dazu aber 1883 die aufgrund der sozialen Notlage der meisten Arbeitnehmer dringend notwendig gewordene Krankenversicherung, ein Jahr danach die Unfallversicherung und schließlich 1889 die Altersversicherung als Teile der Sozialgesetzgebung eingeführt. Ein anderer Schwerpunkt Bismarck’scher Politik war, etwa ab Mitte der 1880er Jahre, die von ihm zunächst nur halbherzig betriebene Kolonialpolitik, die, da man sich schließlich zu den europäischen Großmächten zählte und die übrigen Großmächte England, Frankreich und Russland ebenfalls und schon länger über Kolonien herrschten, schließlich 1884 und 1885 zum Erwerb der Kolonien Togo, Kamerun, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika führte, wobei die beiden letzteren zunächst von zwei privaten Unternehmern erworben worden waren. Damit hatte sich Deutschland in ein letztendlich erfolgloses Wettrennen um Kolonien in Afrika eingeschaltet.
Ein weiterer Kernpunkt war nach dem Sieg im Französisch-Preußischen Krieg der Kulturkampf zwischen dem Kaiserreich und der Katholischen Kirche unter Papst Pius IX. (1792-1878), in dem es im Wesentlichen um die Trennung von Staat und Kirche ging und dem als ein Ergebnis die Einführung der Zivilehe zu verdanken ist.
Weiblicher Kopf in Grau, 1912
Öl auf Leinwand, 57,5 x 39 cm. Privatsammlung
Interieur, 1913
Öl auf Leinwand, auf Karton aufgezogen, 56 x 45,5 cm. Kunstmuseum Stuttgart, Stuttgart
Mädchenkopf mit Silber, 1913
Öl auf braunem Papier, auf Karton aufgezogen, 58,7 x 47,5 cm. Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart
Rosa Strobel, 1914
Öl und Lack auf Leinwand, 58 x 42,8 cm. Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart
Gegenüberstellung des inneren und äußeren Menschen, um 1915
Bleistift, Tusche, Aquarell und Bronzefarbe auf Papier, 19 x 12,1 cm. Privatsammlung
Bild K, 1915-1916
Öl auf Leinwand, 59,5 x 76 cm. Privatsammlung
Den Franzosen kam ihre Niederlage im Französisch-Preußischen Krieg teuer zu stehen, sie mussten immerhin – außer dem Verlust ihrer Departements Elsass und Lothringen – auch noch fünf Milliarden Francs an Reparationszahlungen leisten. Dieser Betrag unterstützte die deutsche Nachkriegswirtschaft ganz erheblich, die, nicht nur bedingt durch die Ersatzbeschaffung verloren gegangenen Kriegsgeräts, sondern auch durch neue Erfindungen und die Weiterentwicklung bestehender Technik, auf vollen Touren lief.
Zu diesen technischen Neuigkeiten, die die Industrialisierung und damit auch die Verstädterung erheblich förderten und Deutschland zum Zuwanderungsland für Arbeiter aus östlichen Ländern machte, gehörten vor allem (die nachfolgende Aufzählung ist absolut nicht vollständig) die elektrische Straßenbahn (Siemens), deren weltweit erste Linie 1881 in Berlin fuhr, die Einführung der elektrischen Straßenbeleuchtung in Nürnberg und Berlin (1882; Potsdamer Platz), die 1883 vom Schweden Carl Gustaf Patrik de Laval (1845-1913) und 1884 vom Engländer Charles Parsons (1854-1931) entwickelte Dampfturbine und das 1885 von Carl Benz (1844-1929) gebaute erste (dreirädrige) Benzinauto. Im selben Jahr brachte der Wiener Chemiker Carl Auer von Welsbach (1858-1929) seine Art der Gasbeleuchtung zur Serienreife, für die Druckereien erfand Ottmar Mergenthaler (1854-1899) die Setzmaschine Linotype