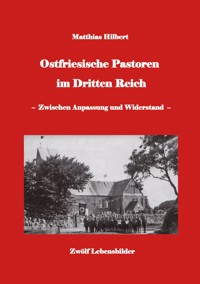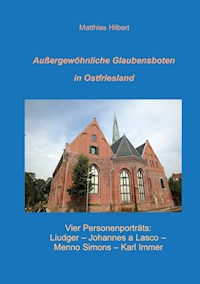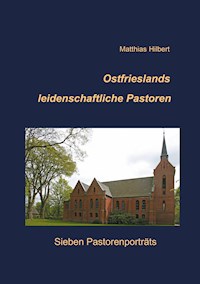
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ostfrieslands leidenschaftliche Pastoren stellt auf lebendige Weise die gewissenhaft recherchierten Lebensbilder von sieben markanten ostfriesischen Pastoren vor, deren Wirken, nicht nur, für die ostfriesische Kirchengeschichte von großer Bedeutung gewesen ist: Hans Bruns und Remmer Janßen, beide ev.-lutherisch, Gerrit Herlyn, Heinrich Oltmann und Carl Octavius Voget, alle ev.-reformiert, den methodistischen Friesenapostel Franz Klüsner sowie den baptistischen Theologen im Bauernrock Harm Willms. Gleichzeitig liefert das Buch auch einen kirchengeschichtlichen Beitrag zu den christlichen Erweckungsbewegungen im Ostfriesland des 19. und 20. Jahrhunderts sowie zum Verhalten ostfriesischer Pastoren im Dritten Reich. Abgerundet wird der Band durch eine kleine Studie über den frommen Background der bekannten ostfriesischen Schriftstellerin Wilhelmine Siefkes, Mennonitin und Sozialdemokratin. Herausgeber: Hans-Jürgen Sträter, Adlerstein Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1. Hans Bruns – Gottes Feuerhaken
Special: Hans Bruns und die Baptisten
2. Gerrit Herlyn – Plattdeutscher Prediger und Bibelübersetzer
Special: Gerrit Herlyn im Dritten Reich: Widerständler oder Hitler-Sympathiesant?
3. Remmer Janßen – Pastorenoriginal mit Tiefen-und Breitenwirkung
Special: Missionsfeste und Missionshaus in Strackholt
4. Franz Klüsner – der „methodistische Ostfriesenapostel“
5. Heinrich Oltmann – als „Papst in Loga“ führend im Kirchenkampf
Special: Oltmanns vielgelesener Roman „Und das Meer ist nicht mehr“
6. Carl Octavius Voget – Pastor mit Charisma
Special: Erweckung im Rheiderland
7. Harm Willms – Theologe im Bauernrock
Special: Unterdrückung und Ausbreitung der Baptisten in Ostfriesland
Anhang
Wilhelmine Siefkes – Mennonitin und Sozialdemokratin
Zum Buch
Zum Autor
Vorwort
Kirchengeschichte ist immer auch Biographiengeschichte, weil es Geschichte ohne Lebensgeschichten von Menschen nicht gibt.
Ich bin dankbar dafür, dass Matthias Hilbert mit diesen hier beschriebenen Porträts das Andenken an sieben Pastoren wachhält und mit Wilhelmine Siefkes an eine Frau erinnert, die sich für ihren Glauben öffentlich eingesetzt hat, noch bevor Frauen Pastorinnen werden konnten.
Es steht den Kirchengemeinden gut an, sich dankbar an diejenigen zu erinnern, die jeweils in ihrer Zeit und in den gesellschaftlichen Umständen als Pastoren gewirkt haben, in erster Linie als Verkündiger des Evangeliums, aber auch als Zeitgenossen, Impulsgeber, Kultur- und Bildungsträger. Sie waren eine prägende Kraft, deren Wirkung in manchen Gemeinden bis heute positiv zu spüren ist.
Mit seiner Auswahl der Personen bedenkt Matthias Hilbert die Vielfalt evangelischer Konfessionen in Ostfriesland. Indem er sich Baptisten, Methodisten und Mennoniten im Umfeld von evangelisch-reformierten und evangelisch-lutherischen Gemeinden im 19. und 20. Jahrhundert zuwendet, wird auf anschauliche Weise deutlich, wie spannungsreich das Verhältnis oft war.
Wir können dankbar sein, wie selbstverständlich das gute Miteinander in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Ostfriesland im gemeinsamen Bekenntnis zu Jesus Christus heute ist.
Die hier beschriebenen Lebensbilder zeigen dabei auch, dass christlich-gläubiges Engagement auch eine politische Dimension hat. Dies wird insbesondere in den Biographien deutlich, die in die Zeit des Nationalsozialismus hineinreichen.
Ich wünsche dem interessant geschriebenen Buch eine große Leserschaft, denn der eigene Glaube wird immer auch mitgeprägt von Menschen, die vor uns gelebt und gewirkt haben. Heute sind wir es, die als Gottes Zeugen in dieser Zeit unseren Glauben gestalten und auf vielfältige Weise in den unterschiedlichen christlichen Kirchen und Gemeinschaften in unserer schönen Region weitergeben dürfen. Dazu ermutigt dieses Buch in besonderer Weise.
Dr. Detlef Klahr
Regionalbischof
Sprengel Ostfriesland-Ems
Hans Bruns – Gottes Feuerhaken
„Meinen ersten Atemzug habe ich am 7. Oktober 1895 im Pfarrhaus unter dem alten, wuchtigen Wilhardikirchturm zu Stade getan. Ich bin also meinem Geburtsort nach Niedersachse, aber dem Blut nach gehöre ich zu den Ostfriesen. Beide Eltern stammten aus Ostfriesland; die Eltern meines Vaters waren Bauern, die der Mutter Müller. Im Laufe meines Lebens habe ich mich je länger, umso mehr als Ostfriese gefühlt. Auch bin ich zehn Jahre in Ostfriesland Pastor gewesen.“ So schreibt Hans Bruns, der im letzten Jahrhundert einer der bekanntesten Pfarrer und Evangelisten in Deutschland war und dessen Bibelübersetzung („Bruns-Bibel“) bis heute nachgefragt wird, in seiner Autobiografie „Ich habe das Staunen gelernt“.
Anfang der 20er Jahre war Bruns nach seiner Vikariatszeit in Kirchlinteln bei Verden für ein halbes Jahr Hauslehrer beim Fürsten Knyphausen auf Schloss Lütetsburg bei Norden gewesen. Nach seiner ersten Pfarrstelle in Drochtersen im „Alten Land“ war er dann zehn Jahre lang – von 1924 bis 1934 – in der ostfriesischen Gemeinde Hollen Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirche. Bei einem seiner Hausbesuche trat einmal die Hausfrau, die gerade das Teewasser heiß machen wollte, plötzlich mit erhobenem Feuerhaken vor ihn hin und meinte zu ihrem verdutzten Pfarrer: „Herr Pastor, Sie sind auch solch ein richtiger Feuerhaken in unserer Gemeinde.“ Bruns ließ sich diesen Vergleich gern gefallen, war doch während seiner Dienstzeit in dieser Gemeinde in der Tat vieles „angefacht“ worden.
Gegen den Willen seines lutherischen Superintendenten lud er noch in seinem ersten Hollener Amtsjahr den reformierten Amtskollegen Heinrich Oltmann aus Loga – ein ehemaliger Studienkollege und guter Freund von Bruns – zu einer mehrtägigen Evangelisation nach Hollen ein. Diese Veranstaltung sollte sich als überaus segens- und folgenreich erweisen, läutete sie doch gewissermaßen den Beginn einer langanhaltenden „Erweckung“ in Hollen und Umgebung ein. Bruns selbst berichtete später über diese Evangelisationsveranstaltung so: „ Wir sahen Abend für Abend eine übervolle Kirche. (…) Es mussten Stühle und Bänke hereingeholt werden. An einem Abend standen die Hörer bis auf den Altarraum Kopf an Kopf und lauschten der Predigt, die an diesem Abend plattdeutsch gehalten wurde. (…) Nachmittags wurden Bibelstunden gehalten, die auch von Tag zu Tag mehr besucht wurden. (…) Und dann brach das Eis. Es kam zu entscheidenden Aussprachen im Pfarrhaus. (…) Überall saßen Menschen, die mit dem Evangelisten sprechen wollten. Viele aber brauchten gar keine besonderen Aussprachen, zumal nicht mit dem Pastor. Sie fanden selbst den Weg zu Jesus und halfen sich gegenseitig in den Häusern.“
Im gleichen Jahr 1924 initiierte Bruns die Errichtung eines Kirchenchores, der am Anfang eher einen Jugendchor darstellte. Ein Jahr später unterstützte er die Gründung eines Posaunenchores, der aus zehn jungen Männern bestand. Überhaupt wusste der junge, dynamische Pastor die Jugend zu begeistern. Unter seiner Obhut begann in seiner Gemeinde die Arbeit eines „Jungmädchenvereins“ und die Errichtung eines „Christlichen Vereins Junger Männer“ (CVJM). Wobei sich die jungen Männer nicht nur zu wöchentlichen Bibelstunden trafen, sondern auch zu sportlichen Aktivitäten, Wanderungen und Radtouren. 1929 wurde sogar ein Jugendheim eingeweiht.
In den Räumen der Schule trafen sich Gemeindeglieder zu Bibelstunden und in Privathäusern zu Hausbibelkreisen bzw. Stubenversammlungen. Sonnabends gab es eine gut besuchte Gebetsversammlung im Pfarrhaus. Im Winter wurden verschiedentlich Bibelkurse für junge Menschen durchgeführt, bei denen man mehrere Tage lang zusammenkam. Das förderte nicht nur den Glauben, sondern auch die Gemeinschaft untereinander. Als auch die erwachsenen Männer und Frauen derartige Veranstaltungen für sich wünschten, gab es auch für sie ein entsprechendes Angebot. Immer wieder lud Bruns auch auswärtige Pfarrer zu Evangelisationen und Vorträgen in seine Gemeinde ein. In der 1996 herausgegebenen Festschrift zum 100jährigen Kirchenjubiläum Hollen heißt es: „Die Zeit war reif zur Ernte. Alle Aktivität, alles Denken und Handeln, alles Beten, Hören und Singen richtete sich auf das große Ziel aus, das ‚Erweckung‘ hieß. (…) In übervollen Gottesdiensten öffneten sich die Menschen unserer Gemeinde für den Glauben an Jesus und fingen ‚ein neues Leben‘ an unter der Leitung Jesu. Sie bekehrten sich, (…) Wie eine Welle ging diese Erweckung durch unsere Gemeinde. Ganze Familien und Nachbarschaften fanden Zugang zum Glauben. Segensspuren dieser lebendigen, ‚revolutionären‘ Zeit sind in unserer Gemeinde noch heute vorhanden.“
Eine missionarische Kirche, das war es, was Bruns sich wünschte. Er wies darauf hin, dass Jesus seinen Jüngern nicht gesagt habe, dass sie Referenten des Christentums sein sollten, sondern seine Zeugen. Und so sollte der Verkündiger auch selbst von der christlichen Botschaft überzeugt sein und bei seiner Verkündigung folgende vier P beachten: Sie sollte a) persönlich sein, so dass die Hörer spürten: „Hier bin ich gemeint“. Sie sollte b) primitiv sein, das heißt: einfach und unkompliziert. Sie sollte c) praktisch sein, mit dem Ziel, „dass jeder etwas mitnimmt für sein Haus, seine Familie, seine Arbeit“. Und sie sollte d) plastisch sein, also bilderreich und anschaulich. In dieser Weise predigte Bruns in und außerhalb seiner Gemeinde, wobei die Menschen in großen Scharen ihm zuhörten.
Aber auch der persönliche Kontakt mit seinen Gemeindegliedern war Bruns sehr wichtig. Er war oftmals stundenlang unterwegs, um seine Hausbesuche zu machen. Er sah es als eine innere Pflicht an, nach Möglichkeit jedes Jahr wenigstens einmal in alle Häuser seiner über 2000(!) Gemeindeglieder gewesen zu sein. So wusste er über deren Freuden, Sorgen und Nöte genau Bescheid. Dabei kam ihm zugute, dass er mit den Leuten plattdeutsch sprechen konnte. Das alles schuf Vertrauen, schuf Nähe. Der Pastor war einer von ihnen.
Peinlich achtete Bruns darauf, auch die sogenannten „kleinen Leute“ nicht zu übersehen. Eines Tages besucht er eine arme Familie. Die kränkliche Hausfrau empfängt ihn freudig. Aber es ist doch recht unsauber und schmuddelig in dem einen Raum, in dem die gesamte Familie wohnen und schlafen muss. Natürlich macht die Frau sofort Tee. Als der auf einem wackeligen Stuhl sitzende Besucher die zwei nur unzulänglich gereinigten Teetassen vor ihm auf dem Tisch betrachtet, da wird ihm schon „etwas ungemütlich“ zumute. Doch das Schlimmste steht ihm noch bevor, als zwei Kinder mit laufenden Nasen in die Stube kommen. Bevor die beiden den Pastor begrüßen, putzt ihnen ihre Mutter mit einem Schüsseltuch die Nase. Und dann wischt sie zu Bruns‘ Entsetzen mit demselben Tuch sogleich die Tassen „sauber“. Nachdem die gute Frau den Tee eingeschenkt hat, meint sie noch: „So, Herr Pastor, das freut mich aber, dass Sie auch mal bei uns eine richtige Tasse Tee trinken, lassen Sie es sich gut schmecken.“ Bruns: „Ich muss offen gestehen, es schmeckte mir nicht gut. Aber die Tasse wurde getrunken, und ich konnte mit der Mutter über Gottes Wort sprechen und mit ihr beten.“
Bei einem anderen Besuch hingegen kam Hans Bruns nicht umhin, sich insgesamt 9 Tassen dieses anregenden Getränks aufnötigen zu lassen. Und das kam so: Als er davon erfahren hatte, dass zwei miteinander verwandte Familien wegen einer Erbschaftsangelegenheit in Streit geraten waren, machte er sich umgehend zu ihnen auf den Weg. Als er nun in das erste Haus tritt, lädt man ihn sogleich zum Tee ein. Nun wusste Bruns, dass es so Sitte war, nicht schon am Anfang der Teezeremonie mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern erst bei der dritten Tasse mit dem eigentlichen Anliegen herauszurücken. Also unterhält man sich zunächst über Unverfängliches: Wie geht’s den Kindern, was macht die Arbeit, was macht das Vieh? Dann aber kommt Bruns auf den Verwandtenzwist zu sprechen. Es gelingt ihm, das Ehepaar zur Einsicht zu bringen, dass es zu einem Teil auch selbst Schuld an dem unseligen Streit habe. Daher nimmt man gerne des Pastors Angebot an, zwischen den beiden Familien zu vermitteln. Also sucht Bruns umgehend die in der Nähe wohnende zweite Familie auf.
Und auch hier derselbe (gast)freundliche Empfang. Und auch jetzt spricht man bei den beiden ersten Tassen über dies und das. Und erst dann schneidet Bruns den Familienstreit an. Wiederum kommt es zu einem ähnlichen Reaktionsablauf wie bei der ersten Familie: Zunächst wird die Schuld den anderen zugeschoben, dann aber folgt das Eingeständnis, dass bei genauerer Betrachtung man selbst wohl auch seinen Anteil am Streit habe. Es wird beschlossen, gemeinsam mit dem Pastor die Nachbarfamilie aufzusuchen. Zuvor ziehen Mann und Frau noch ihre Festtagskleider an.
Feierlicher Empfang nun auch im Nachbarhaus. Am Anfang herrscht zwar noch eine gewisse Verlegenheit. Doch kommt es dann bei der dritten Tasse Tee – für Bruns ist es mittlerweile die neunte! – zu einer herzlichen Versöhnungsszene.
Als 1933 die Nazis an die Macht kamen, „erlag Bruns wie so viele andere zunächst der Faszination des Nationalsozialismus“ (Paul Weßels). Er schloss sich der „Glaubensbewegung Deutscher Christen“ an und trat auch öffentlich für sie auf. So am 29. Mai in Leer bei einer großen Kundgebung. Bereits wenige Monate später kam es dann allerdings bei ihm zu einer konsequenten Kehrtwende. „Als im Dezember“, so Bruns, „die berühmte Kundgebung im Sportpalast Berlins war, in der die Botschaft der Bibel verdreht, ja, geradezu verlästert wurde, bin ich mit einer öffentlichen Erklärung in der Zeitung ausgetreten. Mit einigen meiner Pastorenfreunde, die zum Teil meinetwegen mitgegangen waren, erklärten wir (…), dass wir nun öffentlich Protest einlegen müssten. Darum könnten wir nicht anders, als aus der Bewegung auszuscheiden.“ Gegen das berüchtigte Buch des NSDAP-Ideologen Alfred Rosenberg, „Der Mythos des 20. Jahrhunderts“, verfasste Bruns eine Gegenschrift. Diese wurde zwar gedruckt, dann aber auf Veranlassung höherer Instanzen eingestampft und verboten.
1934 verließ Hans Bruns seine geliebte Hollener Kirchengemeinde und folgte einem Ruf des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes, für den er fortan als viel gefragter Evangelist und Freizeitleiter tätig war. Ihm war es stets wichtig, die Menschen zu einer lebendigen Glaubensbeziehung mit Jesus Christus hinzuführen, welche von Vertrauen zu dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn und dem Gehorsam gegenüber Gottes Wort geprägt war. Er verglich den Entstehungsakt einer solchen Beziehung mit einer Heirat, indem er meinte: „Ich bin mit Jesus verheiratet, wenn ich ihm in aller Klarheit und Öffentlichkeit mein Jawort gebe. Ich gehöre zu ihm. Erst dieses ‚offizielle‘ Ja ist entscheidend, nicht alle früheren Jas und auch nicht, wenn wir später immer neu Ja sagen. Einmal muss jeder sich festlegen.“
Darauf drängte Bruns in seinen Predigten und Evangelisationen, aber auch in persönlichen Gesprächen. Bei dieser „Knopflochmission“ sprach er die Menschen ganz direkt auf die Glaubensfrage an. Dabei kannte er keine falschen Hemmungen, da redete er auch nicht um den heißen Brei. Sein Sohn Warner meinte später: „Vater brauchte Menschen um sich herum, und er sprach sie sehr schnell an, immer mit dem ihm heiligen Anliegen, dass sie Jesus kennenlernen möchten. Er hat wohl kaum eine Reise gemacht, bei der nicht im Zug mit den Mitreisenden ein Gespräch über Jesus und den Glauben geführt wurde.“ Und: „Seine Pastorenbrüder hatten es allerdings nicht immer leicht mit ihm. Er konnte ihnen durch seine direkte Art sehr auf die Nerven fallen. ‚Lieber Bruder …, können Sie zu Jesus beten?‘, so fragte er mehr als einen Amtsbruder. Auch einem Theologieprofessor gegenüber scheute er nicht die sehr direkte Frage: ‚Herr Professor, sind Sie bekehrt?‘.“ Wie Warner Bruns anmerkt, „(konnte) so etwas als taktlose Neugier missverstanden werden, kam aber aus einer echten, tiefen Sorge um die persönliche Klarheit des Verhältnisses zu Jesus. Natürlich lässt sich die große Gelöstheit und Lockerheit, in der Hans Bruns solche Fragen stellte, nicht einfach nachmachen.“
Doch Bruns war nicht nur ein begnadeter Verkündiger und Seelsorger, er besaß auch eine außergewöhnliche schriftstellerische Begabung. Viele erbauliche Betrachtungen und Lebensbeschreibungen sind – in volkstümlicher Sprache verfasst – aus seiner Feder geflossen. Und nicht zu vergessen sein bekanntestes Werk, das zu einem regelrechten Longseller wurde: die sogenannte „Bruns-Bibel“! Dabei handelt es sich um eine moderne Bibelübertragung in allgemein verständlicher Umgangssprache. Sie sollte sich als bahnbrechend für andere moderne Bibelübersetzungen erweisen. Das Besondere an der „Bruns-Bibel“ ist, dass die einzelnen Textabschnitte mit kurzen erklärenden und kommentierenden Anmerkungen versehen sind. 1959 erschien im Brunnen Verlag zuerst das von Bruns übersetzte Neue Testament. Die Nachfrage war überwältigend. Bald schon folgte eine Übertragung des Alten Testaments, und Ende 1963 kam dann die vollständige „Bruns-Bibel“ (AT und NT) heraus. Der Verlag geht inzwischen davon aus, dass alle Auflagen zusammen im siebenstelligen Bereich liegen.
Hans Bruns ist am 8.3.1971 gestorben. Sein Leben war voller Vitalität, Schaffenskraft und Tatendrang gewesen. Dabei sollte allerdings seine Frau Marianne, mit der er acht Kinder hatte, nicht unerwähnt bleiben. Sie hatte ihren Mann bei seinen vielfältigen Diensten nicht nur selbstlos unterstützt, sondern ihm auch stets den Rücken freigehalten.
Special:
Hans Bruns und die Baptisten
Hans Bruns, der später gelegentlich über sich sagte: „Ich bin ein baptistischer-methodistischer-reformierter-lutherischer Pietist“, legte von Anfang an Wert auf gute, vertrauensvolle Beziehungen zu Christen anderer Benennungen, wie etwa den Reformierten oder den Methodisten und den Baptisten. Besonders mit Letzteren teilte er das missionarische Anliegen. So hatte er dann auch gleich zu Beginn seines Dienstes in Hollen seinen reformierten Amtskollegen Heinrich Oltmann aus Loga zu einer mehrtägigen Evangelisationsveranstaltung eingeladen (siehe oben).
Dass schon bald nach dieser missionarischen Veranstaltung auch die Baptisten eine Evangelisation durchführten, sah Bruns durchaus positiv. Dankbar vermerkt er: „Die Nachwirkung dieser Evangelisation (mit Oltmann; M.H.) hielt noch lange an. (…) Eine Evangelisation bei den Baptisten half entscheidend mit, dass das Erleben weiter um sich griff und in die Tiefe ging. Die Weisheit der baptistischen Brüder war so groß, dass sie in keiner Weise zur Taufe drängten, sondern nur Jesus als den Herrn unseres Lebens verkündigten.“
Eines Abends hatte sich Hans Bruns mit seiner Frau gerade zur Nachtruhe begeben. Da hört er draußen vor seinem Haus einen Betrunkenen grölen: „Hier wohnt der junge Baptistenpastor, hier wohnt der junge Baptistenpastor!“ Als er mit dem Krakeelen nicht aufhört, geht Bruns vor die Haustür und ruft dem Mann, in dem er einen seltenen Kirchgänger erkannte, zu: „Sie wollen mich wohl besuchen, jetzt geht das nicht gut. Aber Sie können gern morgen wiederkommen. Ich habe Zeit für Sie.“ Natürlich besuchte der Mann den Pastor am nächsten Tag nicht – stattdessen leistete Bruns dem Mann einen „Gegenbesuch“ ab. Als er in die Küche kommt, flüchtet dieser jedoch in eine kleine Nebenkammer. Somit konnte er nur mit der Ehefrau über den nächtlichen Vorfall sprechen – „etwas lauter als sonst“, damit der Geflüchtete auch alles mitbekam…
Bezeichnend ist nun aber, wie Bruns selbst die gegrölten Worte kommentierte: „Ich war ja“, so schreibt er, „wahrlich kein Baptistenpastor. Mit der kleinen Baptistengemeinde (in Südgeorgsfehn; M.H.) hatte ich ein gutes Verhältnis. (…) Die Leute kamen auch wohl zu mir in die Kirche. Aber ich war landeskirchlicher Pastor. – Warum der Mann mich so nannte, habe ich nie erfahren. Wusste er keinen anderen Ausdruck zu finden, um klarzumachen, dass ich irgendwie anders verkündigte und redete als vielleicht andere? Dann war es ja nur eine Ehre für die Baptisten wie für mich, dass er so schimpfte.“
Gleich am Anfang seines Dienstes hatte Bruns übrigens seinen Antrittsbesuch bei dem Baptistenprediger im benachbarten Südgeorgsfehn gemacht. Diese Gemeinde war etwa zwei Jahrzehnte zuvor entstanden, als der damalige Hollener Kirchenpfarrer allzu stark die lutherische Lehre von der Taufwiedergeburt betonte. Dem konnten eine ganze Reihe von Gemeindegliedern nicht zustimmen und schlossen sich zu einer baptistischen Freikirche zusammen. Seitdem ging der gekränkte Pfarrer dem Baptistenprediger aus dem Weg. Anders Hans Bruns. Er schreibt: „Nun hatte ich in völliger Harmlosigkeit diesen Besuch gemacht. Es ist dann je länger, je mehr zu einer herzlichen Allianz mit allen freikirchlichen Gemeindegliedern gekommen. Die Baptisten kamen sogar gelegentlich zu meinen Gottesdiensten, umgekehrt besuchten viele gern die Stunden der Baptisten. Ich weiß noch, wie ein junges Mädchen durch eine Evangelisation bei den Baptisten zum lebendigen Glauben kam und sich dann taufen ließ. Ich habe sie in keiner Weise gehindert, das zu tun, und sie hat mit unserer kirchlichen Arbeit gerne Verbindung gehalten.“
Der frühere Baptistenpastor Walter Feldkirch erinnerte sich 1971 in einem Beitrag in „Die Gemeinde“: „Als ich 1946 Prediger der kleinen ostfriesischen Gemeinde Südgeorgsfehn wurde, traf ich bei meinen Hausbesuchen überall auf die Segensspuren, die der Dienst von Hans Bruns, von 1924 bis 1934 Pastor in Hollen, hinterlassen hatte. Südgeorgsfehn ist Nachbardorf und Pfarrbezirk von Hollen, und es waren damals knapp zwölf Jahre her, dass Hans Bruns Hollen verlassen hatte. Wenn ich in den blitzsauberen Küchen im Hörnstuhl saß und meine obligaten drei Tassen Tee trank (…), kam das Gespräch oft auf Hans Bruns. Dann leuchteten die Augen meiner Bauern. Ostfriesland hat Hans Bruns viel zu verdanken, aber Hans Bruns auch den Ostfriesen.“
Literatur- und Quellennachweis
Hans Bruns: Ich habe das Staunen gelernt. Wuppertal/Gladbeck 1966
Hans Bruns: Hör mal zu! Kurzerzählungen aus Leben und Dienst. Gladbeck 1951
Hans Bruns: Hör weiter zu! Aus Leben und Dienst schlicht erzählt. Gladbeck 1952
Warner Bruns: Hans Bruns. In: Arno Pagel (Hg.): Sie wiesen auf Jesus. Marburg 1978, 136-143
Georg Collmann: Die Kirchengemeinde Hollen und der junge Pastor Hans Bruns. In: Festschrift 100-jähriges Kirchenjubiläum Hollen (1896-1996), 26-30
Walter Feldkirch: Hans Bruns und Ostfriesland. In: Die Gemeinde 30/1971, 5f
Hella Thorn: Bibel-Pionier und Evangelist. 50 Jahre Bruns-Bibel. In: Fasznation Bibel 3/2013, 37f
Paul Weßels: Hans Bruns. Kurzbiographie auf der Webseite der Ostfriesischen Landschaft sowie BLO IV. Aurich 2007, 76-78
Paul Weßels: Nicht hoffnungslos, sondern handelnd. Heinrich Oltmann (1892-1937). Ein reformierter Pastor im Kirchenkampf. Wuppertal 2002
Pressetext Brunnen Verlag: 50 Jahre Bruns Bibel sowie Mitteilung des Brunnen Verlags an Matthias Hilbert am 15.7.2019 in einer Mail.
Gerriet Herlyn – Plattdeutscher Prediger und Bibelübersetzer
Gerrit Herlyn (1909-1992) ist ein in Ostfriesland und darüber hinaus überaus bekannter und geschätzter reformierter Pfarrer gewesen. Das lag nicht nur an seiner volkstümlichen und humorvollen Art, mit der er als Seelsorger und Verkündiger des Evangeliums viele Herzen erreichte, sondern das lag auch an seinem schriftstellerischen Engagement. So war er von 1938-1979 neben seinem Pfarrdienst Schriftleiter des Sonntagsblattes für ev.-ref. Gemeinden gewesen. Er prägte die norddeutsche Kirchenzeitung so sehr, dass man gemeinhin vom „Herlynschen Sonntagsblatt“ sprach. Auch veröffentlichte er Jahr für Jahr Beiträge für den deutschlandweit vertriebenen Neukirchener Kalender.