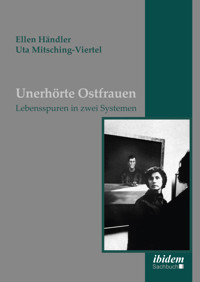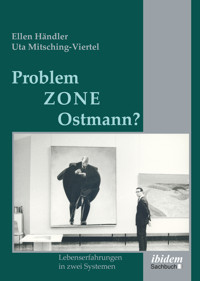
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wendeverlierer, Abgehängte, Rechtspopulisten – mit diesen Schlagworten sehen sich Männer aus dem Osten Deutschlands konfrontiert. Ellen Händler und Uta Mitsching-Viertel blicken hinter die Klischees und geben den Ostmännern eine Stimme. Stück um Stück entsteht ein differenziertes, vielschichtiges Bild der Lebenswirklichkeiten in Ostdeutschland vor und nach der Wende. Die Autorinnen nehmen die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise durch achtzig Jahre deutscher Geschichte, warmherzig erzählt, zuweilen tragisch, immer aber lesenswert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Geleitwort von Matthias Platzeck
Der Ostmann ist anders und will es auch bleiben!
1. Der Ostmann ist durch 40 Jahre DDR geprägt, sein Erfahrungsvorsprung aus beiden deutschen Systemen macht ihn nachhaltig.
Ich bin ein ziemlich sozialer Mensch mit einem Faible für Gerechtigkeit
»Meine Kugel ist tausendmal schneller als ihr rennen könnt.«
FDJ* – diese drei Buchstaben gehören zu meinem Leben wie Vater und Mutter
Seit meiner Schulzeit lege ich als DJ Musik auf
Wenn wir uns streiten, streitet sie und ich höre geduldig zu
Die Seele der Demokratie ist die Liebe zum Kompromiss
Geschäft und Geld sind im Westen immer das Wichtigste
Was andere in der DDR nicht machen konnten, konnten wir machen
2. Die Arbeit ist für den Ostmann Sinn des Lebens, ein kulturelles Gut und nicht nur Mittel zum Geldverdienen. Der Betrieb war für ihn Lebensmittelpunkt. Aufgrund der Mangelwirtschaft lernte er gut zu improvisieren. Der Verlust von Arbeit führte zu Brüchen männlicher Identitäten.
Heute sehe ich die Plattenbauten positiv
Das Schicksal meint es wohl nicht gut mit ostdeutschen Männern
Der Westen kriegte gute Leute, die er sehr billig einkaufen konnte
Das Arbeitsamt meinte: »Eigentlich können wir Sie nicht vermitteln!«
Ich war nie für den Westen, obwohl ich gerne Whisky trinke
Vieles am Bildungssystem der DDR hätte man bewahren sollen
3. Für den Ostmann ist Familie selbstverständlich. Obwohl er Gleichberechtigung anerkennt, ist der Familienalltag im Wesentlichen weiterhin klassisch patriarchalisch organisiert.
Das sind Ossis, die können nichts
Mein großer Vorteil ist, in zwei Systemen gelebt zu haben
Ich hatte so viele Verwandte im Westen, aber keiner nahm mich auf
Für uns war die Familie am wichtigsten
Hartz IV hat mich manchmal in schiere Verzweiflung gebracht
Man musste immer gut mit den Konsumfrauen können
Ich habe nie Unterschiede zwischen meinem eigenen Kind und dem meiner Frau gemacht
4. Die Nichtanerkennung der Bildungsabschlüsse, Arbeitslosigkeit und entwürdigende Kämpfe um Arbeitsplatz, Einkommen und Rente führten zu anhaltenden Verletzungen.
In dieser neuen Gesellschaft kannst du nur als Einzelkämpfer bestehen
Dem Ostmann fehlt nicht die Individualität
Nimm nur die Kämpfe auf, die Aussicht auf Erfolg haben, wenn nicht, verlasse die Situation
Gott hat uns hierher gestellt, und wir wollen unsere Rolle wahrnehmen
Ich brauche zu Hause kein Heimchen, das auf meine Heimkehr wartet
Kontakt zu den Westverwandten wollte ich nicht abbrechen – mein Karriereende
Meine Eltern waren strenger als wir Eltern heute
Wenn wir gewonnen hätten, wäre es schlimmer gekommen
5. Die Erinnerung an die Armeezeit spaltet die Ostmänner. Für einen Teil war sie verbunden mit beruflicher Entwicklung, für einen anderen mit Demütigungen.
Ich wollte mit achtzehn die Enge meines Zuhauses unbedingt verlassen
»Wenn Ihre Frau nicht Mitglied der Partei ist, können Sie nicht Kommandeur werden.«
Wenn damals die Amerikaner nicht aus Thüringen abgezogen wären, wäre ich heute ein Wessi
Ich will keine Heldenbrust
Meine 16 Reisepässe hab ich nach der Wende im Tresor der Reisestelle gefunden
Ich bin ein Flüchtlingskind
6. Für die Mehrheit der Ostmänner ist die AfD keine Alternative. Sie verstehen, dass viele Ostdeutsche frustriert sind. Das Vertrauen in die Politik und parlamentarische Demokratie ist erschüttert.
Zum Glück ist Strom unpolitisch und farbenblind
Ich war der Mann für alles: Reinigung, Reparaturen, Gartenarbeit
Ich bin DDR-kritisch erzogen worden
In meinem Leben spielte Artistik immer die Hauptrolle
»Mit Risiken und Nebenwirkungen«: Ostmännliche Positionen zu Schwangerschaftsabbruch und Vaterschaftstest
»Problemzone Ostmann?« Plädoyer für eine Differenzierung des Diskurses über ›den Osten‹ im Allgemeinen und ›den ostdeutschen Mann‹ im Besonderen
Literaturverzeichnis
Glossar
ibidem Verlag, Stuttgart
Geleitwort
Ein spannendes Buch mit vielen offenen und versteckten Botschaften und Erkenntnissen. Nach den Unerhörten Ostfrauen nun die Männer – in großer Vielfalt und mit völlig unterschiedlichen Lebensentwürfen und Lebensläufen. Und hier liegt für mich eine der wichtigen Botschaften dieses Buches versteckt. Für viele westdeutsche Landsleute ist der Blick auf den Osten bis heute davon bestimmt, oder besser getrübt, dass oft relativ eintönige und einheitliche Biografien erwartet werden. Was soll es im Osten schon Spannendes gegeben haben? Welch ein Irrtum!
Zum zweiten finde ich es immer wieder interessant, wie viel Bestimmtheit für gelebtes Leben doch in den jeweiligen Ausgangssituationen und daraus resultierenden Motivationen enthalten ist. Immer wieder schimmert aus den Schilderungen sehr deutlich, dass die DDR eine Arbeitsgesellschaft war – vieles, auch im privaten Leben, rankte sich um den Betrieb, die Brigade.
Das Buch macht nochmal sehr deutlich, dass wir einem Irrtum unterliegen, wenn wir denken, dass 1989/90 eine neue Zeitrechnung bei null für alle begonnen hat. Es war eine politische und gesellschaftliche Zäsur, aber die Lebensläufe, die Biografien schrieben sich fort. Was nach diesem Einschnitt passierte, hing oft eng mit den Jahrzehnten davor zusammen – im Guten wie im Schlechten.
Man bekommt beim Lesen der einzelnen Geschichten eine Ahnung davon, was unser Bundespräsident Steinmeier meint, wenn er sagt, dass einen solchen Umbruch in seiner Wucht und Tiefe, wie ihn alle Ostdeutschen erlebt haben und verarbeiten mussten, kein Westdeutscher nach dem Zweiten Weltkrieg durchgemacht hat.
Auch deshalb ist es gut, was hier aufgeschrieben wurde – vielleicht wächst damit mehr Verständnis füreinander. Es sind zeitgeschichtliche Dokumente von bleibendem Wert.
Matthias Platzeck,
Ministerpräsident des Landes Brandenburg a.D.,
im Februar 2021
Der Ostmann ist anders und will es auch bleiben!
Was man über Ostmänner wissen sollte:
1. Der Ostmann ist durch 40 Jahre DDR geprägt, sein Erfahrungsvorsprung aus beiden deutschen Systemen macht ihn nachhaltig.
Norbert, Jahrgang 1955 | 4 Kinder, verheiratet in zweiter Ehe
Ost: Rinderzüchter, Baugeräteführer, West: Bauunternehmer, Wildtierzüchter
Kraftfahrer, Bauleiter, Haupttechnologe
Ich bin ein ziemlich sozialer Mensch mit einem Faible für Gerechtigkeit
Ich lebte nicht allzu lange bei meinen Eltern. Sie trennten sich gerade. So kam ich zu meiner Großmutter in ein kleines Dorf bei Magdeburg. Meine Mutter studierte in dieser Zeit an der Universität. Das Dorf hat mich geprägt, die Sehnsucht nach dem weiten Land und nach Stille kommt vielleicht schon aus dieser Zeit. Meine Großmutter war ein einfaches Weiblein, mein Großvater arbeitete im Straßen- und Tiefbaukombinat in Magdeburg. Die Großmutter hatte früher bei der Post die Briefe ausgetragen. Das war nicht mehr notwendig. Sie hatte einen Hektar Spargelfeld, sich vier große Gärten aus irgendwelchen Schrebergärten ergaunert, dazu noch vier alte Häuser erworben, nichts Tolles, alte Bauernhäuser, die sie vermietet hatte. Sie war ein absoluter Spartyp. Mit dem Großvater ging es jeden Tag in die Gärten oder auf die Felder. Bei der Ernte gab's kein Abhauen. Erst nach dem Mittagessen kamen viele Freunde. Eine unbeschwerte Kindheit mit Wäldern und Feldern und Seen. Die enge Beziehung blieb bestehen, auch als ich in Berlin lebte. So fuhr ich in allen Ferien, bis ich 16 oder 17 Jahre alt war, allein mit dem Zug von Berlin-Schöneweide nach Magdeburg. Dort wurde ich abgeholt. Ich war einfach gerne bei meinen Großeltern. Die Tatsache, dass meine Großmutter mich mehr als ihren Sohn denn als ihren Enkel sah, begeisterte meine Mutter sicherlich nicht. Meinen Vater kannte ich nicht. Den lernte ich erst kennen, als ich 28 Jahre alt war. Inzwischen hatte er noch vier Kinder aus verschiedenen Beziehungen und einer Ehe. Nur mit einem Bruder pflege ich engeren Kontakt. Die anderen sehe ich gelegentlich, es ist nett und höflich.
Mein Dorfleben endete abrupt zu Beginn meiner Schulzeit. Diese begann ich in der neuen Familie in Berlin-Adlershof. Ich wusste gar nicht, dass meine Mutter mit einem neuen Mann verheiratet war. Und plötzlich hatte ich eine jüngere Schwester. Das Verhältnis zu meinem Stiefvater war von Anfang an etwas schwierig. Wir fanden nie zueinander. Beide Eltern waren beruflich sehr beschäftigt. Sie bemühten sich um uns. Aber miteinander gespielt wurde nie. Die Arbeit stand an erster Stelle.
Meine Schulzeit war für mich sehr interessant. Ich war zu Anfang ein ganz guter Schüler. Allerdings führte meine Aufmüpfigkeit in der Schule zu großen Konflikten in der Familie, sodass meine Mutter mir antrug, wegen der Neigung zum Land und zur Landwirtschaft einen solchen Beruf zu ergreifen. Dies war mit einem Umzug in ein Internat verbunden. So weit weg zu sein war wohl das Richtige für die ganze Familie. Ich war schon ziemlich renitent. So zog ich in eine kleine Stadt in der Nähe Berlins, um den Beruf des Rinderzüchters oder des Zootechnikers, verbunden mit dem Abitur, zu erlernen. So war die Familienzeit für mich mit 15 Jahren wieder vorbei.
Damit startete 1971 die große Freiheit. Eine wunderbare Zeit war dies in unserem Lehrlingsinternat mit einer Truppe von circa 200 Leuten. Wir wurden gute Freunde und unternahmen gemeinsam unheimlich viel, hatten ausgiebig Spaß, wohnten zusammen, tanzten viel. Wir erlernten einen interessanten, aber körperlich schweren Beruf. Wir 16-Jährigen arbeiteten in Zwölf-Stunden-Schichten. Die Kühe mussten ja regelmäßig gemolken werden. Die drei Jahre flossen schnell dahin. Allerdings hatte ich Schwierigkeiten mit dem Abitur. Mit 18, 19 Jahren wurde Schule zur Nebensache, zumal ich eine wunderhübsche Freundin hatte. So erlebte ich das letzte Vierteljahr vor dem Abitur gar nicht mehr in der Schule. Das führte dazu, dass man mich ausgiebig prüfte. Alle anderen wurden zweimal, ich wurde fünfmal geprüft. Und in Biologie fiel ich durch. Ausgerechnet in Biologie, wo ich vorher sehr gute Noten hatte, und nun wusste ich nicht, wie sich die Farne und Moose vermehrten. Vier Wochen später hat es funktioniert. Bei mehreren Besuchen der Lehrerin konnten wir die Lücken nacharbeiten, sodass ich das Abitur noch ablegen konnte.
Mir war klar, dass Rinderzüchter oder Milchproduzent nichts für mich ist. Das galt vor allem für die Zwölf-Stunden-Schichten, auch Weihnachten und Silvester. Zunächst musste ich aber noch anderthalb Jahre zur Armee. Erst sollte oder wollte ich zum Wachregiment der Stasi. Dann aber nicht mehr, und es gelang mir, mich dort zu entpflichten. Stattdessen wurde ich in die Nähe von Neuseddin eingezogen. Ich war kein guter Soldat, bin sehr oft nachts über den Zaun geklettert und nach Berlin zum Tanzen gefahren. Alles Militärische war mir immer sehr fremd. Ich habe nie verstanden, warum man es zu seinem Beruf machen kann, Leute totzuschießen.
Insofern ist mir der Antifaschismus deutlich näher. Faschisten und Militaristen halte ich mit ihrem politischen Ansatz einfach für schwachsinnig. Nach der Armeezeit kam ich kurz zurück in die Familie, wollte aber nicht mehr zu Hause wohnen. Da meine langjährige Freundin das auch nicht wollte, kamen wir zusammen. Sie wurde schwanger. Mit Kind bekamen wir in Adlershof eine Wohnung. So konnte ich mit 21 Jahren die Familie wieder verlassen. Die erste Ehe war nicht die große Liebe.
Da ich als Rinderzüchter nicht arbeiten wollte, suchte ich mir eine Arbeit auf dem Bau. Ich wurde Bauhelfer bei den großen Kränen. Beim Anhängen großer Lasten wurde ich schwer an der Nase verletzt, als der Kranführer nicht ganz aufmerksam war. Der Bauberuf wurde trotzdem der richtige. Es gab sehr viele Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Das nutzte ich und wurde Baugeräteführer. Bei Ladearbeiten auf dem Gelände des späteren Unfallkrankenhaus Berlin traf ich eine wilde Horde von Kraftfahrern. Die gehörten zum Tiefbaukombinat. Und sie überzeugten mich beim Frühstück, Kraftfahrer zu werden, weil man dort das Doppelte verdienen konnte. Ab 1976 arbeitete ich acht Jahre als Kraftfahrer. Immer öfter kamen leitende Leute auf mich zu und schlugen mir vor, Brigadier und Mitglied der SED* zu werden. Eine Brigade zu übernehmen bedeutete immerhin, 60 Leute in zwei Schichten mit 30 Fahrzeugen zu führen. Die Aufgabe klang interessant, aber zu diesem Zeitpunkt war ich an einer Mitgliedschaft in der SED überhaupt nicht interessiert. Das hätte wahrscheinlich zu Verwerfungen im Freundes- und im Kollegenkreis geführt, weil man so eine Sache kommunizieren muss. Bis dato war ich nicht durch große politische Aktivität aufgefallen. Allerdings war ich immer ein sehr sozialer Mensch. Ich sehe Ungerechtigkeiten sehr deutlich und engagiere mich. Mein soziales Gewissen ist stark ausgeprägt.
Partei- und Betriebsdirektor versuchten mich immer wieder zu überzeugen. Ich fand die sympathisch und ihre Argumente waren so überzeugend, dass ich mich nach bestimmt acht ergebnislosen Werbungsversuchen doch entschloss, die Parteizentrale aufzusuchen und zu sagen: »Okay, ich mache das.« Wenn ich mich entschließe, etwas zu machen, dann aus vollem Herzen und mit Leidenschaft. Wir waren kein einfacher Verein, sondern ein wilder Haufen mit unterschiedlichsten politischen Einstellungen. Mit der Brigadeleitung musste es unbedingt klappen. Die 60 Leute durften keinesfalls weniger Geld verdienen. Nach dem bisherigen System verdienten sie 1.100 Mark. Das klappte aber nur durch Betrug. Man hätte 18-mal sieben Kilometer durch Berlin hin- und herfahren müssen, was in acht Stunden nicht möglich war, aber jeden Tag auf den Zetteln stand. Alle wussten das. Mit meiner Entscheidung, die Brigade zu übernehmen und in die Partei einzutreten, war für mich klar, dass ich diese Methode nicht fortführen würde. Von diesem Tag an wurde nur noch das auf dem Arbeitsschein vermerkt, was wirklich geleistet wurde.
Ich hatte aber auch viele neue Ideen, um sinnlose Fahrten zu unterbinden. So schlug ich vor, eine kleine Zentrale in der Nähe der Baustelle aufzubauen, bestehend aus zwei oder drei Wohnwagen und einem Sanitärwagen. Ich übernahm die Arbeiten vor Ort und schlug vor, unsere Fahrzeuge mit Hängern auszurüsten, um nicht nur zwölf, sondern 20 Tonnen auf einmal zu transportieren. Später bat ich die Technologen, einmal auszurechnen, wie lange man denn für so eine Baugrube eines Hochhauses brauchen würde. Wenn wir es ein, zwei oder drei Tage schneller schafften, könnte man den Gewinn in DDR-Mark ausrechnen und vergüten. So entstanden für das Tiefbaukombinat ganz neue Objekt- und Brigadeverträge mit der Folge, dass meine Leute viel mehr Geld verdienten. Natürlich ging das nicht ohne Widerstände. Die Truppe war nicht homogen. Es gab schon Sprüche: »Du rote Sau, ich häng dich auf.« Es war ganz schön wild. Aber wir erhielten die höchste Auszeichnung der FDJ* auf einem Jugendfest – den Ernst-Zinna-Preis, verbunden mit 30.000 Mark Prämie. Das war das überzeugendste Argument. Danach waren wir eine echte Truppe, über ganze drei Jahre lang.
Parallel dazu wollte ich mein vergammeltes Abitur aufbessern. So habe ich mich zwei Jahre aus eigenem Antrieb in die Abendschule gesetzt, um die beiden Vieren in Biologie und Chemie zu verbessern. Mit Zweien bewarb ich mich für einen Studienplatz im Fernstudium an der Technischen Hochschule Leipzig in der Fachrichtung Technologie der Bauproduktion Tiefbau. Ich wurde angenommen. Dann begann etwas ganz Kurioses: Man bekam, wenn man im Betrieb arbeitete und studierte – das wäre heute unvorstellbar – 56 Studientage zur freien Verwendung, ohne dass jemand gefragt hätte, was man an diesem Tag genau machte. Ich war immer noch der Brigadier und jede sechste Woche war ich die ganze Woche in Leipzig oder in Berlin an der Uni. Und das viereinhalb Jahre lang, verbunden mit einem Kaderentwicklungsplan. Ich sollte nach Abschluss des Studiums Produktionsdirektor des Tiefbaukombinats werden. Mein Grundstudium absolvierte ich in Leipzig, das Fachstudium in Berlin an der Humboldt-Universität. Das waren noch einmal drei Jahre unbeschwerte Zeit mit 56 Studientagen, die schon mal Badetage wurden. In Vorbereitung meiner späteren Tätigkeit als Produktionsleiter wurde ich als Bauleiter eingesetzt, zuständig für die Verkehrsbauten des neuen Stadtbezirks Berlin-Hohenschönhausen. Der Verdienst ging damit von 700 auf 1.100 Mark hoch, was natürlich nicht so viel war, wie die Kraftfahrer bekamen. 1982 erreichte mich die Anfrage, ob ich nicht die Streckenbauabteilung für die Tatrastraßenbahnen*, einem Betrieb der Deutschen Reichsbahn, übernehmen wollte. Das schlagende Argument waren 340 Mark mehr Gehalt. Das hat mich interessiert, zumal ich ohnehin nicht Produktionsdirektor werden wollte. So wurde ich 1984 der Bauleiter für die Tatrabahnen.
Zu diesem Zeitpunkt zerbrach meine erste Ehe mit zwei Töchtern. Sie war aus meiner Sicht zerrüttet. Sicherlich trug dazu bei, dass ich mich kurz vorher in eine Kommilitonin verliebt hatte. So stellte ich für meinen Eintritt in die Tatra-Bauleitung die Bedingung, dass sie dort auch tätig sein kann. Sie wurde Disponentin und ich Bauleiter. Wir bauten zusammen die Tatrastraßenbahn von Berlin-Springpfuhl bis zur Wendeschleife Ahrensfelde. Als die Aufgabe der Verkehrserschließung des Wohngebiets in Berlin-Hellersdorf für 80.000 Leute anstand, wurde ein neuer Betrieb der Deutschen Reichsbahn gegründet. Auftrag war der Neubau der U-Bahn-Strecke nach Hönow, ein 800 Millionen DDR-Mark Projekt. Dort wurde ich Haupttechnologe, verantwortlich für die Koordinierung aller dort eingesetzten 48 Kreisbaubetriebe aus der ganzen DDR. Die hätten lieber im Vogtland oder an der Küste in ihrem eigenen Kreis gearbeitet als Stellwerke oder Bahnhofsgebäude in Berlin zu bauen. Und alles stand unter Zeitdruck. Diese Strecke in nur zwei Jahren zu planen und zu bauen wäre heute undenkbar. Wir hielten den Termin. Pünktlich eröffnete die neue U-Bahn-Strecke am 30. Juni 1989. Danach suchte ich nach einer neuen Herausforderung, zumal zu dem Zeitpunkt meine Ex-Frau und meine beiden Töchter per Ausreiseantrag das Land in Richtung Westberlin verlassen hatten. Das traf mich schwer. Ich nutzte nun alle meine inzwischen guten Beziehungen, um für den Umbau des Bahnhofs Zoo in Westberlin zuständig zu werden. Der unterstand der Deutschen Reichsbahn der DDR. Zwischen Juli 1989 und Januar 1990 überprüfte man meine Kaderakte. Das Thema war mit der Wende erledigt.
Mit dem 9. November änderte sich für mich eigentlich alles. Endlich konnte ich meine Töchter wiedersehen. Inzwischen hatten meine zweite Frau und ich zwei Söhne miteinander. Mit ihr bin ich jetzt seit 36 Jahren verbunden. Gewohnt haben wir damals in Berlin-Hellersdorf in einer Neubauplattenwohnung mit 86 Quadratmetern für 80 Mark. Und das in sehr schöner Umgebung direkt am Stadtrand mit sehr vielen jungen Leuten. Meine Frau hatte einige Verwandte im Westen, unter anderem einen sehr netten Patenonkel, einen Braunschweiger Gynäkologen. Bei unserem ersten Besuch umarmte er mich und erklärte mir, dass ich doch blöd wäre, wenn ich weiterhin als Angestellter arbeitete. Viel besser wäre es, selbst eine Baufirma zu gründen. Vieles war zu bedenken. Ich war entschlossen, quittierte meinen Job und begab mich auf die Suche nach einem Grundstück. Das brauchte man, um Maschinen abstellen zu können. So fuhr ich nach A., das ich 1974 nach dem Abitur verlassen hatte. Dort hatte gerade ein junger, 28-jähriger Bürgermeister aus der DDR-CDU seine Arbeit aufgenommen. Er war sofort bereit, mir eine Fläche zuzuweisen. Den amtlichen Vermerk für meine Tiefbaufirma gab mir der Kreisbaudirektor. Er setzte den DDR-Stempel auf einen DDR-Kopfbogen. So war meine Firma für Tief- und Straßenbau am 9. Februar 1990 etabliert. Mein Nachfolger bei der Bahn überließ mir einen alten kleinen Bagger und einen Radlader und ein paar Aufträge. Nur Arbeitskräfte fehlten mir. Es gab nämlich keinen Arbeitsmarkt. Also suchte ich und fand einen notorischen Trinker und zwei Stasileute, die früher auf der Autobahn die Fahrzeuge kontrolliert hatten. Einen Mitarbeiter aus der alten Firma überzeugte ich auch. Mit vier, fünf Leuten und unserer Hände Arbeit begannen wir, unser Geld zu verdienen. Nach dem ersten Monat stand auf unserer Rechnung ein wahnsinniger Betrag von 88.000 Mark. Das war ein Erfolg. Dann hörten wir im Radio von einem Kredit, einem Sonderprogramm für ostdeutsche Betriebe. Wir gingen zur Dresdner Bank. Man erklärte uns, dass Baubetriebe gefördert würden, und fragte, wie viel Geld wir denn haben wollten. Da schoss ich sofort heraus: 400.000 DM. Und die Sachbearbeiterin: »Ja, das ist in Ordnung. Kommen sie morgen früh um 8:00 Uhr das Geld abholen.« Davon kauften wir sofort vernünftige Arbeitsgeräte. Im Nachbardorf machte mich eine junge Bürgermeisterin darauf aufmerksam, dass die Oberfinanzdirektion in Cottbus Gelder für Bauprojekte verteilte. Ich überzeugte sie, für ihr Dorf eine Entwässerungsanlage zu bauen. Die Projektunterlagen lagen seit Jahren im Dorfarchiv. Damit fuhren wir beide nach Cottbus. Wir saßen zusammen mit 50 Bürgermeistern. Dort hieß es, dass nur der Geld erwarten könne, der bereits ein fertiges Projekt hätte. Das konnte die Bürgermeisterin des Nachbardorfs vorlegen. Das Projekt wurde für gut befunden. Auf die Frage, was das denn koste, rutschte mir raus: »2,6 Millionen.« Sie bekam die Bewilligung. So bauten wir die Entwässerung und unsere kleine Baufirma entwickelte sich, bis ich eines Tages in Berlin meinem alten Vorgesetzten, dem Vizepräsidenten der Reichsbahn Baudirektion, begegnete. Er wäre jetzt der Sprecher der Planungsgesellschaft Bahnbau Deutsche Einheit, obwohl er ein Absolvent der Parteihochschule Moskau war. Er schlug mir vor, meine Aktivitäten wieder mehr auf Eisenbahn-Bauarbeiten zu verlegen. Wir waren nun inzwischen 60 Leute und bauten von 1994 bis 2002/2003 in ganz Deutschland Eisenbahnstrecken. Zur Jahreswende 2002 wurde die Sache komplizierter. Es kam zu sehr vielen Insolvenzen. Meine Firma musste geschlossen werden, weil wir leichtsinnigerweise an einem Großprojekt, der Schnellverbindung München-Nürnberg, beteiligt waren, die wegen technischer Fehler in der Projektierung anderthalb Jahre auf Eis lag. Die auflaufenden Kosten beliefen sich auf erhebliche Größenordnungen. Meine Tätigkeit im Bausektor stellte ich 2006 endgültig ein.
Dazu muss man wissen, dass meine Frau ab 1990/91 eine eigene Baufirma gegründet hatte. Eine Reihe meiner Erfahrungen konnte sie nutzen. Arbeit gab's genug. Diese Firma gibt es bis heute. Sie ist sehr erfolgreich, gerade auch als verlässlicher Partner der Deutschen Telekom bei der Erschließung in Berlin und im ganzen Bundesgebiet. Meine Frau führt diese Firma immer noch. Ich aber beschloss, mich mit 51 Jahren aus diesem Sektor zu verabschieden.
Es war mir körperlich und seelisch zu viel geworden. Ich hatte nervliche Probleme wegen des Stresses: Von früh bis in die Nacht, fast jeden Tag in der Woche nur unterwegs zu sein und die Familie nicht zu sehen, das war zu viel. Wir hatten Baustellen in ganz Deutschland, die ich täglich aufsuchen musste. Wir bauten den Bahnhof Bitterfeld, die Strecke Rostock-Wismar, Nürnberg-Ingolstadt, diverse Brücken im Raum Leipzig, in Mecklenburg-Vorpommern, in Frankfurt oder Berlin, insgesamt mehr als 400 bis 450 Kilometer Eisenbahnstrecke. Für mich war es einfach genug. Bei einem Urlaub 2006 eröffnete ich meiner Frau, dass ich eine Farm für die Zucht wilder Tiere gründen wollte. Das war zu diesem Zeitpunkt, wahrscheinlich, weil ich es mir leisten konnte, die beste Entscheidung. Ich kam zurück zu dem, was ich ursprünglich mal gelernt habe und was ich eigentlich nie wieder machen wollte. So führe ich seitdem einen Wildzuchtbetrieb hier ganz in der Nähe, der mich sehr befriedigt.
Wir haben vier Kinder, zwei aus erster Ehe. Nachdem die beiden Töchter nach Westberlin verschwunden waren und die Grenze 1989 geöffnet wurde, gab es für mich eigentlich nichts Wichtigeres, als diese Kinder wiederzusehen. Alles andere hat mich wenig interessiert. Nach kurzem Streit unter Androhung von Rechtsmitteln klappte das. Eine Tochter war inzwischen dreizehn Jahre alt. Als sie sieben war, hatte ich meine Frau verlassen, als sie dreizehn war, haben wir uns wiedergefunden. Die andere war inzwischen sieben Jahre alt. Wir konnten das nachholen, was wir in den sechs Jahren versäumt hatten. Heute ist es ein wunderbares Verhältnis, auch mit und zu meinen beiden Söhnen aus der zweiten Ehe. Drei haben ihren Weg gemacht. Einer der Söhne ist mit 34 Jahren in die Firma meiner Frau eingestiegen und wird sie in fünf bis sechs Jahren selbst weiterführen. Mein zweiter Sohn sucht noch seinen eigenen Weg.
Ich erwähnte bereits, dass ich ein ziemlich sozialer Mensch mit einem starken Faible für Gerechtigkeit bin. Das betrifft nicht nur das Zwischenmenschliche. Meine Frau, ich und unsere Kinder haben an einigen Orten in der Welt Freundschaften entwickelt, die auch damit zu tun haben, dass wir helfen. Wenn wir zum Beispiel in den Urlaub fahren – wir reisen seit vielen Jahren nach Kenia oder Südafrika –, bauen wir jedes Mal in dem Dorf unserer Freunde ein Haus. Das ist nicht teuer. Es kostet 1.000 Euro. Ich bin nicht bereit, 1.000 Euro an irgendwelche obskuren christlichen Organisationen zu spenden, weil ich nicht möchte, dass sich das christliche Missionieren verfestigt oder dass sie sich davon ihr Auto finanzieren. Wir spenden direkt. Da weiß ich, dass die Spende glücklich macht.
Ich habe eine sehr selbstständige Frau. Wir leben zusammen in einer tiefen Einigkeit und Verbundenheit. Wir haben aber nie die Absicht gehabt, uns gegenseitig zu kontrollieren. Wenn ich morgen sagen würde, dass ich für drei Wochen in die Antarktis fahre, ist das keine Frage der Diskussion, sondern dann habe ich mich bestenfalls mit ihr abzustimmen, dass wir nicht zur gleichen Zeit fahren, damit einer den Hund versorgt. Man muss in einer Beziehung in politischen Dingen übereinstimmen. Man kann zu vielem unterschiedliche Meinungen haben. Wenn man sie kultiviert vorträgt, ist das okay: Aber im unmittelbaren Familienbereich gebe ich mir alle Mühe, die Ideen und Gedanken, die mich prägen, weiterzugeben. Mit meiner Frau bin ich mir darüber einig. Sie führt eine große Firma und hat zum Beispiel – und das sagt schon vieles ,– als in Brandenburg am 8. Mai 2020 noch kein Feiertag war, ihren 36 Angestellten einen bezahlten Feiertag gewährt. Sie hängt zwar nicht die rote Fahne raus, aber in den großen politischen Zusammenhängen denken wir gleich. Ich bin der Überzeugung, dass es ein besseres Gesellschaftsmodell geben muss als den ausufernden Kapitalismus, weil die Lebensgrundlagen durch Maßlosigkeit und ständiges Wachstum von Menschen selbst zerstört werden. Ein auf sozialen Ausgleich orientiertes weltweites System muss sich etablieren.
Gerd, Jahrgang 1950 | 3 Kinder, verheiratet in zweiter Ehe
Ost: Abitur mit Beruf Maurer, Oberbauleiter West: Baudezernent, Oberbürgermeister
»Meine Kugel ist tausendmal schneller als ihr rennen könnt.«
Eines meiner frühesten Kindheitserlebnisse ist der 17. Juni 1953. Mein Großvater wurde in unserem Haus verhaftet. Ich war damals drei Jahre alt und habe das hautnah miterlebt. Mein Großvater und auch mein Vater waren selbstständige Unternehmer. Sie besaßen einen kleinen Betrieb mit 20 Angestellten. In den 1950er Jahren wurden bestimmte Unternehmer in der DDR kriminalisiert. Zum Glück erfolgte in unserem Fall ein Freispruch und keine entschädigungslose Enteignung. Der Betrieb existierte bis 1972. Es war ein Treibstoffhandel mit Heizöl und Benzin. Dazu gehörten zwei Tankstellen und der Vertrieb. 1972 führte kein Weg daran vorbei, der Betrieb musste an Volkseigentum* verkauft werden, weil zwei Landkreise an der Versorgung mit Benzin und Heizöl hingen. Bereits vorher hatte der Staat immer mehr versucht, Einfluss durch überhöhte Steuern, durch die Beschränkungen des Materialflusses, durch Probleme beim Erwerb von Autos zu nehmen. Dieser Betrieb hat natürlich meine und meines Bruders Kindheit und Jugend geprägt. Immer stand im Vordergrund, wie und ob man ihn aufrechterhalten kann. Und da war es selbstverständlich, dass zu Weihnachten, als Kesselwagen vor der Tür standen, sie entleert werden mussten, mein Bruder und ich die Tankwagen befüllen und ausfuhren. Der Betrieb wurde also 1972 verstaatlicht. Mein Vater übernahm die Betriebsleitung und blieb dies bis in sein Rentenalter. Im Jahr 1990 konnte er den Betrieb zurückkaufen und wurde mit 70 Jahren ›Jungunternehmer‹. Unser Betrieb wird noch heute durch meinen Bruder geführt. Diese Entwicklung zeigt exemplarisch die Widersprüche in der DDR.
Da nie klar war, ob der Betrieb privat bleibt, hatte mein Vater frühzeitig darauf gedrängt, dass wir drei Kinder ordentliche Berufe erlernen und studieren, um unabhängig von der Firma zu sein. Da ist es nur verständlich, dass ich kritisch zur DDR aufwuchs. Das führte zu Konflikten in der Erweiterten Oberschule. Um einen Schulverweis bin ich gerade so herumgekommen. In der 12. Klasse bin ich politisch angeeckt und bekam folgenden Satz vom Lehrer zu hören: »Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Du hast noch nichts geleistet, der Steinbruch wäre für dich eine gute Arbeitsstelle.« Meine guten schulischen Leistungen haben mir aber ermöglicht, einen Studienplatz an der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar zu bekommen. In dieser Zeit erlernte man neben dem Abitur einen Beruf. Als Maurer wurde ich damit Angehöriger der Arbeiterklasse. Das war wieder so ein Widerspruch in der DDR, wer gehört zur Intelligenz, wer zur Arbeiterklasse? Ich dachte immer, ein Arztsohn wäre Intelligenz, der Nachfahre des Arbeiters sollte als Angehöriger der Arbeiterklasse vorrangig studieren können. Was waren wir nun?
Nach dem Studium arbeitete ich als Bauleiter und als Oberbauleiter. Vielen Arbeitern fehlte der Stolz und das Engagement für die Arbeit. Das sagten sie auch. Das machte mich traurig. In der Bundesrepublik hörte man später: »Ich arbeite beim Bosch«, oder: »Ich fertige tolle optische Geräte«. Dieses Bewusstsein fehlte in der DDR. Die Kollegen durfte man nicht so sehr zur Arbeit anhalten, musste ihnen ihre Freiräume lassen. Diese Arbeitseinstellung wurde von oben geduldet. Andererseits war alles bei der Planerfüllung sehr bürokratisch. Im ersten Quartal musste genau ein Viertel produziert oder gebaut werden. Dass das widersinnig ist, weiß jeder. Da wurden im Herbst Bauleistungen angespart und im Frühjahr abgerechnet. Diese Widersprüche, diese Kluft von Anspruch der Politik, der Regierung und auch der Presse zur Wirklichkeit machten meine Frau und mich immer unzufriedener. Die täglichen Widersprüche wurden einfach totgeschwiegen. Es durfte darüber nicht gesprochen werden.
So entschieden wir noch im August 1989, einen Ausreiseantrag zu stellen. Denn mein Eindruck war: In der DDR läuft es wie in der Sowjetunion, jeder wusste über das Spionieren Bescheid, und die Wirklichkeit war anders als das, was propagiert wurde. Weil es vielen so ging, gab es letztlich die friedliche Revolution. Den Ausreiseantrag haben wir zurückgezogen. Wir wurden aber noch vom Rat des Kreises* vorgeladen und man teilte uns mit, dass wir jetzt ausreisen könnten. Das wollten wir nun nicht mehr und erklärten, dass wir hierblieben. Wir hatten den Eindruck, dass sich nun etwas veränderte, an dem wir mitwirken wollten. Die DDR war ja unsere Heimat, wir waren jung, wir haben auch viel Schönes erlebt.
Meine erste Frau habe ich während des Studiums kennengelernt. Wir haben 1974 geheiratet, nutzten die sozialpolitischen Maßnahmen wie den Ehekredit und hofften dadurch auf eine Wohnung. Meine erste Ehe hat leider nicht gehalten. Insgesamt habe ich drei Kinder gezeugt. Mit meiner ersten Frau zwei und mit meiner zweiten Frau eines. Seit 1985 bin ich das zweite Mal verheiratet. Meine Frau hat zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir alle guten Kontakt untereinander haben. Das betrifft sowohl meinen Kontakt zu den Kindern als auch aller Kinder untereinander. Als Vater und Opa lade ich alle Kinder möglichst zweimal im Jahr zu einem Treffen ein. Tradition ist unsere gemeinsame Wintersportwoche in Südtirol. Leider passt es manchmal nicht, dass alle Kinder und Enkel mitfahren können. Und im Herbst lade ich immer zu einer Kindertour ein. Wir sind gemeinsam auf dem Rennsteig gewandert, mit der alten Bahn durch den Thüringer Wald nach Neuhaus gefahren oder auf dem Mauerradweg um Berlin geradelt. Alle Kinder sind inzwischen verheiratet und leben verstreut in Ostdeutschland. Nur einer wohnt in Hannover. Ich habe fünf Enkelkinder. Mein ältestes Enkelkind hätte eigentlich jetzt Jugendweihe* gehabt, die fiel aber wegen Corona aus. Der Sohn meiner zweiten Frau hat zwei Kinder und unser jüngster gemeinsamer Sohn ebenfalls. Sie sind gerade in der Coronapandemie sehr belastet, weil sie in einer relativ kleinen Wohnung in Berlin wohnen und im Homeoffice arbeiten. Der Kleine wird am 30. Juni ein Jahr und die größere wird drei Jahre alt. Das sind sehr starke Belastungen.
Früher habe ich mich in der evangelischen Studentengemeinde engagiert. Das habe ich immer als Freiraum gesehen, um bestimmte Themen zu besprechen, und das auch sehr intensiv. Ich habe dabei viel in der Diskussionsführung gelernt, was ich später verwenden konnte. An Treffen mit westdeutschen Studentengemeinden in Berlin konnte ich auch teilnehmen. Später stellte sich heraus, dass wir immer einen von der Stasi an Bord hatten, den man nicht sah, der aber an unseren Gesprächen und Diskussionen sehr interessiert war. Dieses Überwachungssystem haben wir auch beim Stellen des Ausreiseantrags bemerkt. Unangenehm aufgestoßen ist uns, wie uns Leute bei der Ausreise beraten wollten, oder dass plötzlich Reparaturen an unserem Telefon, das ich betrieblich brauchte, nötig wurden. Möglicherweise hörte die Stasi mit. Ich hatte zu einer holländischen Kirchengemeinde Kontakt geknüpft, und diesen ganzen Schriftwechsel fand ich in den Unterlagen der Stasi-Behörde wieder. Es gab also kein Postgeheimnis. Der Schriftwechsel mit meiner Verwandtschaft wurde archiviert, darunter Bilder. Ich habe in meiner Stasi-Akte einige Dinge gefunden, aus denen ich erkennen konnte, wer uns überwacht hatte. Das habe ich aber nicht weiterverfolgt.
Als Bauleiter eines Baubetriebes in der Grenznähe mussten wir sogenannte LVO*-Maßnahmen durchführen. Die Landesverteidigung stand ja an erster Stelle. Wir hatten u.a. an der Grenze am Flussausbau sechs sogenannte Sperrwerke zu errichten, damit man nicht rüber schwimmen konnte. Ich musste alles vorher zur Überprüfung einreichen, nicht nur Namen, sondern auch die Arbeitslisten für die täglichen und wöchentlichen Arbeiten. An der Grenzkompanie gab ich einmal diese Liste ab, als ein junger Offiziersanwärter, ein sogenannter Fähnrich, sie entgegennahm. Ich vermute, dass dort mal was passiert war. Er sagte zu mir, einem zivilen Bauleiter: »Pass auf, in meinem Abschnitt haut keiner ab. Sag das deinen Leuten. Meine Kugel ist tausendmal schneller als ihr rennen könnt.«
In Eisenach war ich im Bauwesen integriert, engagierte mich frühzeitig in einer Arbeitsgruppe Stadtsanierung, die mehrmals tagte und sich mit den Missständen in der Stadt beschäftigte. Das war noch vor der Wende. Zu Wendezeiten wurde ich von dieser Gruppe als Ersatz für den damaligen Stadtbaudirektor vorgeschlagen. Der Anfang war schwierig, weil Vertrautes auf Neues traf. Ich kann mich noch an den Aufschrei erinnern, als wir eine Tchibo-Filiale in der Fußgängerzone eröffnen wollten und sie diese Passage neu strichen. Rundherum war alles Grau. Ich habe mich mit den Gesetzeswerken der DDR befasst, um zu sehen, was man tun kann und darf. Unterschiedliche Auslegungen waren immer möglich. Ich kann mich genau erinnern, dass nicht genau festgelegt war, wann eine Baugenehmigung erteilt werden konnte. Stattdessen gab es Kommissionen, aber Regeln für diese gab es nicht. Dadurch hatten wir viel Spielraum. Diese Tätigkeit habe ich eigentlich sehr gerne gemacht. Danach kamen Verwaltungsveränderungen. Ich wurde Baureferent und bin durch die gewählte Stadtverordnetenversammlung zum Stadtbaudirektor gewählt worden. Danach erhielt ich als Wahlbeamter die Stellung des Baubürgermeisters der Stadt. Das war ich von 1990 und bis 2000. Es war eine sehr interessante, aber auch aufwendige Arbeit, mit hohem Zeitaufwand. Ich war im Prinzip jeden Abend unterwegs. Das hat natürlich die Familie sehr belastet, das möchte ich ausdrücklich sagen. Heute noch bin ich meiner Frau dankbar, dass sie das durchgehalten hat. Als der damalige Oberbürgermeister aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antrat, wurde ich von 2002–2006 zum Oberbürgermeister gewählt. Bei der nächsten Wahl belegte ich den zweiten Platz. Dafür gibt es leider nichts. Manchmal bin ich abends noch um 22:00 Uhr ins Büro gefahren, um den Schriftverkehr zu erledigen, weil ich genau wusste, dass am nächsten Tag sonst doppelt so viel zu tun ist. Dazu gehörte viel Disziplin und Kraft.
1990 war ich im Neuen Forum* engagiert, das sich zu den Grünen entwickelt hat. Ich habe aber doch gesehen, das möchte ich ausdrücklich sagen, wer konsequent an der Wende – auch an der Vereinigung von Ost und West – gearbeitet hat. Das war Helmut Kohl. Deswegen und weil ich die Arbeit des damaligen Bürgermeisters sehr geschätzt habe, bin ich in die CDU eingetreten, ganz ohne Karriereabsicht, aber es hat sich eben so entwickelt.
Das war schon eine Veränderung, als ich auf einmal nicht mehr Oberbürgermeister war – von 120 Prozent auf null, und das mit 56 Jahren. Aber das ist eigentlich ein gutes Alter für einen Neustart. Gar nichts mehr zu machen, war für mich undenkbar. Einerseits brauchte ich Erholung von dem Stress, andererseits war ich dankbar, dass ich mich so lange für die Gesellschaft engagieren konnte. Ich wollte unbedingt weiter etwas für die Gesellschaft tun. So bin ich seit 2002 sehr aktiv im Deutschen Roten Kreuz tätig, bin hier der Präsident des Kreisverbandes. Zusätzlich übernahm ich noch die Funktion des stellvertretenden Landespräsidenten. Das halte ich für eine wichtige Aufgabe im Ehrenamt. Darüber hinaus war ich elf Jahre Vorsitzender eines der größten Sportvereine hier in der Stadt. Dieser Sportverein macht die Basisarbeit für die sportlichen Entwicklungen der jungen Menschen, im Unterschied zu den Profiklubs. Und da muss man leider immer um eine entsprechende finanzielle Unterstützung kämpfen. Es gibt auch bestimmte Vorschriften, an die ich gebunden bin. Ich kann aus finanziellen Gründen nicht in den öffentlichen Dienst zurück. Ein Jahr wirkte ich bei der Stiftung Familiensinn des Landes Thüringen. Seit 2008 arbeite ich für den Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Das ist ein Lobbyverband, der sich besonders um die kleinen und mittleren Unternehmen kümmert, die sehr viel bürokratischen Aufwand betreiben müssen und nicht so reich mit Einkünften gesegnet sind und daher ein hohes Insolvenzrisiko tragen. Dieses Insolvenzrisiko belastet besonders die Ersparnisse der Unternehmer für das Alter. Mir hilft natürlich, dass ich aus einem kleinen mittelständischen Unternehmen komme. Es macht mir Spaß zu beraten, Hilfen zu geben. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
In der DDR hat der normale Werktätige, so wie ich ihn kenne, relativ wenig verdient. Durch Überstunden und Schichtdienst konnten sie den Lohn etwas aufbessern. Die Arbeiter hatten aber auch bestimmte Privilegien, sie konnten nicht so exakt die Arbeitszeit einhalten, sich Kraft für den Feierabend aufsparen. Die zeitlichen Normen waren gut auskömmlich, was den Ostmännern im Westen aufstieß. Der Westen hat sich auch mit Leistungen, mit Ängsten, mit viel Tränen, mit Insolvenzen entwickelt. Dies haben die Ostdeutschen im Westfernsehen aber nie gesehen. Ich habe so das Gefühl, dass viele Ostdeutsche die Vorstellung hatten: »Hier in der DDR werde ich nichts durch meine Arbeit. Wenn ich drüben wäre, dann werde ich was.« Das war der goldene Traum. Dass dieser Traum nur durch Leistung wahr werden kann, bedeutet für den Ostdeutschen: Er muss sich anpassen, er muss sich verändern, er muss sich darauf einstellen, die geforderte Leistung unter großem Einsatz zu erbringen. Für manche ist diese Umstellung sehr schwierig. Ich bin nicht von Arbeitslosigkeit betroffen gewesen, zum Glück. Sehr viele traf es völlig unverschuldet. Plötzlich ohne Selbstverschulden und ohne Chancen aus einem sehr sicheren Arbeitsverhältnis in der DDR in ein unsicheres Leben zu gehen, hat sehr viele in Resignation und einige in Aggression getrieben.
Insofern ist ein kleinerer Teil der Ostmänner in der heutigen Bundesrepublik nicht angekommen. Menschen, die oft arbeitslos waren, heute mit Hartz IV leben, für die ist es schwierig, auch weil die Renten so klein bleiben werden. Ja, wir hatten in der DDR ein ausgeprägtes Sozialsystem, manche haben sich auch in diesem Sozialsystem eingerichtet. Manchen fehlt der Anreiz, wieder arbeiten zu wollen. Ja, wir haben mehr Freiheit bekommen, aber dieses Mehr an Freiheit bedeutet auch, dass man sie selbst gestalten muss.
Für mich war die DDR meine Jugend. Das bedeutet, dass man Ziele hat, etwas für die Gesellschaft tun will. Die gesellschaftlichen Ziele des Sozialismus hat die DDR geschickt ganz nach oben gestellt. Dabei verschwieg man die Widersprüche, die sie auch prägten. In mir ist allerdings nach wie vor der gesamtgesellschaftliche Gedanke, das Arbeiten für die Gesellschaft bedeutend. Dies hat sich verändert. Heute steht die Gestaltung des Individuums vor dem Gesellschaftlichen. Diesen Widerspruch in der DDR zwischen dem tatsächlichen Erleben und dem gesellschaftlichen Anspruch habe ich auch in mir gespürt. Ich habe mich gesellschaftlich in einem sehr starken Überwachungsstaat engagiert. Dieses Überwachen, das überall Hineinlenken und Leiten, sehe ich sehr kritisch. Auch wie man mit der Intelligenz umging, dass ich im Klassenbuch meiner Kinder als Unternehmer geführt wurde und dass dort stand, wer in welcher Partei war, welchen Beruf die Eltern hatten. Das ging zu weit. Eine andere Sache ist, was sie für die Gleichberechtigung der Frau getan haben, auch wenn sie sie als Arbeitskraft brauchten. Frauen wurden bedeutend besser gefördert als im Westen. Ich kann mich noch über das Erstaunen meine Frau erinnern, als sie ein Konto bei einer westdeutschen Bank nach der Wende eröffnen wollte und um meine Zustimmung gebeten wurde.
Nach wie vor stört mich die Bewertung derer, die uns die Freiheit zur Wende brachten. Dass die ehemalige SED als Partei weiter existieren kann, sich nie grundlegend mit ihren Fehlern auseinandersetzen musste, sich nicht neu gründete, sondern mit den alten Kadern weitergeführt wurde, finde ich nicht in Ordnung. Den rechten Rand, deren Forderungen und Hass, zum Beispiel gegen die Juden, kann ich in keiner Weise nachvollziehen. Andererseits muss man aber bestimmte Themen, die auch von der AfD aufgegriffen werden, diskutieren. Man darf sie nicht totschweigen. Dass das nicht funktioniert, haben wir in der DDR erlebt. Es wird in der Gesellschaft immer unterschiedliche Ansichten geben, von Links, Mitte und Rechts. Man muss über diese intensiv diskutieren und natürlich Auswüchse mit dem Rechtsstaat bekämpfen. Ich würde mir wünschen, dass man sich heute nach über 30 Jahren mehr und intensiver mit der DDR-Geschichte, den Parteien, mit dem widersprüchlichen Leben auseinandersetzt.
Alfred, Jahrgang 1929 | 3 Kinder, verwitwet
Ost: Werkzeugmacher, Pionierleiter West: TierparkbegleiterJugendherbergsleiter, Produktionslenker
FDJ* – diese drei Buchstaben gehören zu meinem Leben wie Vater und Mutter
Das letzte Aufgebot, ich gehörte dazu. 15-jährig waren meine Klassenkameraden für »Führer und Vaterland« als Soldaten der HJ-Division Dresden in Altenberg/Erzgebirge von der SS in den Tod getrieben worden. Nur einem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass ich zu diesem Zeitpunkt, am 9. Mai 1945, nicht mehr Teil dieser Einheit war. Für mich war der Krieg zu Ende, als einige Tage vorher unsere Gruppe im Müglitztal Panzer der Roten Armee mit unseren Panzerfäusten aufhalten sollten. Aber es kamen keine. Ein junger Leutnant der Wehrmacht fragte, ob wir mit ihm zu den Amis durchbrechen wollten. Wir wollten. So landeten Karabiner und Munition im Fluss.
FDJ* – diese drei Buchstaben gehören zu meinem Leben wie Vater und Mutter. Es waren junge Antifaschisten der Antifa-Jugend Loschwitz und später die Kommunisten im Werkzeugbau des Sachsenwerkes/Niedersedlitz, die mir halfen, das faschistische Gedankengut aus dem Gehirn zu schwemmen. Elternhaus, Schule, Jungvolk und Hitlerjugend hatten es von früher Kindheit an bei mir und vielen meiner Altersgenossen tief im Kopf verwurzelt. Immer mehr wurde mir klar, was wir doch für eine betrogene Generation waren. Der größte Teil meiner ehemaligen Klassenkameraden aus der 17. Volksschule Dresden konnte diesen Prozess nicht mehr erleben. Sie waren für »Volk und Vaterland« gestorben.
Im Sachsenwerk/Niedersedlitz (SW) hatte ich meine Lehre als Werkzeugmacher 1943 begonnen und 1946 mit der Facharbeiterprüfung im »Roten Werkzeugbau« bestanden. Dies hieß so, weil hier eine Gruppe von Kommunisten tätig war, die während der Nazizeit als Mitglieder der VKA (Vereinigte Kletterabteilung, auch »Rote Bergsteiger« genannt) aktiv gegen die Nazis kämpften und dafür kurz nach der Machtergreifung der Nazis 1933 in eines der ersten Konzentrationslager, die Burg Hohnstein (Sächsische Schweiz), verbracht wurden. Gebrochen werden konnten sie aber nicht. Anfang März 1946 hatte ich ein Erlebnis, welches für mein Leben von großer Bedeutung werden sollte. Ich begleitete meine neuen Freunde der Antifa-Jugend Loschwitz in den Saal des Sachsenverlag Dresden. Hier fand die Gründung der FDJ* in Sachsen statt. Der Saal war brechend voll mit Jungen und Mädchen und ihren älteren Gefährten. Ich stand ganz hinten am Eingang. Ich gehörte ja nicht dazu, war nur Gast. Es wurden Reden gehalten. Das meiste verstand ich nicht. Alles war so neu, obwohl es die Sprache meiner Loschwitzer Freunde war. Am Schluss sang ein Chor ein Lied – und viele stimmten ein, nur einer nicht. Ich! »Es rosten die starken Maschinen ...« Das war die Sprache, die jeder verstand. Ich wollte mitmachen. So wurde ich am 13. September 1946 als Mitglied der FDJ* im Sachsenwerk aufgenommen.
Die FDJ-Gruppe von nicht einmal 30 Freunden wurde meine erste politische Heimat nach dem Krieg. Mitte 1948 wurde die FDJ-Leitung zu unserem sowjetischen Generaldirektor des SDAG* eingeladen. Noch in Uniform der Sowjetarmee hörte er sich unsere Nöte an. Dann sagte er: »Ihr müsst einen Wettbewerb machen. Kommt wieder und schreibt auf, was ihr als Prämien ausgeben wollt.« So entstand die Idee unseres ersten innerbetrieblichen Wettbewerbs. Viele Prämien wurden gebaut. Ich gehörte zu einer Gruppe, die Spielzeug für die Betriebskinder aus Blech bastelten. Am Schluss konnten sich viele Kinder über die Mini-Trümmerlok mit ihren Loren freuen. Mit solchen Initiativen wuchs unsere FDJ-Gruppe bis Ende 1948 auf über 300 Freunde. Von meinen Freunden wurde ich im März 1949 zum hauptamtlichen Pionierleiter gewählt und begann am 1. April meine Tätigkeit an der 88. Grundschule in Dresden-Pillnitz. Für die 180 Schulen gab es damals acht Pionierleiter. Nur wenige hatten zuvor mit Kindern gearbeitet. Logisch, dass wir zusammenhielten, wie eine kleine Familie. Wir teilten oft unser (karges) Brot, wie Geschwister. Als Werkzeugmacher verdiente ich immerhin um die 400 Mark. Das war damals ein recht guter Lohn. Natürlich nicht im Verhältnis zu den Schwarzmarktpreisen: Zwei Kilogramm Brot kosteten 80 Mark, eine (!) Zigarette im Schnitt drei Mark. Unser ›fürstliches Gehalt‹ als Pionierleiter betrug lange Zeit monatlich 180 Mark (brutto), das waren 168 Mark netto, und reichte vorne und hinten nicht.
Meine ersten Erfahrungen bei der Organisation, Versorgung und Betreuung vieler Kinder machte ich 1949 als Lagerleiter im Pionierlager Bräunsdorf. Dort hatte mich ein Mädchen beklaut. Meine 18 Mark waren weg, die Kinder waren alle so traurig und sammelten für mich. So kamen acht Mark zusammen.
Silvester 1948 begegnete ich meiner Inge das erste Mal im Erbgericht Kreischa. »Erbgericht« heißen hier die Dorfgaststätten. Als wir uns einige Zeit darauf wieder trafen, wurden wir uns einig, unser Leben zukünftig gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Edith verbringen zu wollen. Im Rosengarten an der Elbe steckten wir uns am 26. Juli 1949 die versilberten Ringe an die Finger. Jetzt waren wir verlobt! Ein Jahr später wanderten sie von der linken an die rechte Hand. Wir wurden Mann und Frau. Ab Februar 1950 lebten wir drei Erwachsene, Inges Oma kam zu uns, in zwölf Quadratmeter zur Untermiete unter dem Dach. Zumindest hatten wir fließendes Wasser, wenn auch nur bei Regen die Wand herunter. Sonst schleppten wir das Wasser von der ›Plumpe‹ auf dem Hof herauf. Wenigstens einen Ausguss gab es neben dem Kohleherd in der ›Küche‹. Im Winter fror das Wasser im Glas auf dem Nachttisch. Die Schlafzimmermöbel hatten wir auf Raten gebraucht gekauft. Wegen der Dachschräge zahlten wir nur für sechs Quadratmeter Miete, insgesamt 20 Mark. Unsere Wohnung erreichten wir über die ›Hühnerstiege‹, die Inge, hochschwanger, auf dem Hintern herunter segelte. Zum Glück kam sie mit nur ein paar blauen Flecken davon. Den Kampf um eine neue Wohnung habe ich gewonnen, weil ich eine Aktivistenurkunde von 1948 vorweisen konnte. Mit dem Einzug in die neue Wohnung musste ich lernen, die Vaterrolle zu spielen. Im Februar 1952 gab unsere Tochter Marita ihr erstes Brüllerchen von sich.
Große Hilfe erhielten wir von Oma Zuber, Inges Großmutter. Sie schlief neben dem Baby. Oma Zuber war die wichtigste Person in Inges Leben. Die Familie war aus Tschechien ausgewiesen worden, im Rahmen des Beneš-Dekret*. Inge trat als junge Kommunistin in die Fußstapfen von Opa und Vater und wurde jung Mitglied der Partei. Im gleichen Betrieb wie Vater arbeitete sie als Kernmacherin. Das war eine schwere Arbeit in der Gießerei. Auf der Kreisparteischule erwarb sie sich 1948 nicht nur erste Kenntnisse in den Gesellschaftswissenschaften, sondern verliebte sich auch noch in ihren Lehrer. Ergebnis: Edith, geboren am 21. Mai 1949. Dumm nur, dass der Herr Papa nicht der Papa sein wollte. So bot ich mich später an, Edith zu adoptieren. Inges Mutter war dagegen, nahm Edith zu sich. Sie hat nicht eine Nacht bei uns geschlafen. Entsprechend war die Bindung meiner Kinder zu ihr.
Unvergesslich waren für mich die III. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Berlin vom 5. August bis zum 19. August 1951. Sie standen unter dem Motto: »Für Frieden und Freundschaft – gegen Atomwaffen«. Teilnehmer: 26.000 Jugendliche aus 104 Ländern, Ehrenpräsident war Prof. Joliot-Curie aus Frankreich, Präsident des Weltfriedensrates. Trotz vieler Repressalien durch die Polizei nahmen mehr als35.000 junge Menschen aus der BRD und aus Westberlin am Festival teil. Danach wurde ich Instrukteur in der Stadtleitung der FDJ* Dresden. Wir bereiteten das erste Pioniertreffen im August 1952 in Dresden vor. Besonders viel Kraft steckten wir in die Vorbereitung der Pionierparade, die Pionierfeste im Großen Garten und im Pionierpalast, die Auftritte von Kulturgruppen, die Wettkämpfe der jungen Sportler im Rudolf-Harbig-Stadion. Martin Andersen Nexö, der dänische Romancier und Novellist, feierte seinen Geburtstag in seiner Villa auf dem Weißen Hirsch in Dresden. Ich durfte ihm mit einigen Pionieren unsere Glückwünsche überbringen.
Und meine Inge hatte es wieder einmal eilig. Sie schaffte es nicht ins Krankenhaus, und so kam unser Sohn Jürgen in unserem Schlafzimmer zur Welt und ich fiel in Ohnmacht. Oma Zuber kümmert sich bis zu ihrem Tode liebevoll um ihre Urenkel und starb in unseren vier Wänden. Sie hatte sich in der Woche, wenn wir arbeiteten, um die Kinder gekümmert. Aber am Wochenende gehörten wir den Kindern. Oft spazierten wir durch den Großen Garten und besonders gern begleiteten wir die Kinder in den viertältesten Zoo Deutschlands, in Dresden gegründet 1861. Dorthin führten mich schon als Kind meine Eltern. Jetzt zeigte ich meinen Kindern und meiner Frau den 13 Hektar und damit 26 Fußballfelder großen Tierpark am Rande des Großen Gartens.
Nach dem Tod der Uroma gingen unsere Kinder in ein Wochenheim der VP*. Inge war mit der Pflege der Kranken in der Untersuchungshaftanstalt Dresden beschäftigt und ich trieb mich als Instrukteur in den Schulen der Stadt herum. 1956 wurde ich Lagerleiter für ein Winterlager der Kinder der Reichsbahnangestellten. Höhepunkt sollte ein Feuerwerk sein. Im Lager für Pyrotechnik in Pirna sollte ich das Zeug abholen. Im Knallerlager packte mir der Mitarbeiter den Rucksack voll. »Aber Vorsicht, das Zeug ist gefährlich!« Vorsichtshalber sagte ich nicht, dass ich mit dem Bus unterwegs war. Ich hockte auf der Rückbank und merkte, wie sie heiß wurde. Ich saß auf der Heizung – und mir wurde noch heißer. Den Rucksack hatte ich nun auf dem Schoß. Alles ging gut. Für die Kinder war das Feuerwerk eine wahnsinnige Überraschung, sie hatten so etwas noch nie erlebt. Für mich war es ein schweißtreibendes Erlebnis.
Im Frühjahr 1956 musste ich wegen meines fehlenden Hochschulabschlusses zur ›Runderneuerung‹ an die Jugendhochschule Wilhelm Pieck an den Bogensee für fünfeinhalb Monate. Und schon war ich Lehrer!
In meiner politischen Arbeit spielte natürlich der Kalte Krieg gegen die DDR eine große Rolle. Wirtschaftlich litt die Volkswirtschaft der DDR unter dem vielseitigen Embargo. In Vietnam versuchten die USA, das vietnamesische Volk seit 1955 in die »Steinzeit zurück zu bomben«. Der Krieg dauerte bis 1975! Das war die Zeit, als die Kinder aufwuchsen, von denen mir ein Teil anvertraut war. Wenn die Generationen, die heute in Deutschland leben, keinen Krieg mehr am eigenen Leibe erfahren haben, so ist das auch den jüngsten Friedenskämpfern zu verdanken, die zum Beispiel 1958 auf dem Friedensmarsch nach Halle waren. Das darf man nie vergessen!
Von September 1958 bis zum August 1959 musste ich als Vorsitzender einer Kreisorganisation der Pioniere wieder zu einer ›Runderneuerung‹, diesmal als Student an die Bezirksparteischule der SED in Dresden. Zurück von der Parteischule wurde ich Stellvertretender Leiter des Pionierpalastes in Dresden, der in einem der Albrechtsschlösser über der Elbe 1951 eröffnet wurde. Zu meinen Aufgaben gehörten die Abteilungen Sport/Touristik, Naturwissenschaft (NAWI), Kunst und die Abteilung Massenarbeit. Nach Ideen und Vorschlägen der Kinder erstellten wir die Monatspläne und das Monatsplakat für das Kinderparadies, das die Kinder Dresdens an allen Litfaßsäulen der Stadt lesen konnten. Der Palast war für alle offen. Und vom Pionierpalast aus wurden Kinderfeste im Haus, im Park oder im Großen Garten für durchschnittlich 5.000 Kinder gestaltet. Bei den Kindern besonders beliebt waren Ostereiersuchen im Park oder die Märchenstunden im Türkischen Bad. Übrigens: Die Teilnahme am Pionier- oder Betriebsferienlager, 21 Tage, kostete einheitlich zwölf DDR-Mark. Da konnten selbst Arbeiterkinder aus der Bundesrepublik erholsame und interessante Ferientage verleben.
In meiner wenigen Freizeit spielte die Kultur eine große Rolle. Wir besaßen ein Theaterabonnement und jeden Monat war einmal Theatertag. Kultur gehörte zu unserem Leben wie das tägliche Brot.
Während des Pioniertreffens in Halle im August 1961 stand Inge kurz vor der vierten Entbindung. Jahre quälte sie sich mit der Erinnerung an die Geburt unseres Sohnes Lutz 1958. Er starb am gleichen Tag. Inge hatte ihn nicht sehen können. Als ich mich von ihm in der Pathologie verabschiedete, sah ich in ihm die Kleinausgabe von Jürgen, unserem zweiten gemeinsamen Kind. Ich werde das Bild nie vergessen. Sein Hals, er hatte sich mit der Nabelschnur bei der schweren Geburt selbst erdrosselt, war verbunden. Inge habe ich zu ihren Lebzeiten nie davon erzählt. Sie trug schwer daran – bis mir nichts Besseres einfiel, als ihr zu einer neuen Schwangerschaft zu verhelfen. Jetzt hatte sie wenigstens die Hoffnung, dass alles gut gehen würde. Unsere Tochter Annette wurde gesund geboren.
Für meine weitere Entwicklung benötigte ich nach Ansicht meiner Bezirksleitung der FDJ* einen Hochschulabschluss. Meine Abschlüsse als Pionierleiter und Lehrer der Unterstufe und bei der Partei hatten nur den Wert von Fachschulabschlüssen. An der Karl-Marx-Uni Leipzig stand ab September 1963 ein Platz im Fernstudium auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften für mich bereit. Mein Problem war Russisch. Auf diesem Gebiet war ich eine absolute null. Also nahm ich Nachhilfeunterricht bei einer rüstigen Frau, mindestens 80 Jahre alt, in einer piekfeinen Villa in Radebeul. An unseren Milchglasscheiben in unserer Wohnung, an Küche, Schlafzimmer und Wohnzimmer schrieb ich mit Kreide die Vokabeln des Tages, die ich jedes Mal, wenn ich die Tür öffnete, erst übersetzte, bis sie saßen. Inge ermahnte die Kinder, das Geschreibsel nicht weg zu wischen, weil »Papa das braucht!«. Die Russisch-Prüfung endete in einem Blutbad – das ganze Blatt rot, aber bestanden. Ich wusste damals noch nicht, dass der Mann meiner Lehrerin der Vorsitzende Richter im Reichstagsbrand-Prozess von 1933 gewesen war. Seine Witwe meinte: »Mich belastet das sehr und ich möchte wenigstens an einem Kommunisten etwas gut machen. Deshalb möchte ich von ihnen kein Geld nehmen. Ich würde mich freuen, wenn sie mir ein paar Aufbaumarken besorgen könnten. Körperlich kann ich in meinem Alter nicht mehr beim Aufbau helfen.« Der Prozess endete mit einem »Freispruch aus Mangel an Beweisen«. Ihr Mann hatte die Erwartungen der Hitlerleute damit nicht erfüllt. Er starb 1937 in Leipzig aus Schmach, »Werkzeug gewesen zu sein«.
Die Jahre des Studiums wurden zu einer großen Belastung für die ganze Familie und natürlich für mich. Ich musste die Ferien von 800 Kindern aus dem Bezirk Dresden in einem Zentralen Pionierlager retten. Die bisherige Leitung war überfordert. Aus dem einem Jahr wurden zwei Jahre, und dann pendelte ich zwischen Dresden (Wohnort), Leipzig (Studienort) und Güntersberge (Arbeitsort) hin und her. Zugabteile und Bahnhofswartesäle wurden meine Studierzimmer. Man kann sich leicht vorstellen, dass das für die Familie zu einer Festigkeitsprobe wurde. Das Fernstudium musste ich 1966/67 unterbrechen. Die Belastung war zu hoch. Im Februar 1968 legte ich in Leipzig noch das Staatsexamen in Russisch ab. Aber während der Schreiberei an meiner Diplomarbeit war ich gesundheitlich am Ende. Alfred ging zu Boden. Am 1. Oktober 1968 erfolgte meine Exmatrikulation.
Während meines Fernstudiums begann für mich bereits am 1. Dezember 1966 ein vollkommen neuer Lebensabschnitt. Mir wurde die Verantwortung über die größte Jugendherberge der DDR, die Jugendburg Ernst Thälmann in Hohnstein/Sächsische Schweiz, übertragen. Damit endete meine hauptamtliche Tätigkeit in der FDJ* und Pionierorganisation. Nach 17 Jahren wurde ich aus dem Verband verabschiedet und mit der höchsten Auszeichnung »Freund der Jugend« geehrt. Die Burg Hohnstein spielte in meinem Leben eine ganz besondere Rolle. Sie war eines der ersten Konzentrationslager in Deutschland, wurde im März 1933 eröffnet. Konrad Hahnewald hatte sie 1926 zur Jugendburg umgestaltet und wurde ihr erster Jugendherbergsleiter. Er war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und weigerte sich, auf der Burg die Hakenkreuzfahne zu hissen. Er wurde dort einer der ersten Häftlinge. Meine Lehrmeister im Sachsenwerk/Niedersedlitz waren Überlebende dieses KZ und schlugen mich 1966 als Herbergsleiter vor. Diese große Herberge verfügte über 290 Plätze im Winter und 420 Plätze im Sommer. Das waren circa 5.600 Übernachtungen im Jahr. Auf einem internationalen Seminar der Jugendherbergsleiter in Warschau im Jahr 1969 stellte die DDR erneut den Antrag, Mitglied der internationalen Jugendherbergswerksföderation zu werden. Bis dahin waren alle Anträge auf Drängen der Bundesrepublik abgelehnt worden. Als Leiter der größten Jugendherberge sollte ich das Jugendherbergswesen der DDR vorstellen. Ich kannte ja nur meine Herberge und über unsere Jugendburg Hohnstein berichtete ich, wie wir das vielfältige Herbergsleben gestalteten, aber auch das antifaschistische Vermächtnis hochhielten. Die internationale Skepsis, vor allem die der anderen Deutschen, blieb. Daraufhin lud ich deren Generalsekretär ein, sich persönlich zu überzeugen. Er war Engländer, kam mit seiner Frau, blieb nicht wie geplant zwei Stunden, sondern einen ganzen Tag. Er hat für die Aufnahme der DDR gesorgt. Von da an war unsere Jugendherberge Treffpunkt für viele internationale Ereignisse. Hier waren wirklich Jugendliche aus der ganzen Welt.
Leider war die Jugendherberge immer eine große Baustelle und ich der Bauchef. Das hat mir die letzte Kraft genommen. Als mir mein Arzt sagte, dass ich aufhören müsste, sonst gebe es für mich nur noch Grab oder Klapsmühle, zog ich die Reißleine. In einer Abschiedsrunde mit all meinen Freunden, Mitarbeitern, Bauarbeitern ließ ich diese wichtigsten Lebensjahre Revue passieren. Dabei waren auch meine wissenschaftlichen Ratgeber der beiden Ausstellungen über das KZ und die Naturkunde, die wir gemeinsam dort gestaltet hatten. Wir packten unsere Koffer und stürzten uns in das nächste Abenteuer: die bedeutend kleinere Jugendherberge in Chorin. Der bisherige Leiter hatte nach dem Tod seiner Frau zu trinken begonnen. Die Jugendherberge war verwahrlost. Innerhalb weniger Wochen sollte ich sie in einen vorbildlichen Zustand bringen. Man gab mir 480.000 Mark, damit die Herberge für die Weltfestspiele im Sommer 1973 in Berlin als Reservequartier für ausländische Touristen bereitstand. Dazu musste eine Zufahrt für Busse gebaut werden. Ich schaffte es wieder. Die ersten Gäste wurden die normale Belegung, die Reserve wurde nicht nötig. Ausgelegt war die Herberge für 99 Betten. Ab 100 Betten hätte dem Herbergsleiter ein höheres Gehalt zugestanden. Nach unserer Silberhochzeit 1975 reichte es meiner Frau. Wir hatten seit 1966 nie mehr in einer eigenen Wohnung, sondern immer in Zimmern der Herberge gelebt. In den zurückliegenden zehn Jahren machten wir zweimal Urlaub, davon einmal in einer Herberge, in der wir die 14 Tage doch gearbeitet hatten. Sie stellte mich vor die Wahl: »Entweder, wir ziehen zusammen von hier weg, oder du bleibst allein hier.« Daraufhin habe ich das erste Mal in meinem Leben aus persönlichen Gründen gekündigt.
Ich schaute ins Protokoll des Parteitages, um nach einem Neubauwohngebiet zu suchen, in dessen Nähe ich Arbeit finden könnte. So kam ich auf Marzahn und die dortige Berliner Werkzeugmaschinenfabrik. Beim Kaderleiter fragte ich, ob er einen Werkzeugmacher gebrauchen könne. Als er hörte, wie lange ich aus dem Beruf war, schlug er mir vor, für die Produktionsvorbereitung die Produktionslenkung zu übernehmen. Die Erfüllung meiner zweiten Bitte, eine Wohnung zu bekommen, dauerte noch sehr lange. Schneller als alles andere wurde ich Innendienstleiter der Kampfgruppe* des Betriebes. Endlich, nach einem Jahr und Krach mit dem Kaderleiter, nahmen sie mich in die AWG* auf. Für eine Wohnungszuweisung war es notwendig, selbst Arbeitsstunden zu leisten. Die durfte ich nach Feierabend im Betrieb ausführen. In der Abteilung Feinmechanik habe ich nach meinem ersten Feierabend oft bis spät abends entgratet, und das ein halbes Jahr lang. Ich habe darüber Buch geführt. Ich bekam die Wohnung und suchte mir eine Zweizimmerwohnung mit Balkon aus. Wir dachten, dass unsere Tochter irgendwann ausziehen und es für uns reichen würde. Wichtig war der Fahrstuhl. Hier wohne ich noch heute. Ich hatte die Wohnung noch nicht bezogen, da kam die Partei und meinte: »Jetzt, wo du in der Nähe eine Wohnung in Aussicht hast, brauchen wir dich unbedingt für das Gebiet um das Dorf Marzahn als Parteisekretär.« Ich ließ mich breitschlagen und startete mit 18 Genossen verstreut über ganz Marzahn und Hellersdorf. Das habe ich bis 1990 gemacht. Dann waren wir 420 Genossen und ich schlug eine Teilung vor. Nachdem ich geholfen hatte, drei Leitungen zu bilden, vergaß mich meine Partei. Keiner war hier, niemand wollte meinen Parteibeitrag, lud mich zu Parteiversammlungen ein. Sie waren so sehr mit sich selbst beschäftigt, vielleicht auch aus Selbstschutz. Mich sprechen die Leute bis heute an. Niemals ist mir einer blöde gekommen.
Anfang April 1995 kam Inge vom Briefkasten mit einem Schreiben vom FFO-Reiseclub. »Ich habe dir doch gesagt, dass du noch einmal nach Italien kommen wirst.« Sie erinnerte sich daran, dass ich 14-jährig ein paar Wochen im Postkinderaustausch in Pesaro und in Rom war. Alt war mein gehegter Wunsch, noch einmal an der Adria spazieren zu gehen. In Rimini kamen wir beim Strandspaziergang an einem Gebrauchtwagenhandel vorbei. Inge bemerkte als erste einen roten Opel Corsa Swing. »Das ist ein schöner Wagen: Fünftürer, Automatik-Getriebe ... Den müssen wir haben.« Im Autohaus in Marzahn fanden wir den Bruder. Mit unserem OCSI machten Inge und ich schöne Reisen. Gerade hatten wir die letzte Rate an die Bank bezahlt, da musste sich meine Inge für immer verabschieden. Der Krebs hatte zugeschlagen. Die Fahrt zum Balaton in Ungarn sollte die letzte sein. In den Folgejahren führte mich mein OCSI unfallfrei durch halb Europa. »Zoo-Safari« hießen die meisten Unternehmungen. Dazwischen, von 2001–2010, war er mein Transportmittel zur Arbeit in den Tierpark Berlin-Friedrichsfelde. 380-mal brachte er mich allein zu Einsätzen als Tierparkbegleiter in den größten Landschaftstierpark Europas. Zwischendurch klaute mir jemand auf dem Parkplatz die Kennzeichen und ›kaufte‹ dafür billig Sprit. 2013 sollte OCSI endgültig in Rente gehen, also in die Schrottpresse. Mein Nachbar hatte etwas dagegen: »Verkaufe uns doch den Wagen. Der Bruder in Armenien würde sich freuen.« Die Nachbarn sorgen sich liebevoll wie die eigene Familie um Opa Alfred. Ihre Angehörigen gehören zu meinem Freundeskreis. Es ist schön, dass solche Inseln des Zusammenlebens in der Gesellschaft mit den Ellenbogen erhalten blieben. Verschenken ging nicht, also verkaufte ich OCSI für einen Euro. Und er bekam ein zweites Leben. Im Container reiste er von Berlin über Hamburg mit dem Schiff bis ins Schwarze Meer nach Batumi (Georgien). Jetzt musste er nur noch 500 Kilometer mit eigener Kraft fahren. In der bergigen Gegend um Arteni in Armenien kann OCSI noch einmal so richtig zeigen, was in ihm steckt.