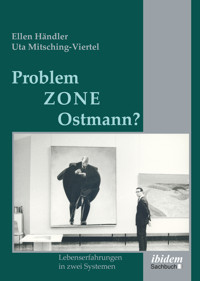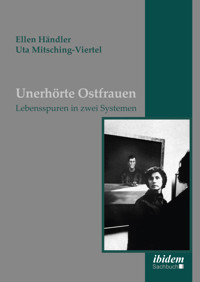
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Unerhört – und doch prägend: Das sind sie, die Ostfrauen, die in diesem Buch zu Wort kommen. Schon in den 1960er, 70er und 80er Jahren haben sie Beruf und Familie erfolgreich vereinbart, haben das Kind geschaukelt und im Beruf ihre Frau gestanden. Anders als ihre Geschlechtsgenossinnen im Westen profitierten sie dabei von frauenpolitischen Maßnahmen wie flächendeckender Kinderbetreuung, Ausbildungsförderung oder Haushaltstag – und mit der Wende erschien es einigen, als seien sie in Sachen Gleichberechtigung ins Mittelalter zurückgefallen. Authentisch, emotional und auch trotzig verteidigen die interviewten Frauen ihre Erfahrungen in Ost und West. Entwaffnend offen ziehen sie persönliche Bilanz, berichten über fehlende Anerkennung und Vorurteile, die ihnen im Westen begegnet sind, über ihren Neuanfang nach der Wende und über ihren Erfahrungsvorsprung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, den sie in den Westen eingebracht haben. Die Autorinnen versprechen den Leserinnen und Lesern eine interessante, spannende und unterhaltsame Lektüre mit einer Prise Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
Zu Beginn
Dankbar
Ines | Ich wollte unbedingt genauso viel wie die Männer verdienen
Dörthe | Wenn es dicke kommt, setzt sich der Mann eben eher durch
Sonja | Hartes Brot gibt gute Zähne
Gerda | Auf Sonja kann man nur stolz sein
Marianne | Meine Kindheit war nicht so schön
Christine | Nach der Wende wollte keiner eine alleinerziehende Mutter einstellen
Heidi | Mit den Kindern wuchsen mir immer so viele Kräfte zu
Edeltraut | Edeltraut mit t
Dagmar | In der DDR war ich mit 27 Spätgebärende
Heike | Mama, du hast es allein geschafft, dann schaffe ich es auch
Anja | Ich kam mir als Hausfrau und Mutter ausgegrenzt und minderwertig vor
Annelis | Ich wurde immer in die nächste Aufgabe geschubst
Christa L. | Frauen hatten das größere Päckchen zu tragen
Christa B. | Vor allen Dingen nicht danebenstehen, sondern sich einbringen
Helga H. | Beide Partner müssen die Kinder gemeinsam formen und ausbilden
Ingrid P. | Hauptsache, du bleibst eine Frau
Ehemalige DDR-Frauen erleben die westliche Berufswelt - Abschrift einer Sendung des Sender Freies Berlin vom 7. Dezember 1985
Hanne | Du hast als Frau in der DDR eine Chance mehr bekommen als ein Mann
Gundi | Das Wichtigste an der Wende ist mir die Förderung meiner behinderten Tochter
Ingrid G. | Ich hätte gerne noch eine Tochter bekommen, aber noch einmal daheim bleiben wollte ich auf keinen Fall
Ilse | Kann ich in diesem Staat weiterhin Lehrerin bleiben?
Johanna | Ich habe als Mädchen keinen Beruf erlernen dürfen
Kerstin | Mein Geld verdiene ich selbst, weil mich das frei macht
Sabine | Ein Leben für den Frauenfußball
Monika | Mein Mann meinte: Emanzipation ja, aber die Frau muss es mit Haushalt und Kindern alleine schaffen
Sieglinde | Gleichberechtigung haben wir erst dann, wenn ich sagen kann: »Ich helfe meinem Mann im Haushalt«
Elsa | Wenn ich etwas machen will, dann tue ich es
Annelie | Ich war im Westen anders, ich ging trotz zwei Kindern arbeiten
Ursula | Alles wäre nie möglich gewesen ohne die Unterstützung meines Mannes
Waltraud | Ich wollte alles dafür tun, nicht das Leben meiner Mutter nachleben zu müssen
Renate H. | Für mich hatte immer eigenes Geld Priorität
Renate K. | Wir haben nicht alles Sozialistische mitgemacht
Helga K. | Manchmal habe ich mich abgewandt, damit sie meine Tränen nicht sahen
Anne | Oft haben sie sich lieber auf mich und meine Entscheidungen verlassen
Ute | »Die Schweine sind die gleichen, aber die Tröge ändern sich«
Maya | Heute kann ich mit Stolz sagen: Ich habe es geschafft, auch wenn ich aus dem Osten kam«
Christa M. | … aber dann sollen die Männer die gleichen Steine in den Weg geschmissen kriegen wie die Frauen!
Zum Schluss: Stark, selbstbewusst und verletzlich – Frauenleben in zwei Welten
Ostfrauen in beiden deutschen Systemen. Ein Diskurs
Glossar
Impressum
Unerhörte Ostfrauen: „Ich wollte unbedingt genauso viel wie die Männer verdienen“
Lebensläufe von Ostfrauen, jüngeren und älteren Jahrgängen, gut ausgebildet mit breiter Berufskompetenz, selbstbewusst und authentisch.
Diese Biografien spiegeln Lebensrealität im Osten Deutschlands, sind aber zugleich ein Bündel an weiblichen Kompetenzen, Alltagsbezügen und Visionen. Diese Frauen klagen nicht, sie gestalten, meistern ihren Alltag mit all den Anforderungen und Überlastungen. Wer sich auf die Texte einlässt, gewinnt einen anderen Blick auf die Ostfrauen, auf ihre Kompetenzen und Beanspruchungen.
Wichtig sind ihnen die menschlichen Beziehungen, ihre Kinder, ihre Partner, und nicht zu vergessen die Großeltern, ohne die sie den Alltag nicht meistern könnten.
Sie verstecken wenig, sprechen über das, was sie stark gemacht hat, wie sie sich unter den Bedingungen der damaligen DDR verselbstständigt haben. Beschrieben wird ihre Emanzipation, ihr Kompetenzzuwachs, ihr Umgang mit den alltäglichen Lebensbedingungen, ihren Wünschen und Visionen. Diese Frauen ermutigen, haben mit ihren Lebensmustern Vorbildcharakter für die nachwachsende Generation. Diese Frauen haben sich eingestellt auf die Realitäten, sie für sich verändert und Stärken entwickelt. Eine beachtenswerte Sammlung, ein Buch, dem ich viele Leser wünsche.
Prof. Dr. Rita Süssmuth,
Bundestagspräsidentin a.D.
Zu Beginn
Als was man sie nicht alles bezeichnet hat, die DDR-Frauen: als Kittelheldinnen, Rabenmütter, multitaskende Viertaktweiber oder gebärfreudige Arbeitsbienen, die sich in einem System, in dem Berufsautomatismus herrschte, kaum individuell entwickeln konnten – kollektivistische Gleichmacherei statt Gleichberechtigung. Stimmen diese landläufigen Annahmen? War das die Lebenswirklichkeit von Frauen in der DDR, werden so ihre Empfindungen über Arbeits- und Familienleben widergespiegelt?
Wir, die Autorinnen, haben selbst in der DDR gelebt. Und wir wollten wissen, wie andere Frauen ihr Leben in Ost und West beurteilen, was sie über Familie, Karriere und Gleichberechtigung zu sagen haben. Denn wir meinen, dass es dreißig Jahre nach der Wende an der Zeit ist, Mythen in Ost und West abzubauen und Illusionen zu begraben.
Es geht um die heutigen »Alten«, die 60- bis 80-Jährigen. Sie gingen zur Schule, erlernten Berufe, studierten, arbeiteten, liebten, heirateten, brachten Kinder zur Welt und lebten vierzig Jahre in einem System, das nicht die Markenklamotten, nicht das Schönheitsideal, sondern die ökonomische Unabhängigkeit der Frau durch eigene Arbeit als wichtigen Sinn des Lebens propagierte. Darüber kann man streiten, es aber auch als einen Modernisierungsvorsprung aus vierzig Jahren DDR anerkennen.
37 Frauen erzählen uns ihre Lebensgeschichten, ziehen ihr Fazit aus beiden Systemen, gesellschaftlich und privat. Ihre Geschichten sind so wertvoll, weil diese Generation zwei deutsche Staaten erfahren hat, weil sie vergleichen und bewerten kann. Sie sind Zeitzeugen und erzählen, wie sie die BRD-isierung des Ostens, die Ausgrenzung oder Integration unter Wert hautnah miterlebten. Diese Empfindungen mitzuteilen ist ihnen wichtig, weil die Jüngeren, auch ihre Kinder, eine andere Perspektive auf gesellschaftliche Entwicklungen haben und zu anderen Bewertungen kommen.
Unsere Interviews sind nicht repräsentativ. Die Frauen kommen aus 17 unterschiedlichen Berufszweigen – von der Köchin bis zur Politikerin, von der Eisenbahnerin bis zur Wissenschaftlerin. Uns war es wichtig, dass möglichst alle mindestens zwanzig Jahre im Osten und zwanzig Jahre im Westen gearbeitet haben. Und wir wollten sie zu Wort kommen lassen, ohne Vorgaben und Fragenkatalog, denn alle hatten etwas zu sagen. Es sind narrative Interviews, biografische Momentaufnahmen, authentisch und einmalig, Stimmen, die bewahrt werden sollten. Die Sicht auf die Geschichte der Interviewten ist nicht rückwärtsgewandt. Es geht nicht um Ostalgie oder die Beschönigung des ewig Gestrigen. Es geht um eine differenzierte Betrachtung ostdeutscher Frauenwirklichkeit. Es muss einfach zu den Akten gelegt werden, dass Frauen bis heute dem Druck von allein westdeutschen Familienmodellen ausgesetzt sind, die ihre Berufung in Heim und Herd oder als Zuverdienerin durch geringfügige Teilzeitarbeit propagieren. 37 berufstätige Ostdeutsche beweisen, dass es anders geht.
Unsere Frauen sprechen über schöne und weniger schöne Kindheitserinnerungen, über Wünsche und Träume mehrerer DDR-Generationen. Sie bekennen sich dazu, als Mütter oft mit einem schlechten Gewissen gekämpft zu haben, weil ihnen lange Arbeitszeiten weniger Zeit mit ihren Kindern ließen. Gleichzeitig berichten sie, Gleichberechtigung im Beruf als Errungenschaft empfunden und dennoch unter der Ignoranz einiger Männer gelitten zu haben. Gemeinsam ist ihnen die Auffassung, dass sie in die Lebenswelt der Bundesrepublik viel eingebracht haben, dass sie gerade bei Gleichberechtigung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie einen Erfahrungsvorsprung besitzen, den sie sich nicht nehmen lassen.
Die Frauen für unsere qualitative Befragung haben wir nach dem Schneeballprinzip gefunden und uns dabei an der neuen Sozialforschung orientiert. Nach dieser Methode sollen die Befragten von innen heraus berichten, um ganz unterschiedliche, subjektive Perspektiven und soziale Hintergründe beleuchten zu können. Diese Herangehensweise setzte eine Offenheit, eine Vertrautheit in der Kommunikation zwischen uns und den erzählenden Frauen voraus. Denn erst der persönliche Zugang ermöglichte es, die Haltungen innerhalb der Lebenswelten in der hier vorliegenden Variationsbreite zu erfassen und mit diesem Buch vorzustellen. Die Interviews zeichnen sich gerade wegen der Spontanerzählungen durch eine tiefe Erinnerungsarbeit aus, sind damit sehr emotional und ergreifend und haben die Frauen in ihrer jetzigen Realität betroffen. Sie sind in einem Prozess von Interaktion und Kommunikation entstanden. Wir gehen davon aus, dass die Frauen das Fazit, das sie aus ihrem Leben ziehen, diese gelebten DDR-Erfahrungen, die entstandenen Lebensansprüche ein bis heute schwelender Konflikt sind, der die innerdeutsche Einheit belastet. Mit der Zurücknahme der Bedürfnisse der Frauen ist deshalb sicher nicht zu rechnen, im Gegenteil: 30 Jahre nach dem Mauerfall ist die Entwicklung in Deutschland weitergegangen und Gleichstellung hat heute einen Anspruch für das 21. Jahrhundert. Das Zeitalter der Digitalisierung erfordert neue weitergehende Lebenskonzepte für Männer und Frauen. Die Ostfrauen sollten dabei nicht erneut vernachlässigt werden.
Dankbar
sind wir vielen Unterstützern, Motivatoren, Diskussionspartnern, vor allem den ostdeutschen Frauen, die sich uns mit ihren Lebenserinnerungen vertrauensvoll öffneten und so die vorliegenden Erzählungen ermöglichten.
Unterstützung waren uns auch österreichische Gleichbehandlungsbeauftragte, die mit Spannung und vielen Fragen zu der ihnen weitgehend unbekannten Welt der DDR die Entwicklung des Projektes begleiteten.
Ganz besonders danken wir Frau a.o. Universitäts-Professorin Dr. Marija Wakounig vom Institut für Osteuropäische Geschichte an der Universität Wien. Sie machte Uta bereits im Jahr 2013 darauf aufmerksam, dass »die wunderbaren ostdeutschen selbstbewussten Frauen mit ihren Erfahrungen aus 40 Jahren DDR so wenig gehört werden, und dass dies unbedingt erfolgen muss, bevor es zu spät ist«.
2016 überzeugte Uta Ellen, an diesem Projekt mitzuwirken. Ellen legte neben den Interviews ihren Schwerpunkt auf die theoretische Betrachtung des Anspruchs und der tatsächlichen Umsetzung der Frauenpolitik der DDR. Dabei konsultierte sie insbesondere Prof. Dr. Herta Kuhrig, die Nestorin der Frauenforschung der DDR. Wir sind Herta sehr dankbar, dass sie sich dabei nicht scheute, die vielen Schwierigkeiten, Auseinandersetzungen, politischen Vorgaben, eigenen Haltungen und Fehler damaliger DDR-Politik zu benennen; und das trotz ihres hohen Alters und gesundheitlicher Einschränkungen.
Insgesamt 42 Frauen erzählten über sich, ihre berufliche Entwicklung, ihre Familien und teilten uns persönliche Meinungen zur Gleichstellung in Ost und West mit. Beachtenswert fanden wir, dass fünf Frauen, die in der DDR in hohen Führungsfunktionen tätig waren, über ihr Leben offen mit uns sprachen.
Traurig dagegen stimmte uns, dass fünf Frauen aus unterschiedlichen Gründen einer Veröffentlichung ihres Interviews letztlich nicht zustimmten.
Allen Frauen sind wir dankbar.
Gefreut haben wir uns sehr, dass Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth, die sich in vielen führenden Positionen in der Bundesrepublik für die Gleichberechtigung der Frauen eingesetzt hat, und Frau Prof. Dr. Meier-Gräwe, die an der Universität Gießen dazu lehrte, unser Projekt so positiv bewerteten.
Das gilt auch für Valerie Lange – unsere junge Lektorin. Sie hatte es nicht immer leicht mit uns, denn sie könnte unsere Enkelin sein. Doch ihre konsequente, freundliche Art der Zusammenarbeit war so überzeugend, dass wir uns für den ibidem-Verlag entschieden.
Interessant fanden wir die Karikaturen von Beate Kern, einer jungen Künstlerin, mit ihrem heutigen Blick auf das Projekt »Unerhörte Ostfrauen«.
Dank gilt zudem Evelyn Richter. Die ostdeutsche Fotografin gab uns die Lizenz, das Foto »Vor Wolfgang Mattheuers ›Die Ausgezeichnete‹ im Dresdner Albertinum (1975)« als Umschlagsbild zu nutzen. Dieses Bild löste bereits während der Kunstausstellung der DDR 1974 kontroverse Diskussionen aus.
Letztlich wäre das Projekt nicht realisiert worden, hätten uns unsere Kinder und Freunde nicht in stundenlangen Diskussionen zugehört, wäre mit Ihnen nicht in vielen Streitgesprächen am Projekt gefeilt worden. Danke.
Ellen Händler und Uta Mitsching-Viertel
Berlin, November 2018
Ich wollte unbedingt genauso viel wie die Männer verdienen
Ines, Jahrgang 1960
Ost: Schneiderin, Büglerin West: Straßenbahnfahrerin, Frauenvertreterin bei der BVG*,
Abgeordnete der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus
Eigentlich wollte ich nach der zehnten Klasse Technische Zeichnerin werden. Meine Mutti wollte das nicht und schlug mir dagegen vor, wie sie Schneiderin zu werden. So wurde es. Geboren wurde ich in Berlin-Friedrichshain, nah am Fischmarkt, und lebte dort mit Bruder und Mutter. Die Schulzeit habe ich in guter Erinnerung, ich war immer der Pausenclown. Besonderen Spaß gemacht hat mir der Russischunterricht. Russisch lernen und die russische Literatur waren schon immer meine absolute Nummer eins. Nach der Schule begann ich meine Ausbildung bei VEB* Treffmodelle, in der schweren Damenoberbekleidung. Schwer bedeutete Kostüme und Mäntel im Unterschied zur leichten Bekleidung, den Kleidern und Blusen. Nach der Lehre arbeitete ich dreieinhalb Jahre dort in der Schneiderei. Wir waren alles Frauen.
In der Abteilung Bügelei über uns arbeiteten nur Männer und die verdienten dreihundert Mark mehr als wir Frauen. Das wollte ich auch. Also nutzte ich die Gelegenheit als der Meister im Urlaub war und fing da oben an. Das war eine riesengroße Bügelei mit zehn Dampfpressen, Riesenpuppen und fünf Tischen mit jeweils neun Kilo Bügeleisen zur Futterbügelei. Die Männer wollten keine Frauen bei sich aufnehmen und haben es mir nicht leicht gemacht. Ich dagegen wollte immer mit dazu gehören. Das, was sie mit mir getrieben haben, war teilweise schon mehr als verletzender Schabernack. Sie meinten: »In kurzer Zeit bist du sowieso wieder verschwunden.« Also haben sie mir böse Streiche in den Pausen gespielt, die Elektroeisen, wie gesagt neun Kilo schwer, mit Senf beschmiert, zum Feierabend meine Schuhe an den Heizungsrohren hochgebunden, sie gefüllt mit Knöpfen, und als ich sie herunterholte, stand ich da wie Goldmarie. Und zu allem musste ich lächeln. Ich wollte unbedingt dazugehören und bin zehn Jahre geblieben. Ich wollte die Anerkennung der Männer, habe alle Sprüche über mich ergehen lassen und alles mitgemacht. Die anderen Frauen haben am Band genäht für 600-700 Mark. Die Männer im Zuschnitt und in der Bügelei haben 1.000 Mark bekommen. Dafür hat sich das gelohnt. Es hat mir schon gefallen und ich war noch unverheiratet.
In der Bügelei zu arbeiten war natürlich am Anfang schwer. Zum Schluss haben fünf oder sechs Frauen dort gebügelt. Da war ich eine Art Vorreiterin, aber es hat Spaß gemacht. Ich konnte selber mitbestimmen und finde es nach wie vor richtig, dass ich gekämpft habe. Und da ich an den Wochenenden die kleinen Zusatzverdienste hatte, ging es mir gut. Ich habe diese Freiheit genossen.
1989, als ich bereits verheiratet war und wir unseren Sohn hatten, gehörten wir mit zu denjenigen, die ausreisen wollten. Wir hatten miterlebt, wie auf der Prenzlauer Allee der letzte 7. Oktober gefeiert wurde, wie Leute in die Hausflure geschubst und dort verprügelt wurden. Das wollten wir nicht mehr mitmachen. Mir selbst ging es nicht schlecht. Ich habe in der Woche gearbeitet, am Wochenende Kleider genäht und sie am Ostbahnhof verkauft. Wir versuchten noch vergeblich, mit unserem Trabbi abzuhauen. Aber als wir kurz vor der tschechischen Grenze ankamen, wurde sie geschlossen. Das war, als Genscher in Prag in der Botschaft erklärt hatte: »Ihr dürft ausreisen.« Also haben wir eine Reise nach Rumänien gebucht, sind dorthin geflogen, dann zurück mit dem Zug nach Budapest, von Budapest mit dem Bus über Österreich nach Westdeutschland. Das war, schätze ich, zehn Tage vor der offiziellen Grenzöffnung. Wir landeten in Bamberg. Im Aufnahmelager brauchten wir gar nicht erst auszupacken. Abends kamen Leute und suchten bestimmte Fachleute. Die anderen schliefen in Kasernen, alles belegt mit Ostdeutschen.
Uns nahm eine Familie mit einer großen Heizungsfirma auf, Familie K. Mein Mann war Heizungsbauer. Bei mir als Frau war es mit Arbeit natürlich nicht gleich möglich. Also habe ich als Putzfrau angefangen und abends in einer Hausfrauenrunde Rohrschellen montiert. Das ging von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Wir bekamen keinen Stücklohn, sondern Stundenlohn. Einige Frauen versuchten besser als andere zu sein, denn sie hofften für die nächste Woche wieder auf neue Arbeit. Schließlich fing ich in einer Strickbude an, in der Stricksachen zugeschnitten, genäht und gebügelt wurden. Ich arbeitete wieder bei den Büglern. Da wurde ich das erste Mal mit dem blanken Kapitalismus konfrontiert. Die Frau neben mir am Tisch hatte die Lohnsteuerklasse 3 mit drei Kindern alleinstehend und ich hatte die Lohnsteuerklasse 4. Solche unterschiedlichen Löhne habe ich ja vorher aus dem Osten nicht gekannt. 500 Mark Unterschied, obwohl wir die gleichen Stückzahlen bearbeiteten. Ich war total fix und fertig.
Der Kindergarten war in Bayern ein Riesenproblem. Morgens brachte ich das Kind zu einer Tagesmutter, die es um 08:00 Uhr in den kirchlichen Kindergarten brachte, mittags um 12:00 Uhr abholte und von 15:00 bis 17:00 Uhr wieder hinbrachte. Ich war ja ganz anderes aus den staatlichen Kindergärten in Berlin gewöhnt. Das ging auf Dauer für uns und den Jungen nicht gut. Irgendwann holte ich mir einen Termin bei meinem Chef, nachdem ich erfahren hatte, dass meine Firma sich mit 70 Prozent finanziell an dem Kindergarten beteiligte. Die anderen Frauen schlugen die Hände über den Kopf zusammen. Man macht doch als Frau keinen eigenen Termin beim Chef, meinten sie. Wir haben uns dann zusammengesetzt. Er hatte gesehen, dass ich arbeiten kann, dass ich mein selbst verdientes Geld benötige und diesen Kindergartenplatz über die Mittagszeit brauchte. Im Ergebnis hat der Chef dafür gesorgt, dass unser Sohn über Mittag im Kindergarten bleiben durfte. Er konnte dort sogar schlafen.
Das und anderes führte zu Auseinandersetzungen. Einmal stritt ich mit meiner Vorarbeiterin darüber, wer welche Sachen zugewiesen bekam. Ich habe sie gebeten, mir auch mal die besseren Sachen zu geben. Sie sagte: »Nein, Ines, du bist ja noch nicht lange dabei.« Also nahm ich mir diese Sachen einfach so. Ein riesiger Aufschrei! Alle gaben mir zu verstehen: Du kommst aus dem Osten, und du willst uns erklären, wie man arbeitet und uns die besseren Sachen wegnehmen? Eine der Frauen wollte mich regelrecht verhauen, so wütend war sie.
Wie wurde ich in Bamberg aufgenommen? Ein paar Sachen bekamen wir geschenkt, das war hilfreich. Ansonsten mussten wir uns alles hart erarbeiten. Ich hörte im Supermarkt zwei Frauen schimpfen, dass die Ossis hier die besten Wohnungen bekämen, wir uns hier im Westen alles schenken ließen, das ganze Geld mitnehmen, dann wieder zurückgehen würden, dass wir sowieso nicht arbeiten könnten. Das hat echt wehgetan, das war total verletzend. Es stimmt, wir haben eine Couchgarnitur geschenkt bekommen und für einen Kredit haben wir uns einen alten Passat kaufen können. Aber wie weit kommt man mit 1.000 DM Begrüßungsgeld? Ich war wütend, denn ich hatte mich sofort selbst um Arbeit bemüht, bin abends noch putzen gegangen. Ja, geputzt habe ich, weil ich diese tollen Weihnachtskugeln kaufen wollte. Die waren richtig teuer. Die Putzerei war schwer, die ganze Werkstatt wischen, dazu Klo und Büro.
Ich habe die Familie, die uns damals aufgenommen hat, jedes Jahr weiter zu Ostern besucht. Erst vor vier Jahren habe ich aufgehört, nach Bamberg zu fahren. Nun hat die Tochter das Unternehmen vom Vater übernommen. Sie hat meine ganze Karriere mit verfolgt, gesehen, wie ich in die Politik eingestiegen bin. Sie selbst ist eine der wenigen sehr selbstständigen Frauen, die ich in Bamberg kennengelernt habe. Sie hat studiert. Und obwohl sie verheiratet ist und zwei Kinder hat, gehört ihr der Laden und sie managt ihn allein. Inzwischen haben sie einen Bürgerverein gegründet, in dem sich alle Hausfrauen zusammentun und sich jeden Tag eine andere um alle Kinder kümmert. Die sind inzwischen fortschrittlicher als die Kirche. Frau K. hat mich am Sonntag manchmal in die Kirche mitgenommen. Da saß ich oben auf der Empore und die von unten ließen mich ihre Sorge spüren, dass ich ihnen etwas wegnehmen könnte.
Bevor ich nach Bamberg kam, kannte ich ja das Leben im Westen nur aus dem Fernsehen. Die Rolle der Frauen ändert sich nach meiner Beobachtung im Verlauf ihres Lebens ganz grundlegend. Ich kann zwar nur von Bamberg sprechen, aber das ist mir aufgefallen. Die Frauen fangen frühzeitig an zu arbeiten und das, bis sie 30 Jahre alt sind. Dann haben sie genug für den Hauskredit gespart, Vati kann das Haus bauen und sie bekommen die Kinder. Das Kinderkriegen war im Prinzip in der DDR zwischen 20 und 25 Jahren erledigt. Mit 30 waren die DDR-Frauen bereits wieder fleißig im Beruf aktiv. Bei den Westfrauen beginnt alles erst ab 30 Jahren. Ab dann bleiben sie zu Hause, kümmern sich um die Kinder, fahren sie überall hin, und es fehlt ihnen an Geld. Zumindest an eigenem Geld. So nehmen sie Hausfrauenjobs an. Die sind aus meiner Sicht pure Ausbeutung, mehr als alle anderen. Und wenn man keinen Stücklohn, sondern nur Stundenlohn erhält und mit der Nachbarin im Akkord arbeitet, bloß um beim nächsten Anruf wieder einen Job zu bekommen, ist das schlimm. Und du siehst die Ungerechtigkeit in der Bezahlung. Was ist das für ein Leben, die Frau muss darauf warten, was der Mann jeden Monat nach Hause bringt. Und sie muss es einteilen und weiß doch, dass es vorne und hinten nicht reicht. Die Frauen sind dadurch völlig unselbstständig. Ja, und wenn die Kinder aus dem Haus sind, suchen die Frauen Jobs, finden sie aber nicht mehr in ihrem Beruf und bleiben abhängig vom Mann.
In der Zeit in Bamberg habe ich in der Zeitung gelesen, dass eine Kindergärtnerin nach einer Scheidung nach 25 Jahren aus dem kirchlichen Kindergarten entlassen worden sei, »weil so eine Person die Kinder nicht mehr erziehen könne«. Am nächsten Tag habe ich mit meinen Kollegen darüber gesprochen und gesagt: »Das kann doch nicht euer Ernst sein.« Die waren alle über meine Reaktion total erstaunt. Da sagte ich: »Die Kirche ist ja schlimmer als die Partei zu DDR-Zeiten.« Damals keimte erstmals der Gedanke auf, wieder nach Hause, in unser Berlin, zurück zu gehen. Das hing auch mit der Einschulung unseres Sohnes zusammen. Wir sollten entscheiden, ob er evangelisch oder katholisch eingeschult werden sollte. Da habe ich Nein gesagt, er solle später selbst entscheiden, ob er in die Kirche eintreten wolle. Die Antwort: »Dann kann er nicht eingeschult werden.« Es kamen ganz viele Faktoren zusammen, ehe wir unsere Sachen packten und wieder nach Berlin kamen. Zu Hause habe ich wie ein Schlosshund geheult.
Zunächst arbeitete ich in Westberlin als Büglerin. Aber irgendwann wollte ich das nicht mehr, ich wollte etwas mit Menschen machen. Und ich suchte etwas, bei dem ich sicher sein konnte, dass ich genauso viel wie Männer verdienen kann. Da kam ich auf die Idee, Straßenbahnfahrerin zu werden. 1993 begann ich, Straßenbahn zu fahren. U-Bahn fahren war nichts für mich, dass ist zu depressiv im Dunkeln, und Busfahren war mir zu heikel wegen der vielen engen Baustellen. 1994 kam der Personalrat auf mich zu und fragte, ob ich Lust hätte, Frauenvertreterin zu werden. Sie meinten: »Du gehst jetzt nach Hause und besprichst das mit deiner Familie und entscheidest dich nach der Adenauer-Methode: das Für und Wider aufschreiben.« Die Frauenvertreterin hat gewonnen, und das war ich 20 Jahre lang. Ich wurde eine von acht Gesamtfrauenvertreterinnen in Berlin.
In der Zeit habe ich viele Projekte, zum Beispiel zur Werbung für Ausbildungsplätze für Mädchen an Schulen, angeschoben, eng mit der Agentur für Arbeit zusammengearbeitet, den dritten Frauenförderplan für jeweils sechs Jahre neu verhandelt und habe damit viel für die Personalentwicklung von Frauen im Unternehmen tun können.
Nach 20 Jahren rief DIE LINKE bei mir an und fragte: »Ines hast du nicht Bock, bei uns frauenpolitische Sprecherin zu werden?« Ich sollte einen Wahlkreis übernehmen, dort Wahlwerbung machen. Ich fand das verwirrend, spannend und habe zugesagt. Meinen Wahlkreis als Direktkandidatin habe ich leider bei der letzten Wahl noch nicht geschafft. Der ging an die AfD. Das wird sich bis zur nächsten Wahl ändern. Über einen Listenplatz bin ich nun frauenpolitische Sprecherin im Abgeordnetenhaus von Berlin. Das ist auf dem Papier ein Halbtagsjob. Im wahren Leben ist das eine Wahnsinnsarbeit, was ich da auf meinen Buckel geladen habe. Mit der anderen Hälfte arbeite ich noch in der BVG*, dazu im Aufsichtsrat als Arbeitnehmervertreterin und bei Verdi* in ganz vielen Gremien. Da muss ich noch einiges abbauen.
Inzwischen bin ich eine total zufriedene Frau. Von meinem Mann habe ich mich 1994 getrennt. Nach einer Reihe von unterschiedlichen Partnerschaften mit älteren und jüngeren Männern habe ich meine Partnerin kennengelernt. Wir werden jetzt in diesem Jahr im Oktober heiraten. Dann sind wir neun Jahre zusammen. Ansonsten bin ich glücklich ohne Ende und wachse jetzt tagtäglich an meinen neuen Herausforderungen. Ich lerne die unterschiedlichsten Berliner Frauenprojekte kennen. Wenn ich vorher schon gedacht habe, 14.000 Beschäftigte bei der BVG*, das ist groß – nein, das ist lächerlich, wenn du siehst, was in Berlin passiert. Das macht so viel Spaß, das hätte ich echt nicht gedacht. Und natürlich will ich in meinem Wahlkreis weiterarbeiten, ich will ihn in fünf Jahren für DIE LINKE zurückbekommen, ihn der AfD abnehmen. Dazu muss ich noch einmal ganz viel lernen über die Probleme der kleinen Frau, des kleinen Mannes, muss gucken, wie ich das alles packe, aber es macht Spaß ohne Ende.
Wenn ich auf die DDR zurückblicke, muss ich zuerst daran denken, wie viel ich vor meiner Hochzeit verreist bin. Das Reisen war meine Sache. Ich war überall, wo man zu Ostzeiten hinkonnte, Moskau, Leningrad, Taschkent, Prag, Budapest, das Paris des Ostens. Dabei habe ich mich wohlgefühlt. Und dann wollten sie mich doch zum Ingenieurstudium für Bekleidung schicken, forderten vom Betrieb meine Unterlagen an. Ich hatte aber kein Parteibuch und es war nicht so einfach mit mir, mit meiner großen Fresse. Hat irgendwie nicht geklappt. Gestört hat mich, wie sie manchmal mit den Menschen umgegangen sind, die immer unzufriedener mit dem System wurden. Da reagiere ich schon unwirsch, wenn man erlebt, wie sie einigen mitgespielt haben. Viele störte, dass sie nicht reisen konnten, dass alles ein bisschen bieder war, dass es keine große Auswahl an Farbfernsehern und Couchgarnituren gab. Aber dafür war die Miete niedrig, dafür war Brot, Milch billig und Strom und Wasser preiswert und es gab ein kostenloses Gesundheitswesen. Wie es wirklich im Westen war, wusste ich ja nicht. Ich kannte doch nur die Werbung im Fernsehen, in der alles schön war. Mit meiner schulischen Bildung wusste ich es nicht besser. In der Zwischenzeit habe ich viel dazu gelernt, habe das Fachabitur abgelegt, wurde sogar Projektmanagerin. Wenn ich das zur Wende schon gehabt hätte, möchte ich wetten, dass ich viel weiter wäre als ich jetzt bin.
Wenn ich an meine schwere Damenoberbekleidung denke, 97 Prozent dessen, was wir produziert haben, ging in das NSW*. Wir haben für Otto, für Quelle produziert, die ganzen Kataloge waren voll von billig in der DDR gearbeiteten Klamotten. Und der Rest, die 3 Prozent, war für uns. Der war wiederum nicht so billig und die Leute mussten dafür Schlange stehen. Von diesen Widersprüchlichkeiten – und das macht mich besonders wütend – haben die Oben nichts mitbekommen, die Leute mussten erst auf die Straße gehen. Die DDR-Bürger waren aber wegen des Mangels sehr erfinderisch, wir konnten alles selbst bauen, wir konnten den Schnaps selber brennen, wussten, wen man anrufen musste, um Rosenthaler Kadarka* oder Ersatzteile für den Trabbi zu kriegen. Und Sonnabend, wenn die Männer unten am Trabbi bauten, die Frauen alle Wäsche aufhängten und tratschten, saß man abends beim Schnaps zusammen. Da gab es nicht so viele Hunde, dafür viele Kinder. Die konntest du in der Wohnung alleine lassen, hast im Haus Bescheid gesagt, die Nachbar-Omi hatte den Schlüssel. Das war alles möglich. Es gab einen Zusammenhalt, die Tür draußen war nicht abgeschlossen und du warst doch ein Stück weit willkommen. Die Kriminalität war damals in diesem kleinen Land nicht so schlimm. Das Haus war nicht so bunt und so schön, aber die Menschen waren glücklicher, sind anders miteinander umgegangen.
Wenn ich gefragt werde, warum ich eigentlich gegangen bin, sage ich: »Weil ich reisen wollte.« Es wurde alles zu eng, du wolltest nicht mehr nach Raufaser und Rosenthaler Kadarka* anstehen. Du wolltest nach Österreich in die Berge oder nach Frankreich oder nur nach Westberlin fahren. Vielleicht wollte man da ja nicht bleiben, vielleicht wären wir zurückgekommen. Ab dem 7. Oktober sind viele aufgewacht, um mit für die Freiheit zu kämpfen, haben gerufen: »Wir sind das Volk.« Es entstand eine Umbruchstimmung. Und alles ging ohne jede Art von Waffengewalt ab, einfach nur: »Macht die Grenzen auf!« Bestimmt sind damals viele nur in den Westen gegangen, um zu sehen, wie die Freiheit aussieht. Später sah die Freiheit für andere eher schlecht aus, weil sie keine Arbeit fanden und Männer oft von den arbeitenden Frauen abhängig wurden.
Und zu dieser Zeit ist meine Ehe gescheitert. Ich war 1994 in der BVG*, als ich endlich den Schritt zum Gericht gegangen bin. Die Beziehung ist innerlich zerbröselt. Erst habe ich gedacht: »Er ist doch der Vater deines Kindes«, und dann wieder: »Nein, du bist du, und du bist nicht für ihn verantwortlich.« Und es war richtig. Ja, mein Mann wurde handgreiflich, als ich von der Scheidung sprach. Jetzt erinnere ich mich erstmalig wieder daran. Als ich so richtig verprügelt wurde, stand mein Entschluss ganz fest: »Diese Trennung wird vollzogen.« Ich glaube, ich brauchte die Erfahrung, dreimal verprügelt zu werden, ehe ich endgültig Schluss gesagt habe.
Mein Selbstbewusstsein war schon immer ganz schön stark. Ich habe mich nie unterdrücken lassen. Das war auch damals in der Bügelei so. Aus heutiger Sicht ist das vielleicht Mobbing, damals war es zwar nicht immer lustig, wenn die Jungs sich einen Streich einfallen ließen. Aber ich habe mich nicht diskriminiert gefühlt, ich konnte selbstbestimmt über mich und mein Leben entscheiden.
Wenn es dicke kommt, setzt sich der Mann eben eher durch
Dörthe, Jahrgang 1944
Ost: Verkäuferin, Buchhalterin, Finanzwirtin, Betriebswirtin West: Sachbearbeiterin
Im Juli 1945 ist mein Vater aus unserem Haus in Berlin abgeholt worden und nicht wieder gekommen. Wir wissen heute, dass er bereits im November 1945 in einem Internierungslager in Sachsen verstorben ist, aber mehr hat meine Mutter nie erfahren. Er war Kriminalbeamter. Ob er in der Partei war, wissen wir nicht genau, aber meine Mutter sagt Nein. Das alles haben wir erst vor einigen Jahren erfahren. In Halbe befindet sich eine Kriegsgräberstätte und eine Gedenktafel. Dort ist er beerdigt. Als ich dort war, empfand ich es als sehr ergreifend. Als ich die Grabplatte betrachtete, dachte ich: »Ihn hat es ja doch gegeben.«
Eigentlich bin ich Berlinerin. Geboren bin ich jedoch in Freiburg im Breisgau, weil meine Eltern durch den Krieg im Schwarzwald wohnten. Als ich ein Jahr alt war, zogen wir nach Berlin, und hier lebe ich bis heute. Meine Mutter hat uns drei allein großgezogen. Zwei große Jungs und mich. Zwischen den beiden Großen gab es noch einen Bruder, der gestorben ist. Meine Mutter hat immer auf ihren Mann gewartet und ihn erst für tot erklären lassen, als sie Rentnerin wurde. Darauf habe ich gedrungen. Sie hat immer gehofft. Deshalb hat sie um alles kämpfen müssen, zum Beispiel um eine Halbwaisenrente für uns, da mein Vater offiziell nicht tot war. Vielleicht ging man davon aus, dass er irgendwo mit einer anderen Frau lebt.
Meine Mutter war von Beruf Handelskauffrau. Aber sie hat sich nach dem Krieg eine Tätigkeit suchen müssen, mit der sie Geld verdient und die sich mit der Betreuung von uns Kindern vereinbaren ließ. Sie arbeitete zunächst bei einer Zahnärztin als Reinigungskraft, dann als Helferin und später machte sie in der Abendschule ihren Abschluss zur Stomatologieschwester*.
Wir sind nicht in den Kindergarten gegangen. Meine Mutter kannte eine alte Dame, die mit ihrem Ehemann nach dem Krieg keine Bleibe hatte. Sie nahm das Ehepaar bei uns im Haus in einem Zimmer auf. 1948 starb der Mann, die Frau ist bei uns geblieben und wurde sozusagen unsere zweite Mutter und hat uns betreut. Das eine war die Mutti, das andere die Mutter.
Es war eine schöne Zeit, wir hatten nichts, aber das Haus mit dem Garten gehörte uns, wir waren viele Kinder, spielten draußen. In dem großen Garten pflanzten wir Kartoffeln und Gemüse an und die alte Dame trug durch ihre Rente ein bisschen zur Haushaltskasse bei. Mein Großvater lebte in Angermünde und besaß eine Autowerkstatt. Er hat uns unterstützt, er reparierte zum Beispiel das Dach, weil es durchregnete.
Die Sorgen unserer Mutter in der schweren Nachkriegszeit haben wir mitbekommen, obwohl sie versuchte, sie uns gegenüber zu verheimlichen. Es ging ihr sicher vieles durch den Kopf, vor allem die finanzielle Situation. Ich schlief mit ihr zusammen im Ehebett und merkte, dass sie wenig schlief.
1950 bin ich in die Grundschule gekommen und ohne Unterbrechung bis zur achten Klasse dorthin gegangen. Nach der achten Klasse begann ich eine Lehre als Textilfachverkäuferin. Ich wusste einfach nicht, was ich werden wollte, Friseuse oder Technische Zeichnerin. Technische Zeichnerin habe ich verpasst, weil ich mich an der falschen Stelle angemeldet hatte. Ich bin im Nachhinein nicht traurig, dass ich diesen Beruf nicht erlernt habe, denn es wäre nicht meine Welt gewesen. Verkäuferin hat mir Spaß gemacht. Nach drei Jahren Lehre arbeitete ich schon in einem großen Warenhaus.
Meinen Mann habe ich 1963 kennengelernt und 1966 geheiratet. Er ist Diplomwirtschaftler, studierte an der Humboldt-Uni und arbeitete beim Magistrat in Berlin bis zur Wende. Danach war er beim Senat.
Mein Mann hat ein leidenschaftliches Hobby, er segelt, schon sein ganzes Leben. Als wir uns kennenlernten, hat mir das Hobby gefallen und es wurde ein gemeinsames. Mit meiner Arbeit als Verkäuferin im Warenhaus war das aber schwer zu vereinbaren, weil sonnabends gearbeitet wurde. Insbesondere im Sommer war das ein Hindernis. Später verlängerten sich auch noch die Verkaufszeiten, schon damals bis 18:00 Uhr. Das war nicht mehr schön und ich hörte im Warenhaus auf und verließ den Handel ganz.
Ich habe kein anderes Hobby als das Segeln. Wir beide sind im Segelverein, das macht viel Arbeit, auch ehrenamtlich. Wir machen im Verein alles selbst. Es ist ein Arbeitersegelsportverein, in den mein Schwiegervater schon 1928 eintrat. Alle Traditionen haben wir aufrechterhalten, von DDR-Zeiten bis heute.
Als ich den Handel verließ, ging ich an die Humboldt-Uni als Buchhalterin. Damit begann sozusagen der »finanzielle und rechnerische Teil« meines Arbeitslebens. Das habe ich vier Jahre gemacht, dann wechselte ich erneut, da ich mit einem Fernstudium begonnen hatte. Ich studierte vier Jahre Finanzwirtschaft an der Fachschule Gotha und schloss sie als Finanzwirt ab. Während der Studienzeit habe ich nochmal die Anstellung gewechselt und bin vom Staatshaushalt in die Wirtschaft gegangen. Ich habe beim VEB* Schiffselektronik Rostock, mit Standort Berlin, gearbeitet, und war dort als Betriebswirt im Forschungsbereich tätig.
Ich wollte das Studium machen, bemühte mich selbst darum, denn ich hatte für diese Berufsrichtung keine Ausbildung. Eigentlich wollte ich nur den Facharbeiter machen, aber mein Chef sagte: »Machen Sie mal gleich ein richtiges Studium, denn das Zeug dazu haben Sie.« Das Programm war ein Fernstudium als Frauensonderstudium*, das sich dadurch auszeichnete, dass man einen Tag Konsultation an der Schule vor Ort hatte und einen Studientag. Wir waren also zwei Tage von der Arbeit freigestellt. Das war eine schöne Sache. Man musste seine Arbeit natürlich trotzdem schaffen. Manchmal habe ich deshalb sonnabends gearbeitet. Wenn man das eine will, muss man eben das andere auch machen. Gleichzeitig musste ich den Abschluss der zehnten Klasse nachholen. Das ging in einem Vorbereitungslehrgang über ein Jahr, der ebenfalls über ein Frauensonderstudium lief. Der Betrieb bot das an, kümmerte sich um alles und es war kostenlos.
Mein Kind, eine Tochter, ist 1973 geboren. Wir als Eltern haben sie 1977 erhalten. Der Versuch, eigene Kinder zu bekommen, war erfolglos, obwohl wir uns letztlich sogar mit einer Hormonbehandlung bemühten. Wir entschieden, ein Kind zu adoptieren. Der Antrag lief und es wurde geprüft, ob wir geeignet, die Familienverhältnisse in Ordnung sind, und und und. Es gab aber noch kein Angebot. Die Frau meines Chefs hatte eines Tages ein kleines Mädchen an der Hand und sagte: »Mein Bruder ist an Lungenkrebs gestorben, seine Ehe war geschieden, und die Kleine ist ihm als Vater zugesprochen worden.« Das Mädchen war drei Jahre alt und immer bei der Oma oder bei anderen ihrer Kinder, die bereits Kinder hatten. Die Frau meines Chefs hatte zwei eigene, sodass die Situation für das Kind kompliziert war. Und der Mann wollte das alles nicht. Da habe ich gesagt: »Na, dann gib sie doch uns.« Und weil wir ohnehin einen Antrag gestellt hatten, ist das alles für uns gut gelaufen.
Elternzeit gab es damals nicht. Ich hätte frei nehmen müssen. Ich habe aber einen Kindergartenplatz bekommen. Das war problemlos. Ich arbeitete nicht voll, auch nicht vor der Adoption. Mein Mann konnte im Haushalt nicht viel machen, und um das alles zu schaffen, auch mit dem Studium, habe ich verkürzt gearbeitet, sechs Stunden.
Die Großmutter hatte das Mädchen auf die Adoption vorbereitet und ihr gesagt, dass sie heute zu ihrem Vater komme. Mein Mann hatte wohl tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrem leiblichen Vater, sodass sie ihn von Beginn an akzeptierte. Sie sagte bei der Übergabe: »Papa, endlich bist du wieder da.« Es war eine herzzerreißende Szene. Sie hatte eine verschwommene Erinnerung an ihren Vater, weil sie ihn im Krankenhaus immer besucht hatte. Bewusst war ihr nicht, dass sie adoptiert wurde, aber später haben wir ihr es gesagt.
Das Kind haben wir großgezogen. Es war sehr schwer. Sie hat oft nicht das gemacht, was wir wollten oder empfahlen. Sie sagte immer »ja, ja«, hat aber das Gegenteil gemacht.
Sie ist leider ihren Weg nicht gegangen, hat es nicht geschafft, den Abschluss der zehnten Klasse zu bekommen. Wir nahmen sie nach der achten Klasse von der Schule. Die Schule hat zugestimmt, damit sie eine Berufsausbildung als Gärtnerin machen konnte, da sie sich für Pflanzen interessierte. Es hat ihr Spaß gemacht, aber es fehlte ihr teilweise an Konzentration und Geduld. So war sie leider auch da immer am letzten Ende. Die Wende fiel in ihre Ausbildungszeit, und so war es auch damit vorbei. Heute kommt sie zurecht.
Ich bin der Meinung, dass wir im Osten ganz frei groß geworden sind. Gleichberechtigung von unten war nicht nötig. Wir sind ja nicht unterdrückt worden von irgendjemandem, auch nicht vom Chef.
Wir saßen in Leitungssitzungen zusammen, redeten, berieten, ich habe da nie etwas Negatives empfunden. Der Mann ist eben ein Mann. Das darf man mit der Gleichberechtigung nicht so eng sehen. Wenn der Mann der Hauptverdiener ist und den ganzen Tag unterwegs ist und spät nach Hause kommt, hast du als Frau viel mehr im Haushalt erledigt und bist mehr damit verwachsen. Da musstest du eben Frau sein. Beim Studium hat mich mein Mann unterstützt. Er hat mir die Zeit gegeben, wenn ich für die Schule etwas machen musste. Das war vor allem am Wochenende. Er hat dann im Haushalt etwas gemacht. Es ist trotzdem für mich noch viel übrig geblieben. Das sehe ich als Arbeitsteilung an. Mein Mann hat nicht weniger gearbeitet.
Zu DDR-Zeiten hatten wir nicht so viele technische Küchengeräte. Wenn wir etwas gebrauchen konnten, kauften wir das gemeinsam. Geld war da, um etwas zu kaufen, um Arbeitserleichterung zu schaffen. Das ist heute noch so. Küchengeräte geschenkt hat mir mein Mann nie, ein Geschenk war eher etwas Persönliches.
Das Verhältnis zwischen meinem Mann und mir ist normal. Wenn es Dicke kommt, setzt sich der Mann eher durch, aber ich auch. Jetzt sind wir 53 Jahre verheiratet.
In unserer Familie gab es viele politische Diskussionen. Mein Mann war sozialistisch erzogen, meine Familie nicht. Mein Schwiegervater hatte die Grausamkeiten zweier Weltkriege erlebt und wollte eine bessere Gesellschaft. Mein Mann ist in seiner Familie dadurch geprägt worden. Wir beide haben keine großen Unterschiede im Denken. Aber da wir nunmehr beide Systeme miterlebt haben, haben meine Geschwister und wir inzwischen eine differenziertere Anschauung.
Die Wende haben wir am Fernseher verfolgt und den Fernseher keine Minute ausgeschaltet, um auf dem Laufenden zu sein. Als es hieß, dass die Grenzen für immer offen seien, kam ich gerade vom Sport. Ich bin aber bei Grenzöffnung nicht gleich losgerannt. Am nächsten oder übernächsten Tag ging ich mit meiner Tochter rüber. Der Menschenauflauf war unglaublich. Ich habe die 100 DM geholt und habe ihr alles gezeigt, denn ich bin ja früher immer in den Westen gefahren. Meine Mutter hatte dort eine Bekannte. Ich wusste also vieles aus meiner Jugendzeit. Es war für mich spannend, wieder einmal in das KaDeWe zu kommen. Für meine Tochter war das nicht so interessant, auch heute nicht, sie geht kaum in den Westen. Der große Kaufrausch blieb bei uns aus. Wir waren ja in der DDR nicht unzufrieden. Wir hatten unser Auskommen, wenn es doch manchmal stressig war. Man konnte natürlich andere verstehen, die die Mangelwirtschaft nervig fanden. Die hätte meines Erachtens nicht sein müssen, denn wir haben in der DDR genug produziert, aber haben alles in den Westen verkauft.
Nach der Wende wurde ich arbeitslos. Unsere Außenstelle fiel weg und ich ging zurück in die Hauptfirma. Zu DDR-Zeiten arbeitete ich in einer Leitungsfunktion als führende Ökonomin, nun als Sachbearbeiterin in der Kalkulation. Ich habe noch einmal eine Weiterbildungsmaßnahme gemacht, die vom Arbeitsamt angeboten wurde und sich auf die kapitalistische Wirtschaft bezog. Mein Mann vermittelte mich danach zu einem Bauinstitut. Da habe ich als Ökonomin gearbeitet. Unter den Beschäftigten gab es mehr Wessis. Wir aus dem Osten haben die freien Plätze bekommen und wurden akzeptiert. Es war ein nettes Verhältnis.
Auch finanziell war es gleich, kein Unterschied Ost/West. Es wurde nach Tarif bezahlt. Ich habe nicht voll gearbeitet, aber die Fachkräfte schon. Nach viereinhalb Jahren bin ich mit sechzig in Rente gegangen, das wollte ich so, obwohl ich eine Rente mit Abzügen habe. Ohne das Geld meines Mannes wäre es eng.
Die erweiterten Reisemöglichkeiten nach der Wende haben wir gut genutzt. Ich sehe es so, dass das System der DDR positive Seiten hatte, weil wir offen, ehrlich und frei miteinander umgingen. Wir kannten unsere Gehälter, haben politisch und fachlich im Arbeitsprozess diskutiert und den anderen akzeptiert. Letzten Endes haben wir uns geeinigt, einen gemeinsamen Weg gefunden. Auch im Westen hatte ich keine Probleme. Herablassendes Verhalten, weil ich ein Ossi bin, habe ich nicht erlebt. Auch nicht meine anderen Kolleginnen.
Ich bin in beiden Systemen gut klar gekommen. Die Gleichberechtigung war meiner Meinung nach zu DDR-Zeiten wesentlich besser und der Schwache wurde mehr mitgenommen. In der DDR waren wir zwölf Leitungsmitglieder, darunter war ich die einzige Frau. Wenn einer gegen mich war, ist mir kein anderer zur Seite gesprungen. Aber meine Strategie war, mir einen Sympathisanten zu suchen. Dann haben wir beide nachgedacht und eine Lösung gefunden. Vielleicht hängt das mit meiner Kindheit zusammen, weil ich lernen musste, andere Meinungen zu akzeptieren. Und dafür darf man nicht stur sein.
Ich würde heute in jedem Falle allen Frauen empfehlen, arbeiten zu gehen. Das schafft Freiheit und Selbstbewusstsein. Natürlich spielt eigenes Geld eine Rolle. Arbeit schafft Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Nur Hausfrau zu sein wäre für mich absolut nichts gewesen, ich hätte mich nicht wohlgefühlt. Auch wenn man im Kollektiv ist, bestimmte Sachen erstreiten und nach Lösungen suchen muss, bringt es Vorteile und erweitert den Horizont. Man ist charakterlich nicht so verbohrt. Für den Menschen ist das unheimlich wichtig.
Versetzung. © copyright 2018, Beate Kern
Hartes Brot gibt gute Zähne
Sonja, Jahrgang 1948
Ost: Elektrozeichnerin, Diplom-Mathematikerin, West: Marketingleiterin, Mitarbeiterin einer
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Technologievermittlungsagentur,
Referentin Vorstandsstab DKB
Das absolute Wunschkind kann ich ja nicht gewesen sein, denn meine Mutter hatte mich gerade einem Monat nach ihrem 19. Geburtstag und ihrer Hochzeit entbunden. Sie sagte mir mal, sie hätte es vorher gar nicht gemerkt, denn zu ihrer Hochzeit war sie so schlank, dass das Konfirmationskleid noch passte. Ein Punkt, der mich mein ganzes Leben lang beschäftigte. Aber dank meiner Oma habe ich wirklich eine sehr gute Kindheit erlebt.
Meine Eltern waren in ihrer politischen Arbeit engagiert. Sicherlich wollten sie immer das Beste für mich, aber ob das wirklich das Beste für mich war, ist eine ganz andere Sache. Ich hätte wahrscheinlich andere Sachen gut gefunden, statt im Kinderheim Königsheide oder in den Wochenheimen in Erfurt und in Berlin-Kaulsdorf untergebracht zu werden. Das muss man als kleines Kind nicht unbedingt gut finden. Ich hätte vielleicht manchmal lieber zu Hause geschlafen. Geholfen haben mir viele Gespräche mit meiner aus einem Taschentuch geformten Gesprächspartnerin.
Warum ich in einem Kinder- und in Wochenheimen war? Ich vermute, dass meine Eltern davon überzeugt waren, dass das während ihrer beruflichen Abwesenheit die beste Möglichkeit war, ihre Tochter sozialistisch zu erziehen, also im Sinne einer neuen Zeit. Eine Gemeinschaftseinrichtung und Koedukation waren schon etwas, was vor allen Dingen mein Vater, der ja nach dem Zweiten Weltkrieg als Neulehrer anfing, als sehr richtig empfand. Sicherlich glaubten sie, dass es mir dort an nichts fehlen würde, dass ich dort Freunde finde und ich in dieser schwierigen Zeit richtig verpflegt werde. Alles Dinge, die sie aufgrund ihrer Verpflichtungen nicht immer hätten gewährleisten können. Und da ich nicht zu meiner Oma konnte, weil mein Opa Tuberkulose hatte, denke ich, dass meine Eltern wirklich davon ausgegangen sind, dass es das Beste für mich war, während mein Vater zum Studium in der Sowjetunion und meine Mutter zu einem Lehrgang in Erfurt war. Es war nicht das Beste für mich, aber ich habe es überlebt.
Viele Erlebnisse aus der Kindheit überträgt man ins Alter. Ich habe mir in den letzten Jahren eine wunderbare alte Puppenstube neu zusammengekauft. Denn ich habe immer sehr gerne mit Puppen gespielt. Jetzt erinnere ich mich, wie meine Mutter eines Tages einfach eine meiner zwei Puppen verschenkt hat, weil die Nachbarskinder wohl keine hatten. Ohne mich zu fragen, eine Puppe war einfach weg. Das fand ich nicht so toll. Nun denke ich an eine Episode aus dem Kinderheim Königsheide. Sie haben uns öfter im Bett angebunden. Ich war ja noch klein und habe mit meinen Füßen immer auf dem Bettlaken gerieben, bis ich plötzlich merkte, dass es an den Füßen warm wird. So habe ich erkannt, dass Reibung Wärme erzeugt. Das habe ich damals fürs Leben gelernt. Ich denke, dass ich da fünf Jahre alt war.
Das Beste war meine Oma. Sie hat mir ganz viel Liebe gegeben. Das war ein wunderbarer Ausgleich zu meinen sicherlich sehr ehrgeizigen Eltern. Ich bin ihr mein Leben lang dankbar gewesen. Sie war tatkräftig, hat aus jeder Situation das Beste herausgeholt, für ihre Familie gekämpft und immer etwas Gutes auf den Tisch gebracht. Meine Oma war von Beruf Schneiderin. Aus alten Stoffen zauberte sie Neues zum Anziehen für mich, auch weil es bei meiner Figur oft nichts Passendes zu kaufen gab. In den Ferien fuhr ich immer zu ihr. Sie war für meinen Sohn eine ganz wunderbare Urgroßmutter.
Meine Eltern wollten natürlich eine schöne und kluge Tochter haben. Das war ich nicht, klug ja, ich hatte aber leider immer ein paar Pfund zu viel. Sicherlich wird man als hübsches Mädchen mit blonden Zöpfen von allen ein bisschen mehr beachtet und geliebt. Ich musste mir vieles erkämpfen, ohne dass ich dabei unglücklich wurde. Im Gegenteil, ich bin sehr stolz darauf, wie ich mich entwickelt habe. Im Laufe des Lebens habe ich mir gesagt: »Hartes Brot gibt gute Zähne, und du hast dann für dein Leben vielleicht ein bisschen mehr davon.«
Die Schulzeit war harmonisch, ich hatte immer gute Leistungen und habe mit dem Abitur den Beruf einer Elektrozeichnerin erlernt. Danach studierte ich Mathematik, weil ich erstens einen Mathelehrer hatte, der der schönste Mann der Schule war, und mir zweitens dachte, was Jungs können, das kann ich auch. Während des Studiums habe ich natürlich den FDJ*-Sekretär geheiratet. Dem schloss sich ein Mathematik-Forschungsstudium an. Ziel war die Dissertation. Mein Betreuer war der Bruder von Tanja Bunke, der Freundin von Che Guevara. Wir wurden aber keine Freunde. Er betreute als Forschungsstudenten zwei Jungs und mich. Ich musste jeden Mittwoch antanzen und über das Erreichte berichten. Die Jungs dagegen hatten Freiraum. Als ich fand, die Doktorarbeit sei fertig, meinte mein Betreuer: »Ja, sie ist gut, allerdings als Diplomarbeit. Als Dissertation bekommst du ein neues Thema und kannst von vorne anfangen.« Darauf hatte ich keine Lust. Ich habe also das Diplom genommen und das Studium mit Auszeichnung abgeschlossen. Im Anschluss bewarb ich mich völlig selbstständig ohne die zentrale Studentenvermittlung im Geräte- und Regler-Werk Teltow (GRW), Betriebsteil Berlin. Sie stellten mich als Programmierer ein.
1975 kam das erste Kind und ein Jahr darauf das zweite, was leider mit einer Behinderung geboren wurde. Ich bin mir sicher, dass die Ursache nicht etwa ein genetischer Defekt war, sondern Probleme in der ersten Schwangerschaftshälfte, die ich genau datieren kann. Ich erhielt ein Parteiverfahren, weil ich mich sträflicher Weise traute, im Beisein meines Kaderleiters zu sagen: »Das Buch von Solschenizyn ›Archipel Gulag‹ müsste Pflichtliteratur für alle Genossen sein.« Ich konnte danach nicht weiter im GRW arbeiten. Leider ist das Baby verstorben. Man hatte noch versucht, es zu operieren. Aber zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Herz-Lungen-Maschine für kleine Säuglinge. Heute wäre das möglicherweise kein Problem mehr. Das hat mich hart getroffen, ich war monatelang nicht arbeitsfähig. Dann stellte ich mich eines Tages morgens im EAW* zu allen anderen Arbeitssuchenden an die Pforte. Ich habe mich heulend beworben. Eine Kaderleiterin erbarmte sich meiner. Sie wies mir eine Stelle in der Betriebsorganisation zu. Dort war ich ein Jahr und musste als Diplom-Mathematikerin Ordnerrücken mit Normschrift beschriften, weil ich das ja als Elektrozeichner gelernt hatte. Dass das nicht lange gut gehen konnte, war klar. Schließlich entdeckte mich dort ein ehemaliger Schulkamerad und schlug mir vor, in die Abteilung Wissenschaft und Technik zu wechseln. Nichts lieber als das.
Dieser Wechsel hat sicherlich meinen ganzen weiteren Lebensweg beeinflusst. Ich wurde wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Direktor der Abteilung Wissenschaft und Technik. Da war ich 30 Jahre alt. Als eine Anforderung aus dem Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik kam, schaute man auf mich: Frau und keine Westverwandtschaft. Ich hatte überhaupt keine Lust, dorthin zu gehen, und so formulierten wir in den Vertrag, dass ich nach einer gewissen unbestimmten Zeit zurückkommen konnte. Dieser Vertragszusatz hat mir geholfen, nach der Wende vom Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik wieder in das EAW zurückzugehen. Ich habe mich einfach auf dieses Schriftstück berufen. Im Ministerium war ich für den Staatsplan Wissenschaft und Technik verantwortlich. Hier lernte ich alle Kombinate und vor allem deren Forschungsdirektoren kennen, was mir später nach der Wende in all meinen Tätigkeiten sehr geholfen hat. Mir hat die Arbeit sehr großen Spaß gemacht. Sie haben mich auf die Bezirksparteischule geschickt und mich im Jahr der Wende zum Sekretär der Abteilungsparteileitung gewählt. Das war nicht mein Ding, jeden Monat einmal über Planerfüllung zu reden.
Stattdessen besorgte ich mir immer interessante Leute, die von ihren Erfahrungen berichten konnten. Einmal war der ehemalige Kulturminister Hans Bentzien unser Gast, einmal eine Sinologin der Humboldt-Universität, die über China nach den Ereignissen auf dem Platz des Himmlischen Friedens sprach. So habe ich interessante Parteiversammlungen organisiert, was mir den Ruf einbrachte, eine Vertreterin der neuen Generation zu sein. Ich glaube, dass das eigentlich die Grundlage für meine Tätigkeit nach der Wende war, als ich Messen, Kongresse, Veranstaltungen organisiert habe, bis zu den Eliteforen der Deutschen Kreditbank (DKB). Alles hat etwas damit zu tun, sich selbst interessante Themen auszudenken, sich zu überlegen, was die anderen interessiert und mutig die entsprechenden Referenten dazu zu holen. Ein Fazit meines Berufslebens wäre, dass alles aufeinander aufgebaut hat. Dass ich nicht einen Tag arbeitslos war, verdanke ich dieser Einstellung und Fähigkeit, auf die ich schon stolz bin.
Das Thema Wissenschaft und Technik ließ mich nach der Wende nicht los. Wieder zurück im EAW war schnell klar, dass die Strategie des EAW, sich mit AEG zu vereinigen, nicht aufgehen wird. Das Forschungszentrum nutzte die Chance, sich im Rahmen eines Management-Buy-out auszugründen. Ich habe mit über vierzig Gesellschaftern »aucoteam« gegründet und wurde Marketingleiterin, weil das keiner machen wollte. Den Namen habe ich erfunden. Von Marketing hatte ich natürlich keine Ahnung, habe viel gelesen, bin oft in die Amerika-Gedenkbibliothek gegangen.
Und da spielt ein Bild, was in meinem Leben immer wichtig war, eine Rolle, und zwar der Butterfrosch. Es gibt eine Geschichte, die geht so: Zwei Frösche fallen in einen Brunnen, gefüllt mit Milch und Sahne. Der eine Frosch geht unter, und der andere strampelt wie ein Irrer, bis er aus dieser Sahne Butter geschlagen hat. Dann klettert er aus dem Brunnen heraus. Das war meine Devise: Du musst immer aus allem etwas machen, treten, treten, trampeln, also die Milch so lange schlagen, bis daraus Butter wird. Und wenn man dir Steine in den Weg legt, kannst du noch etwas Schönes daraus bauen.
Ja, als Marketingleiterin ging ich in den Marketing-Club Berlin. Ich dachte, West- und Ostexperten sollten zusammenkommen, voneinander lernen. Die Westexperten wollten wohl lieber wie Heuschrecken in die Ostunternehmen einfallen und dort alles in die Hand nehmen. Das habe ich dort laut gesagt, denn wir konnten Vieles, waren durchaus in der Lage, uns schnell auf neue Situationen einzustellen und eins und eins zusammenzählen. Im Ergebnis habe ich sieben Arbeitsangebote aus Westunternehmen bekommen. Ich wechselte zunächst in eine Technologie-Vermittlungsagentur, eine Selbsthilfeeinrichtung der Berliner Wirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen. Das war in einem Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit für Technologietransfer und Innovationsförderung in den neuen Bundesländern.
Mir halfen meine Kontakte zu den Forschungsdirektoren, die nun oft Betriebsdirektoren waren. Ich habe die erste Laser-Optik Messe in Berlin organisiert, eine Kongressmesse. Und ganz besonders stolz bin ich, dass ich für eine dieser Messen Konrad Zuse, den Erfinder des Computers, bei seinem letzten Berlin-Besuch, bevor er gestorben ist, gewinnen konnte. Dieses Thema bearbeitete ich auch im Innovationsteam neue Bundesländer in der Deutschen Bank, ehe ich mich bei der DKB bewarb, meiner letzten beruflichen Station. Das war eine wirklich interessante Aufgabe, die mich die letzten fünf oder sechs Jahre meines Berufslebens im Vorstandsstab der DKB beschäftigt hat, nämlich die Entwicklung und Organisation von Eliteforen zu den Themen Bildung, Gesundheit und erneuerbare Energien. Es hat sich keiner beschwert, dass ich zu alt bin, sondern im Gegenteil, wir waren wirklich immer ein gutes Team. Einige Kollegen versuchen heute noch, in Kontakt mit mir zu bleiben.
Zu meiner Familie. Der erste Sohn wurde 1975 geboren, der zweite 1976. Er ist 1977 verstorben. Ich frage mich heute manchmal, wie mein Sohn diese Zeit überhaupt erlebt hat. Zum Glück war das ja die unbewusste Zeit, aber ich konnte mich, glaube ich, nicht viel um ihn kümmern. Ich kann mich nicht erinnern, wann er laufen und sprechen gelernt hat, weil ich natürlich mit der Sorge um den Kleinen voll zu tun hatte. Nach dessen Tod sind wir zuerst einmal zu meiner Oma gefahren. Sie hat uns beide wirklich aufgepäppelt. Als mein Sohn wieder in die Krippe kam, fragten sie mich, was ich denn mit dem Kind gemacht hätte. Er sähe jetzt gesund und wohlgenährt aus. In der Zeit haben mein Mann und ich uns die Arbeit natürlich geteilt. Mein Mann hat ihn in die Krippe gebracht, und da wir kein Auto hatten, mussten wir ein ganzes Stückchen laufen, und das bei Wind und Wetter. Das war manchmal nicht einfach, denn meine Arbeit im EAW begann um 6:45 Uhr. Das hieß um 6:00 Uhr vor der Krippe stehen und war eine starke Belastung für mich und meinen Sohn. Das änderte sich zum Glück mit dem Wechsel in den Kindergarten, ganz in unserer Nähe.
Die Anmeldung in die Musikschule ging auf eine Initiative seiner Kindergärtnerin zurück. Dafür waren wir ihr sehr dankbar, denn unser Sohn hat gut Flöte spielen gelernt. Er ging in die gleiche Schule wie ich. Seine Klassenlehrerin schlug nach zwei Jahren den Wechsel an die Schule mit erweitertem Russischunterricht vor, wo die besten Schüler des Bezirks Treptow zusammengezogen waren. Auf diese Idee wäre ich selbst nicht gekommen und kann nur sagen: Danke. Er hat dort ganz gute Leistungen erreicht, gute Freunde gefunden, die er heute noch hat, und viel fürs Leben gelernt. Heute ist er Analyst – zum Glück nicht Fondsmanager. Er ist verheiratet und sie haben einen fünfjährigen Sohn. Beide arbeiten in Frankfurt. Mein Enkelsohn geht in die Kita. Sie wohnen in Mainz, dadurch gibt es für mich leider wenige Möglichkeiten, schnell mal hinzufahren. Aber wir telefonieren, skypen, und ich bin immer in der Fastnachtszeit da.
Meine Ehe mit meinem ersten Mann, dem Mathematiker, war nicht unkompliziert. Zu DDR-Zeiten hatte er eine außerplanmäßige Professur, die nach der Wende natürlich nicht mehr anerkannt war. Er fiel in ein Loch. Irgendwann kaufte ich eine Zeitung und schlug ihm vor, sich auf eine Stellenausschreibung in K. zu bewerben. Da wir kein Auto hatten und er nicht jede Woche nach Hause kam, führten wir eine Fernbeziehung. Und wenn er nach Hause kam, gab es in meiner Erinnerung für ihn folgende Reihenfolge: Schachcomputer an, erst kam die weiße, dann die schwarze Dame, und danach ich. So empfand ich das. Wir entfremdeten uns. Dies trug sicherlich dazu bei, dass ich eine alte Beziehung aus dem EAW wieder aufgriff. Er war mittlerweile Geschäftsführer eines mittelständischen Maschinenbauunternehmens, Witwer und hatte einen elfjährigen Jungen. Ich sah es als meine Aufgabe an, ihm und dem Sohn zur Seite zu stehen, und wir haben geheiratet. Ich denke, ich habe wesentlichen Anteil daran, dass der Sohn das Fachabitur geschafft hat. Die Ehe hielt aber nicht sehr lange. W. neigte sich seiner 16 Jahre jüngeren Buchhalterin zu. Und ich nutzte die Zeit, um mich voll auf meine Arbeit zu konzentrieren. Das fiel zeitlich zusammen mit meinem Wechsel zur DKB, wo ich mich mit den Worten beworben habe: »Meine Scheidung läuft gerade, ich kann mich jetzt voll auf meine Arbeit konzentrieren.« Schließlich war ich 54 Jahre. Andere denken da schon an den Ruhestand. Aber das hätte ich mir nicht leisten können, denn mit meiner Scheidung übernahm ich die Schulden für meine Eigentumswohnung. Das hieß, sehr sparsam leben, um den Kredit abzubezahlen. Es ist mir gelungen, und darauf bin ich recht stolz.
Sehr gute Kontakte habe ich zu ehemaligen Mitschülern aus meinem Abiturjahrgang. Da ich ja Zeit hatte, familiär nicht mehr so gebunden war, konnte ich mich in der Organisation eines Jahrgangstreffens anlässlich unseres 40-jährigen Abiturjubiläums engagieren. Dazu wollte ich unbedingt den Kontakt zu einem Schüler aus der damaligen Parallelklasse aufnehmen, weil ich wissen wollte, was aus dem Jungen geworden war, der das Abitur mit 1,0 schaffte und besser als ich war. Ich fand ihn in England und wir haben einen sehr intensiven Kontakt über E-Mails und Telefon. In der Zeit, als ich alleine war und eine Scheidung zu verarbeiten hatte, hat er mir sehr beigestanden, kluge Ratschläge gegeben und mir geholfen, wieder zu mir selbst zu finden. Damals begann ich, etwas zu dichten, einige Gedichte sind sogar veröffentlicht worden. Jetzt schreibe ich vor allen Dingen zu Ostern und zu Weihnachten ein bisschen politische Festtagslyrik.
Eigentlich kann ich sagen, dass ich mit meinem Leben zufrieden bin. Seit einiger Zeit absolviere ich ein Fernstudium als Spitzenklöpplerin für Torchonspitze. Dazu regte mich meine Puppenstube an, ich benötigte doch Gardinen.
Noch im Jahr 2010 ist B., ein ehemaliger Schulkamerad, in mein Leben getreten. Eigentlich hatte ich mich auf ein Sololeben eingerichtet. Zwei meiner Gruppenkontakte zeigten mir an, dass er Geburtstag hatte. Also rief ich ihn an. Einen Termin zu vereinbaren, erwies sich als kompliziert. Der auf Wochen einzige freie Termin war am gleichen Tag. Also trafen wir uns. Ich kann mir nicht erklären, warum ich ihm mein ganzes Leben erzählt habe. Und er lächelte nur. Mir war aber klar, dass aus uns nichts werden konnte, denn alle meine Männer hatten im Vornamen als zweiten Buchstaben ein »O«. Als ich ihm das sagte, entgegnete er: »Mein eigentlicher Name ist Lorenz.« Und das andere Komische hing mit seiner Visitenkarte zusammen. Auf der befand sich eine Ameise. Von Ameisen hatte ich am Vorabend Besuch erhalten, sie waren in einer langen Prozession durch meine Wohnung zogen und ich hatte nach Mitteln gesucht, sie wieder loszuwerden. Das konnte alles kein Zufall sein. Irgendwann stand er mit dem Koffer vor meiner Tür und zog langsam bei mir ein. Meine Wohnung sieht jetzt nicht mehr so aufgeräumt aus wie zuvor, und den Keller kann man nicht mehr betreten. Wir haben die Prüfung für den Bootsführerschein für Motorboote gemacht, B. hat es sofort geschafft, ich bei der Wiederholung. Jetzt fahren wir Boot. Unser Boot heißt Super Sonja, mittlerweile II, und ist knallrot.
Gleichberechtigung, das ist ja eine Gewissensfrage. Ich denke, ich bin in dem Gefühl einer Selbstverständlichkeit aufgewachsen. Ich habe mich Jungs nie unterlegen gefühlt. Allerdings sollte es keine Gleichmacherei geben. Die Kohlen können die Jungs weiter aus dem Keller holen und die Mädchen können von mir aus das machen, was sie besser als Jungs können. Jeder Mensch hat andere Stärken. Später ist mir schon klargeworden, dass die Gleichberechtigung noch nicht vollständig durchgesetzt war. In der DDR, hatte ich den Eindruck, konnte man als Frau ganz gut Karriere machen, wenn man es wollte, die notwendige Unterstützung fand, sein Familienleben organisieren konnte, das Kind gut versorgt war und man selbst frei war, sich zu entwickeln.
Heute sehe ich, dass Frauen deutlich weniger verdienen als Männer. Vielen Frauen fehlt der Mut und das Selbstbewusstsein. In der Bundesrepublik war die Gesellschaft ganz anders organisiert. Da war der Mann durchaus der Dominante, der das Sagen hat, der sich auch materiell um die Familie kümmern musste, die Verantwortung trug. Es wurde ihm nicht so leicht gemacht, sich scheiden zu lassen. Die Frauenbewegung hat ihren großen Anteil daran, bestimmte Dinge überhaupt erst einmal zu hinterfragen. Es wurde auch ganz viel geschafft, etwa als die jungen Menschen in der 68er-Bewegung einiges geradegerückt haben.