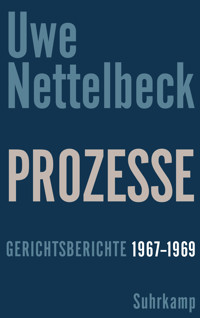
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In den sechziger Jahren erlebt die Bundesrepublik ihren bis dahin radikalsten Wandel: Traditionelle Werte verlieren ihre Überzeugungskraft, die bürgerliche Kleinfamilie gilt vielen als Zwang, Studenten tragen ihren Protest aus den Universitäten auf die Straße, die erste Generation der RAF formiert sich. Als Gerichtsreporter der »Zeit« ist Uwe Nettelbeck mittendrin. Er berichtet von alltäglichen Schicksalen, aber auch über einige der spektakulärsten Strafsachen der Nachkriegszeit, etwa den Prozess gegen den »Kirmesmörder« Jürgen Bartsch oder den Frankfurter Brandstifterprozess gegen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und andere. Nach fast fünfzig Jahren versammelt dieser Band erstmals die Gerichtsreportagen, die Nettelbeck zu einem der bekanntesten Journalisten des Landes machten. Bis heute gehören sie zu den besten Artikeln, die je in deutschen Zeitungen veröffentlicht wurden. Nettelbeck schreibt verständlich, stets getrieben von dem Wunsch, die Motive, die Umstände und die Geschehnisse zu begreifen und sie dem Leser begreiflich zu machen. So entsteht ein einzigartiges Panorama jener bewegten Zeit. Doch seine meisterhaften Texte sind mehr als nur Zeugnisse: Immer stellt er sich auf die Seite der Opfer von Justiz, Politik und Gesellschaft. Wo andere überreden wollen, fordert er vom Leser, Partei zu ergreifen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
In den sechziger Jahren erlebt die Bundesrepublik ihren bis dahin radikalsten Wandel: Traditionelle Werte verlieren ihre Überzeugungskraft, die bürgerliche Kleinfamilie gilt vielen als Zwang, Studenten tragen ihren Protest aus den Universitäten auf die Straße, die erste Generation der RAF formiert sich. Als Gerichtsreporter der Zeit ist Uwe Nettelbeck mittendrin. Er berichtet von alltäglichen Schicksalen, aber auch über einige der spektakulärsten Strafsachen der Nachkriegszeit, etwa den Prozeß gegen den »Kirmesmörder« Jürgen Bartsch oder den Frankfurter Brandstifterprozeß gegen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und andere. Nach fast fünfzig Jahren versammelt dieser Band erstmals die Gerichtsreportagen, die Nettelbeck zu einem der bekanntesten Journalisten des Landes machten. Nettelbeck schreibt verständlich, stets getrieben von dem Wunsch, die Motive, die Umstände und die Geschehnisse zu begreifen und sie dem Leser begreiflich zu machen. So entsteht ein einzigartiges Panorama jener bewegten Zeit. Doch seine meisterhaften Texte sind mehr als nur Zeugnisse: Immer stellt er sich auf die Seite der Opfer von Justiz, Politik und Gesellschaft. Wo andere überreden wollen, fordert er vom Leser, Partei zu ergreifen.
Uwe Nettelbeck (1940-2007) war Journalist, Schriftsteller und Musik-produzent. Er arbeitete unter anderem als Gerichtsreporter und Filmkritiker für Die Zeit, bevor er 1969 stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift konkret wurde. Zwischen 1970 und 1975 produzierte Nettelbeck die Krautrockband Faust. Von 1976 bis zu seinem Tod gab er, gemeinsam mit seiner Frau Petra Nettelbeck, die Zeitschrift Die Republik
Uwe Nettelbeck
PROZESSE
Gerichtsberichte 1967–1969
Herausgegeben von Petra NettelbeckMit einem Nachwort von Henrik Ghanaat
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2015.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Inhalt
Ich hatte doch keinen Grund
Der Fall des Malergesellen Eckart Mellentin, der zum Doppelmörder wurde
Ich hab' doch solche Angst gehabt vor dem Mann
Ein Leben ohne Chance – Der Frankfurter Kindsmordprozeß gegen Ursula Kablau (I)
Ich wollte nicht, daß meine zweite Ehe kaputt ging
Das Doppelleben des Mannes – Der Frankfurter Kindsmordprozeß gegen Ursula Kablau (II)
Die dreizehn Tage des Oberamtsrichters Maul
Witze in der Hauptverhandlung – Der Frankfurter Kindsmordprozeß gegen Ursula Kablau (III und Schluß)
Ein Mord, der ohne Strafe bleiben mußte
Der Türke Mahmut und die alte Dame
Recht in höchster Instanz
Eine Revisionsverhandlung des Bundesgerichtshofs – Paragraph 51, Absatz eins oder zwei? – Im Namen des Volkes gegen Volkes Stimme
Pechvogel als Kidnapper
Und dann hat sie geschossen
Mordprozeß Kreutzmann – Eine beinahe alltägliche Geschichte vom Mädchen, das dem Leben nicht gewachsen war
Das war kein Amüsement für mich, Herr Richter
Der Prozeß gegen Jürgen Bartsch – Ein beispielloser Fall (I)
Sein Leben – abgestimmt auf die Uhr der Mutter
Ein beispielloser Fall – Der Prozeß gegen Jürgen Bartsch (II)
Ich bin heute noch froh, daß alles herauskam
Ein beispielloser Fall – Der Prozeß gegen Jürgen Bartsch (III und Schluß)
Es geschah im VW
Sie nennen es einen Sittenprozeß
Nur ein Bild des toten Timo
Notizen aus dem Prozeß gegen Klaus Lehnert
Der Frankfurter Brandstifter-Prozeß
Viermal drei Jahre Zuchthaus für eine sinnlose Demonstration
Die Justiz ist kein Papiertiger
Der Frankfurter Prozeß gegen den Theologiestudenten Christian Boblenz (I)
Es wird verurteilt – auf Biegen und Brechen
Der Frankfurter Prozeß gegen den Theologiestudenten Christian Boblenz (II)
In eigener Sache
Nachwort
Editorische Notiz
Textnachweise
Ich hatte doch keinen Grund
Der Fall des Malergesellen Eckart Mellentin, der zum Doppelmörder wurde
Vor der Justiz lag alles, was nacheinander so natürlichgewesen war, sinnlos nebeneinander in ihm …Robert Musil
Am Abend des 6. Oktober 1965 tötete der damals vierundzwanzigjährige Malergeselle Eckart Mellentin aus Hamburg-Eppendorf, daran ist nicht mehr zu zweifeln, in seinem Mercedes 190 seine dreiunddreißigjährige Geliebte, die Redressiererin und spätere Sekretärin Ingrid Griebau, und den acht Monate alten Thorsten, ihr gemeinsames Kind.
Am Morgen des folgenden Tages bereits entdeckte ein Feuerlöschboot, das im Frühnebel dicht unter Land gelaufen war, am Elbstrand bei Övelgönne die halbbekleidete Leiche der Frau. Ein paar Meter von ihr entfernt fanden die Beamten der Mordkommission zwischen den Steinen auch die Leiche des Kindes. Beide Leichen wiesen Schlagverletzungen auf. Der Kopf der Frau war mit einem stumpfen Gegenstand eingeschlagen, um ihren Hals war ein zerrissener Nylonstrumpf zweimal geschlungen und verknotet. Am Hals des Kindes waren deutliche Würgemale zu erkennen. Als Todesursache konnte bei beiden Leichen zweifelsfrei Erwürgen festgestellt werden.
Noch am gleichen Tage, am Abend des 7. Oktober 1965 um 23 Uhr, wurde Eckart Mellentin in der Wohnung seiner Eltern festgenommen. Wenig später legte er ein volles und detailliertes Geständnis ab.
Er habe, sagte Eckart Mellentin in seiner ersten Vernehmung auf dem Polizeipräsidium, nach einem Geschlechtsverkehr, der sich über längere Zeit hingezogen habe, mit einem Stein auf Ingrid Griebau eingeschlagen. Weil sie noch gestöhnt habe, er meine sogar, seinen Namen gehört zu haben, deshalb habe er ihr einen Strumpf vom Bein gerissen, den rechten, und sie erdrosselt. Weil das Kind auf dem Rücksitz geschrien habe, deshalb habe er auch noch das Kind getötet, mit der Hand erwürgt, nachdem das Kissen, mit dem er es zunächst bedeckt haben will, nicht half. Ingrid habe ihn erpreßt, ihn gequält, körperlich und moralisch. Er habe sie und Thorsten an diesem Abend vom S-Bahnhof Stadtpark abgeholt, in der Nähe, am Südring, habe er den Wagen abgestellt, es sei vorher schon zu einem Streit gekommen, weil er Ingrid nicht die fünfhundert Mark habe geben können, die sie von ihm gefordert habe. Er sei ausgestiegen, um auszutreten, dabei sei er mit dem Fuß gegen einen Stein gestoßen. Ich wußte plötzlich, daß einer von uns beiden gehen mußte. Er habe den Stein aufgehoben und mit in den Wagen genommen. Es sei noch zum Austausch von Zärtlichkeiten gekommen, danach habe er zugeschlagen. Dann erfolgte mein Handeln gegen das Kind. Es hatte ja keine Mutter mehr und war allein auf der Welt, und es schrie, und ich konnte das nicht mehr hören. Als es im Auto still war, hätte ich mich am liebsten selbst getötet. In rasender Fahrt, sagte er, sei er kurz darauf zum Hafen gefahren, dort habe er an einer dunklen Stelle Ingrid und Thorsten, ihre Handtasche und den Kinderwagen, ihren Schlüpfer und ein Netz mit Windeln in die Elbe geworfen. Dabei sei er von einem Streifenwagen vorübergehend gestört worden, dessen Besatzung die dortigen Fischhallen abgeleuchtet habe.
Eckart Mellentin fuhr nach Hause zu seinen Eltern. Am nächsten Morgen unternahm er die ersten unbeholfenen Versuche, Spuren zu beseitigen, obgleich es da keine Spuren mehr zu beseitigen gab. Pünktlicher als sonst erschien er an seinem Arbeitsplatz und bat darum, seinen Wagen zur Inspektion bringen zu dürfen. Zur Tankstelle gegenüber seiner und der Eltern Wohnung brachte er ihn. Er habe Farbe verschüttet, sagte er zu den Tankwarten, die er kannte, ob er seine Fußmatten auswaschen dürfe. Die blutigen Polster schnitt er heraus, den rechten Vordersitz montierte er ab, die Polsterstücke steckte er in einen Papiersack, den Sitz verstaute er im Kofferraum. Als die Kriminalpolizei den Wagen am Tag darauf sicherstellte, fand sie den Sitz im Kofferraum, fand sie den Papiersack, waren die Polster noch feucht von Blut.
Am 17. Januar 1967 fällte ein Hamburger Schwurgericht nach fünftägiger Verhandlung das Urteil über Eckart Mellentin: Wegen erwiesenen Mordes in zwei Fällen, begangen aus niederen Motiven, verurteilte es ihn zu zweimal lebenslangem Zuchthaus; es erkannte ihm die bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit ab und legte ihm die Kosten des Verfahrens auf.
Das Gespenst Ali
Aber der Spruch erreichte Eckart Mellentin nicht mehr, nicht den Mann, der zweimal getötet hatte. Er sei nicht der Täter gewesen, waren seine letzten Worte; er sei unschuldig, hatte er zu Beginn der Hauptverhandlung gesagt. Der Eckart Mellentin, der sich nach der mündlichen Urteilsbegründung widerstandslos abführen ließ, nachdem er sich, dem Richter zugewandt, an die Stirn getippt hatte, war wahrscheinlich schon, auf der Flucht vor seiner Tat, die er nicht begreifen kann, hinter jene endgültige Schranke geraten, über die hinweg keine Verständigung mehr möglich ist. Wie können Sie sagen, daß ich es begangen habe. Ich hatte doch keinen Grund. Es war Ali, der Algerier.
Um sich zu retten, hatte er Ali, den Algerier ohne Familiennamen, erfunden – in einem Brief an die Staatsanwaltschaft drei Tage nach seiner Verhaftung, in dem er sein erstes Geständnis widerrief. Vielleicht hatte er in der Untersuchungshaft gehört, daß man es so anstellen müsse, vielleicht war Ali am Anfang wirklich nur ein plumper Trick, inzwischen jedoch, so sah es in der Hauptverhandlung aus, hat er sich Ali, dem Algerier, den es nicht gibt, anheimgegeben. Vielleicht glaubt er schon heute an ihn, daß er eines Tages an ihn glauben wird, an das Gespenst, das er beschworen hat, wohl um sich vor allem vor sich selber zu retten – dazu schien er entschlossen.
Es hätte der Geständnisse, die Eckart Mellentin abgelegt hat, seines ersten und der Geständnisse, die er dem Widerruf folgen ließ, der drei oder vier verschiedenen Geständnisse, die vermutlich alle einen Teil der Wahrheit enthalten, gar nicht bedurft, um Eckart Mellentin zu überführen – zu eindeutig waren die Indizien, die gegen ihn sprachen. Bei seiner ersten Vernehmung gab er Details zu Protokoll, die nur der Mörder wissen konnte: die Art der Kopfverletzungen; daß der Strumpf, mit dem er Ingrid erdrosselt habe, dabei gerissen sei; ein Streifenwagen hatte tatsächlich in der fraglichen Nacht die Fischhallen abgeleuchtet. Später gab er an, diese Einzelheiten habe ihm Ali am Telephon mitgeteilt. Die Ingrid habe aber mürbe Strümpfe angehabt, soll Ali da gesagt haben, als er ihm lapidar die Kausalität zur Tat hin geschildert habe.
Daß einer, der des Doppelmordes überführt ist und ihn gestanden hat, ihn dann leugnet bis zuletzt, einem Richter ins Gesicht, der es nicht hat fehlen lassen an menschlicher Anstrengung, zu verstehen, Erklärungen zu finden für das Unfaßbare, das doch in ein Strafmaß gefaßt werden mußte, damit der Ordnung, dem Recht der Sozietät, Ordnung sich zu schaffen und zu erhalten, Genüge geschehen konnte, das kann, auf unserer Seite jener Schranke, nichts anderes sein als Berechnung, als ein üblicher Versuch, sich der Strafe zu entziehen, als Unverbesserlichkeit auch dann, wenn es nur der blanke Irrsinn ist.
Eckart Mellentin hatte eine Chance: die, bei seinem Geständnis zu bleiben, dem Richter bei seiner Suche nach Erklärungen zu helfen, um Mitleid zu bitten. Aber es war, als wollte er sich allem Mitleid verschließen. Das ist einer der Schrecken dieses Falles: Durch sein unbegreifliches Leugnen, durch die abstrusen und doch so kläglich durchsichtigen Erfindungen, die Eckart Mellentin zwischen sich und seine Tat schob, nahm er dem Gericht jeden denkbaren Zweifel an der Verworfenheit seines Handelns. Unablässig, so schien es, war er darum bemüht, den Geschworenen den Anblick eines heimtückischen Mörders zu bieten, eines Mörders, dem keine Lüge zu frech ist, der für das Gericht nur ein verächtliches Grinsen hat. Dabei gibt es Erklärungen für Eckart Mellentins Tat und waren – wenn auch vielleicht nicht im Sinne des Mordparagraphen – Zweifel daran erlaubt, ob Eckart Mellentin wirklich der voll zurechnungsfähige, gemeine Mörder war, als der er jetzt für immer hinter Zuchthausmauern verschwindet.
Ich hatte Angst abzustürzen
Eppendorf – das ist einer der besseren Stadtteile in Hamburg. Man kann sagen, daß dort vor allem brave Leute wohnen. Und die Mellentins, Adolf, der Vater, und Marie, die Mutter, sind brave Leute. Während des Krieges zogen sie, ausgebombt, nach Mecklenburg; 1957 nahm Adolf Mellentin seinen Sohn Eckart von der Schule, der damals, wie der Angeklagte sagte, keine Ambition mehr zum Lernen hatte, und kehrte mit ihm illegal zurück nach Hamburg. Die Mutter und Eckarts jüngere Schwester Gisela, der von einer frühen Poliomyelitis eine halbseitige Lähmung geblieben ist, sollten später nachkommen. Erst wollte Adolf Mellentin zusammen mit Eckart das Malergeschäft in Eppendorf aufbauen. Anderthalb Jahre lang schufteten Vater und Sohn – dann war es soweit. Das Geschäft florierte, weil die Mellentins auch nachts und an den Wochenenden arbeiteten, bei Ärzten und Rechtsanwälten, die tags und in der Woche ihre Räume nicht entbehren konnten. Die Mellentins legten Wert auf eine gute, gehobene Kundschaft.
Nach einigen Jahren verließ Eckart das väterliche Geschäft und nahm Arbeit bei einer Anstreicherfirma an, die ihn nach Tarif bezahlte, doch bis zu jenem 6. Oktober 1965 hat er seinem Vater stets geholfen, wenn es nottat – nachts und am Wochenende. Eckart Mellentin war ungewöhnlich tüchtig, fast tausend Mark im Monat hatte er zum Ausgeben, davon konnte er sich den großen Wagen leisten, den er korrekt bezahlt hat. Überhaupt gab es in seinem Leben nichts, das nicht nach Eppendorf paßte. Er trank nicht, nur Malzbier, rauchte nicht und mied Vergnügungslokale, bei der Bundeswehr trug er sogar eine Auszeichnung davon, die gewöhnlich an Reservisten nicht verliehen wird. Eckart sei nicht wie die anderen gewesen, sagte der Vater vor dem Richter, stolz auf den Erfolg seiner Erziehung und umso ratloser zugleich angesichts dessen, was sich dennoch entlud.
1962 lernte Eckart das Mädchen Heide Krothel kennen, die damals siebzehn war. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen, sagte sie vor dem Richter. Als ihre Tochter Carmen kam, verlobten sich Heide und Eckart, die Heirat schien nur noch eine Frage der Zeit. Doch Heide Krothel fuhr in den Schwarzwald, ein paar Monate nur, aber zu lange; denn Eckart traf inzwischen bei der Arbeit in der Wohnung der Reinmachefrau Kommritz deren Tochter Ingrid, die geschiedene Frau Griebau. Sie hat mich praktisch verführt. Ich bin sehr reizbar. Sie lud mich ein, an einem Sonnabend, und sie kam mir mit offenem Morgenrock entgegen. Und da war plötzlich etwas in Eckarts Leben, das nicht hineinpaßte, eine ältere Frau, die mit ihm Dinge trieb, über die er zu Hause nicht reden konnte. Sie war eine erfahrene Frau, und sie war sehr gerissen. Ich machte alles mit, was sie wollte, aber ich schämte mich. Ich hatte Angst vor ihr, Angst, daß sie mich auslachen würde, und es war sehr anstrengend, immer nach der Arbeit, jeden Tag. Und weil ich so viel arbeitete, dachte ich, das würde nicht gut sein für mich, ich könnte abstürzen, dachte ich, ich arbeitete draußen im vierten Stock. Aber auf dem Sofa wurde mir immer ganz anders, da kam der erotische Teil über mich, und sie war offenbar begeistert, hatte nie genug. Sie kannte sich in jeder Lage so gut aus. Wenn sie merkte, daß ich gut in Form war, Sie wissen schon, verführte sie mich immer.
Ob er seinen Sohn denn jemals aufgeklärt habe, fragte einer der Sachverständigen Adolf Mellentin. Nein, das habe er nicht, aber ihn selber habe man auch nicht aufgeklärt und bei ihm sei alles gutgegangen. Ob er jemals mit seinem Sohn über Frau Griebau gesprochen habe. Nein, das habe er nicht, die Frau sei der Familie solch ein Ekel gewesen, daß sie nie über sie gesprochen hätten. Eckart war Frau Griebau überlassen, und er wurde nicht fertig mit ihr. Der Arzt habe ihr gesagt, sie könne keine Kinder bekommen, er brauche keine Angst zu haben, erklärte sie ihm. Aber sie bekam doch ein Kind – Thorsten. Da wurde dem Eckart Mellentin bang, aber sie ließ nicht locker. Heiraten wolle sie ihn zwar nicht, soll sie gesagt haben, aber sie werde dafür sorgen, daß ihn auch keine andere kriege. Und Ingrid Griebau ging nicht zimperlich mit ihrem Malergesellen um, steckte Zettel an seinen Wagen, in den Hausbriefkasten der Mellentins: An die männliche Nutte Eckart Mellentin. Du müder Liebhaber. Deine Eltern sind genauso verlogen wie Du, Du Schwein. Wenn Du huren kannst, kannst Du auch arbeiten. Ich zeige Dich bei der Krankenkasse an. Sie habe immerzu angerufen, auch nachts, sagten die Eltern, sie habe Kunden aufgesucht und Eckart schlecht gemacht, sie habe das Kind herumgezeigt. Das sei von Eckart, der männlichen Nutte, von dem Mellentin, dem Schwein, soll sie dabei erklärt haben.
Schlimm wurde es für Eckart Mellentin, als seine Verlobte Heide, die inzwischen nach Hamburg zurückgekehrt war, sich mit Frau Griebau hinter seinem Rücken in Verbindung setzte. Als er eines Abends Ingrid besuchte, trat Heide ins Zimmer. Seine Augen seien immer größer geworden, sagte Heide vor dem Richter, dann sei er die Treppe hinuntergelaufen, aber die Haustür sei schon verschlossen gewesen. Ingrid habe ihn zurückgeholt, lachend, er habe nichts gesagt, noch einmal sei er davon, wieder sei Ingrid hinter ihm hergestürzt, erst beim dritten Mal habe sie aufgeschlossen und ihn hinausgelassen, es sei eine schreckliche Szene gewesen. Am gleichen Abend noch sei Eckart zu ihr gekommen, um sich zu erklären, aber sie habe ihn weggeschickt. Ja, sie habe ihm auch einen bösen Brief geschrieben und ihm gedroht, sie werde etwas unternehmen, wenn er die Alimente für Carmen nicht zahle. Aber er habe eigentlich immer bezahlt. Er sei auch sehr nett gewesen zu dem Kind. Auf der Zeugenbank rang Heide Krothel, die erwachsen geworden ist, ihre Hände, niedergedrückt von ihrem, wenn auch noch so geringen Teil an Schuld. Sie hat sich mit Ingrid Griebau geduzt. Sie habe Ingrid Griebau häufig besucht, aber nur, um zu verhindern, daß Ingrid Griebau sie ihrerseits besuchte. Sie hat zu dem Druck beigetragen, unter dem Eckart Mellentin stand, und sie weiß es. Dem Richter sagte sie, sie betrachte sich entgegen einer früheren Aussage nach wie vor als die Verlobte des Angeklagten.
Dieser Junge Eckart Mellentin wehrte sich. Zum ersten Mal in seinem Leben, das müssen wir ihm und seinen Eltern glauben, schlug er zurück, und das war dann gleich die Katastrophe. Sie hatte sich nicht angekündigt, sie kam unvorbereitet über alle, die an ihr zugrunde gingen. Wenige Tage vorher hatte Eckart Mellentin noch das Kinderbett gestrichen – Thorstens Bett. Und als Ingrid Griebau am S-Bahnhof Stadtpark in seinen Wagen stieg, ahnte er den Mord so wenig wie sie. Wohl war zu erwarten, daß es nicht gutgehen werde auf die Dauer, eine Lösung mußte gefunden werden, für eine der Frauen mußte Eckart Mellentin sich entscheiden. Aber er versuchte es nicht einmal, die Fäden zu entwirren, die ihn gefangenhielten in einer für ihn unerträglichen Situation. Dazu fehlte es ihm an Geschick, an Übersicht. Er wehrte sich, aber so radikal und so unbeholfen auch, wie sich nur Menschen wehren, denen der Verstand nicht gegeben ist, den der Mensch so nötig braucht, um zwischen Erdulden und Raserei den Weg zu finden. Auch darum begreifen die Mellentins nicht: Was Eckart in einem Augenblick als die einzige Lösung erschien, erscheint heute als die einzige Lösung, die keine war. Keine Spur führt zu einem Mord, wenn er geschehen ist, und alle Erklärungen erklären das eine nicht: seine Unwiderruflichkeit.
Als Zeugin der Anklage trat die Mutter der Ermordeten vor den Richter, eine kleine, verbitterte Frau, eine Greisin mit neunundfünfzig Jahren. Sie hatte alles vergessen, auch den ewigen Zank mit ihrer Tochter, der Ingrid Griebau bewog, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen und sich ein möbliertes Zimmer zu nehmen. Sie wiederholte nur, was damals, nach der Tat, die Zeitungen schrieben: Es werde alles wieder gut, habe Ingrid noch zu ihr gesagt, sie werde jetzt gehen, um den Vati zu treffen.
Widerstand mit dem Kopf
Am ersten Tage der Verhandlung versuchte Eckart Mellentin noch, wenigstens sein Leugnen in Worte zu fassen, nachdem er seine Tat nicht mehr in Worte fassen konnte, in der absurden Hoffnung vielleicht, sich zusammen mit Ali zu seinem Richter durchlügen zu können, wenn ihm nur die richtigen Wendungen einfielen, wenn es ihm nur gelänge, Ali in der Sprache seines Richters auferstehen zu lassen. Und so trug er an Fremdwörtern und vermeintlich feinen Wendungen zusammen, was sein armer Kopf noch hergab. Auf die Frage des Richters, warum er sich denn mehrmals durch Geständnisse belastet habe, wenn er die Tat nicht begangen habe, sagte er, diese Symptome deutend, es sei dies wohl eine Bildungslücke gewesen, aber er habe in der Haft dazugelernt: Die Hausnummer ist mir jetzt obskur. Da war ich schon arretiert. Ich habe mit so einem naiven Realismus der Beamten nicht gerechnet, deshalb habe ich gestanden. Die wollten ja Nonsense hören. Da habe ich die Decken eliminiert. Ich habe das in meinem Affidavit schriftlich niedergelegt. In meiner sympathetischen Alteration. Um das für mich veritabel erscheinen zu lassen. Es gab für mich eine Alternative dawider, und ich bitte mit Silentium darüber hinwegzugehen. Vom zweiten Tag an schwieg er, leistete er Widerstand mit dem Kopf nur noch, indem er ihn schüttelte.
Unser aller Unglück
Die Mellentins haben es schwer gehabt nach der Festnahme ihres Sohnes, nach den Schlagzeilen der Groschenpresse vom Elbemörder, der seine Geliebte und sein Kind aus Geiz erwürgt habe, von der rührenden Frau, die das Opfer ihrer Liebe geworden sei. Anonyme Anrufe kamen, sie sollten ihre Sachen packen und verschwinden. Aber schwerer als daran trugen und tragen sie an den Fragen, die sich ihnen stellten und auf die sie keine Antworten fanden und finden: Wie konnte das geschehen, sie hatten doch alles für ihren Jungen getan. War es denn wirklich geschehen?
Die Mellentins haben den 6. Oktober 1965 so wenig überstanden wie ihr Sohn. In der Hauptverhandlung versuchten sie, ihm ein notdürftiges Alibi auszustellen: Eckart könne es nicht gewesen sein, er sei den ganzen Abend zu Hause gewesen. Sie kenne doch die Schritte ihrer Männer, sagte Marie Mellentin, auch Eckarts Schuhe habe sie gesehen an jenem Abend, das Paar, das er immer zum Ausgehen angezogen habe. Den Ali, den hätten sie zwar nie getroffen, aber daß es ihn gebe, da seien sie sicher. Es habe auch jemand am Tage darauf abends angerufen. Und auch später noch seien Anrufe gekommen, in einer ausländischen, unverständlichen Sprache, und im Hintergrund sei die gleiche wilde Musik zu hören gewesen wie bei den Anrufen der Ingrid Griebau. Das haben die Mellentins auch herumerzählt in der Gegend, in der sie wohnen, in Eppendorf. Es meldete sich sogar ein Zeuge für die Verteidigung, ein Friseur, der wußte, daß Ingrid Griebau mit Ausländern und auch mit Rauschgift zu schaffen hatte. Woher er das wisse? Von den Mellentins. Und seit wann? Das habe er nach dem 6. Oktober erfahren.
In Eppendorf wohnen brave Leute, aber was geht in diesen braven Leuten vor? Auch aus ihnen brach es heraus. Casablanca, man wisse doch schließlich, sagte Adolf Mellentin, wer da hingerate, der komme nicht zurück, das habe er erlebt mit einem Freund. Ingrid Griebau habe eine Schwester, die sei in Marokko, in Casablanca verheiratet mit einem Marokkaner, und Ingrid Griebau habe Eckart nach Casablanca locken wollen. Sein Sohn sei bedroht worden, da sei er sicher.
Daß es ineinandergriff, was Eckart sagte und was seine Eltern sagten, lag nicht an Absprachen oder Kassibern, die Übereinstimmung saß tiefer: Casablanca und Ali, das deckte sich nicht von ungefähr; diese Frau, die den Eltern ein Ekel war, war es dem Sohn in einer Weise nicht minder. Von ihr kam unser aller Unglück, sagten die Eltern, die an böse Geister nicht mehr glauben, aber an böse Ausländer und verruchte, geschiedene Frauen und die Sünde des Fleisches. Sie war mein Unglück, sagte sich der Sohn, guterzogen wieder. Was ich mit ihr trieb, das war schlecht, ich mußte mich von ihr befreien, irgendwie. Ali hat es getan, denn wie konnte es Eckart Mellentin tun.
Während der fünf Tage der Hauptverhandlung stemmten sich Vorurteile gegen das zu erwartende Urteil, versetzte der Glaube, daß nicht sein kann, wofür es keine eppendorfschen Erklärungen gibt, seinen Berg, traten die Mellentinschen Fiktionen gegen unleugbare Tatsachen an, wurde eine Realität gegen eine andere ins Feld geführt und verlor sich immer wieder eine greifbare Schuld, die zwei tote Menschen hinterlassen hat, in der grauenvollen Solidarität einer vernichteten Familie.
In der mündlichen Urteilsbegründung reduzierte das Gericht die Tat des Eckart Mellentin auf das an ihr Feststellbare, den gemeinen Mord. Eckart Mellentin habe, um sich aus einer durchaus unangenehmen Situation zwischen zwei Frauen zu lösen, eine Frau getötet, die ihm lästig geworden sei, und ein Kind, das ihn gestört habe. Diese Tat stehe auf dem niedrigsten sittlichen Niveau. Es konnte nicht anders entscheiden. Das Strafgesetz ist nicht für einen, sondern für alle da. Nur trifft es eben immer einen Menschen, der keinem anderen gleicht, und richtet es stets über einen Fall, der ohne Beispiel ist.
Ich hab' doch solche Angst gehabt vor dem Mann
Ein Leben ohne Chance –Der Frankfurter Kindsmordprozeß gegen Ursula Kablau (I)
Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.Strafgesetzbuch § 211
Am Abend des 5. Januar 1965, einem Dienstag, erschien auf einer Polizeiwache der Frankfurter Innenstadt die vierundzwanzigjährige verheiratete Reinmachefrau Ursula Kablau und gab das Verschwinden ihrer kleinen Tochter, der siebenjährigen Beate, zu Protokoll. Das Kind habe, erklärte Ursula Kablau unter Tränen, gegen Mittag die Wohnung verlassen und sei nicht zurückgekehrt.
Nach einer kurzen, routinemäßigen Befragung schickte die Polizei Ursula Kablau nach Hause: Sie solle sich bis zum nächsten Morgen gedulden, vielleicht finde sich das Kind von selber ein.
Aber Beate blieb verschwunden, auch über Nacht. Am nächsten Morgen erschien Ursula Kablau erneut auf der Revierwache 1 – diesmal in Begleitung ihres Mannes, des achtunddreißigjährigen Glasers und Hausmeisters Walter Kablau, des Stiefvaters. Er sei in Sorge, erklärte Walter Kablau, er könne sich nicht vorstellen, was mit dem Kind geschehen sei. Vergeblich habe er das ganze Haus von oben bis unten nach Beate abgesucht.
Die Polizei versprach, alles Notwendige zu veranlassen, nahm eine förmliche Vermißtenanzeige auf und kurbelte die Fahndung an. Kriminalbeamte suchten die Wohnung der Eltern in der Großen Friedberger Straße 31 auf – ein kärglich eingerichtetes Zimmer, das die im selben Haus untergebrachte Einkaufsgenossenschaft selbständiger Glaser, bei der Walter Kablau arbeitete, ihm und seiner Familie, zu der noch die vierzehn Monate alte Tochter Dagmar zählte, als Hausmeisterwohnung zur Verfügung gestellt hatte. Das alte Haus, das wie ein düsterer Block in der geschäftigen Innenstadtstraße steht und durch dessen schmale Hofeinfahrt man in einen geräumigen Hof gelangt, steckte an diesem Morgen voller Polizisten. Hunde wurden eingesetzt, die Beamten verhörten die Hausbewohner und die Arbeitskollegen Walter Kablaus – Beate blieb spurlos verschwunden, niemand wußte über ihren Verbleib etwas zu sagen.
Am Donnerstag machte Beates Verschwinden Schlagzeilen in der Lokalpresse. Am Freitag wurde die Polizei nervös. Der Verdacht, daß ein Verbrechen vorliege, müsse in Erwägung gezogen werden, erklärte die Staatsanwaltschaft, es bestehe nur noch eine geringe Hoffnung, das Kind lebend zu finden. Eine Belohnung von zehntausend Mark wurde ausgesetzt.
Am Morgen des 9. Januar, einem Sonnabend, taumelte Walter Kablau in den Hof des Hauses in der Großen Friedberger Straße und schrie: Beatschen liegt tot im Keller! Welch ein Anblick! Das Schloß ist aufgebrochen! Als die Beamten der sofort alarmierten Mordkommission unter der Leitung des Kriminalhauptkommissars August Schmidt wenige Minuten später eintrafen, begann Walter Kablau um sich zu schlagen. Fangt mir den Mörder! Von dem Stuhl, auf den ihn Arbeitskollegen setzten, fiel er herunter, er mußte auf einen Tisch gelegt und festgehalten werden. Ich war ein guter Vater! Ich habe das Kinderzimmer schon eingerichtet! Und Beate eine Tapete nach ihrem Geschmack ausgesucht! Ursula Kablau stand daneben und weinte; ihr eine Beruhigungsspritze zu geben, die ihr Mann schon bekommen hatte, hielt der herbeigeholte Arzt für überflüssig.
Immer gut mit dem Kind …
Zum erstenmal betraten in diesem Augenblick, obwohl der Verdacht eines Verbrechens bereits seit zwei Tagen in Erwägung gezogen worden war, Kriminalbeamte den mit einem einfachen Zahlenschloß gesicherten Kellerverschlag der Kablaus. Das Schloß war geöffnet, aber nicht aufgebrochen. Auf einer durchnäßten Matratze, in Anorak und Stiefeln, lag in einer Ecke die übel zugerichtete Leiche des Kindes. Deutlich war zu erkennen, daß Beate geschlagen und erwürgt worden war, ebenso deutlich, daß es im Keller geschehen sein mußte. Die Eheleute Kablau wurden daraufhin vorläufig festgenommen.
Am Abend des gleichen Tages war für die mit der Aufklärung des Falles betrauten Beamten die Sache schon gelaufen. Aus dem Tötungsfall zum Nachteil des Kindes Beate wurde auch ein Ermittlungsfall zum Nachteil der Frankfurter Kriminalpolizei.
Nur die Kablaus, entweder zusammen oder einer von ihnen, konnten es gewesen sein. Das stand fest. Nur sie hatten Zugang zu ihrem Keller gehabt. Zwar hatte Walter Kablau die Beamten davon abgehalten, den Keller schon am Mittwoch zu durchsuchen, indem er ihnen mehrmals erklärte, das schon selber besorgt zu haben, sogar mit anderen Hausbewohnern zusammen, was nicht stimmte, aber Walter Kablau belastete seine Frau. Er traue Frauen alles zu, sagte er, die Ursel müsse es gewesen sein, denn sie habe Beate schon einmal in den Keller gesperrt und auch geschlagen, und damals habe Beate genauso dort gelegen wie jetzt. Er dagegen sei immer gut zu dem Kind gewesen. Und Ursula Kablau verwickelte sich in – wenn auch zunächst nur geringfügige – Widersprüche zu den Angaben ihres Mannes.
Da hatten wir doch etwas in der Hand. Uns kam die Frau gleich verdächtig vor. Sie hat nicht richtig geweint, sondern uns über ihr Taschentuch angeblinzelt. Walter Kablau aber zeigte echte Rührung. Daß er uns in die Irre geführt hatte, kam uns nicht wesentlich vor. Wir sagten ihm, er solle sich alles einmal in Ruhe überlegen. Da hat er sich alles in Ruhe überlegt. Wir hatten ein gelöstes Gespräch mit ihm. Es tat ihm leid, daß wir durch seine Schuld in den Zeitungen herumgeschmiert werden würden. Wenn er es gewesen wäre, hätten wir in einer Viertelstunde ein Geständnis von ihm gehabt. Er war ein weicher, hilfloser Mensch. Wir haben schließlich unsere Erfahrungen. Der Kriminalhauptkommissar August Schmidt ist sich auch heute noch seiner Sache sicher. Daß er fahrlässig ermittelt haben könnte, kommt ihm nicht in den Sinn. Er ist ein erfahrener Beamter. Er leitet das Erste Kommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei, zuständig für Mord und Raub, schon seit Jahren.





























