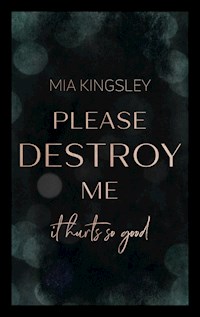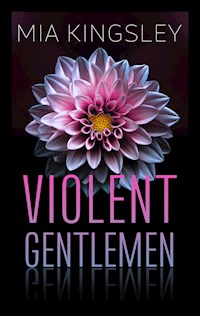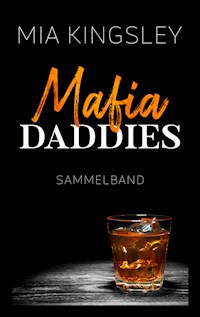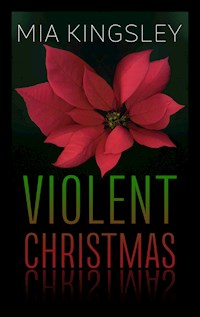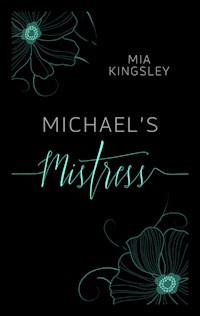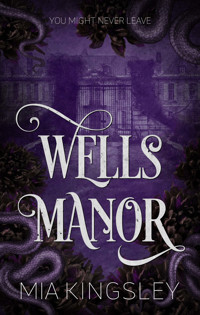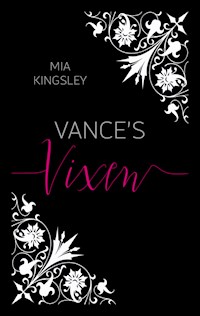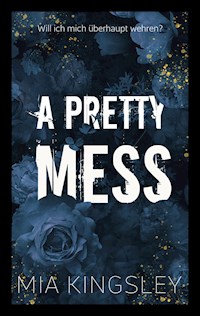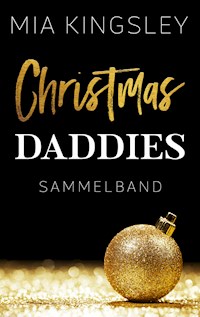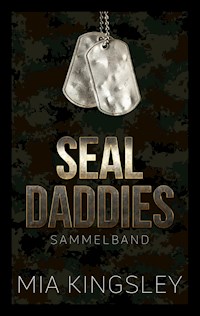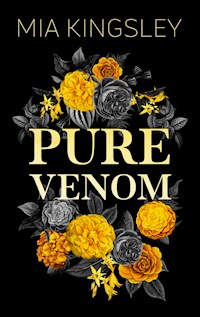
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Black Umbrella Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Schlange hat ihr Gift, auch wenn sie unter den schönsten Blumen liegt. (Dänisches Sprichwort) venom (engl.) – Gift, speziell: Schlangengift. Auch: Bosheit, Gehässigkeit Stell dir vor, die Polizei klopft an deiner Tür, um dir mitzuteilen, dass sich ein extrem reicher Unternehmer umgebracht hat. Neben seiner Leiche wurde ein Abschiedsbrief gefunden, in dem er sich für alles entschuldigt, was er dir angetan hat. Deswegen macht er dich mit seinem letzten Willen zur Alleinerbin seines Imperiums. Das einzige Problem: Dieser Mann hat dir niemals auch nur ein Haar gekrümmt – denn du hast ihn noch nie in deinem Leben gesehen … DARK ROMANCE. Ein Liebesroman. Düster. Nicht romantisch. Eindeutige Szenen. Hart. Nicht zärtlich. Keine dunklen Geheimnisse, sondern richtige Leichen im Keller. Deutliche Sprache. Happy End. In sich abgeschlossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:5 Std. 38 min
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
PURE VENOM
MIA KINGSLEY
DARK ROMANCE
Copyright: Mia Kingsley, 2017, Deutschland.
Coverfoto: © Mia Kingsley
Korrektorat: http://www.swkorrekturen.eu
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nachdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Sämtliche Personen in diesem Text sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Black Umbrella Publishing
www.blackumbrellapublishing.com
INHALT
PURE VENOM
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Wesleys Brief
Mehr von Mia Kingsley lesen
Über Mia Kingsley
PURE VENOM
Die Schlange hat ihr Gift, auch wenn sie unter den schönsten Blumen liegt.(Dänisches Sprichwort)
venom (engl.) – Gift, speziell: Schlangengift. Auch: Bosheit, Gehässigkeit
Stell dir vor, die Polizei klopft an deiner Tür, um dir mitzuteilen, dass sich ein extrem reicher Unternehmer umgebracht hat. Neben seiner Leiche wurde ein Abschiedsbrief gefunden, in dem er sich für alles entschuldigt, was er dir angetan hat. Deswegen macht er dich mit seinem letzten Willen zur Alleinerbin seines Imperiums.
Das einzige Problem: Dieser Mann hat dir niemals auch nur ein Haar gekrümmt – denn du hast ihn noch nie in deinem Leben gesehen …
DARK ROMANCE.
Ein Liebesroman. Düster. Nicht romantisch.
Eindeutige Szenen. Hart. Nicht zärtlich.
Keine dunklen Geheimnisse, sondern richtige Leichen im Keller.
Deutliche Sprache.
Happy End.
In sich abgeschlossen.
KAPITEL1
EMILY
Der Typ grunzte an meiner Schulter und stieß ein letztes Mal in mich, bevor er sich zurückzog. Das Kondom landete mit einem Schmatzen auf dem dreckigen Boden des Toilettenraums.
Enttäuschung brannte in meiner Magengegend. Vielleicht war es auch der billige Alkohol. Der Kerl hatte so groß und kräftig gewirkt – dabei konnte ich jetzt geradezu froh sein, dass er nicht in der Löffelchenstellung auf dem Boden hatte Liebe machen wollen.
Ich wischte meinen Hals dort ab, wo er mich geküsst hatte, während er seine mittelmäßige Performance abgeliefert hatte.
Wo musste ein Mädchen in dieser Stadt denn hingehen, um einen vernünftigen Fick zu bekommen? Zu gern wäre ich in einen dieser exquisiten Sexklubs gegangen, die ich nur aus den Beschreibungen diverser Internetforen kannte. Aber dazu fehlte mir schlicht das Geld.
Ohne den Kerl, dessen Namen ich mir ohnehin nicht gemerkt hatte, eines weiteren Blickes zu würdigen, schob ich die rot lackierte Holztür auf und ergriff die Flucht.
»Baby«, rief er hinter mir her. »Du hast mir deine Nummer gar nicht gegeben.«
Ich rollte mit den Augen und zeigte ihm über die Schulter den Mittelfinger. »Meld dich, wenn du gelernt hast, was hart wirklich bedeutet.«
Die Musik hämmerte so laut aus den Boxen, dass er mich vermutlich nicht verstand. Bis auf den Mittelfinger, der funktionierte immer.
Nachdem ich genug Abstand zwischen mich und die Waschräume gebracht hatte, tauchte ich in eine dunkle Ecke ab und zog sein Portemonnaie hervor. Streng genommen war es kein Diebstahl, sondern Schmerzensgeld, das ich ihm geklaut hatte. Craig stand auf seinem Führerschein, den ich achtlos fallen ließ. Das Bargeld war alles, was mich interessierte. 120 Pfund.
Zufrieden schnalzte ich mit der Zunge. Damit konnte ich mir noch einen Drink genehmigen und mir eventuell sogar ein Taxi nach Hause leisten. Letztlich war Craig wohl doch zu etwas gut gewesen.
Vernünftiger Sex wäre mir trotzdem lieber gewesen. Ich ging zur Bar und musste mich dabei durch die Menge schieben. Der Klub war trotz der merkwürdigen EBM-Party bis unter die Decke gefüllt.
Als ich auf den letzten freien Barhocker klettern wollte, wurde mir bewusst, dass ich kein Höschen trug. Für einen Moment gaukelte mir mein alkoholisierter Kopf vor, es verloren zu haben, und ich ärgerte mich. Ich hatte kaum Geld und konnte das wenige, das ich besaß, nicht ständig für neue Unterwäsche ausgeben.
Mit einem Kopfschütteln vertrieb ich den Gedanken und strich meine Haare nach hinten. Reiß dich zusammen, Emily, sagte ich mir selbst und winkte den Barkeeper mit einer zusammengefalteten Banknote heran. Ich war ziemlich klein und musste eben anders auf mich aufmerksam machen. Jedenfalls redete ich mir ein, dass es am Geld lag und nicht dem immensen Ausschnitt meines Kleids.
Wenn ich loszog, um einen Mann aufzureißen, dann überließ ich nichts dem Zufall – deshalb hatte ich auch auf Unterwäsche verzichtet.
Meine Mum hatte immer gesagt, dass man mit dem arbeiten musste, was man hatte.
Zumindest stellte ich mir vor, dass Mütter solche Ratschläge verteilten. Da ich im Heim aufgewachsen war, konnte ich diesbezüglich nicht wirklich auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Manchmal versuchte ich, mich auch davon zu überzeugen, dass meine lose Moral ebenfalls daherkam, ohne Eltern oder Familie groß geworden zu sein – und nicht einfach daher, dass ich nichts zu verlieren und niemanden zu enttäuschen hatte.
Nicht mehr jedenfalls.
Der Barkeeper stellte den Wodka vor mich, und ich stürzte den Inhalt des Glases hinunter, bevor die Emotionen gewannen. Ich wollte nicht gleich heulend aus dem Klub stolpern – was für ein Klischee!
Obwohl es nicht so spät war, wie ich gern gehabt hätte, beschloss ich, es besser nicht zu riskieren, Craig noch einmal in die Arme zu laufen, und nach Hause zu fahren.
Morgen musste ich lernen und eine Tour im Museum führen, ein wenig Schlaf konnte nicht schaden.
Ausnahmsweise hatte ich Glück und direkt vor der Tür parkte ein Taxi. Ich stieg ein und begegnete dem unfreundlichen Blick des Fahrers im Rückspiegel.
»Getrunken?«, knurrte er.
»Nicht so viel, wie ich gern gehabt hätte.«
»Kotzen kostet extra.«
Ich winkte ab und kuschelte mich in die Rückbank. »Zur Marybeth III. Universität.«
Statt zu antworten, fuhr er los.
Meine Güte, wenn er die Tour hasste, warum fuhr er sie dann? Ich schielte in seine Richtung und bemerkte, wie derangiert er aussah. Er trug abgewetzte Kleidung und ein neuer Haarschnitt war längst überfällig. Offenbar brauchte er dringend Geld und übernahm deshalb die verhassten Nachtschichten.
Seine Augen blieben an mir hängen, als wir an einer roten Ampel hielten.
»Harte Nacht?«, fragte ich, dieses Mal sanfter.
Mit einem Seufzen, das tief aus seinem Inneren zu kommen schien, wischte er sich übers Gesicht. »Hartes Jahr.«
Ich nickte nur.
Der Wagen rollte an, und er fügte so leise hinzu, dass ich es kaum hörte: »Meine Frau hat Krebs.«
»Scheiße«, erwiderte ich inbrünstig und sparte mir die überflüssigen Beileidsbekundungen, die ohnehin nicht halfen.
Er lachte befreit – kurz und trocken. »Du sagst es, Mädchen. Es ist wirklich scheiße. Wir sind da.«
Ich gab ihm ein großzügigeres Trinkgeld, als ich eigentlich geplant hatte und mir leisten konnte, aber er tat mir leid. Sein Gesicht hellte sich für einen Moment auf, und ich wusste, dass es die richtige Entscheidung gewesen war.
Wenn ich es jetzt noch schaffte, aus dem Taxi zu klettern, ohne ihm meine nackte Pussy zu präsentieren, weil das Kleid hochrutschte, war der Abend nahezu ein voller Erfolg.
Müde reckte ich mich, nachdem er weggefahren war, und riss mich zusammen, um den Weg bis zum Studentenwohnheim unfallfrei zurückzulegen. Kopfsteinpflaster, hohe Absätze und Alkohol waren in keinem Szenario eine gute Kombination.
Erleichtert, es geschafft zu haben, drückte ich die schwere Klinke nach unten, und die Tür in die ehrwürdigen Hallen der Uni schwang mit einem Knirschen nach innen auf, das für jeden Gruselfilm als Untermalung geeignet gewesen wäre.
Mein Magen machte einen Satz, als ich zwei Männer auf dem Chesterfield-Sofa im Foyer sitzen sah. Es war drei Uhr morgens. Wer waren sie und was taten sie um diese Zeit hier?
»Miss Parkford?«
Scheiße! Craig hatte mich identifiziert und mir die Bullen auf den Hals gehetzt. Wer sollten die beiden Kerle sonst sein?
Schlagartig war der Alkohol wie weggeblasen. In bester Upperclass-Manier rümpfte ich die Nase. Sie konnten mir gar nichts. Ich hatte nur das Geld bei mir und sein Portemonnaie im Klub entsorgt. Im Zweifelsfall würde Aussage gegen Aussage stehen.
»Wer will das wissen?«
Ich arbeitete nebenbei in einem Museum und hatte genug polierten Akzent aufgeschnappt, um mich tapfer zu schlagen.
»Mein Name ist Michael Anderson, das ist mein Kollege Sean McLeod, wir sind von Scotland Yard.«
Meine Knie wurden weich, doch ich schaffte es wie durch ein Wunder, nicht einfach umzukippen. Stattdessen hob ich das Kinn höher. »Das kann ja jeder behaupten. Haben Sie Ausweise dabei, und wissen Sie eigentlich, wie spät es ist?«
Anderson sah mich entschuldigend an, bevor er einen Blick mit seinem Kollegen tauschte. Es funktionierte, sie hielten mich für eine arrogante Bitch aus der High Society, die mit goldenem Löffel im Mund geboren worden war. Die arme Streunerin, die sich nicht einmal das Studium leisten konnte, sondern ein Stipendium hatte, erkannten sie nicht.
Das war gut, denn dann würden sie mich mit Respekt behandeln und nicht aufgrund meiner Herkunft vorverurteilen.
Ich streckte die Hand aus, um die Ausweise entgegenzunehmen. Hoffentlich stank ich nicht zu sehr nach dem Klub, Craigs billigem Aftershave und noch billigerem Alkohol.
Zwar hatte ich keine Ahnung, wie Dienstausweise von Scotland Yard auszusehen hatten, diese wirkten allerdings verdammt echt.
Mit einem verkniffenen Lächeln gab ich sie zurück. »Sie müssen meine Skepsis entschuldigen. Heutzutage kann eine Lady nicht vorsichtig genug sein.«
Für einen Moment fürchtete ich, mit der Betonung von Lady zu dick aufgetragen zu haben, doch sie nickten nur ergeben.
McLeod räusperte sich. »Wir kommen mit schlechten Nachrichten, fürchte ich.«
Seine Stimme war bedeutend dunkler als die seines Kollegen und verlieh ihm automatisch mehr Autorität. Meine Nervosität wuchs. Was konnten sie von mir wollen?
»Andrew St. Cross hat sich umgebracht.«
Ich blinzelte ihn stumm an, weil ich der Unterhaltung beim besten Willen nicht folgen konnte. Offenbar dachte Anderson, dass meine Trauer mich übermannt hatte, und drückte aufmunternd meine Schulter. Wer zum Teufel war Andrew St. Cross und warum sollte sein Tod mich interessieren?
»Unfassbar«, murmelte ich und griff mir an den Hals, um verletzlicher zu wirken. Da ich keine Ahnung hatte, was ich aus der Situation machen sollte, musste ich mehr Details in Erfahrung bringen. »Wie ist es passiert?«
Nun nahm auch McLeod Körperkontakt auf, fasste nach meiner Hand und tätschelte sie. »Er hat sich in seinem Arbeitszimmer auf St. Cross Manor erschossen.«
Manor? Das klang … teuer.
Ich hauchte: »Um Gottes willen.«
»Als Grund hat er alles angeführt, was er Ihnen angetan hat, Miss Parkford. Haben Sie eine Ahnung, was er damit gemeint haben könnte?«
Was zur Hölle?
KAPITEL2
WESLEY
FÜNF JAHRE ZUVOR
Andrew St. Cross’ Gesicht blieb ausdruckslos, als er knapp nickte. Mit einem Achselzucken drehte ich mich wieder um und griff nach dem Hammer. Bisher hatte ich es vermieden, Blut zu vergießen, und würde es so lange wie möglich hinauszögern, weil es das Aufräumen immens erleichterte.
Ich betrachtete den armen Kerl auf dem Stuhl und korrigierte mich selbst, denn aus seiner Nase und dem Cut an der Unterlippe tropfte Blut. Es war zumindest verhältnismäßig wenig.
»Bitte nicht«, keuchte er und starrte mich aus weit aufgerissenen Augen an.
Mein Boss seufzte hinter mir. »Mister Curtis. Ich dachte, das Thema hätten wir jetzt zur Genüge erläutert. Ich will wissen, wer dafür gesorgt hat, dass diese spezielle Diamantenlieferung, nach der ich mich erkundigt habe, den Zoll passieren konnte. Solange Sie sich darüber ausschweigen, wird Wesley nichts anderes übrig bleiben, als weiterzumachen.«
Weil ich lange genug dabei war, um mein Stichwort zu erkennen, wenn ich es hörte, packte ich sein Handgelenk und presste seine Hand flach auf die Tischplatte vor ihm, bevor ich den Hammer darauf krachen ließ.
Ich hörte den Schmerzensschrei, spürte, wie er zuckte und nach Atem rang – aber ich fühlte nichts. Kein Bedauern oder Mitleid, Reue oder Bedenken.
Als ich Curtis’ anderen Arm packte, schnalzte St. Cross hinter mir mit der Zunge. »Nimm das Knie. Es dauert mir zu lange.«
»Daniel Pope hat die Lieferung abgesegnet«, stieß Curtis aufgebracht hervor.
Am Rascheln seines Mantels hörte ich, dass mein Boss aufgestanden war. »Pope? Er arbeitet für mich. Genau wie Sie übrigens, Mister Curtis. Wie soll ich es auffassen, dass Sie beschlossen haben, mich zu hintergehen?«
Curtis zerrte an den Fesseln und wurde sichtlich nervöser, als St. Cross nach einem der langen Messer griff. Ich trat zur Seite, um ihm Platz zu machen. Die meisten dachten, er würde die ganze Drecksarbeit anderen Leuten wie mir überlassen. Das stimmte nicht ganz.
Andrew St. Cross machte sich nichts daraus, Menschen zu foltern, um an Informationen zu kommen, die er brauchte. Für ihn war es ein Vergnügen, das er nicht durch niedere Absichten beschmutzen wollte.
Mit einer geschickten Bewegung schlitzte er das Hemd seines Gefangenen auf und hinterließ dabei einen dreißig Zentimeter langen Schnitt auf Curtis’ Oberkörper. Seine Nasenlöcher blähten sich auf, als er die Luft einsog, um sich an dem Kupfergeruch zu weiden. »Wesley, knebelst du Mister Curtis bitte? Mir sind seine schrillen Schreie zuwider.«
Ein letztes Mal zerrte Curtis an seinen Fesseln und schüttelte hastig den Kopf, bevor ich St. Cross’ Wunsch nachkam. Ich wusste, dass er Curtis häuten würde, denn das war seine bevorzugte Bestrafung für Verräter. Andrew St. Cross war kein Mann, den man hinterging.
»Ich wünschte, Mister Curtis, Sie könnten es genauso genießen wie ich, dass ich mich für Ihre mangelnde Loyalität revanchiere. Wobei … dann wäre es für mich vermutlich nur halb so schön.«
Da ich vorläufig nicht mehr gebraucht wurde, setzte ich mich auf den Stuhl, auf dem mein Boss zuvor Platz genommen hatte. Er würde es als Affront auffassen, wenn ich ging, deshalb blieb ich. Vielleicht auch aus Interesse – irgendetwas konnte man immer lernen.
Dafür, dass er vorher so sehr gejammert hatte, dauerte es dieses Mal erstaunlich lange, bis Curtis begann, in seinen Knebel zu brüllen.
Später wischte St. Cross das Messer mit einem blutigen Lappen ab und schob es ordentlich zurück zwischen die anderen Waffen. Er brauchte eine Weile, bis er zufrieden damit war, wie es lag. »Du musst nachher zurückkommen und dich um den Rest kümmern.«
Ich nickte knapp.
Mein Boss zeigte sein schmales Lächeln, zog die schwarzen Lederhandschuhe aus seiner Manteltasche und streifte sie über. »Wie geht’s weiter?«
»Das Dinner mit dem Bürgermeister und danach eine Verabredung mit Ihrer Verlobten.«
»Gut, dann setzt du mich am Rathaus ab und erledigst das Saubermachen.«
Ich folgte ihm aus der Lagerhalle am Hafen und schaltete beim Rausgehen das Licht aus. Da er keinen Wert darauf legte, dass ich ihm immer die Tür aufhielt, saß er schon auf der Rückbank des Wagens, als ich ihn erreichte.
Wortlos glitt ich hinters Steuer.
»Bezahle ich dir genug?«, fragte St. Cross plötzlich ohne Zusammenhang, nachdem ich losgefahren war.
War das so eine Art Fangfrage? Ich runzelte die Stirn und sah in den Rückspiegel.
Mein Boss beachtete mich nicht, sondern hatte den Ellenbogen auf der Türkante abgestützt, sein Kinn auf der Hand gebettet und starrte aus dem Fenster.
Manchmal fragte ich mich, wie er seinen Tagesablauf überhaupt durchhielt, besonders an Tagen wie heute. Die Zeit vor Weihnachten war schon für mich stressig gewesen, und ich war nur sein Fahrer und Handlanger, der die unangenehmen Aufgaben übernahm. Jetzt nach den Feiertagen hatte sich die Situation unwesentlich beruhigt, und abgesehen von der riesigen Silvesterparty, die er selbst ausrichtete, war er zu unzähligen Veranstaltungen eingeladen.
Andrew St. Cross war der CEO von St. Cross Diamonds, Philanthrop und Unterstützer der Stadt, spendete jedes Jahr mehrere Millionen an wohltätige Stiftungen, vergab Universitätsstipendien und war ein gern gesehener Gast auf jeder Party. In seiner Freizeit kontrollierte er den gesamten Schwarzmarkt für Blutdiamanten, hatte die halbe Regierung in der Tasche und schüchterte die andere Hälfte auf regelmäßiger Basis ein. Dazu trieb er Sport und hatte seit zwei Monaten eine bezaubernde Verlobte namens Jade Chandler. Es war mir ein Rätsel, wie er es schaffte, nicht einfach den Verstand zu verlieren.
»Ich kann mich nicht beklagen, Boss.« Mein Schweigen wurde mit einem sechsstelligen Jahresgehalt aufgewogen, und ich hätte der größte Idiot auf diesem Planeten sein müssen, um mich darüber zu beschweren.
»Hm«, machte er. »Ist es nicht zu wenig für alles, was ich von dir fordere?«
Das Problem war, dass St. Cross zu psychopathisch veranlagt war, als dass ich ihm auch nur einen Meter über den Weg getraut hätte. Deshalb zuckte ich mit den Achseln und zwang mich zu einem gleichgültigen Tonfall. »Ich finde es angemessen. Wenn ich in ein paar Jahren meine Loyalität bewiesen habe, würde ich mich nicht wehren, falls ich nach einer Gehaltserhöhung gefragt werde.«
Meine Antwort schien ihn vollkommen zufriedenzustellen. Es war leicht, ihm das zu sagen, was er hören wollte. Er verlangte Treue, und bei den Aufgaben, die ich für ihn übernahm, fiel es mir nicht schwer, sie vorzutäuschen.
»Wir nehmen einen Umweg.«
»Sir?«, fragte ich verwirrt. »Sie müssen in einer halben Stunde am Rathaus sein.«
»Das schaffen wir problemlos. Nimm dort vorn gleich die Abzweigung zur Church Road.«
Er war noch nie von seinem Plan abgewichen, was meiner Ansicht nach bedeutete, dass er diesen Ausflug geplant und mir lediglich nichts davon erzählt hatte. Trotzdem versicherte ich mir selbst, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gab.
»Fahr langsamer.«
Ich ließ den Wagen rollen und versuchte zu erkennen, was St. Cross in dieser verlassenen Gegend wollte. Hier gab es eigentlich nichts, was sein Interesse erregen konnte.
Es sei denn, er spielte neuerdings mit dem Gedanken, ein Kind aus dem Heim am Ende der Straße zu adoptieren.
Ich wurde ruhiger, als mir klar wurde, dass das hier ansässige Kinderheim tatsächlich die logischste Erklärung bot. Sicherlich überlegte er wieder, zu spenden, und wollte sich die Institution vorher ungestört ansehen.
»Du kannst hier parken und mach bitte die Scheinwerfer aus.«
Mit einem Mal klang er angespannt und von seiner sonst so lockeren Körperhaltung war nichts mehr übrig. Kauernd presste er sich gegen das Fenster, die Augen zusammengekniffen, und starrte nach draußen.
Er erinnerte mich dabei auf sehr unangenehme Art und Weise an einen Junkie auf der Suche nach dem nächsten Fix. Für ein paar Sekunden fragte ich mich, ob er mich überhaupt wahrnahm.
Da ich ohnehin nichts Besseres zu tun hatte, wandte ich mich ebenfalls zur Seite und musterte die Straße, während ich überlegte, wonach er wohl Ausschau hielt. Es fiel Schnee, Rauch stieg von den Schornsteinen auf und nur vereinzelt waren Menschen unterwegs.
Ich wusste sofort, dass es so weit war, da St. Cross’ Anspannung innerhalb weniger Sekunden mit den Händen greifbar wurde.
Von rechts näherte sich eine junge Frau. Trotz der Dunkelheit hielt sie ein aufgeklapptes Buch in der Hand und las beim Gehen darin. Wie sie erkannte, wo sie hinlief, und nicht auf dem gefrorenen Schnee ausrutschte, war mir ein Rätsel. Lange, dunkle Haare fielen vor ihr Gesicht und machten es mir unmöglich, zu sagen, wie sie aussah.
Sie war nicht besonders groß und trug einen kurzen Mantel, einen Faltenrock und diese merkwürdigen Schuhe mit den Plateauabsätzen, die momentan bei Teenagern so beliebt waren.
Der Gedanke ließ mich erstarren. Ich korrigierte meine Einschätzung. Sie war keine Frau, sie war ein junges Mädchen. Mein Puls stieg an und ich biss die Zähne aufeinander.
»Hup einmal ganz kurz«, bat mein Boss.
Da ich schlecht ablehnen konnte, kam ich seiner Aufforderung nach.
Das Mädchen fuhr zusammen und ließ beinahe das Buch fallen. Sie musste zwei Schritte nach vorn machen, um es noch schnappen zu können, bevor sie sich umsah, woher das Geräusch gekommen war.
Sie war wunderhübsch, das war nicht zu leugnen, doch sie konnte maximal siebzehn Jahre alt sein. Ihr Mantel schwang auseinander und enthüllte ein schwarzes Metallica-Shirt. Ihr Make-up war für meinen Geschmack viel zu dunkel und durch ihre Blässe stach der rote Lippenstift wie Blut hervor – vielleicht gehörte das aber auch zu ihrem Style. Was wusste ich schon?
Ich arbeitete jetzt ein knappes Jahr für St. Cross und hatte in dieser Zeit mehr Scheiße gesehen, als ich es mir in meinen wildesten Träumen ausgemalt hätte. Auch vorher war ich nicht unbedingt leicht zu schockieren gewesen, weshalb man schon festhalten konnte: Um mich zu ängstigen, brauchte es einiges.
Der Ausdruck in St. Cross’ Augen, während er das junge Mädchen mit dem Blick fixierte, schickte einen eisigen Schauer über meinen Rücken und ein ungutes Gefühl durch meinen Magen. Er war ein kranker Bastard – das stand außer Frage. Bisher war es mir nicht dermaßen bewusst geworden. Durch meine Arbeit für ihn verschwamm oft die Linie zwischen dem, was normal war, und dem, was für mich zum Alltag geworden war.
Ich war abgestumpft, umso schlimmer erschien mir die Erkenntnis, dass St. Cross unmöglich gute Absichten verfolgen konnte.
Die Vorahnung, mich geradewegs auf direkter Talfahrt in eine Katastrophe zu befinden, ließ sich nicht länger zurückhalten. Es war wie auf einem turbulenten Flug. Die Maschine zitterte und bebte in der Luft, die Sauerstoffmasken waren längst heruntergefallen und baumelten vor meinem Gesicht. Während die Stewardess versuchte, die übrigen Passagiere zu beruhigen, konnte ich vor dem Fenster den Rauch von den Triebwerken aufsteigen sehen. Die Stewardess und der Kapitän konnten noch so viele Worte verlieren – die Tragödie entfaltete sich bereits, und es gab keine verdammte Möglichkeit, sie aufzuhalten.
Genauso fühlte ich mich. Und ich wollte mich nicht so fühlen.
Ich schluckte, um zu vermeiden, dass ich mich räuspern musste und damit schwach klang. »Wer ist sie?«
»Das, mein lieber Wesley, ist Emily.«
KAPITEL3
SHERMAN
Meine Augen brannten. Ich hatte zu lang auf das Rollfeld gestarrt, ohne zu zwinkern. Die endlose Wiederholung von startenden und landenden Flugzeugen hatte etwas Beruhigendes – exakt das, was ich gerade gebrauchen konnte. Mit dem Handrücken rieb ich mir durchs Gesicht und lehnte mich im Stuhl zurück. Für gewöhnlich war ich nicht dermaßen angespannt. Allerdings war es eben keine gewöhnliche Situation.
Unmittelbar wurde ich wieder ruhelos, also stand ich auf, um mir einen Kaffee zu holen. Vermutlich half Koffein nicht unbedingt dagegen, wie aufgekratzt ich war.
Außer mir hielten sich nur wenige andere in der Lounge auf, hauptsächlich Geschäftsreisende mit knittrigen Anzügen und tiefen Schatten im Gesicht. Die meisten von ihnen starrten auf Smartphone-Bildschirme, zwei schliefen. Der Geruch nach fettigem Rührei und billigen Würstchen wurde kurzzeitig verdrängt von frisch gemahlenem Kaffee aus dem Vollautomaten.
So viel war falsch gelaufen. War ich ihr nicht wenigstens schuldig, sie zu warnen? Nach all der Zeit? Kein Tag war vergangen, an dem ich nicht an früher gedacht hatte. An sie. Kontinuierlich musste ich mich gewaltsam davon abhalten, ihr einfach zu schreiben. Aber ich hatte versprochen, mich zurückzuhalten. Es war nicht die richtige Zeit, das stimmte leider. Ein Schritt nach dem anderen, das war der Deal.
Ich kehrte zurück zu meinem Platz und starrte ins dampfende Schwarz in meiner Tasse. Würde sie mich erkennen? Ich hatte mich verändert, daran bestand kein Zweifel – nicht nur äußerlich. Wollte sie mich wiedersehen? Wie würde sie reagieren? Was würde sie sagen? Was sollte ich erwidern, wenn es überhaupt dazu kam? Die richtigen Worte zu finden, war nie meine Stärke gewesen.
Schweigen, das konnte ich, sehr gut sogar – und anders hätte der Plan nicht funktioniert.
Ich versuchte, meine ziellosen Gedanken zu vertreiben, indem ich mich wieder aufs Rollfeld konzentrierte. Vielleicht lenkte es mich ein paar Minuten ab. Nur noch ein wenig Zeit absitzen, hier in der Lounge und später im Flugzeug. Geduld.
Dann würde ich endlich wissen, wie es weiterging. Dann würde ich sie endlich wiedersehen.
KAPITEL4
EMILY
»Was er mir angetan hat?«, wiederholte ich. Die Geschichte schien mit jeder Sekunde absurder zu werden. »Entschuldigung, ich kenne gar keinen Andrew St. Cross. Wenn er nicht zufällig etwas mit diesem Juwelier zu tun hat, sagt mir der Name gar nichts.«
McLeod lächelte verkniffen. »Er war der Juwelier oder besser formuliert der Geschäftsführer der St. Cross Diamonds Group.«
Sein Kollege musterte mich dermaßen eindringlich, dass ich ihn anfuhr: »Warum starren Sie mich so an? Wenn ich Ihnen sage, dass ich ihn nicht kenne, dann stimmt das auch.«
»Mr. St. Cross hat einen Brief hinterlassen, in dem er Sie erwähnt und Ihre Adresse notiert hat, Miss Parkford. Das muss doch einen Grund haben.« Er zog ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus seiner Manteltasche. »Haben Sie eine Narbe auf der Hüfte, die mit fünf Stichen genäht werden musste?«
Mir wurde schwindelig und ich tastete nach dem Sofa hinter mir. Leider war es viel zu weit weg. Ich griff ins Leere und wurde von McLeod gestützt, der mich auffing, als meine Beine für ein paar Sekunden nachgaben.
»Das kann nicht sein.« Ich klammerte mich an seinen Arm, bis mir bewusst wurde, was ich da tat.
Anderson nickte. »Also haben Sie die Narbe?«
»Ja. Aber das kann ein Fremder unmöglich wissen.«
* * *
ACHT JAHRE ZUVOR
»Emily, bleib stehen. Wir bekommen so viel Ärger!«, fluchte Sherman hinter mir und versuchte trotzdem, mit mir Schritt zu halten.
»Ärger bekommen wir sowieso, wenn sie uns erwischen.« Ich sprang über das schmale Flussbett und blieb auf der Lichtung stehen.
Mein bester Freund stolperte von hinten in mich hinein und packte meine Schultern, um nicht zu fallen. »Wow.«
»Sag ich doch.« Der Atem kondensierte vor meinen Lippen und meine Nasenspitze war längst taub. Der Anblick des gefrorenen Wasserfalls im Mondschein war es allemal wert gewesen.
Sherman legte die Arme um mich. »Wir müssen vorsichtiger sein; wenn sie uns erwischen, machen sie vielleicht die Drohung wahr und trennen uns.«
»Drei Jahre noch, dann sind wir volljährig. Wir werden einfach durchhalten.« Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. Seine Lippen waren warm, obwohl es um uns herum eisig war.
»Em, hör auf«, bat Sherman zwischen zwei Küssen. »Du weißt, dass ich dir nicht widerstehen kann.«
»Keine Sorge, hier ist es eh zu kalt. Komm, wir klettern rauf.«
Unsicher schaute er zu der Steinformation. »Das ist keine gute Idee.«
»Du findest immer, dass es keine gute Idee ist.«
Er legte den Kopf schräg. »Einer von uns muss ja der Vernünftige sein. Lass uns zurückgehen und ein bisschen schmusen.«
»Schmusen? Das ist alles, was du zu bieten hast?« Ich schob meine Finger zwischen seine und verzog das Gesicht, als würde ich schmollen.
»Du bist unmöglich. Wie kannst du mir vorhalten, dass ich für unser erstes Mal gern ein romantischeres Setting als eine durchgelegene Couch im Aufenthaltsraum des Waisenhauses möchte?« Sherman schnaubte, und ich streichelte seine Wange, um ihn zu versöhnen.
»Ich bin eben ungeduldig. Sieh es als Kompliment. Also ich klettere kurz hoch, danach gehen wir zurück.«
Er stöhnte und bedeutete mir, mich zu beeilen.
Ich war schon fast am Felsen und wollte hochsteigen, als hinter uns ein lautes Geräusch ertönte. Es klang wie ein trockenes Husten oder das Knacken eines großen Astes. Als ich herumfuhr, spürte ich einen scharfen Schnitt an der Hüfte und meiner Handfläche.
Die ganze Seite der Felswand war mit Glasscherben gespickt! Wer zum Teufel tat so etwas? Die armen Tiere, die sich hier vermutlich ständig verletzten.
Sherman rannte zu mir, nahm meine Hand, und wir sprinteten gemeinsam los, um nicht bei unserem streng verbotenen nächtlichen Ausflug erwischt zu werden.
Meine Lunge brannte wie Feuer, als wir vor der Küchentür des Heims stehen blieben. Die Lampe über der Tür flackerte und mir lief nicht nur der Schweiß über den Körper. Ich spürte, wie meine Hose an der Stelle klebte, wo ich mich am Glas geschnitten hatte. Hoffentlich hatte ich keine verräterische Blutspur hinterlassen.
Sherman holte den kleinen Schraubenzieher hervor, den er immer dabeihatte, und öffnete das Schloss für uns. Ich schlüpfte hinein und schaltete das Licht ein. Die untere Etage war um diese Uhrzeit absolut verlassen, und selbst wenn wir hier erwischt wurden, war es nicht ganz so schlimm, da wir behaupten konnten, Durst oder Hunger gehabt zu haben.
»Wir haben ein Problem.«
Mein bester Freund stöhnte. »Nur eins?«
Mit zusammengebissenen Zähnen öffnete ich die Jeans und zog sie hinunter. Sherman würgte, als er die Wunde sah. »Großer Gott. Wir müssen Schwester Faith wecken.«
»Nein. Dann wissen sie, dass wir draußen waren.«
Er beugte sich vor und würgte wieder, weil er kein Blut sehen konnte. »Sie ist tief und groß.«
»Das hatte ich befürchtet. Du musst sie nähen. Hol den Verbandkasten.«
»Em! Das kann ich nicht.«
»Du musst«, beharrte ich.
»Können wir dich nicht in ein Krankenhaus bringen? Wir kommen doch jetzt gar nicht an ein Betäubungsmittel. Und nähen kann ich auch nicht. Wahrscheinlich werde ich vorher ohnmächtig.«
Ich brachte ihn zum Schweigen, indem ich einen Kuss auf seine Lippen presste. »Sie werden uns trennen. Wir können niemandem davon erzählen. Niemals, hörst du? Das bleibt unser Geheimnis.«
Er starrte auf den Boden und schwieg, bevor er eine Faust ballte. »Wo ist der Erste-Hilfe-Kasten?«
* * *
»Können wir vielleicht auf mein Zimmer gehen?«, fragte ich, weil ich mich endlich setzen und die Angelegenheit besprechen wollte, ohne potenziell belauscht zu werden.
»Selbstverständlich, Miss Parkford.«
Während ich die beiden durch den Flur zur Treppe führte, holte ich mein Handy aus der kleinen Abendtasche, die ich dabeihatte, und gab »Andrew St. Cross« in das Suchfeld meines Browsers ein. Aus reiner Neugier und um ganz sicherzugehen, sah ich mir zuerst die Bilder von ihm an.
Nein. Ich hatte den Kerl nie zuvor gesehen. Und er war verheiratet. Das hatte ich auch nicht gewusst. Er war recht attraktiv gewesen, aber für mich viel zu alt. Eine weitere Suche ergab, dass er Anfang vierzig war. Warum sollte er sich für mich interessiert haben? Wo war die Verbindung, die ich nicht sah? Es gab keine frappierende Ähnlichkeit zwischen uns, sodass ich ihn für einen Verwandten hätte halten können. Aufgrund des Altersunterschieds hätte er vielleicht mein Vater sein können, wenn er sich früh rangehalten hatte. Wie wahrscheinlich war das schon?
Viel mehr Sorgen bereitete mir die Frage, woher er gewusst hatte, dass mein bester Freund mich vor einigen Jahren mitten in der Nacht mit fünf Stichen genäht hatte.
Ich wünschte mir nicht zum ersten Mal, dass Sherman wieder aus der Versenkung auftauchte, in die er vor einer Weile verschwunden war. Hatte er jemandem davon erzählt? Das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und noch weniger, dass er ausgerechnet dem CEO von St. Cross Diamonds davon berichtet haben sollte.
Nichts ergab mehr einen Sinn – was vermutlich auch an der Tatsache lag, dass es inzwischen vier Uhr morgens war, ich seit nun vierundzwanzig Stunden wach und obendrein betrunken war.
Ich bat die Herren in mein Zimmer, schloss die Tür und ging direkt zu dem kleinen Kühlschrank, um mir ein Wasser zu nehmen, bevor ich die Kaffeemaschine anschaltete. Zuerst einmal musste ich nüchtern werden.