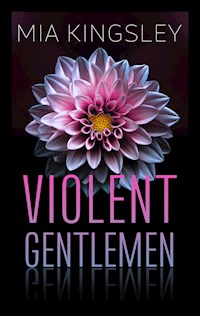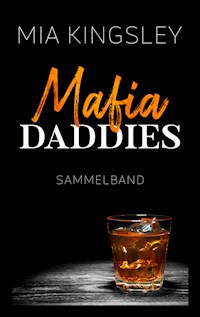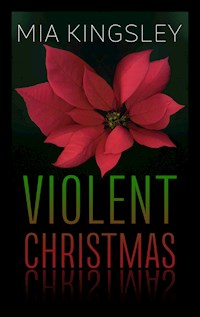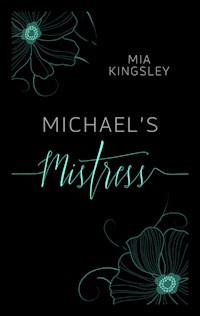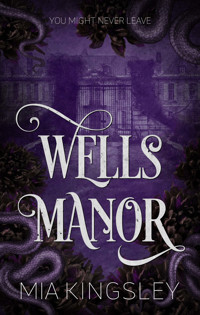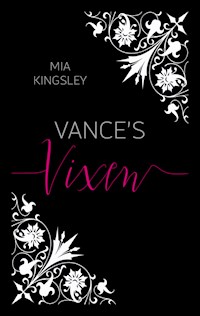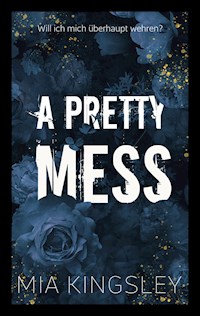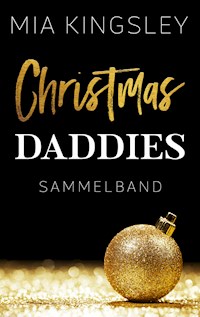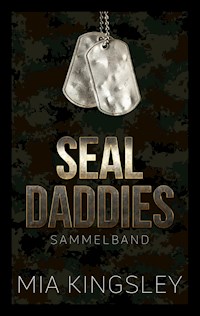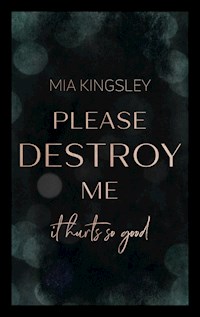
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Black Umbrella Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alles andere war nur Vorspiel. Seit meinem 18. Geburtstag sitze ich in einer Institution mit dem eleganten Namen »Rose Point Behind The Trees Estate«. Klingt wesentlich ansprechender als Klapse. Mein Onkel sagte, ich dürfe zurück nach Hause, sobald ich Vernunft gelernt habe. Da seitdem sieben Jahre vergangen sind, schätze ich, dass er lange warten kann. Meine beste Freundin ist eine Kleptomanin und den Esstisch teile ich mir mit einer Frau, deren einzige Gesprächsbeiträge aus »Miau« bestehen. Trotzdem fühle ich mich hier gut aufgehoben – bis der neue Arzt anfängt. Er scheint einem Abenteuer nicht abgeneigt, sonst würde er mich nicht so ansehen. Dass er etwas völlig anderes vorhat, wird mir allerdings erst klar, als ich gefesselt in seinem Bett aufwache. Er verspricht, mich loszumachen, sobald ich brav bin. Was er nicht weiß: In diesem Spiel bin ich sehr viel besser als er … Dark Romance. Düstere Themen. Eindeutige Szenen. Deutliche Sprache. In sich abgeschlossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
PLEASE DESTROY ME
MIA KINGSLEY
DARK ROMANCE
Copyright: Mia Kingsley, 2017, Deutschland.
Coverfoto: © Mia Kingsley
Korrektorat: Laura Gosemann
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nachdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Sämtliche Personen in diesem Text sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
Black Umbrella Publishing
www.blackumbrellapublishing.com
INHALT
Please Destroy Me
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Mehr von Mia Kingsley lesen
Über Mia Kingsley
PLEASE DESTROY ME
Seit meinem 18. Geburtstag sitze ich in einer Institution mit dem eleganten Namen »Rose Point Behind The Trees Estate«. Klingt wesentlich ansprechender als Klapse. Mein Onkel sagte, ich dürfe zurück nach Hause, sobald ich Vernunft gelernt habe. Da seitdem sieben Jahre vergangen sind, schätze ich, dass er lange warten kann.
Meine beste Freundin ist eine Kleptomanin und den Esstisch teile ich mir mit einer Frau, deren einzige Gesprächsbeiträge aus »Miau« bestehen. Trotzdem fühle ich mich hier gut aufgehoben – bis der neue Arzt anfängt.
Er scheint einem Abenteuer nicht abgeneigt, sonst würde er mich nicht so ansehen. Dass er etwas völlig anderes vorhat, wird mir allerdings erst klar, als ich gefesselt in seinem Bett aufwache. Er verspricht, mich loszumachen, sobald ich brav bin.
Was er nicht weiß: In diesem Spiel bin ich sehr viel besser als er …
Dark Romance. Düstere Themen. Eindeutige Szenen. Deutliche Sprache. In sich abgeschlossen.
KAPITEL1
BROOKE
Vorsichtig zählte ich die Honigbällchen ab und legte sie in einer geraden Reihe auf den Tisch. »Neununddreißig. Vierzig. Einundvierzig.« Dann nickte ich.
Suzanne rührte in ihrem Latte Macchiato und kicherte. »Wir sollen nicht mit dem Essen spielen.«
»Wir sollen auch aus der Küche keine Frühstücksflocken klauen, wenn nicht Frühstücksflockentag ist – habe ich trotzdem gemacht.« Noch einmal zählte ich nach, um sicherzugehen, dass ich genügend Honigbällchen aus der Schüssel gefischt hatte.
»Erzähl mir von deinem Plan.« Suzanne ließ den Löffel sinken und sah mich an.
»Schon wieder? Langsam solltest du ihn auswendig kennen.«
»Aber er ist lustig.«
Dass Suzanne meinen Ausbruchsplan unterhaltsam fand, war mir klar, denn sie hatte nicht die geringste Ahnung, wie ernst ich jedes Wort meinte. Doch damit war ich im Rose Point Behind The Trees Estate die Einzige. Alle anderen hier hatten nämlich einen Knall.
Allerdings war ich mir nach sieben Jahren in dieser Anstalt nicht mehr sicher, ob mein Verstand in der Zwischenzeit nicht gelitten hatte.
Ich kannte Suzanne gut genug, um zu wissen, was sie wollte. »Was bietest du mir, damit ich es dir erzähle?«
Ihr Lächeln wurde schelmisch, bevor sie drei Packungen Schlaftabletten aus der Tasche ihres grauen Kapuzenpullovers zog. »Das ist das gute Zeug – nicht die, von denen man sofort brechen muss, wenn man zu viele nimmt.«
»Ah, für meinen Notfallplan. Du hörst tatsächlich zu.«
»Ich hänge an deinen Lippen«, schwor sie.
»Trotzdem solltest du nicht stehlen. Das wirft deine Therapie um Wochen zurück.«
Sie schnaubte. »Wir wissen beide, dass ich nur die Zeit absitze, bis Pauly sich mit seiner neuesten Geliebten langweilt und mich zurückholt.«
»Pauly« hieß eigentlich Simon Paul van Beddingfield III. und war Suzannes stinkreicher Mann. Aus Langeweile und um die Aufmerksamkeit ihres unterkühlten Gatten auf sich zu ziehen, hatte Suzanne angefangen zu stehlen. Leider hatte sich ihr neues Hobby schnell zur Sucht entwickelt, und deshalb hatte der Ehemann des Jahrtausends sie kurzerhand hierher verfrachtet.
Rose Point Behind The Trees Estate klang besser als Klapse. Oder Sanatorium. Psychiatrie. Nervenheilanstalt. Entziehungsklinik. Kur.
Oder in meinem Fall: Gefängnis.
Mir war klar, dass es nie sonderlich überzeugend klang, wenn jemand aus der Klapse versicherte, keinen an der Waffel zu haben, doch in meinem Fall stimmte es. Ich war lediglich eingesperrt worden, um keinen Unsinn zu machen.
»Bis du Besserung gelernt hast.« Das waren die Worte meines Onkels gewesen, während meine Mutter eifrig genickt und mein Vater seine Hände geknetet hatte.
Ich schob die Tablettenpackungen in meinen Sweater. Wir trugen alle graue Jogginganzüge mit einem verschnörkelten Logo auf der Brust. Anfangs hatte ich die Dinger schrecklich gefunden, aber inzwischen konnte ich nicht leugnen, dass sie verdammt bequem waren und mir die Frage erleichterten, was ich anziehen sollte. Außerdem waren die Taschen schön tief, wodurch man jederzeit herrlich verbotene Sachen schmuggeln konnte.
»In einundvierzig Tagen werde ich fünfundzwanzig.« Mit dem Zeigefinger rollte ich das letzte Honigbällchen in der Reihe hin und her. »Und davor muss ich ausbrechen.«
»Was ist, wenn der Versuch scheitert?«
»Dann werde ich mich umbringen.«
Suzanne seufzte theatralisch und schlug die Hände vor die Brust. »Brooke, das ist so Shakespeare! Ich liebe es!«
»Es ist die Wahrheit.« Ich lächelte schwach.
»Natürlich.« Sie tätschelte meine Schulter. »Und ich würde nie stehlen.«
Mit einem Fingerschnippen beförderte ich den Cornflake in Richtung von Charlotte, die mit ihrem Strickzeug am anderen Ende des Tisches saß. Nachdem sie das Bällchen eindringlich betrachtet hatte, hob sie den Kopf und sah uns an. »Miau.«
Suzanne nickte. »Charlotte hat einen guten Tag. Wie schön. Erzähl weiter. Was ist mit dem Zaun?«
Ich drehte mich um. Die bodentiefen Fenster des Speisesaals waren geöffnet, um frische Luft hereinzulassen. Dahinter lag der Garten, der sich schier endlos erstreckte. Eine nette Illusion, um uns Gästen das Gefühl von Freiheit zu vermitteln.
Immerhin waren wir auch »Gäste« und keine »Patienten«. Dafür war der Aufenthalt in Rose Point Behind The Trees bedeutend zu teuer.
Am Ende des Rasens wartete jedoch ein drei Meter hoher schwarzer Zaun aus Gusseisen mit Metallspitzen auf der oberen Kante. Ein unüberwindbares Hindernis, das mir lange Kopfschmerzen bereitet hatte. Ich nahm Frühstücksflocke Nummer vierzig in die Hand und steckte sie mir in den Mund. Nachdem ich sorgfältig gekaut hatte, sagte ich: »Wie so oft übersieht man die naheliegende Lösung – den Haupteingang.«
»Miau?« Charlotte klimperte mit den Wimpern, während sie den blauen Wollfaden um die linke Nadel wickelte.
»Es ist viel logischer. Ich warte, bis der Empfang für die Nacht geräumt wird und flüchte durch die Eingangstür direkt auf den Besucherparkplatz. Warum sollte ich hinten raus und den ganzen Weg bis zum Zaun laufen, über den ich ohnehin nicht komme, wenn es nur zwei Schritte bis nach draußen sind?«
»Ha«, machte Suzanne. »Ich weiß nicht, ob das ein unfassbar brillanter oder dummer Plan ist.«
»Er ist brillant.« Ich rollte das nächste Bällchen unter dem Finger. »Doch was mache ich, wenn ich auf dem Parkplatz bin? Ich müsste darauf hoffen, einen unverschlossenen Wagen zu finden, oder lernen, wie man stiehlt, damit ich einem der Pfleger den Schlüssel klauen kann.«
»Wenn du die Finger von Steve gelassen hättest, würde er noch hier arbeiten und hätte dir bestimmt sein Auto gegeben. Vermutlich hätte er dich sogar gefahren.« Suzanne dachte nach, bevor sie ihre Worte mit einem Nicken bekräftigte.
Ich wurde wehmütig – wie jedes Mal, wenn ich an Steve dachte.
»Vermisst du ihn?«, wollte sie wissen.
»Ja.«
Suzanne streckte die Hand aus und strich über meine Wange. »Das vergeht. Glaub mir. Als ich in deinem Alter war, habe ich mich jeden zweiten Tag neu verliebt.«
Ich hob eine Augenbraue. »Hier drin habe ich wohl kaum große Auswahl. Außerdem war ich nicht verliebt. Es war nur …« Mit einem Seufzen brach ich ab.
»Miau.« Charlotte nickte, als würde sie mich verstehen.
»Ach.« Suzanne gab ein abfälliges Geräusch von sich. »Du weißt gar nicht, wovon du redest, verrückte Katzenlady. Natürlich war Brooke verliebt. Das hat sie nur zwischen dem ganzen Vögeln nicht gemerkt.« Sie wandte sich zu mir. »Ich habe gleich gesagt, ihr sollt vorsichtiger sein und nicht ständig wie Tiere übereinander herfallen. Der Professor ist so pingelig, wenn es um dich geht. Es war klar, dass er Steve sofort feuern würde.«
»Es ist trotzdem unfair. Immerhin holt der Prof unsere Empfangsdame bei jeder Gelegenheit in sein Büro, als würden wir es nicht merken.«
»Das ist etwas anderes, Schatz. Stacey ist kein Gast.«
»Herrgott. Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Sag Patienten und nicht diesen beschönigenden Unsinn.« Ich verschränkte die Arme und ließ mich in den Stuhl sinken.
»Sorry. Ich wollte dich nicht verärgern.«
»Hast du nicht, Suzanne. Du kannst nichts für meine Laune.«
»Kann ich dir bei deinem Plan helfen?«
Ihr Tonfall brachte zum Ausdruck, dass sie mich trösten wollte und im gleichen Moment nicht an mein Gedankenspiel glaubte.
»Nein, danke.« Ich stand auf, fegte die verbleibenden Cerealien zurück in meine Schüssel. »Irgendwie bin ich müde. Wenn mich jemand sucht, ich bin in meinem Zimmer.«
»Miau.«
»Bis später.«
Ich hob die Hand und verließ den Speisesaal. Wären die Fenster nicht vergittert, dachte ich, als ich mein Zimmer betrat, hätte ich die Hotel-Illusion besser aufrechterhalten können.
Vor dem Bett sank ich auf die Knie, zog das Laken von der Matratze und holte die Tablettenschachteln aus meiner Tasche. Ich öffnete den Reißverschluss des Matratzenbezugs und schob die Pillen zu meinem kleinen Sammelsurium von Dingen, die ich vielleicht oder vielleicht auch nicht für meine Flucht gebrauchen konnte. Bisher hatte ich ein scharfes Messer, knapp einhundert Dollar in bar, einen Schraubenzieher und nun die Schlaftabletten gebunkert.
Da Professor Johnstone als Einziger neben mir wusste, dass ich geistig vollkommen gesund war, wurde mein Zimmer nie durchsucht, und ich besaß ein paar Freiheiten, die andere Patienten sich nicht herausnehmen durften. Trotzdem hielt ich es für klüger, meine Besitztümer zu verstecken, denn auch wenn mein Verhältnis zum Anstaltsleiter eher freundschaftlich war, würde er ausflippen, falls er von meinem Plan erfuhr.
Suzanne hielt mein Vorhaben für leeres Gerede, aber das lag daran, dass ich offiziell aufgrund von Paranoia in Rose Point war.
Es gab durchaus Tage, an denen ich mir wünschte, es wäre die Wahrheit, denn diese Version war um einiges netter als die Realität.
Obwohl ich nicht paranoid war, wusste ich, wie überflüssig ich an meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag werden würde. Damals, als sie mich hier eingesperrt hatten, waren mir die Konsequenzen nicht ganz klar gewesen, doch nun ahnte ich, dass mir die Zeit davonlief.
Mein Vater war Erbe einer Hoteldynastie und hatte ein schönes Leben gehabt – bis zur Heirat mit der Frau, die mich zur Welt gebracht hatte. Nach allem, was passiert war, fiel es mir schwer, das Wort »Mutter« in den Mund zu nehmen oder es nur zu denken.
Während mein Großvater Simon Dupois sein ganzes Leben geschuftet und die Dupois-Hotelkette aus dem Nichts erschaffen hatte, war sein Sohn ein rückgratloser Feigling geworden, der sich von Angelica Wilson hatte einwickeln lassen. Nachdem er ihrem Charme verfallen und sie gegen den Wunsch meines Großvaters geheiratet hatte, war der alte Mann klug genug gewesen, Dad in der Erbreihenfolge zu überspringen und stattdessen mich zu wählen. Allerdings würde ich den Zugang zu allem erst an meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag erhalten. Sollte mir vorher etwas zustoßen – beispielsweise ein ungeklärter Unfall –, würde das gesamte Imperium an eine wohltätige Organisation überschrieben werden.
Also musste ich am Leben bleiben und manipuliert werden.
Glücklicherweise konnte ich von mir behaupten, mit etwas mehr eisernem Willen ausgestattet worden zu sein als mein Vater. Irgendetwas musste ich ja von meiner Erzeugerin haben. Als ich alt genug war, die ganzen Zusammenhänge zu verstehen, erkannte ich, warum mein Vater sich praktisch in die Hose machte, sobald mein Onkel Charly uns besuchte.
Charles Wilson, der Bruder meiner Mutter, war der gefährlichste und berüchtigtste Gangsterboss in ganz Neuengland – und er wollte das Dupois-Imperium. Es gab kaum einen besseren Weg als Hotels, um seine Macht zu demonstrieren, einen sicheren Platz für seine Geschäftsdeals zu haben und Geld zu waschen. Dass die Kette zu dem Zeitpunkt bereits siebenundvierzig Häuser umfasste und sowohl in Amerika als auch Europa vertreten war, stellte einen wunderbaren Bonus dar.
Als mein Großvater herausgefunden hatte, was seine neue Schwiegertochter und ihr Bruder vorgehabt hatten, änderte er das Testament. Leider hatte er dabei nicht bedacht, wie er mich damit zur Zielscheibe machte, denn natürlich hatte Charles für solche Fälle einen Plan parat.
Er hatte einen Adoptivsohn, der knapp zehn Jahre älter war als ich. An meinem achtzehnten Geburtstag wurde mir mitgeteilt, dass ich ihn gefälligst heiraten würde. Morrison Wilson – allein der Name war so dämlich, dass es wehtat.
Morrison war in vielerlei Hinsicht noch schlimmer als sein Vater und blickte der Idee, eine hilflose Achtzehnjährige zu heiraten, voller Vorfreude entgegen. Er versuchte sogar, mich während der Verkündung zu küssen. Als ich ihm daraufhin eine Ohrfeige gab, schlug er zurück, und meine Mutter sagte, ich solle mich nicht so anstellen.
Ich tat das einzig Logische: Ich stimmte zu und wollte noch in der gleichen Nacht davonlaufen. Leider erwischten sie mich.
Daraufhin drohte ich offensichtlich dermaßen überzeugend damit, mich umzubringen, bis ihnen nichts Besseres einfiel, als mich nach Rose Point Behind The Trees Estate zu bringen.
In einundvierzig Tagen würden sie kommen und mich holen. Egal was Suzanne glaubte: Wenn mir die Flucht nicht gelingen sollte, würde ich mich tatsächlich umbringen. Allein um Charles und meiner Mutter eins auszuwischen.
Die Aussicht, Morrison zu heiraten, war so schrecklich, dass ich dankbar für die Pillen war, die meine beste Freundin mir besorgt hatte. Unter allen Insassen kannte ich Suzanne am längsten, weil sie alle paar Monate zurückkehrte und meist nur wenige Tage mit ihrem Mann verbrachte, bevor er sie erneut verbannte.
Mein Plan war simpel: Ich würde flüchten und irgendwo ein neues Leben beginnen, nachdem ich mir einen kleinen Teil des Geldes geholt hatte. Das stand mir zu. Was sollte ich sonst tun? Ich brauchte eine Ausbildung, um mein restliches Leben lang auf eigenen Füßen zu stehen.
Ich legte mich aufs Bett, schob die Arme hinter den Kopf und starrte an die Decke, während ich leise ein Kinderlied summte. Mein Großvater war der Einzige, den ich manchmal vermisste. Alle anderen in der Familie waren so schrecklich, dass die Verrückten hier in Rose Point eine viel attraktivere Gesellschaft waren. Ich fragte mich oft, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn er nicht kurz nach meinem siebzehnten Geburtstag gestorben wäre.
Sicherlich hatte er eine andere Vision für mich gehabt als das Leben in einer Klapse für die gehobene, stinkreiche Gesellschaft, das den einzigen Schutz vor meiner Familie darstellte.
Noch einundvierzig Tage.
Es klopfte an meine Tür, und ich richtete mich auf. »Ja, bitte?«
Antonio kam herein und strahlte mich an. »Señorita Brooke, Professor Johnstone bat mich, Ihnen das Buch zu bringen. Sie hätten danach gefragt?«
Ich mochte Antonio und seinen temperamentvollen Charme, den er aus Texas mitgebracht hatte. Außerdem war ich als leichenblasse, geisterhafte Erscheinung neidisch auf seinen bronzefarbenen Teint.
Er ersetzte Steve, den der Professor rausgeworfen hatte, nachdem unsere kleine Affäre aufgeflogen war. Ich hätte gern die Schuld auf mich genommen, aber in Wahrheit waren Steve und ich zu gleichen Teilen daran schuld gewesen. Er hatte die Finger nicht mehr von mir lassen können, und ich hatte ihn nicht gehindert.
Antonio hingegen war verheiratet, hatte drei reizende Töchter und eine Frau, die als Dessous-Model hätte Karriere machen können. Professor Johnstone war auf Nummer sicher gegangen, als er den neuen Pfleger eingestellt hatte.
Nicht nur, dass ich Steve vermisste, mich ärgerte auch, dass Suzanne recht hatte – denn mein Pfleger und Liebhaber hätte mir sicher bei der Flucht geholfen. Ich konnte nicht leugnen, dass ich mir ein solches Szenario mehr als einmal ausgemalt und deshalb tatsächlich die richtige Planung der Flucht vernachlässigt hatte. In meiner Fantasie hatte Steve mich auf die Arme gehoben, nach draußen getragen und in Sicherheit gebracht.
»Danke, Antonio. Wie geht es Chloe?«
Er setzte zu einem Monolog über seine jüngste Tochter an, die jetzt in den Kindergarten gekommen war, und ich nahm das Buch entgegen. Mit einem Lächeln las ich den Titel. Bei unserem letzten Pokerspiel hatten der Prof, den ich bei seinem Vornamen Raymond nannte, wenn niemand dabei war, und ich darüber diskutiert, ob es das Phänomen Stockholm-Syndrom wirklich gab.
Nach sieben Jahren hier hatte ich verdammt viele Bücher über Psychologie gelesen und hätte es vielleicht in Betracht gezogen, ein Studium in dem Bereich zu beginnen, aber ich wollte nicht den Rest meines Lebens permanent daran erinnert werden, dass ich in der Vergangenheit eingesperrt worden war.
Jedenfalls waren unsere Meinungen stark voneinander abgewichen, und nun hielt ich »Die Kunst, Recht zu behalten« von Arthur Schopenhauer in den Händen. Der dezente Hinweis entging mir nicht.
Antonio ging erst, nachdem er mir von Marissa und Louisa erzählt hatte, seinen beiden anderen Töchtern.
Ich legte das Buch auf den Tisch unter dem vergitterten Fenster. Später würde ich an einer der üblichen Therapiesitzungen teilnehmen, doch bis dahin hatte ich nicht wirklich viel zu tun. Ohne Steve war es langweilig geworden.
Mein Handy hatte ich schon sieben Jahre nicht mehr gesehen. Es befand sich im Büro des Profs, zusammen mit einem Computer, an den ich ebenso wenig herankam. Wenn ich nicht las oder wie Charlotte stricken wollte, musste ich mir die Zeit anderweitig vertreiben.
Das Wetter war schön genug für einen Spaziergang, aber in den letzten Wochen hatte mich der Garten deprimiert. Je näher ich meinem Geburtstag kam, desto bewusster waren mir die Mauern des Gefängnisses. Früher und mit Steve hatte ich ausblenden können, dass ich eigentlich gefangen war, jetzt wollte es mir nicht mehr gelingen.
Noch einundvierzig Tage.
KAPITEL2
BROOKE
Suzanne hielt ihr Gesicht in die Sonne, als ich mich zu ihr gesellte. Sie lag auf einer grau-rot karierten Decke und rollte sich herum. »Brooke. Ich habe etwas für dich.« Mit einem verschwörerischen Lächeln winkte sie mich zu sich. »Noch fünfunddreißig Tage, richtig?«
»Richtig«, bestätigte ich und schlug die Beine unter. Das Wetter war traumhaft schön, und mit ein bisschen Fantasie konnte ich mir vorstellen, mit meiner Freundin im Park zu sitzen, nachdem wir einen Kurs an der Uni besucht hatten.
»Wie läuft es mit deinem Plan?«
»Gut«, log ich und zupfte ein paar Grashalme aus, die nichts für meine schlechte Laune konnten. »Ich mache echte Fortschritte.«
»Dann habe ich genau das Richtige für dich.« Suzanne wirkte stolz, als sie in die Tasche ihres Pullis griff. Sie zauberte einen großen silbernen Schlüssel hervor.
Mein Herz klopfte schneller, und ich wollte danach greifen. Suzanne zog ihn schnell weg. »Versprichst du mir, an mich zu denken, wenn du abgehauen bist?«
»Natürlich. Ist das der Schlüssel zur Eingangstür?«
Sie nickte. »Der Hauptschlüssel für alle Türen mit dem Sicherheitsschloss. Der Hausmeister hatte zwei. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis sie merken, dass er weg ist und ob sie die Schlösser austauschen. Du solltest dich beeilen.«
Dafür, dass sie mir nicht glaubte, war sie eine erstaunlich loyale Freundin. Ehrfürchtig nahm ich den Schlüssel entgegen. »Danke. Natürlich denke ich an dich. Ich werde dich wie verrückt vermissen.«
»Haha«, sagte sie. »Verrückt. Guter Witz.« Sie zwinkerte mir zu und rollte sich wieder auf den Bauch.
Ich starrte auf das blank polierte Metall. Vermutlich hätte ich mich freuen sollen, aber ich empfand nichts als Panik. Mein Plan kam vor allem deshalb nicht voran, weil ich nicht genau wusste, was ich draußen überhaupt sollte.
In Rose Point hatte ich zumindest eine Art Sozialgefüge. Suzanne war eine Freundin, und mit dem Professor verstand ich mich gut. Momentan überwog die Angst, in der richtigen Welt nicht zurechtzukommen. Wo sollte ich überhaupt anfangen?
Ich hatte nichts. Kein Geld, keine Papiere – nur ein paar mordlustige Verwandte, die von meinem Tod profitierten. Nicht gerade eine Aussicht, die mich in die Freiheit lockte.
Es wirkte insgesamt verführerischer, mich einfach umzubringen. Meine Finger schlossen sich um den Schlüssel. Letztlich würde ich die Entscheidung wohl zwischen dem Schlüssel und den Tabletten treffen.
Meine Kehle wurde eng, und ich räusperte mich.
»Alles okay?«, fragte Suzanne.
»Klar. Wenn du mir meine Uhr wiedergibst.«
»Mist«, murrte sie. »Du wirst immer besser. Wie hast du es so schnell bemerkt?«
»Die Decke hat auf dem Gras geraschelt, als du dich bewegt hast.«
»Verdammt!«
Ich stieß meine beste Freundin mit der Schulter an. »Kannst du Türen knacken? Du könntest es mir beibringen.«
Sie spitzte die Lippen. »Was springt dabei für mich raus?«
»Ich zeige dir, wie man beim Pokern betrügt. Beim nächsten Mal kannst du mit Pauly spielen und ihn über den Tisch ziehen, wenn du vorher deine Freiheit setzt, musst du vielleicht nicht erneut hierher.«
»Aber dann sehe ich dich nicht wieder.«
»Siehst du eh nicht, wenn ich flüchte.«
»Ach ja. Richtig.« Sie nickte langsam, doch auf ihrem Gesicht war die Skepsis zu sehen. Suzanne glaubte nicht, dass ich wirklich floh.
Hoffentlich würde sie sich nicht allzu schuldig fühlen, falls ich mich für die Tabletten entschied, weil sie mir diese besorgt hatte. Wahrscheinlich sollte ich ihr einen Abschiedsbrief hinterlassen. Für alle Fälle.
Unwirsch schüttelte ich den Kopf. Dieser Pessimismus sah mir gar nicht ähnlich. Ich benahm mich fast, als wäre es beschlossene Sache, dass ich mich umbrachte, statt zu fliehen.
Suzanne hob die Hand und winkte. Ich blickte in die Richtung und sah Benjamin auf uns zukommen. Er war siebzehn und von seiner Mutter nach Rose Point geschickt worden, weil er ein paar nervöse Ticks hatte.
Zuerst war es verwirrend gewesen, dass er immer dreimal hintereinander nickte und ständig seinen Nacken knacken ließ, bis ich mich daran gewöhnt hatte.
»Hey, Bennie.« Suzanne lächelte ihn an.
Ich wusste, dass sie immer Kinder haben wollte, doch Pauly dagegen war. Deswegen war sie nun die stolze Besitzerin von fünf verzogenen Chihuahuas, die sie nach den Mitgliedern von Smokie benannt hatte. Seit dem Tag, an dem Benjamin angekommen war, hatte sie ihn adoptiert und verhätschelte ihn, so gut sie konnte.
»Suzanne. Brooke. Darf ich mich setzen?«
»Natürlich.« Sie klopfte neben sich auf die Decke, und ich machte ihm Platz.
»Danke.« Er ließ sich auf die Knie sinken und schien unschlüssig zu sein, wie es jetzt weitergehen sollte.
Suzanne wuschelte ihm durch die Haare. »Wie geht es dir heute? Immer noch Heimweh?«
Benjamin rollte mit den Augen. »Ganz sicher nicht.« Er ließ seinen Nacken kreisen, und ich fragte mich wie jedes Mal, ob dieses Knacken nicht schmerzhaft war. »Ich bin froh, meinen Stiefvater eine Weile nicht sehen zu müssen.«
»Warum?«, fragte ich und streckte mich auf der Decke aus. Weiße Wolken zogen vorbei, da ein leichter Wind ging. Das Wetter war wirklich perfekt. Warm, aber nicht zu heiß.
Benjamin machte es uns nach, und kurz darauf lagen wir zu dritt auf dem Rücken, den Blick in den Himmel gerichtet. »Er kommt nicht mit mir klar, weil ich nicht der typische Sportler bin. Wenn ich öfter auf dem Football-Feld zusammengeschlagen werden würde, renkt sich das mit meinen Ticks ein, vermutet er.«
Suzanne schnalzte mit der Zunge. »Hat er wirklich zusammengeschlagen gesagt?«
Der Junge zog die Achseln hoch. »Rempeln war das Wort, das er benutzt hat. Ist es nicht das Gleiche? Und dann wollte er mir eine Prostituierte aufs Zimmer schicken, als Mum nicht zu Hause war. Als ob das helfen würde.«
Ich verstand langsam, warum Benjamin erleichtert gewirkt hatte, nachdem seine Mutter verschwunden war.
»Du Armer.« Ich tätschelte sein Bein. »Das wird sicher alles werden, mach dir keinen Kopf.«
»Leichter gesagt als getan«, brummte er. Doch ich merkte, dass er sich entspannte.
Nach einer Weile brach er die Stille. »Ich habe eine Frage.«
»Immer raus damit«, ermunterte Suzanne ihn.
»Wie ist das mit Beziehungen zwischen den Patienten?«
Sofort richtete Suzanne den Oberkörper auf und sah zu Benjamin hinunter. »Wer? Raus mit der Sprache.«
»Ich finde Andrea süß.«
»Sorry, Bennie, aber lass die Finger von ihr. Sie ist noch nicht dafür bereit.«
»Wo ist sie überhaupt? Ich habe sie schon ein paar Tage nicht mehr gesehen.«
Ich biss mir auf die Unterlippe, während Suzanne hilflos zu mir sah.
»Das Leben hier wird uns leicht gemacht«, erklärte ich und drückte seinen Unterarm. »Manchmal vergessen wir deswegen, dass manche von uns richtige Probleme haben. Andrea steht momentan unter Beobachtung. Sie hat versucht, …« Ich brach ab, da es mir die Kehle zuschnürte.
Bens bleiches Gesicht versicherte mir, dass er mich trotzdem verstanden hatte. »Warum?«, hauchte er.
Suzanne strich mit den Fingern über seine Wange. »Sie ist in Rose Point, weil sie missbraucht wurde. Von ihrem Vater. Jahrelang – und ihre Mutter hat ihr nicht geglaubt, als sie um Hilfe gebeten hat. Erst als sie eine Fehlgeburt hatte, obwohl sie auf ein reines Mädcheninternat ging, konnte die Mutter die Augen nicht länger verschließen und hat Andrea hierher abgeschoben. Dem Mädchen geht’s wirklich nicht gut. Solche Dinge sollte niemand durchmachen müssen, schon gar nicht mit sechzehn.«
Ben vergrub das Gesicht in den Händen »Großer Gott. Und ich jammere herum.«
»So kannst du das nicht sehen«, erwiderte ich. »Wir haben alle unsere Probleme. Deine sind nicht leichter zu ertragen, nur weil jemand anders mehr gelitten hat. Wenn du so denkst, machst du es dir nur schwerer. Andrea kann dir leidtun, du kannst versuchen, sie zu trösten, aber das lässt deine eigenen Probleme nicht verschwinden. Du musst dich damit auseinandersetzen.«
Benjamin dachte lange nach. »Kann ich Andrea irgendwie helfen?«
»Du kannst versuchen, ihr ein Freund zu sein.«
Suzanne nickte. »Nur darfst du sie nicht anfassen. Sie hasst es, wenn Männer sie anfassen.«
Benjamin verzog das Gesicht, da er offensichtlich der Meinung war, kein richtiger Mann und somit keine Bedrohung für Andrea zu sein. Er sah vermutlich nicht, was wir sahen, wenn er in den Spiegel blickte. Ben war groß und hatte breite Schultern, wenn er etwas mehr gegessen hätte, wäre er eine beeindruckende Erscheinung gewesen – außerdem war er erst siebzehn und hatte noch eine Menge Zeit, sich zu entwickeln.
»Schätze, das bekomme ich hin.«
»Bedräng sie nur nicht. Sie ist …«, fing Suzanne an.
»Beschädigt. Wie wir alle«, ergänzte ich.
»Was ist mit dir, Brooke? Du wirkst so normal.«