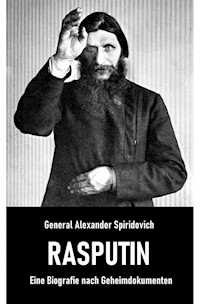
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rasputin - eine der bekanntesten und mysteriösesten Persönlichkeiten der russischen Geschichte, wenn nicht gar der Weltgeschichte. Grigori Jefimowitsch Rasputin (1869-1916) war Wanderprediger und selbsternannter Geistheiler, vermeintlicher Sexguru und Mordopfer. Rasputin pflegte eine enge Freundschaft mit dem letzten russischen Monarchen, Zar Nikolaus II., und hatte in den letzten Jahren des russischen Kaiserreichs großen politischen Einfluss. General Alexander Spiridovich (1873-1952) war der Chef der Leibwache von Zar Nikolaus II. und erzählt in der vorliegenden, erstmals 1936 publizierten Biografie über das turbulente Leben Rasputins. Ausgehend von persönlichen Erlebnissen und Geheimdokumenten berichtet Spiridovich aus erster Hand und spannend wie in einem Krimi, was es mit den Mythen und Legenden um Rasputin auf sich hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
General Alexander Spiridovich
Rasputin
Eine Biografie nach Geheimdokumenten
Vorwort
Rasputin - eine der bekanntesten und mysteriösesten Persönlichkeiten der russischen Geschichte, wenn nicht gar der Weltgeschichte. Grigori Jefimowitsch Rasputin (1869-1916) war Wanderprediger und selbsternannter Geistheiler, vermeintlicher Sexguru und Mordopfer. Rasputin pflegte eine enge Freundschaft mit dem letzten russischen Monarchen, Zar Nikolaus II., und hatte in den letzten Jahren des russischen Kaiserreichs großen politischen Einfluss. General Alexander Spiridovich (1873-1952) war der Chef der Leibwache von Zar Nikolaus II. und erzählt in der vorliegenden, erstmals 1936 publizierten Biografie über das turbulente Leben Rasputins. Ausgehend von persönlichen Erlebnissen und Geheimdokumenten berichtet Spiridovich aus erster Hand und spannend wie in einem Krimi, was es mit den Mythen und Legenden um Rasputin auf sich hat.
1. Eine mysteriöse Vision
Verfolgt man die Geschichte der letzten zehn Regierungsjahre des Zaren Nikolaus II., so stösst man auf Schritt und Tritt auf die seltsame Figur des »Staretz« Rasputin, der mit den Geschehnissen dieser Epoche eng verknüpft ist.
Der Bauer Grigori Jefimowitsch Rasputin wurde im Jahre 1863 im Dorfe Pokrowskoje im Distrikt Tiumen des sibirischen Gouvernements Tobolsk geboren.
Das Dorf Pokrowskoje liegt an den klaren, durchsichtigen Wassern der Tura, auf ihrem hohen linken Ufer, dort wo die Tura mit der Tobol zusammenfliesst. Die Tura beschreibt gerade hier einen grossen Bogen, so dass der Reisende vom Dampfer aus lange noch die Häuser des Dorfes und vor allem die weisse Kirche mit ihrer vergoldeten Kuppel sieht. Lange Zeit heften sich seine Blicke noch auf das Kreuz, das in der untergehenden Sonne funkelt, lange noch begleiten ihn die Türme von Pokrowskoje mit ihrem wiegenden Glockenspiel, das sich allmählich in den unermesslichen Ebenen und Wäldern Sibiriens verliert.
In diesem Dorf lebten die Eltern des Grigori: sein Vater, der Bauer Jefim Andrejewitsch Rasputin, und seine Mutter Anna Jegorowna. Sein Vater bebaute das Land und betrieb daneben das Gewerbe eines Fuhrmanns; seine Mutter besorgte den Haushalt. Für sibirische Verhältnisse waren es gutsituierte Bauersleute, aber sie waren nicht reich.
Ihr Haus aus dicken Baumstämmen war geräumig, aber ohne Etagen. Es enthielt eine Diele mit zwei Zimmern, von denen jedes mehrere Fenster hatte. Das eine nannte man »Isba«, das andere »Gornitsa«. In der Isba, die zur rechten Hand von der Haustür lag, war ein grosser russischer Ofen aus Ziegelsteinen, breit und stabil, in dem man kochte und das Brot backte. Er reichte bis zur Decke hinauf, abgesehen von einer Stelle, wo man sich ausstrecken und schlafen konnte.
Über der Tür, in der Nähe des Ofens, bildete eine Balkenlage dreiviertel Meter unter der Decke einen geräumigen Hängeboden, auf dem die Familie schlief. In einer Ecke, der »schönen Ecke«, stand ein grosser viereckiger Tisch, über dem an der Wand ein Heiligenbild, ein Ikon, aufgehängt war.
Diese Isba war der eigentliche Mittelpunkt des Familienlebens, hier hielten sie sich gewöhnlich auf, hier assen sie, ruhten sie sich aus und schliefen sie.
Das andere Zimmer, die »Gornitsa«, war für die Gäste bestimmt. Auch dort waren, wie in der Isba, Tisch und Bänke, aber der Hängeboden fehlte; stattdessen stand dort eine Holzbettstelle.
An das Haus stiess ein grosser umzäunter Hofraum. Ein Stall gewährte den Pferden Unterkunft. In diesem Stall war ein mannshoher, aber nicht sehr geräumiger Keller ausgehoben, von dem späterhin noch ausführlich die Rede sein wird. Im Hintergrund des Hofraums stand – ein für jede bäuerliche Häuslichkeit unentbehrliches Nebengebäude – ein kleines Bauwerk für die russischen Bäder.
Die Pferde sowie Wagen und Schlitten, die in einem Schuppen untergebracht waren, bildeten den Hauptreichtum des Vaters, der Reisende und Waren in die Dörfer und Städte der Nachbarschaft beförderte.
Zweihundertfünfzig Werst nördlich von Pokrowskoje, am Zusammenfluss des Tobolflusses mit dem Irtysch, lag die Hauptstadt des Gouvernements, Tobolsk, mit ihrem Kloster Abalak. Achtzig Werst südlich, an der Tura, lag Tiumen, die Kreishauptstadt, durch die in späteren Jahren die West-Ost-Eisenbahn führte. Petersburg lag zweitausend und zweihundertsechsundzwanzig Werst von Tiumen entfernt. Die grosse Poststrasse, der »Trakt«, die Tiumen und Tobolsk verband, führte durch Pokrowskoje. Und auf dieser Strasse spielte sich in der Hauptsache die Fuhrmannstätigkeit des Vaters Rasputins ab. Dank dem »Trakt« war Pokrowskoje selbst im Winter ein lebhafter Ort, in dem immer Betrieb war; es gab da eine Posthalterei, einen Kaufladen und eine Gastwirtschaft.
Bevor Nikolaus II. das Alkoholmonopol einführte, verkaufte man in der Gastwirtschaft Wodka. Man verabreichte ihn bald gegen Barzahlung, bald auf Pump, aber auch gegen Austausch mit allerlei Dingen. Der Inhaber war für die Bauern nicht nur Kaufmann, sondern auch Gläubiger und Wucherer. In dieser weit zurückliegenden Zeit war die Gastwirtschaft das grosse Zentrum des bäuerlichen Lebens, aber auch gleichzeitig seine Landplage. Dort ertränkte man seinen Kummer, dort begoss man die frohen Ereignisse. Aber man vertrank dort nicht nur sein Geld, sondern auch seine Kühe, seine Pferde und sogar seine Kleider. Alles hing von der Geschicklichkeit des Gastwirts ab.
Vierhundert Werst westlich von Pokrowskoje lag Irbit, die Distriktshauptstadt des Gouvernements Perm, die durch ihren Markt berühmt war und wohin den Vater des Rasputin oft sein Beruf führte. Noch weiter, am Turafluss aufwärts, lag die Stadt Werchoturje mit ihrem nicht weniger berühmten Kloster, das in ganz Sibirien bekannt war und wo die Gebeine des Heiligen Simeon des Gerechten ruhten. Im Sommer konnte man von Werchoturje aus die Tura mit dem Dampfer bis Pokrowskoje und weiter bis Tobolsk hinunterfahren.
Alle Jahre kam eine Menge von Wallfahrern durch Pokrowskoje, die auf dem Wege nach dem Kloster Abalak oder nach dem Kloster Werchoturje waren. Manchmal liessen sich einige dorthin weiterfahren, und Rasputin blieb dann lange Zeit von Hause fort. Häufig kam es vor, dass die Familie in ihrem Hause solche durchziehende Pilger aufnahm, die dann von ihren Reisen nach den heiligen Stätten erzählten. Oft auch beherbergte sie »Stranniki«, umherziehende Wanderer, die das Land von einem Ende bis zum anderen durchstreiften.
Diese Gewohnheit, auf Wanderschaft zu gehen, ist eine besondere Eigenart im Leben Russlands, die eben nur in einem so ergiebigen Lande und bei einem Volke von so freigebiger Natur entstehen konnte. Im allgemeinen wie Mönche gekleidet, den Bettelsack auf dem Rücken und den Pilgerstab in der Hand, so wanderten Tausende und Abertausende von Menschen durch die Unermesslichkeit des heiligen Russland. Im Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, ohne Sorge um den nächsten Tag, gingen sie von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt, besuchten Klöster und heilige Stätten. Gutherzige Seelen spendeten ihnen Almosen, nahmen sie bei sich auf, liessen sie ausruhen und beherbergten sie für die Nacht. In den Klöstern und in den »Podworija«, den Häusern, die die Klöster in den grossen Städten unterhielten, hatten sie ihren besonderen, sozusagen reservierten Platz.
Nahm man diese Wanderer bei sich auf, so erzählten sie, was sie auf ihren Wanderungen und bei ihren Pilgerfahrten zu den heiligen Stätten gesehen und gehört hatten. Sie schilderten die fernen Länder, die Menschen und ihre Bräuche. Die Bauern horchten auf diese Geschichten und glaubten sie. Man speiste die Wanderer und gab ihnen, was man konnte. Und zogen sie weiter, so gaben die Bauern ihnen oft sogar noch etwas von dem schwerverdienten Gelde mit auf den Weg, damit sie an dieser oder jener heiligen Stätte für sie beteten oder vor diesem oder jenem Heiligenbild eine Kerze aufstellten oder ein geweihtes Brot in Auftrag gaben.
Es gab unter diesen Wanderern auf russischer Erde viele brave Leute, die von aufrichtigem Glauben beseelt waren, aber es gab auch eine Menge Scharlatane: unter dem Kleid des Mönchs oder des Pilgers verbargen sich richtige Vagabunden, Faulpelze und Parasiten, die die religiösen Empfindungen der Bevölkerung ausnutzten.
Wenn »Wanderer« zu den Rasputins kamen, bereitete man ihnen einen freundlichen Empfang, man lud sie ein, sich zu stärken, und sass man unter dem Heiligenbild um den grossen Tisch herum, stellte man ihnen Fragen und lauschte auf ihre Erzählungen.
Auf dem Hängeboden, neben seinem Bruder platt auf dem Bauch liegend, die Ellbogen auf dem Boden, den zerzausten Kopf auf die Hände gestützt, trank der kleine »Grischa« die Worte der Wanderer in sich hinein. Ihre wunderbaren Erzählungen erfüllten ihn mit Staunen. Er riss die Augen weit auf, und keines ihrer Worte entging ihm, wenn sie die Lawra in Kiew, die Grotten der Heiligen und vor allem den Berg Athos schilderten, wo ewiger Sommer herrscht, die Orangen wachsen und der Winter unbekannt ist, wo das Wasser nicht friert und niemals Schnee fällt … Ohne zu wollen, glitten seine Blicke dann hinüber zum Fenster der Isba: bis zur halben Höhe hinauf war es vom Schnee zugemauert, Windstösse rüttelten daran, und draussen knirschten die Fensterläden, während der Wintersturm im Kamin heulte …
Zeitweise machte Grischa einen etwas sonderbaren Eindruck, besonders seit jener Zeit, da er beinahe ertrunken wäre, als er in die Tura sprang, um seinem Bruder zu Hilfe zu kommen. Die beiden Kinder wurden von einem Bauern aus dem Wasser gezogen, hatten sich aber eine Erkältung geholt. Michael war gestorben; Grigori hatte sich erholt. Von diesem Augenblick an behandelten seine Eltern ihn mit grösserer Nachsicht. Wenn man dem glaubt, was seine Tochter später über ihn in ihrem Buch geschrieben hat, soll Grigori von dieser Krankheit an mit dem zweiten Gesicht ausgestattet gewesen sein. Als er zwölf Jahre alt war, wurden eines Tages im Dorf Pferde gestohlen: Grigori konnte den Dieb beschreiben und auch den Ort angeben, wohin man die Pferde gebracht hatte. Man stellte Nachforschungen im Sinne seiner Angaben an – und tatsächlich: man fand die gestohlenen Pferde wieder.
Der Junge lernte weder lesen noch schreiben. Mit fünfzehn Jahren rückte er heimlich von Hause aus und machte sich auf den Weg nach dem Kloster Werchoturje. Man griff ihn unterwegs wieder auf. Ungefähr zwei Jahre später war er ein richtiger Faulpelz geworden, der seine Zeit damit zubrachte, hinter den Mädchen herzulaufen, zu trinken oder in der Gastwirtschaft zu den Klängen eines Akkordeons mit anderen Bauernjungen seines Alters zu tanzen. Besonders die »Komarinskaja«, einen russischen Bauerntanz, tanzte er brillant, wie ein richtiger Künstler und mit solchem Temperament, dass man beim Zusehen Lust bekam, mitzumachen.
Er war besonders befreundet mit Dimitri Petscherkin, einem klugen, heiteren Bauernjungen, der aber ebenfalls etwas bizarr war und auch von religiösen Problemen gefesselt wurde. Die beiden Freunde sassen oft zusammen und führten lange Gespräche. Die Erzählungen der Pilger und der Wanderer riefen in ihnen den Wunsch wach, auf und davon zu gehen und durch die Welt zu wandern, die geheiligten Stätten zu besuchen.
Mit neunzehn Jahren traf Grigori bei einem Fest des Klosters Abalak ein junges Mädchen aus dem Nachbardorf: Praskowia Dubrowina. Sie war hochaufgeschossen, schlank, schön, hatte dunkelblaue Augen und blonde Haare. Sie gefiel Grigori, und auch er liess sie nicht kalt. Ein Jahr lang trafen sie sich häufig bei Festlichkeiten und bei gemeinschaftlichen Abendunterhaltungen im Dorf. Sie verliebten sich leidenschaftlich. Sie sagten es ihren Eltern, und bald darauf verheiratete man sie. Das junge Paar zog in das Haus der Eltern des Rasputin.
»Wer sich verheiratet, ändert sich«, sagt ein russisches Sprichwort. Und tatsächlich schien Grigori ernster zu werden. Er half jetzt gern seinem Vater, zeigte sich frommer und sorgte sich um das Heil seiner Seele.
Zu jener Zeit musste er einen Mönch nach dem Kloster Abalak fahren. Unterwegs sprachen sie sich in aller Ausführlichkeit über Religion aus, und diese Unterhaltung machte auf Grigori einen solchen Eindruck, dass er sich jetzt noch mehr als vorher für die Glaubensprobleme interessierte. Viel später einmal hat der Pater Iliodor die Behauptung aufgestellt, dass das zufällige Zusammentreffen Rasputins mit Meleti, dem Bischof von Barnaul, das auch um diese Zeit stattfand, einen sehr günstigen Einfluss auf Grigori ausübte: der Bischof lenkte ihn hiernach auf den Weg der Busse und befahl ihm, auf Wanderschaft zu gehen und ein »Staretz« zu werden.
Neun Monate nach der Hochzeit schenkte Praskowia einem Sohn das Leben, aber das Kind starb schon nach sechs Monaten. Die Eltern waren vom Kummer wie niedergeschmettert, besonders Grigori. Er fing an zu beten und entschloss sich, zum Kloster Werchoturje zu pilgern, um sich dort vor den Gebeinen des Heiligen Simeon des Gerechten zu Boden zu werfen und sich gleichzeitig Rat beim Staretz Makari zu holen, der nicht weit vom Kloster als Eremit lebte.
Praskowia packte sein Reisebündel und legte das Evangelium, Wäsche, trockene Biskuits und etwas Tee und Zucker hinein. Als alles fertig war, betete Grigori vor dem Heiligenbild, verabschiedete sich von Frau und Eltern und machte sich auf den Weg, den Bettelsack auf dem Rücken und den Pilgerstab in der Hand.
Unterwegs traf er andere Pilger, die dasselbe Ziel hatten. Auf dem Marsch und beim Ausruhen sprachen sie nur vom Heil der Seele, von den heiligen Stätten und vom Staretz Makari. Nach zwei langen Wochen waren sie in Werchoturje.
Das Kloster erhob sich, mit einer steinernen Mauer mit Türmen umgeben, ganz weiss auf dem hohen, steilen Ufer der Tura. Daneben lag der grosse Marktplatz von Werchoturje. In der Kathedrale ruhten die Überreste des Heiligen Simeon des Gerechten, des »Bojarensohnes«, der der Welt Lebewohl sagte und alles im Stich liess, um die ewige Seligkeit zu erlangen. Nach der im Volke verbreiteten Legende sollen diese Reliquien von Goldsuchern entdeckt worden sein, die im Ural ihr Glück zu machen versuchten. Als Grigori seine Pilgerfahrt machte, lagen sie noch in einem ganz armselig aussehenden Reliquienkasten; erst sehr viel später stiftete Nikolaus II. dafür einen silbernen, reichverzierten Sargschrein.
Nachdem Grigori und die anderen Pilger sich vor den Gebeinen des Heiligen auf die Erde geworfen hatten, begaben sie sich zum Staretz Makari.
Und was ist nun eigentlich ein »Staretz«? Die griechisch-katholische Kirche kennt diese Startsy seit sehr langer Zeit, länger als tausend Jahre. Es sind Führer, Ratgeber, Lehrer, die auf Grund ihrer Lebensweisheiten, ihres Alters und ihrer Glaubenserleuchtungen lehren, wie man zu leben hat. Der Staretz lehrt die »göttliche Wahrheit«. Oft liest er in den Seelen und blickt in die Zukunft.
Dostojewski, der mit Geist und Herz das wahre Wesen dieser Startsy erfasste, hat in seinem Roman »Die Brüder Karamasow« ausführlich darüber gesprochen. »Ein Staretz«, sagt er, »ist ein Mensch, der mit seiner Seele und mit seinem Willen von eurer Seele und von eurem Willen Besitz ergreift. Wenn ihr euch einen Staretz erwählt, so verzichtet ihr auf einen eigenen Willen und legt ihn in seine Hände, um blindlings und voller Selbstverleugnung nur noch seinen Befehlen zu folgen …«
Für das Volk ist ein Staretz ein Mann Gottes: alles, was er sagt, ist der Ausdruck der göttlichen Wahrheit; alles, was er befiehlt, muss ausgeführt werden. Und in Massen kamen die Pilger, um die Startsy in den Klöstern um Rat zu fragen, sie offenbarten ihnen ihre Mühsal, ihre Fehler und ihre Krankheiten und flehten sie an, ihnen zu helfen.
Von diesem Glauben und Vertrauen waren auch Grigori und seine Weggenossen durchdrungen, als sie sich zum Staretz Makari begaben. Der Gottbegnadete lebte in einer kleinen Hütte mitten in einem dichten Walde, ungefähr zehn Werst von Werchoturje, und trug Ketten, um sein Fleisch abzutöten. Er war ungefähr fünfzig Jahre alt. Seine Ausdrucksweise war wenig klar, seine Worte aber von auffallender Aufrichtigkeit und Treuherzigkeit. Seine Herzensreinheit schien seine Hörer mit seinen Worten zu durchdringen, und was ihre Ohren nicht verstanden, begriffen sie mit dem Herzen.
Eine Menge Hühner und Küken tummelte sich rings um die Hütte des Staretz. Er sprach mit ihnen, und es war merkwürdig anzusehen, wie jedes einzelne Federvieh ihn verstand, ihm folgte und gehorchte.
Grigori Rasputin vertraute dem Staretz seinen grossen Kummer an. Wir wissen nicht, was der Staretz antwortete. Aber Rasputins Tochter Matrona sagt aus, dass ihr Vater, wie er ihr erzählt habe, den Segen des Staretz erhielt und mit Frieden im Herzen zu seiner Frau zurückkehrte.
Das Leben nahm wieder seinen üblichen Verlauf. Eines Tages im Sommer kam Grigori in grosser Erregung vom Felde nach Haus. Er erzählte seiner Familie, dass er eine Vision gehabt habe. Die heilige Jungfrau sei ihm, über dem Boden schwebend, in ihrer ganzen Glorie erschienen, habe ihn gesegnet und sei dann wieder verschwunden. Das Ganze habe nicht länger als eine Minute gedauert. Die Familie war von dieser Erzählung erschüttert. Man suchte Dimitri Petscherkin auf und berichtete ihm, was Grigori geschehen war. Die beiden Freunde kamen überein, dass man nach Werchoturje gehen und mit dem Staretz Makari über die Erscheinung sprechen müsse. Sie machten sich zusammen auf den Weg. Grigori erzählte dem Staretz seine Vision. Nach Matronas Behauptung soll dieser zu Grigori gesagt haben: »Der Herr hat dich auserwählt für eine grosse Aufgabe. Um deine Seele zu stärken, geh zum Berge Athos und bete zur Mutter Gottes!«
Nach seiner Rückkehr aus »Werchoturje teilte Grigori seiner Familie mit, dass er sich entschlossen habe, die Pilgerschaft zum Berge Athos anzutreten. Seine Frau und seine Mutter brachen in Tränen aus, aber niemand versuchte, ihn von seinem Entschluss abzubringen.
Grigori und Dimitri bereiteten sich auf ihre Abreise vor. Im Dorf machte die Sache grosses Aufsehen. Bald machten sich die beiden Freunde auf den Weg zu ihrer grossen Pilgerfahrt. Die Familie Grigoris begleitete sie, in Tränen aufgelöst, bis zum Ausgang des Dorfes, die Bauern und Bäuerinnen kamen aus ihren Isbas heraus und wünschten ihnen eine glückliche Wanderschaft. Allerdings bemerkte man auf einigen Gesichtern ein ungläubiges Lächeln, denn es fiel manchem schwer, an die Aufrichtigkeit der religiösen Gefühle Grigoris zu glauben.
Hat Rasputin wirklich diese Erscheinung der heiligen Jungfrau gehabt? Die Geschichte ist uns mit lebendigen Worten von seiner Tochter Matrona erzählt worden, und auch Rasputin selbst hat darüber zu vielen seiner weiblichen Bewunderer gesprochen. Er hat die Vision sogar dem Zaren beschrieben. Man hat seinen Worten Glauben geschenkt. Der Zar hat sich darüber mit anderen unterhalten.
Wir dagegen bezweifeln, dass die Geschichte wahr ist. Und wenn die Erscheinung wirklich stattgefunden hätte, so hätten fromme Leute oder Rasputin selbst an dem betreffenden Ort sicher bald ein Kreuz aufgestellt. Und ferner: wenn ein solcher Ort existierte, weshalb sollte dann Rasputin später ihn nicht voller Stolz seinen Freunden und Anhängerinnen, die von St. Petersburg herüberkamen, gezeigt haben? Und das hat er niemals getan. Rasputin hat sich immer darauf beschränkt, von der Vision als solcher zu erzählen, und obendrein hat er immer nur dann davon gesprochen, wenn er Tausende von Werst von Pokrowskoje entfernt war.
Aus all diesen Gründen glauben wir nicht, dass Rasputin wirklich eine »Vision« gehabt hat, selbst wenn wir seine schwachen Nerven mit in Betracht ziehen, und wenn wir auch unterstellen wollen, dass er sich damals in einem Zustand äusserster religiöser Exaltiertheit befunden haben mag. Und wenn wir sie erwähnt haben, so geschah es nur deshalb, weil manche Autoren sie als feststehende Tatsache hinstellen und weil Rasputin selbst oft davon gesprochen hat.
2. Der Staretz – Erste Triumphe
Drei Jahre lang, von 1893 bis 1896, blieb Rasputin auf Wanderschaft. Er durchquerte im heiligen Russland Tausende und Abertausende von Werst, und nachdem er viele Länder und Menschen gesehen, nachdem er grosse Schwierigkeiten überwunden hatte, kam er schliesslich mit Petscherkin auf dem Berge Athos an.
Aber dieses ferne Kloster, das jedem wahren Orthodoxen ans Herz gewachsen ist, gefiel ihm ganz und gar nicht. Die Ordensregeln waren dort streng und hart. Gleich nach ihrer Ankunft mussten die beiden Freunde sich an die Arbeit begeben. Das war nicht nach Rasputins Geschmack. Er war von Natur aus faul. Ausserdem waren die Frauen aus den russischen Klöstern verbannt. Auf der ganzen Halbinsel von hundert Kilometer Länge und zwanzig Kilometer Breite, auf der sich die Klöster des Berges Athos erhoben, nicht eine einzige Frau! Rasputin litt mit seinem leidenschaftlichen und stürmischen Temperament unter dieser erzwungenen Enthaltsamkeit. Eines Tages ging er mit Petscherkin durch den Wald, der das Kloster umsäumte, und überraschte dort in einem Graben einen Mönch mit einem jungen, hübschen Novizen. Das war für den sibirischen Bauern, der in seinem Gefühlsleben sehr naturnahe geblieben war, ein ganz neuartiges Laster. Er spuckte voll Verachtung aus und erging sich in Schmähungen gegen das Leben, das man im Kloster führte. Kurze Zeit darauf verliess er den Berg Athos, um nach Russland zurückzukehren. Petscherkin dagegen blieb dort, wurde Mönch und starb auf dem Berge Athos.
Von dem Augenblick an, in dem Rasputin jetzt allein seinen Rückweg wieder antrat, kennt man sein Leben – oder vielmehr Fragmente seines Lebens – nur aus seinen eigenen Erzählungen. Und doch ist diese Periode seines Daseins von wesentlicher Bedeutung, denn gerade im Laufe dieser Jahre wird er zu jener tragischen Persönlichkeit – Staretz für die einen, heiliger Teufel für die anderen, Flagellant und Scharlatan für die dritten –, die eines schönen Tages in St. Petersburg auftauchte und vor der sich so viele schlichte Menschen und so viele Mächtige dieser Welt in tiefer Verehrung beugten.
Rasputin suchte die Lösung der Fragen, die ihn quälten, im Besuch der heiligen Stätten, in Unterhaltungen mit der offiziellen Geistlichkeit und mit Mönchen, in Gesprächen mit Wanderern und Pilgern. Wo lag der Weg zum Heil? Wie konnte man seine Seele retten? Das Kloster hatte ihn nicht befriedigt, denn Fleisch und Geist lagen in Rasputin in ununterbrochenem Kampf. Er diskutierte in gleicher Weise mit Vertretern religiöser Sekten, mit »Alt-Gläubigen«. Jeder von diesen Menschen suchte auf seine Weise den Weg des Heils. Alle glaubten, ihn entdeckt zu haben, und alle glaubten, den wahren Gott gefunden zu haben. Und ebenso traf er mit »Chlysty« zusammen, den Anhängern eines exaltierten, mysteriösen Flagellantismus, und es schien ihm, dass es in ihrer Lehre sehr viele merkwürdige und höchst interessante Punkte gäbe.
Allmählich gewöhnte er sich so sehr daran, in dieser Atmosphäre des Suchens nach der göttlichen Wahrheit zu leben, nach und nach wurde er so versiert in den religiösen Fragen, dass er mit grösserer Sicherheit zu sprechen und zu diskutieren lernte und auch anfing, andere zu belehren.
Mit seiner mittelgrossen, nervigen, knochigen Figur, seinem mageren, gelblich-blassen Gesicht, dem wildbuschigen Bart machte er einen ungeheuer starken Eindruck, um so mehr da er seinen Gesprächspartner mit seinen blitzenden Augen prüfend zu mustern, ja geradezu zu durchdringen pflegte. Er hatte eine abgehackte Sprechweise und redete in Rätseln. Er zitierte häufig die Evangelien und die Kirchenväter. Und während er sprach, hörte er nicht auf, an seinem Bart herumzuarbeiten, aufgeregte Gesten zu machen und dem anderen prüfende, misstrauische Blicke zuzuwerfen. Man hätte meinen können, dass er dem anderen bis auf den Grund der Seele sah, um festzustellen, was da unten vorging und was für eine Art Mensch er vor sich hatte.
Es war etwas Merkwürdiges an diesem Rasputin: man merkte ihm an, dass ihn eine auffallende innere Kraft bewegte. Später hat man von einer Art Hypnose gesprochen. Wenn er die Augen auf seinen Partner gerichtet hielt, schien er auf seinem Gesicht lesen zu können; er sprach ihm von seiner Vergangenheit und sagte ihm Kommendes voraus, so dass man hätte glauben können, dass er die Gabe hätte, in die Zukunft zu blicken. Besonders die Frauen betrachteten ihn als Propheten und Heiligen.
Gut und Böse, Gott und Teufel lieferten sich in Rasputins Inneren erbitterte Kämpfe. Nach seiner Auffassung war das Kloster nicht der Weg zum Heil. Dazu war die fleischliche Glut viel zu stark in ihm. Trotz des religiösen Geistes sah sich Rasputin doch zur Sünde hingerissen. Er sündigte gerade mit den Frauen, mit denen er betete und mit denen er sich über das Seelenheil unterhielt. Rasputin kämpfte mit sich. Er wollte seine Seele stark machen. Manchmal gelang es ihm; meistens aber besiegte ihn sein Begehren, sein Temperament und die Willfährigkeit der Frauen.
Man musste eine Möglichkeit finden, Gut und Böse auszusöhnen! Er fand sie bei den Anhängern gewisser Sekten, mit denen er während seiner Wanderschaften sich zu unterhalten Gelegenheit hatte. Obgleich er im Grunde orthodox blieb, entlehnte er von diesen Sekten gewisse Punkte ihrer Lehre, die mit seiner Natur in Einklang standen. Er liebte es, sich irgend jemandem, irgend etwas zu unterwerfen, sogar der Autorität der Kirche. Und daher entlehnte er vieles nicht nur von den Sekten, sondern auch von der Kirche, aber überall nur das, was für ihn vorteilhaft war und was ihm passte. Unter anderem schöpfte er so reichhaltig aus der Lehre der »Chlysty«, der Flagellanten, dass es bei seiner Rückkehr nach Pokrowskoje nicht verborgen blieb.
Diese mystische Sekte der »Chlysty« oder »Gottesmänner«, wie sie sich selbst nannten, stammte aus dem ersten Drittel des XVII. Jahrhunderts. Sie wurde von einem abtrünnigen Bauern des Gouvernements Kostroma, Danila Philippow, ins Leben gerufen.
Die Lehre der Chlysty sagt darüber:
»Eines Tages stieg Danila auf das Gebirge Gorodino, und dort stieg mitten unter den Engeln, Erzengeln, Seraphinen und anderen himmlischen Heerscharen der Herr Zebaoth selbst vom Himmel hernieder. Die himmlischen Heerscharen stiegen wieder zum Himmel empor, doch der Herr Zebaoth inkarnierte sich in Danila Philippow und blieb in der Gestalt eines Menschen auf Erden.«
Danila Philippow wurde zum »lebendigen Gott« und seine Anhänger zu »Gottesmännern«. Er gab zwölf Gebote heraus. Im ersten proklamierte er sich als Gott und verlangte, dass man ihn anbetete. In den anderen verbot er: alkoholische Getränke zu trinken, sich zu verheiraten, Obszönitäten zu sagen, bei Hochzeiten und Taufen zugegen zu sein, zu stehlen. Die Anhänger mussten die Gebote geheimhalten und in gutem Einvernehmen miteinander leben. Im zwölften Gebot sagte er: »Glaubt an den Heiligen Geist!«
Die Predigten des Danila Philippow hatten grossen Erfolg. Trotz aller Verfolgungen machte die Sekte im Laufe der Zeit rasche Fortschritte.
Nach ihrer Lehre kann sich der Heilige Geist gleichzeitig in zahlreichen Anhängern ihrer Sekte niederlassen, ebenso kann Christus sich in mehreren Anhängern inkarnieren. Der Christus aller Christen ist kein Gott; er ist nur ein Lehrer und Gesetzgeber für seine Anhänger. Das Fundament ihres Glaubens und ihrer Morallehre ruht in den Lehren ihrer »Christusse«. Sie erkennen die Riten der orthodoxen Kirche nicht an, aber sie tun so, als ob sie sie beobachteten, um sich keinen Verfolgungen auszusetzen.
Ihre Morallehre beruht auf dem Dualismus von Geist und Körper: der Geist ist das Prinzip des Guten, der Körper ist das Prinzip des Bösen. Man muss die Bedürfnisse des Körpers ersticken. Mit seiner legitimen Frau Beziehungen zu unterhalten, ist verboten. Doch mit der Frau im Geiste, den der »Christus« verleiht, sind fleischliche Beziehungen erlaubt, denn dann handelt es sich um eine Manifestation der Liebe als Geist.
In den Dörfern versammelten sich die Chlysty gewöhnlich in Kellern oder in Scheunen im Hintergrunde der Höfe. Der Gottesdienst begann mit Hymnen, die bald melancholischen Charakter hatten, bald voller Jubel waren, je nach den Umständen und dem Charakter des Gottesdienstes. Dann folgte die »Radenje«, die Inbrunst, die bis zur Ekstase getrieben wurde. Die erotische Erregung spielte bei den Inbrunsten der Chlysty eine besondere, sogar eine überragende Rolle.
Zur Zeit, als Rasputin sich auf Pilgerschaft befand, war die Sekte der Chlysty in mehr als dreissig Gouvernements und Territorien Russlands verbreitet. In den einzelnen Gegenden nahm sie die verschiedensten äusseren Formen an, bediente sich vielfach sogar ganz verschiedener Bezeichnungen.
Drei Jahre lang blieb Rasputins Frau ohne jede Nachricht von ihrem Mann. Sie wusste nicht einmal, ob er überhaupt noch am Leben war. Während dieser Zeit starb seine Mutter. Praskowia war eine schöne junge Frau von blühender Gesundheit und ertrug die Abwesenheit ihres Mannes nicht leicht.
Eines Abends klopfte es an die Tür der Isba. Praskowia fragte, wer da sei. »Ein Händler, der gerne Seide vorlegen möchte!« antwortete man. Sie öffnete die Tür: es war Grigori. Einen Augenblick dauerte es, bis sie ihn erkannte; so sehr hatte er sich verändert. Sein wilder Bart und die langen Haare, die ihm von der Stirn herunterfielen, verdeckten sein Gesicht. Praskowia erkannte ihn aber an den brennenden, lachenden Augen, die sie zu durchbohren schienen. Sein Vater stieg von dem Hängeboden herunter, man umarmte und küsste sich, und es war des Fragens kein Ende.
Am nächsten Tage gab es in der Isba ein ständiges Kommen und Gehen von Nachbarn. Jeder wollte den Heimkehrer sehen und seine Geschichten hören. Grigori hatte anfangs nur seine Abenteuer erzählt, dann aber ging er allmählich dazu über, seine Zuhörer zu belehren, wie er es sich während der Jahre seiner Wanderschaft angewöhnt hatte. Die bäuerlichen Beschäftigungen waren für ihn fortab ohne jedes Interesse. Er, der nie sehr arbeitsam gewesen war, hatte jeglichen Geschmack an der Arbeit verloren.
Aus dem Keller unter dem Pferdestall machte Rasputin ein Betzimmer. Er hing heilige Bilder an die Wände. Eine kleine Oellampe unter einem Ikon tauchte die Zelle in ein weiches Licht, Kerzen verbreiteten ihren flackernden Schein. Hierhin zog er sich zum Beten zurück.
In der Isba, dem Wohnzimmer, fanden endlose Unterhaltungen statt. Diese Diskussionen wurden besonders leidenschaftlich, wenn ein durchziehender Pilger daran teilnahm. Man interpretierte die Evangelien und die Kirchenväter. Heftige Kontroversen tauchten auf. Rasputin hatte dabei eine ganz besondere Art, zu sprechen und sich vom Thema durchdrungen zu zeigen. Man hörte ihm mit Bewunderung zu. Bald hatte er Schüler. Um ihn herum bildete sich eine Art von religiösem Zirkel, deren Mitglieder sich »Brüder« und »Schwestern« nannten. Sie kamen zum Beten und zum Singen frommer Psalmen zusammen, und dabei sang man auch gewisse Lieder der Chlysty.
Im Dorf begann man aber bald zu tuscheln: seltsame Dinge hatten sich bei den Rasputins abgespielt; Rasputin und seine Schüler nahmen gemeinsame Bäder, Männer und Frauen zusammen, und was sich dabei ereignete, war weit davon entfernt, harmlos zu sein; sie organisierten »Inbrunsten«!
Diese Gerüchte kamen auch zu Ohren des Priesters, des Paters Piotr, der sich schliesslich darüber beunruhigte. Schon bald nach Grigoris Rückkehr hatte er sich über die seltsamen Erzählungen, die Rasputin über den Berg Athos in Umlauf setzte, geärgert. Er erkundigte sich ausführlicher bei seinen Pfarrkindern, bekam auch Auskünfte und sandte nun an seinen Vorgesetzten, den Bischof von Tobolsk, eine Anzeige gegen Rasputin, in der er ihn beschuldigte, illegale Zusammenkünfte und Chlysty-Gottesdienste zu organisieren. Insbesondere gäbe es bei Rasputin, so schrieb er, einen Bottich, um den herum Tänze und »Inbrunsten« stattfänden.
Der Bischof von Tobolsk gab Anweisung, eine Untersuchung wegen Sektiererei zu eröffnen. Ein Missionar, der Pater Berioskin, wurde mit der Untersuchung beauftragt. Wenn die Beschuldigung begründet war, musste die Sache an den Untersuchungsrichter weitergeleitet werden. Die kirchlichen Behörden wandten sich an die Polizei, und eines schönen Tages fand eine Haussuchung statt. Rasputin war gerade abwesend. Man durchsuchte mit aller Gründlichkeit die Isba, den Hof, den Pferdestall, aber man fand nichts Verdächtiges, abgesehen von der kleinen Zelle, in der Grigori seine Gebete verrichtete. Vergebens suchten die Beamten, selbst unten im Keller, die inkriminierte Badewanne. Man vernahm die Leute aus dem Hause: es gäbe bei ihnen nur diesen einen Bottich, antworteten sie, der offen auf dem Hofe stehe und mit Wasser gefüllt sei, sonst nichts dergleichen.
Der Brigadier verschwieg der Frau Rasputins nicht, dass man ihren Mann im Verdacht habe, der Sekte der Chlysty anzugehören, und dass eine Anzeige seitens des Paters Piotr gegen ihn vorliege. Praskowia geriet in grosse Wut und erging sich in Schmähungen gegen den Reverend. Die Polizei ging wieder, aber schon kurze Zeit darauf fand eine neue Haussuchung statt. Wieder durchsuchte man den Kellerraum, man schaffte die Kartoffeln zur Seite, schob die Mehlsäcke fort. Als die Beamten wieder zum Vorschein kamen, waren sie vom Kopfe bis zu den Füssen weiss, aber sie hatten nichts Verdächtiges gefunden.
Praskowia sah ihnen voller Wut nach, als sie gingen, und murmelte vor sich hin: »Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich alles mit Russ eingerieben! Dann wäret ihr nicht weiss, sondern schwarz fortgegangen!«
Dieses Mal allerdings verlangte die Polizei, dass die Betstube aufgelöst würde, und als Grigori nach Hause kam, musste er seine Heiligenbilder in die Goritsa, ins Fremdenzimmer, bringen.
Aus Mangel an ausreichenden Beweisen gab man die Sache nicht an den Untersuchungsrichter weiter. Rasputin wurde also nicht weiter behelligt. Das betreffende Aktenstück ist in den Archiven des Konsistoriums von Tobolsk und der Heiligen Synode aufbewahrt worden.
In der Zeit zwischen Rasputins Rückkehr und dem Jahre 1900 schenkte Praskowia ihrem Manne drei Kinder: eine Tochter Matrona im Jahre 1897, dann einen Sohn Dimitri und im Jahre 1900 eine Tochter Warwara. Diese Geburten, die mit der Lehre der Chlysty im Widerspruch stehen, fallen gerade in jene Zeit, als Rasputin gewisse Praktiken dieser Sekte durchführte.
Ob ihn die behördlichen Verfolgungen, denen er ausgesetzt war, in Unruhe versetzten, oder ob er wirklich von religiösem Gefühl getrieben war – jedenfalls machte Rasputin sich bald nach den Haussuchungen wieder auf den Weg, und zwar pilgerte er nach Kiew.
»Kiew, die Mutter der russischen Städte«, sagt das russische Volk. Dort ist eines der berühmtesten und ältesten russischen Klöster: die Lawra mit den Katakomben. Die Keller, in denen die Gebeine der Heiligen ruhen, zogen jedes Jahr Hunderttausende von Pilgern an. Es war also nichts Besonderes, dass auch Rasputin den Wunsch verspürte, dorthin zu pilgern.
Nachdem er die Lawra in Kiew besucht hatte, machte er sich wieder auf den Rückweg und wanderte über Kasan. Kasan, eine grosse, schöne Stadt an der Wolga, ist das viertgrösste russische Zentrum für religiöses Unterrichtswesen. Es gab dort neben Petersburg, Moskau und Kiew eine theologische Fakultät, ausserdem Lehrkurse für Missionare und ein Kloster. Kasan galt als Zentrum für die »Alt-Gläubigen«. Ausserdem lebten dort, wegen der grossen tatarischen Kolonie, viele Anhänger der muselmanischen Religion. Alles das machte diese Stadt in religiöser Hinsicht recht interessant. Rasputin gefiel sie, und er blieb dort. Das war zu Anfang des Jahrhunderts. Und in Kasan erlangte er alsbald einen gewissen Ruf, bevor sein Name sich über die Welt verbreitete.
Hier machte er auch die Bekanntschaft des Reverend Pater Michail vom Grossen Seminar. Das war ein magerer, kleiner Mann, kahlköpfig, das Gesicht bedeckt von einem dichten schwarzen Bart, ein Mönch, der vom Judentum zum Christentum übergetreten war, ein sehr exaltierter Mensch. Er galt für klug und für gelehrt. Ein paar Jahre später wurde er »Alt-Gläubiger«, wurde Bischof und donnerte gegen die orthodoxe Kirche.
Rasputin machte damals auch die Bekanntschaft des Volksvikars Chrisanth und des Bischofs Andrei (Prinz Uchtomski). Der erste wurde ein grosser Bewunderer Rasputins, während Andrei sich schon im Jahre 1903 in sehr abfälliger Weise über ihn ausliess.
Rasputin wurde auch in mehrere Familien in Kasan eingeführt, wo er dann seine ersten weiblichen Bewunderer fand. Hier, in diesen intellektuellen Milieus, betrachtete man Rasputin zum erstenmal als einen Mann Gottes, als einen »Staretz«. Die Damen waren von ihm tatsächlich wie verhext, schreibt zu jener Zeit ein sehr ehrbarer Bürger von Kasan. Es gab Häuser, in denen höchst tugendsame Familienmütter Rasputin erlaubten, ihre Töchter zu küssen, weil sie davon überzeugt waren, dass dies für den heiligen Mann gut sei. Man legte sich mit dem Staretz ins Bett und liess sich von ihm küssen und umarmen, um damit eine von ihm auferlegte Busse zu vollziehen. Man muss dabei daran denken, dass der Beginn des XX. Jahrhunderts eine Zeit war, wo man in gewissen intellektuellen Schichten auf jedem Gebiet auf der Suche nach neuen Wegen war.
Was war es eigentlich, was die Damen von Kasan so hinriss und faszinierte? Ein origineller Gesichtspunkt, eine einfache, kurze und bilderreiche Sprache; ausdrucksvolle Augen, die einen zu durchbohren schienen; ein gut ausgeprägter Typ ohne Disharmonie, und schliesslich die Tatsache, dass der Staretz bis zu einem gewissen Grade die Gabe hatte, diejenigen, die mit ihm zusammenkamen, zu hypnotisieren.
Als der Staretz dann Kasan wieder verlassen hatte, hörten, mit wenigen Ausnahmen, seine weiblichen Bewunderer auf, ihn anzubeten. Sie erröteten fortan über ihre Eingenommenheit und bemühten sich, den Gegenstand ihrer Bewunderung aus ihrer Erinnerung zu verbannen.
Aus diesen intellektuellen Kreisen Kasans, in denen sich all diese Dinge abspielten, drangen die ersten Gerüchte über den Staretz nach St. Petersburg in Kreise, die dem Hof nahestanden. Die Akademie von Kasan war es, die die ersten günstigen Auskünfte über Rasputin gab und ihn sogar, worauf wir später noch zurückkommen werden, der Theologie-Akademie in Petersburg empfahl, wobei sie ihn als einen Mann hinstellte, der ein heiliges Leben führte, als einen Propheten, als einen Staretz.
Wenn sich nun auch Rasputin in den intellektuellen Kreisen Kasans in diskreter Weise betrug und keinen Anstoss erregte, so machte er es aber ganz anders, wenn er mit Frauen aus dem Volke zusammen war. Bei ihnen war er viel freier und weniger vorsichtig bei der Anwendung seines Systems zur Erlangung des Seelenheils. Und daher wurde gleichzeitig gerade von Einwohnern der Stadt Kasan zum erstenmal die Beschuldigung der Unzucht gegen ihn erhoben.
3. Die Petersburger Atmosphäre
Zu Beginn des XX. Jahrhunderts nahmen gewisse Kreise der Petersburger Gesellschaft ein ganz besonders reges Interesse an religiösen Fragen. Die russische »Intelligentsia« kommt auf dem Gebiete des Geisteslebens niemals ganz zur Ruhe. Immer ist sie auf der Suche nach neuen Dingen, und in den genannten Kreisen standen die religiösen Fragen auf der Tagesordnung. Überall sprach man von Religion, von Christentum, von den Beziehungen zwischen Kirche und Gesellschaft. Ein Teil der bedeutendsten Schriftsteller marschierte an der Spitze dieser Bewegung. Zirkel und Gesellschaften bildeten sich, so die »Gesellschaft für Religion und Philosophie«, in der Laien mit Vertretern der Kirche diskutierten. Gewisse Salons der grossen Gesellschaft, in denen man sich früher schon mit religiösen Fragen beschäftigt hatte, erlebten einen neuen Aufschwung. Manche interessierten sich ganz besonders für die Vertreter des »Volksglaubens«, für die Wandersleute, die »heiligen Kinder«.
Ein Mann namens Mitia aus der Stadt Koselsk wurde deshalb damals sehr berühmt. Er war Stotterer, halb taub, halb stumm, sprach nur zusammenhanglose Worte, stiess nur eine Art Gebrüll aus. Doch kam es manchmal vor, dass er auch sprechen konnte. Man lud ihn in den Salons ein und behandelte ihn mit grösster Zärtlichkeit und Rücksicht. Die Schwärmerei ging so weit, dass eine Schülerin des Smolny-Instituts, in dem die jungen Mädchen der hohen Aristokratie erzogen wurden, Mitia in einem Anfall von religiöser Exaltiertheit heiratete. Sogar die Vertreter der hohen Geistlichkeit der Hauptstadt behandelten Mitia voller Achtung. Alle sahen in ihm einen »Gottesmann«, einen unschuldigen Heiligen, einen »Jurodiwy«.
Der Prinz Jewachow, der ehemalige Adjunkt des Hohen Prokurators der Heiligen Synode, sagt darüber in seinen Erinnerungen folgendes:
»Die Mitglieder der Petersburger Gesellschaft, und ihre Prälaten an der Spitze, hatten sogar zu dem Stotterer Mitia Zutrauen, nicht etwa blindlings, sondern im Gegenteil, weil sie ausserordentlich empfindsam gegenüber allen Manifestationen des religiösen Lebens waren. Sie wollten lieber einen Sünder für einen Heiligen halten, als möglicherweise irrtümlich einen Heiligen links liegenlassen und zurückstossen.«
Die theologische Akademie in der Alexander-Newski-Lawra war in der Hauptstadt das eigentliche Zentrum für religiöse Erziehung. Ihr Rektor war der Bischof Sergi, das spätere Oberhaupt der russischen orthodoxen Kirche, damals ein junger Mensch mit sympathischem Gesicht, ein grosser Mystiker und Bewunderer des »Volksglaubens«. Der Inspektor der Akademie, der in unmittelbarem Kontakt mit den Studenten stand, war der Bischof Theophan, der mit aussergewöhnlichen moralischen Qualitäten eine auffallende theologische Gelehrsamkeit verband. Auch er war bis aufs äusserste vom Mystizismus durchdrungen, war ein Asket im vollen Sinne des Wortes.
Diese geistige Haltung der Leiter der Akademie schuf in der Anstalt eine ganz besondere Atmosphäre. Mitia war dort beliebt und wurde empfangen. Ein junger Student, Sergei Trufanow, der später unter dem Namen Iliodor Mönch wurde, hatte Mitia in Kronstadt entdeckt und mit an die Akademie gebracht, wo man diesem aus dem Volke hervorgegangenen »Gottesmann« sofort mit grossem Respekt begegnete.
Es war gegen Ende des Jahres 1902, als der Name Rasputin zum erstenmal an der Akademie ausgesprochen wurde. Von Kasan herüber war das Gerücht gekommen, dass in Sibirien ein Prophet namens Grigori aufgetaucht sei, ein Mann voll göttlicher Klarheit, ein Asket, der Wunder tun könne. Man sprach über ihn in den Kreisen der Studenten, aber auch in den Kreisen der Akademieleiter. Der Bischof Theophan gab dann bekannt, dass ein Prior den Grigori nach Petersburg bringen solle, und die Studenten, darunter auch Iliodor, warteten voller Ungeduld auf diesen aussergewöhnlichen Mann, auf diesen »Staretz«.
Im Frühjahr lief plötzlich eines Tages die Neuigkeit durch die ganze Akademie, dass der »Staretz« eingetroffen sei. Der Prior Chrisanth, der Leiter der religiösen Mission von Korea, hatte ihn nach Petersburg gebracht und gleichzeitig mit ihm noch ein Empfehlungsschreiben des Bischofs Michail aus Kasan. Der Staretz wurde den Bischöfen Sergi und Theophan vorgestellt. Er erhielt Wohnung bei Theophan, unterhielt sich oft mit den Studenten und weissagte verschiedenen von ihnen die Zukunft.
Im Dezember liess ihn der Bischof Theophan im Korridor der Akademie die Bekanntschaft des Iliodor machen, der einen Monat vorher Mönch geworden war. Iliodor war im ersten Augenblick einigermassen erstaunt, als er diesen Bauern mit schmutzigen Händen vor sich sah, der einen alten grauen Rock und hohe Teerstiefel trug und dessen Kleider einen üblen Geruch ausstrahlten. Sie küssten sich. Rasputin bohrte dann seine Blicke in Iliodors Augen, klopfte ihm auf die Schulter und sagte zum Bischof Theophan: »Das ist ein Mann, der scharf betet! … Oh, wie betet er scharf!«
Iliodor verneigte sich und wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Der Bischof Theophan nahm Rasputin am Arm und führte ihn nach Hause. Von diesem Tage an wurde der junge Mönch ein glühender und fanatischer Bewunderer des Staretz.
Ein anderer Bewunderer war der Pater Weniamin, der bei der Akademie geblieben war, nachdem er seine Examina mit Erfolg bestanden hatte. Er war der Typus des aus dem Volke hervorgegangenen russischen Mönches: ein Mann von starkem Knochenbau, mit gesunder Gesichtsfarbe und einem ins Rötliche gehenden Bart. Sein Mystizismus grenzte an Neurose. Er glaubte von der ersten Sekunde an und unerschütterlich wie Eisen an die Heiligkeit Rasputins. Man kann sagen, dass es in der Geistlichkeit in diesem Augenblick keine glühenderen Anhänger des »Staretz« gab als die beiden gelehrten Mönche Weniamin und Iliodor.
Rasputin lebte damals in einer kleinen Siedelung. Dort machte er die Bekanntschaft von mehreren Priestern und befreundete sich mit dem Pater Jaroslaw Medwed, der eine Zeitlang der Beichtvater der Grossfürstin Militsa Nikolajewna war. Er ging nach Kronstadt und erhielt dort den Segen des Pater Jean.
Schon lange war der Name dieses Paters Jean aus Kronstadt allen orthodoxen Russen bekannt. Alle, vom schlichten Bauern bis zum Zaren selbst, hatten Vertrauen zur Macht seiner Gebete. Er verrichtete Wunder. Man betrachtete ihn als einen Heiligen. Zahllose Pilger aller Klassen und aller sozialen Schichten strömten nach Kronstadt, wo er als Erzpriester an der Kathedrale amtierte. Ohne abzureissen, fanden dort gemeinsame Gebete und gemeinsame Beichten statt. Seit vielen Jahren hatte das heilige Russland so etwas nicht erlebt.
Auch Rasputin betete in Kronstadt, beichtete und empfing die Kommunion aus den Händen des Paters Jean. Rasputin selbst und seine Tochter Matrona haben später erzählt, dass Grigori dem Pater unter den Gläubigen aufgefallen sei, und dass der Pater ihn aufgefordert habe, vorzutreten, um ihn vor den übrigen kommunizieren zu lassen. Bei Rasputins Abreise soll der Pater Jean ihn gesegnet und dabei gesagt haben: er sende ihn aus, um die grosse Mission zu erfüllen, die ihm von der Vorsehung vorgezeichnet sei. Die Petersburger Anbeterinnen haben später alle an diese heilige Mission des Staretz geglaubt, und Grigori selbst war davon überzeugt, dass Gott ihn auserwählt habe.
Nachdem er sich einige Zeit in Petersburg aufgehalten hatte, ging er wieder nach Pokrowskoje. Er schilderte seinem Vater, seiner Frau und allen Freunden, mit welcher Achtung man ihm in der Hauptstadt begegnet war, und wie der Pater Jean in Kronstadt ihn vor allen Übrigen ausgezeichnet habe. Wenn er sich seiner Erfolge erinnerte, packte ihn die Lust, nach Petersburg zurückzukehren.
Einige Zeit nach Grigoris Fortgang, im Januar 1904, war jedoch in Petersburg der Bischof von Wolhynien, Antoni, ein eminenter, von religiöser Kultur durchdrungener Prälat, eingetroffen. Er wohnte in der Lawra und hatte dort Gelegenheit, von Rasputins vorübergehendem Aufenthalt und von dem Eindruck, den er in Petersburg gemacht hatte, sprechen zu hören. Bischof Antoni war selbst Rektor einer der theologischen Akademien gewesen; trotzdem er diesen Posten aufgegeben hatte, interessierte er sich immer noch für alles, was in diesen Lehranstalten vorging, und betrachtete sich als Freund der jungen Theologiestudenten. Nun traf es sich, dass er ziemlich detaillierte Auskünfte über die Theologie-Fakultät in Kasan und über das Leben, das Rasputin dort geführt hatte, besass. Und er war es, der als erster eine Warnung vor Grigori aussprach. In seiner ungeschminkten und bilderreichen Sprache setzte er die Bischöfe Theophan und Sergi und die Studenten ins Bild und empfahl ihnen Vorsicht: man dürfe zu Rasputin, der ein so ausschweifendes Leben in Kasan geführt habe, keinen Glauben haben; ein solcher Mann sei kein Gerechter und kein Staretz.
Doch der Krieg mit Japan lenkte alsbald die allgemeine Aufmerksamkeit nach dem Osten, und darüber schien man Rasputin vergessen zu haben.
Da kam das Jahr 1905, das für Russland so ereignisvolle Jahr. Der harte, unglückliche Krieg mit Japan dauerte an. Am 9. Januar fand unter Führung des Priesters Gapon in Petersburg eine Arbeiterkundgebung statt, die mit Flintenschüssen auseinandergetrieben wurde. Eine breite revolutionäre Bewegung löste sich in ganz Russland aus. Die Niederlagen der russischen Armee stachelten die allgemeine Unzufriedenheit auf. Ein Terrorist tötete den Grossfürsten Sergi Alexandrowitsch, den Onkel des Zaren. In der Petersburger Gesellschaft und in der Umgebung des Hofes herrschte grosse Unruhe.
Da erschien Rasputin zum zweiten Male in Petersburg. Er stieg in der Siedlung, der »Podvorie«, des Berges Athos ab. Wieder wurde er von seinen Protektoren aus der theologischen Akademie mit offenen Armen empfangen. Wieder Unterhaltungen, Diskussionen, Predigten. Der Umgang mit diesen hervorragenden Lehrern erweiterte Rasputins theologische Ausbildung. Das ermöglichte es ihm, die zahlreichen Glaubensfragen besser zu beantworten, die seine Bewunderer ihm in seiner Eigenschaft als Staretz vorlegten. Zunächst handelte es sich bei diesen Bewunderern einzig und allein um Bauern, aber später erschienen auch Vertreter der gebildeten Stände.
Rasputin wurde von einigen bürgerlichen Familien, dann aber auch in einigen Salons empfangen. So wie manche vorher dem Pater Petrow, dem Georgi Gapon und anderen einen triumphalen Empfang bereitet hatten, so war man jetzt ebenfalls voller Begeisterung für den neuen Meister, den neuen Propheten. Um diese Zeit herum heilte Rasputin gerade die Frau O. V. Lochtina, die lange Zeit krank gewesen war und bei ihren Aerzten keine Heilung gefunden hatte. Frau Lochtina war die Frau eines Ingenieur-Staatsrates, eine schöne und reiche Grundbesitzerin. Nachdem Rasputin sie von ihrer Krankheit geheilt hatte, wurde sie für immer seine leidenschaftlichste und aufrichtigste Anhängerin, die bereit war, ihm jedes Opfer zu bringen. Sie sah in ihm nicht nur einen Mann, der vom Allerhöchsten die Gabe des göttlichen Klarblicks erhalten hatte, sondern sie ging sogar so weit, ihn »Christus« zu nennen. Ihre Anbetung grenzte an mystischen Wahnsinn, wenn man darin vielleicht nicht gar einen Beweis dafür erblicken muss, dass sie eine Anhängerin der modernisierten Lehre der Chlysty war, die davon ausging, dass Christus sich auch heute noch in Anhängern ihrer Sekte zeigen könne. Frau Lochtina folgte Rasputin, wie die Jünger ihrem Meister folgen; sie sagte der Welt Lebewohl, wurde eine seiner Vertrauten, seine Privatsekretärin. Rasputin begreift sofort, dass diese Frau ihm in der Hauptstadt nützliche, ja sogar unerlässliche Dienste leisten kann, und tut alles, um sie an sich zu fesseln.
Theophan, der Beichtvater der Grossfürstin Militsa Nikolajewna, der Frau des Grossfürsten Piotr Nikolajewitsch, stellte zu Ostern Rasputin der Grossfürstin vor. Das entschied über das Schicksal Rasputins … und damit gleichzeitig, auf Jahre hinaus, über das Schicksal Russlands!
Die Grossfürstin Militsa Nikolajewna und ihre Schwester Anastasia Nikolajewna (Stana), die Frau des Prinzen Maximilianowitsch Romanowski, Herzogs von Leuchtenberg, waren damals mit der Zarin Alexandra Feodorowna sehr eng befreundet. Die Grossfürstin Militsa Nikolajewna, eine intelligente, energische Person mit vielen Kenntnissen, hatte auf die Zarin grossen Einfluss. Nach dem eigenen Ausspruch der Zarin war diese geradezu betroffen von der Intelligenz und dem Wissen der Grossfürstin, die in den Augen ihrer Intimen fast für eine Prophetin gehalten wurde.
Ein paar Jahre vorher hatten diese beiden Schwestern – montenegrinische Prinzessinnen, die am Smolny-Institut erzogen worden waren – der Zarenfamilie einen gewissen Herrn Philippe aus Lyon vorgestellt. Dieser geheimnisvolle Mann tat so, als ob er ein heiliger, tief religiöser Mann sei. In Wirklichkeit war er ganz einfach ein Quacksalber, ein äusserst geschickter Hypnotiseur. Er erzielte gewisse Erfolge vermittels Suggestion, nachdem er sein Opfer vorher einer speziellen psychologischen Vorbereitung, die er geschickterweise in Form von Gebeten vornahm, unterzogen hatte; aber man war davon überzeugt, dass Gott selbst es war, der, von Philippes Eingreifen gerührt, dessen Gebete erfüllt hatte. Der Zar und die Zarin glaubten an diesen Philippe, hielten ihn fast für einen Heiligen und machten ihn zu ihrem »Freund«.
Polotsew, ein Mitglied des Reichsrats, schreibt darüber in seinem Tagebuch unter dem 30. August 1902: »Den Intrigen der beiden Montenegrinerinnen (Militsa und Stana) ist es gelungen, den Zaren in die Hände eines verdächtigen Abenteurers, des Franzosen Philippe, fallen zu lassen; ihm verdanken wir das beschämende Abenteuer von der vermeintlichen Schwangerschaft der Zarin, ohne von all seinen anderen bösen Streichen zu reden. Durch hypnotische Manipulationen war es ihm gelungen, die Zarin glauben zu machen, dass sie schwanger sei. Unter dem Einfluss seiner Suggestion weigerte sie sich, Aerzte zu Rate zu ziehen. Mitte August indessen liess sie den Hofarzt Otto kommen, der ihr sofort sagte, dass sie nicht schwanger sei …«
Die von Philippe dank den mystischen Neigungen des Zarenpaares geschaffene Situation verstärkte noch die Freundschaft der Zarin für die beiden Schwestern und insbesondere auch den Einfluss Militsas auf die Zarin. Die Grossfürstin Militsa stand gerade in voller Macht, als Rasputin ihr vorgestellt wurde, und man sieht daraus klar, welchen Riesenschritt Grigori an dem Tage machte, als er den Salon der Grossfürstin betrat. Militsa wurde seine Anbeterin. Und ebenso ihre Schwester, die, damals ein wenig in Verwirrung wegen der Scheidung von ihrem ersten Mann, gerade bereit war, Rasputins Macht zu erliegen. Man stellte den Staretz auch den Grossfürsten Piotr Nikolajewitsch und Nikolai Nikolajewitsch vor.
Rasputins primitive Miene, sein naiver Glaube, die Tatsache, dass er von seinem Abertausende von Kilometern entfernt liegenden Geburtsort abgeschnitten war – all das sprach zu seinen Gunsten. Seine wenig flüssige, aber bilderreiche und charaktervolle Redeweise, die oft im ersten Augenblick etwas dunkel war, liess ihn als Propheten erscheinen. Seine tief eindringenden und originellen Auslegungen der Evangelien und vor allem der Apokalypse machten einen ungewöhnlichen Eindruck. Bei ihrer mystischen Gemütseinstellung erschien Militsa der Staretz bald als ein Mann, der von einer geheimnisvollen, religiös schwärmerischen Atmosphäre umgeben war.
In diesem Milieu wahrte der Staretz die Bescheidenheit einer reinen Jungfrau, aber er war klug wie eine Schlange. Sein praktischer Sinn, seine Intelligenz und seine Bauernschlauheit soufflierten ihm, dass bei diesen Anbeterinnen die Erotik keine Rolle spielen dürfe.
Das Schicksal kam Rasputin obendrein zustatten: Am 20. Juli kam aus Frankreich die Nachricht, dass Herr Philippe gestorben sei. Da dieser treue »Freund« nun nicht mehr unter den Lebenden weilte – wer sollte ihn ersetzen? Und die, die seinerzeit den Hypnotiseur vorgeschoben und geschickt für ihre Zwecke ausgenützt hatten, brauchten jetzt nur den sibirischen »Staretz« an die Stelle des toten »Freundes« zu schieben. Hatte doch der »Freund« selbst einmal zum Zarenpaar gesagt, dass sie nach seinem Tode einen anderen »Freund« finden würden, mit dem sie über Gott sprechen könnten. Man hatte einen Kandidaten zur Hand! Man brauchte ihn nur vorzuschieben, ihn dem Zaren und der Zarin in günstigem Licht vorzuführen und ihn im gewünschten Sinne handeln zu lassen. Und mit diesem neuen »Heiligen« begann dann eine zweite politische Intrige, deren Akteure genau dieselben Personen waren wie im Falle Philippe: die beiden Montenegrinerinnen und der Grossfürst Nikolai Nikolajewitsch.
Die Zarenfamilie wohnte damals in Peterhof, in ihrem Sommerpalais »Alexandrie«. Das Palais Snamenka, in dem die Grossfürstin Militsa wohnte, lag nur zehn Minuten davon. Die Villa Sergejewka der Grossfürstin Anastasia lag auf der andern Seite von Peterhof und war zu Fuss in einer halben Stunde zu erreichen. Der Zar und die Zarin sahen die beiden Schwestern fast alle Tage. Ungefähr jeden zweiten Tag begab sich das Zarenpaar nach dem Abendessen nach Snamenka, wo der Grossfürst Nikolai Nikolajewitsch ebenfalls erschien. Man veranstaltete spiritistische Sitzungen. Die Palais der beiden Schwestern und des Grossfürsten Nikolai Nikolajewitsch waren eine Zeitlang die Zentren der spiritistischen Bewegung.
Der Monat Oktober 1905 kam. Die revolutionäre Welle überspülte ganz Russland. Der Generalstreik brach aus, legte das Leben auf dem Lande lahm und drohte, dem Regime den Gnadenstoss zu versetzen. Die Zarenresidenz in Peterhof war von der Hauptstadt abgeschnitten. Unter dem Druck der Ereignisse und unter dem Einfluss Wittes und des Grossfürsten Nikolai Nikolajewitsch, der drohte, sich andernfalls eine Kugel in den Kopf jagen zu wollen, unterzeichnete Nikolaus II. am 17. Oktober sein Manifest: Russland hatte nun eine Verfassung, die Autokratie hatte ausgelebt …
Gerade um diese Zeit wurden die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Schwestern und dem Grossfürsten Nikolai Nikolajewitsch besonders eng. Es bildete sich da eine neue Gruppierung unter den Mitgliedern der Familiendynastie. Man begann von einer Heirat zwischen dem Grossfürsten und Anastasia zu reden. Der Staretz erklärte eines Tages: »Die Heirat der Schwester mit dem Bruder wird Russland retten.« Diesen dunklen Satz interpretierte man in der Weise, dass man sagte: damit Russland gerettet werde, müsse der Grossfürst die Anastasia heiraten. Man fing also an, die »Rettung« Russlands vorzubereiten. Das war das erstemal, dass Rasputin von Mitgliedern der Dynastie in die politischen Intrigen hineingezogen wurde.
Am 1. November stellte die Grossfürstin Militsa den Staretz Grigori dem Zarenpaar vor. Wieder trieb man das klug und fein eingefädelte Spiel, das man dem Zaren und der Zarin gegenüber bereits mit dem Hypnotiseur Philippe angewendet hatte, nur mit dem einen Unterschied, dass dieses Mal der Grossfürst Nikolai Nikolajewitsch eine wichtigere Rolle haben sollte.
Dieser wurde, ebenso wie seine zukünftige Frau, von den mysteriösen Seiten der menschlichen Natur, von den Problemen des Jenseits und den mystischen Fragen angezogen und fasste ein grosses Interesse für Rasputin, dessen originelle Interpretationen der Evangelien und der Apokalypse auch ihn besonders fesselten.
Rasputin selbst hatte niemals eine solche Ehre erträumt, er war zu jener Zeit noch viel zu naiv, um sich in dem politischen Intrigenspiel von Petersburg zurechtfinden zu können. Aber seine Schlauheit liess ihn erkennen, dass er das Projekt der Heirat billigen und das Loblied des Grossfürsten Nikolai singen musste. Und das tat er denn auch. Man weiss, wie sehr die Damen darauf erpicht sind, Hochzeiten zustande zu bringen. Die Zarin, eine ideale Gattin und Mutter, war entzückt von dem Projekt. Natürlich sprach man ihr gegenüber nicht von der »Rettung Russlands«. Die Zarin betrachtete diese Heirat nur als ein Mittel, den Grossfürsten seinem stürmischen Junggesellenleben zu entziehen. Sie tat deshalb ihr Möglichstes, um die Eheschliessung zu beschleunigen.





























