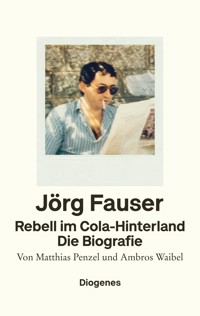
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wer war Jörg Fauser? Was hat ihn geprägt, gefuchst, wovon hat er geträumt und worüber geflucht? Matthias Penzel und Ambros Waibel gehen dem Rebellen und Junkie, dem Sohn und Menschen Jörg Fauser auf den Grund statt auf den Leim.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 857
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Matthias Penzel | Ambros Waibel
Jörg FauserRebell im Cola-Hinterland
Die Biografie
Diogenes
»Was ist schon ein Rebell? In einer Welt, in der es von Revolutionären nur so wimmelt, ist der Rebell der Mann von gestern, der Konservative. Mag sein. Bei so viel Menschen von heute wirkt auch die Erde wie von gestern, und – wie Brando, Marlon – halte ich es im Zweifelsfall mit der Erde.«
Jörg Fauser 1978
Hinweise zur Lesart und den Abkürzungen
In den Fuß- und Endnoten wird Jörg Fauser nicht explizit als Autor genannt, wenn es sich um Zitate aus seinem Werk handelt.
Bei Quellenhinweisen in den Endnoten bis Juli 1987 handelt es sich jeweils um Korrespondenz von bzw. an Fauser. Nach 1987 handelt es sich um Briefe, Mails und Gespräche an die, von oder mit den Autoren dieser Biografie.
Abkürzungen:
AFN: Arthur Fauser Nachlass
JFN: Jörg Fauser Nachlass, Marbach
BREL1: »Ich habe eine Mordswut«, Briefe an die Eltern 1957–1987 (Frankfurt/M. 1993)
BREL: Man hängt halt so an dem, was man hat. Briefe an die Eltern (Zürich 2023)
BRCW: Eine Freundschaft. Briefe 1971–87 (Zürich 2021); mit »CW« bedeutet Brief von Carl Weissner an Jörg Fauser.
BRFW: Eine Freundschaft. Briefe 1971–87 (Zürich 2021); hier mit »FW« bedeutet Brief von Fauser an Weissner.
TOP: Tophane (erstmals 1972)
HGS: Die Harry Gelb Story, Gedichte (erstmals 1973)
TGG: Trotzki, Goethe und das Glück, Gedichte (erstmals 1979)
AWG: Alles wird gut, Erzählungen (erstmals 1979)
RQG: Requiem für einen Goldfisch,5 Stories (erstmals 1979)
MUM: Mann und Maus, Erzählungen (erstmals 1982)
S: Der Schneemann, Roman (erstmals 1981)
R: Rohstoff, Roman (erstmals 1984)
SL: Das Schlangenmaul, Roman (erstmals 1985)
K: Kant, orig. 1986 (München 1987)
T: Die Tournee, Fragment, orig. 1987 (Berlin 2007)
BB: Marlon Brando – Der versilberte Rebell. Biografie (erstmals 1978)
SDS: Strand der Städte, Essays (erstmals 1978)
STRND: Der Strand der Städte. Gesammelte journalistische Arbeiten 1959–1987 (Alexander Verlag, Berlin 2009)
BFB: Blues für Blondinen, Essays (erstmals 1984)
Aufblende
Spiel mit mir
»Erzähl mir mal deine Geschichte.«
»Ich hab keine Geschichte.«
»Komm, jeder Mensch hat seine Geschichte. Nun rück schon raus mit deinem Waisenhaus, deiner Ehe, deinen Selbstmordversuchen …«
»Ich mag diese Geschichten aber nicht. Du brauchst nichts von mir zu wissen. Ich wollte auch nichts von dir wissen, bis du mit deinem Wahnsinn angefangen hast.«
Jörg Fauser in Der Schneemann1
Eine junge Frau. Die ersten Kohlmeisen stehen gerade auf, beginnen vergnügt zu zwitschern, die Frau kommt von der Nachtschicht. Schließt die Haustür auf, geht mehrere Stockwerke hoch zur kleinen Wohnung unterm Dach. Erschöpft und ausgelaugt. Zu müde, um das alles langweilig zu finden. Ihr Freund ist wach. Nicht schon, sondern noch. Wohl auf Amphetamin, Speed. Ritalin, um genau zu sein. Wach und vorm Spiegel. Geschminkt und bemalt, in Unterwäsche. Ihrer. Irgendwas, Strapsgürtel, vielleicht ein Unterrock. Eine merkwürdige Begebenheit, das Bild in der Erinnerung verbuddelt wie Sachen, die man im Morgenrot eben schnell wegstopft und vergisst, jahrelang. Die man nie jemandem mitteilt.
Wenige Jahre vorher, schwer verliebt in England, schreibt der junge Mann seinem Vater, »vielleicht ist die wichtigste Erfahrung die einer nahtlosen Gespaltenheit in allem, was ich tue«.2
Etliche Jahre später, als Rebell im Cola-Hinterland im Jahr 2004 erscheint, ist in einer überregionalen Zeitung zu lesen, »Fauser wäre heute 60 Jahre alt und vergessen – wenn er noch lebte«. In der Tat war er zu dem Zeitpunkt im Buchhandel nicht vorhanden, erhältlich nur noch ein Titel bei winzigem Verlag ohne Vertrieb, Vertreter, Präsenz.
Unvergesslich blieb er dennoch, auch für viele, die selbst schreiben wollten – wegen Alles wird gut, wegen den Gedichten, seinem Journalismus, wegen Harry Gelb in Rohstoff. Der wiederum ist »ein Candide der Gegenkultur: nicht gänzlich passiv wie Voltaires Held, aber kaum politisch motiviert« (Clive Sinclair in The Times Literary Supplement) oder ein »zeitgenössischer Asphalt-Anton-Reiser«,3 erschaffen von einem »Autor, der gern den harten Mann markiert« (FAZ1984) … und der seriell markige Sprüche absonderte1.
Kurz: nicht zu fassen.
Eine andere Erinnerung, zum Besten gegeben von einem Kollegen beim Tip, auch 2004 weggesteckt und nicht in der ersten Jörg-Fauser-Biografie erwähnt. Berlin, Anfang der 1980er-Jahre. »Da erzählte er mir … Da saß er mal in der Kneipe in der Potse, und da erzählte er mir, das ist die Kneipe, wo er immer mit dem – nicht immer … – wo er mal reingegangen ist und gesagt hat, er sei von der Lebensmittelkontrolle, zeigte ihnen einen Ausweis und ging hinter die Theke, nachschmecken, ob auch in jeder Flasche das Richtige drinnen ist. Da hat er alles ausprobiert, bis er auf dem Boden lag. Solche Geschichten hat er gedreht, das war ja auch ganz wichtig, aber … ich habe ihn nie erlebt, wenn er dann wirklich auf dem Boden lag.«4
Gut erfunden oder echt und ehrlich erlebt? Oder eben so nebenbei erzählt, Dichter in den Städten? »Das Leben ist immer da. Hier ist es und hier und hier«, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung feststellte (»Die 25 besten deutschsprachigen Bücher der letzten 20 Jahre«). Nicht weggestopft und vergessen: »Der Rohstoff, das Leben, die Wirklichkeit. Muß nur abgeschrieben werden.«5 Nur das: abgeschrieben. Und das dann so: »Ich glaube, das hat alles mit Diebstahl zu tun. Man stiehlt vom Leben was und setzt das um – und das ist dann, wenn’s gut wird, etwas Eigenes, etwas Neues, Frisches. Aber der Schriftsteller ist eine Art Tourist im Leben … ein diebischer Tourist. Ja.«6
Harry Gelb in Rohstoff war »am Beginn Junkie und am Ende Alkoholiker«.7 Drogen-Poet, Junk-Autor, Heroin-Dichter. »Ein Junkie war Fauser nicht, obwohl er die Drogenszene aus erster Hand kannte – etwa von 1964 bis 1970 rauchte, schnupperte, spritzte er alles, was Gott verboten hatte.«8 Gebrochen, voller Widersprüche, am Ende immer wieder – wie in Rohstoff – am Boden. Aber nicht geschlagen.
Dass Fauser der Mensch kaum zu unterscheiden ist von Fauser als Rohstoff-Autor und der kaum zu unterscheiden von Harry Gelb, wird gerne untersucht, wurde es auch schon von Jonathan Woolley, der diagnostizierte, dass jedes Resultat – egal von wem und aus welcher Perspektive – im Grunde belegt, dass es keine plausible, klare oder stringente Antwort gibt. Autofiktion hin oder her, Fauser schrieb nicht mit der Germanistik im Hinterkopf, ganz bestimmt nicht fürs Proseminar in Philologie. Trotzdem darf er – oder Harry Gelb – unters Mikroskop gelegt werden, logisch.
Der Erzählfigur in Rohstoff geht es um das Rohe und nicht um irgendwelche Konzepte des Hipsters oder von Pop. Er theoretisiert nicht gern und sucht auch in der Literatur nach dem prallen Leben – und schließt damit an den Sozialtypus Hipster an, wie er den amerikanischen Beats vor Augen stand: autodestruktiv, exzessiv, ›faustisch‹ (Mailer1992, 357).9
Eine Lektorin, mit der er eng zusammengearbeitet hat: »Hinter seiner Art, jeden zu verschrecken, zeigte sich Hilflosigkeit, das war wüst, er kam da angesaust wie ein Stier. Das machte ja auch seine Faszination aus. Aber der, der reinkam, um zu arbeiten, konnte auch herrlich schimpfen, war aber ein anständiger Kerl, ungeheuer gebildet, mit enormem Gedächtnis, mehrgleisig talentiert – der aber auch viel kaputtgemacht hat. Gleichzeitig war er sehr interessiert, mit einer Wachheit gegenüber allem ausgestattet. Er hatte das Zeug zu einem ganz großen Schriftsteller – und eine Menge Masken.«
»Alle wahren Junkies sind Experten im Manipulieren und im Täuschen ihrer Umwelt«, so eine langjährige Geliebte. »Das gehört zum Metier, es liegt darin eine Art Gesetzmäßigkeit. JCF war darin eher besser als mancher andere, er besaß noch ausreichend Freiraum für ein Arsenal an Alternativrollen, derer er sich notfalls bedienen konnte. Maskieren kann man es auch nennen.«
1968, Aussteiger und Rebellierende in Batikhemd, Fauser im Nadelstreifen. Abgehoben, verkleidet wie nach einer Nacht auf Speed, im eigenen Leben nur ein Besucher. Grundmotiv des Lebens von einem, der als Kind-Darsteller erstes Geld verdiente, ewiger Spieler – und das in mehrerlei Hinsicht: des Gamblers, des Schauspielers, der Rollen wechselt, sein Leben aufs Spiel setzt, sich wünscht, er »wäre ein Stein« – wie seine Mutter nie vergessen hat. Einschätzung eines Saufkumpans etlicher nächtlicher Touren, an deren Details sich keiner erinnert: »Reserviert, fast schüchtern – was oft missinterpretiert wurde als Arroganz, arrogante Maske! Im Streitgespräch konnte er Leute killen, besonders, wenn er getrunken hatte. Aber auf gutem Niveau. Aber die Opfer sind schon mal weinend vom Tisch gegangen.«
Jörg Fauser war schillernd und nicht zu fassen, auch wegen seiner Haltung. Einen Moment lang zahm und zart und verletzlich, dann brüllend, er bräuchte jetzt eine Knarre, um Baader zu befreien.
»Ein Bürgerschreck, der sich weder nach rechts noch nach links anpassen wollte«, resümierte ein befreundeter Schriftsteller, nachdem er die posthum erschienenen Briefe an die Eltern las.10
Das Anarchische, das ehrliche Interesse für den ›kleinen Mann‹, die Liebe zum Leben als Lesen – oder umgekehrt –, in seinem Schreiben diese Wirklichkeitsnähe, ein Vorreiter der Popliteratur … oder alles zusammen: Er passte in keine Schublade. Ob Fauser, hätte er länger gelebt, geschätzt worden wäre: Kaffeesatz. Reine Spekulation. Schulkameradinnen wie Eva Demski oder Ulrike Heider veröffentlichten bis zu ihrem 43. Geburtstag vier Romane oder zwei Bücher, Brüder im Geist wie Bukowski keine Handvoll Gedichtbände, Robert Stone saß noch an seinem dritten Roman, Chandler hatte drei Dutzend komplett vergessener Gedichte und Artikel untergebracht – und ein halbes Jahr nach seinem 43. Geburtstag die erste Story in Black Mask. In dem Alter hatte Joseph Conrad von seinen neunzehn Romanen erst vier veröffentlicht, von Fontane fangen wir gar nicht erst an … Frank McCourt debütierte mit über 60.
Und Fauser – treu in der Untreue zu Schubladen, relativ zuverlässig auch mit dem Rohmaterial seiner Protagonisten Harry Gelb, Johnny Tristano, Blum oder Harder mit seinem Fimmel fürs Rotlicht, Harry Lipschitz (in Miramare,Wenn er fällt, dann schreit er, Machs noch mal, Harry bis zum unvollendeten letzten Roman … »eine meiner Lieblingsfiguren, und das ist kein Penner, kein Junkie, kein Kulturkritiker, keine BB-Blondine, sondern ein 53-jähriger Ex-Geheimdienstmann, den ich schon in drei Erzählungen drin habe, der sich auch in so einer Randzone zwischen den Diensten und Abteilungen und den kleinen illegalen Geschäften bewegt.«)11 Ein Stück Fauser steckte auch in Kant, Freiberufler auf der payroll von Menschen mit viel Geld und verluderter Moral, der verdroschen, verhört und verschaukelt wird – sodass es am Ende philosophisch wird, Fauser-philosophisch und gruslig: »Die längsten Reisen fangen an, wenn es auf den Straßen dunkel wird.«
Erster Eindruck, so der Hasardeur und erste große wichtige Verleger ThomasLandshoff: »Sympathisch, kein unangenehmer Zeitgenosse. Ein bißchen verschlossen und, das fiel mir auf, sehr mißtrauisch.«12
Bleibender Eindruck des letzten Redakteurs, der eine lange Zusammenarbeit gerade startete, Wolfram Knorr: »Wenn er mal aus sich heraus kam, konnte er ein brillanter und amüsanter Unterhalter sein, der gerne von seinen Lieblingen Bukowski, Len Deighton und Mickey Spillane erzählte.«13 Und der letzte der Dichter-Freunde, Michael Köhlmeier, im Waterloo von Klagenfurt dabei, dem Wettlesen am Wörther See: »Er war anders als wir. Ganz anders.« Auch, so einen Tacken später, auch »anders als seine Fans meinten und meinen«.14
Nahtlos gespalten, für manchen zum Vergessen. Für den Schriftsteller, so Fauser als 22-Jähriger, ist »sein eigenes Leben eine Übung und Prüfung für die Tauglichkeit seiner Kunst«. Daher das Maskenspiel. Erproben diverser Rollen. Ein Dichter, der mit ihm in Berlin las, als Fauser wieder damit spielte, den Geheimdienstler-auf-Abwegen in Randzonen zu positionieren: »Ich kann mich erinnern, dass der Text, den er dabei hatte, noch in Arbeit war, der war also vollgeschrieben, maschinengetippt, und mit ungeheuer vielen Korrekturen, sodass er in seinem Manuskript oft den roten Faden suchen musste. Was den Reiz, auch für die Zuschauer des Aus-der-Werkstatt-Dargebotenen ausmachte. So eine Lesung ist ja ein Stück weit auch ein Schauspiel, bei Lesungen spielt dieses Moment eine Rolle.«15
Schön und gut, der übergroße Trenchcoat lässt sich ja noch weglächeln, lauthals lachen – wie Carl Weissner – über die 2004 ausgegrabene Episode, Fauser »wollte sich in Marokko einen weißen Anzug schneidern lassen, mit Hut. Solchen Stoff hatten die gar nicht, also bekam er einen grau-melierten, und der saß nicht einmal richtig, sodass er ihn nur ein-, zweimal getragen hat«16 – aber in Frauenkleidern und geschminkt?
»Im nächsten Moment, wenn er sich dann häutete«, so seine erste große Liebe, »dann war das vorige ganz weg. Multiple Persönlichkeit. Auch das mit Jazz: Hat er gar nicht verstanden, sich aber quasi übergestülpt bei langen Gesprächen im Jazzkeller.«17
In Randzonen, seelisch wie örtlich. Zwischen dem Gewohnten und dem Üblichen, Gemütlichkeit und dem Anrüchigen.
»Obwohl die Presse sich über seinen Kult ›harter Männlichkeit‹ mokierte«, bemerkte im Juli 1987 der neuste Fauser fördernde und bezahlende Redakteur, war Fauser »ein ruhiger und stiller Mensch, der lieber zuhörte und beobachtete«. Weltwoche-Redaktor Wolfram Knorr weiter: »In Wahrheit umgab ihn weder das puerile ›he-man‹-Getue eines Wondratschek noch die Punk-Masche eines Rainald Goetz.«18
In Randzonen. Zwischen dem Gewohnten und dem Üblichen, zwischen Gemütlichkeit und dem Anrüchigen. »Ich habe«, so eine Freundin, bei der Fauser kurz vor seinem Tod übernachtete, »auch Bilder von ihm geschminkt und verkleidet. Zusammen haben wir das gemacht: ihn in Frauenkleider gesteckt.« Also doch Gender Bender wie Bowie – ebenso zu Lebzeiten jahrelang verschmäht von denen, die den Diss-Kurs bestimmten, und posthum bestaunt.
In jedem Fall ein Evergreen, nicht nur für Küchentischpsychologen: Fauser und die Frauen. Das Frauenbild in seinem Werk, gegenüber der von ihm so bezeichneten »rohen Masse Mann«.19
Fauser hat daher auch keine zeitlose und allgemeingültige Literatur geschrieben. Seine Texte situieren sich vor einem bestimmten kulturellen und gesellschaftlichen Hintergrund: die Siebzigerjahre der Bundesrepublik Deutschland in proletarischen Lebenswelten. Doch auch hier engt er sein Blickfeld noch weiter ein. Denn auch wenn Frauenfiguren vorkommen, stehen im Zentrum seines Schreibens alleinstehende Männer ohne nennenswerte Schul- und Ausbildung, häufig gezeichnet vom Alkoholmissbrauch und einem ungesunden und unsteten Leben.20
Speziell Reporter, die Fauser zuerst lasen, bevor sie ihn trafen, staunten, dass er so gar nicht den Erwartungen entsprach, am liebsten der des »wilden Typen in Lederjacke, Jeans und Stiefeln«.21
»Ich hatte einen ›harten Mann‹ erwartet … Fauser ist zwar so klein wie Humphrey Bogart, aber den Kopf hält er meist gesenkt. Seine Stimme ist zerbrechlich und schleicht sich im Nuschelton durch die Sätze. Während unseres zähflüssigen Gesprächs befürchte ich, er könnte plötzlich in seinem braunen Samtcord-Anzug verschwinden und mich allein lassen mit den Fragen, auf die zu antworten er ohnehin nicht vorhat. Deutlichstes Zeichen seiner Anwesenheit ist das Aufflammen eines pinkfarbenen Einwegfeuerzeugs, mit dem er ein Zigarillo seines Gastgebers anzündet.«22
Nicht zu fassen. Und doch tauschen sich Menschen – mit oder ohne Ausbildung – immer noch regelmäßig aus über das, was sie bedeutungsvoll finden, beharren auf ihren Standpunkten, entdecken Teile ihrer Sicht bei anderen Lesenden oder Staunenden, und geben auch diese wieder, als seien diese verbatim kopierte Sentenzen. Fakten.
Männer, die Jörg Fauser lasen, waren latent misogyn, eher homophob als schwul, eher Stoffel als Dandy. Sie verstanden sich als Außenseiter, Maler, Künstler oder Musiker, sie litten an sich, am Leben, an der Stadt und den Verhältnissen. Ihr Leiden, ihr Ekel an der Welt lähmte sie, sie waren unfähig, einen Brief an den Vermieter zu schreiben, in Urlaub zu fahren, den Schlüssel nachmachen zu lassen oder Wohngeld zu beantragen.23
Andere nennen ihn »Kultautor und ewiger Geheimtipp«,24 »Geschäftsmann der deutschen Literatur« (Dobler, SR2004), »Kultautor mit Krawatte«,25 »Kultautor … von der Neuen Rechten zwangsumarmt«,26 »einer der bedeutendsten Vertreter der deutschen Untergrundliteratur«27 und damit »Schriftsteller also für die wilden Kerle«,28 »Deutschlands bester Krimi-Autor, ein Kind der Beat-Generation«,29 ein »Rebell, ein Asphaltliterat, der für lui und den Playboy schrieb, der oft saufen und boxen ging. Ein deutscher Schriftsteller, der die deutsche Kulturszene geißelte«,30 der »deutsche Bukowski«,31 »der ›Amerikaner‹ unter Deutschlands Edelfedern der achtziger Jahre«,32 »Kafka of crime writing«,33 der »deutsche Chandler«, »eine männliche Christiane F.«34 oder der »Burroughs aus dem Reihenhaus«,35 ein »vom Opium inspirierter Hippie mit dem Hang zur Levantede«,36 »Kenner deutscher Wirklichkeiten«,37 »ein totaler ›Punk‹« (Sabit Fikir in Rezension von Hammadde, der türkischen Fassung von Rohstoff), »der deutsche Quentin Tarantino der Literatur«38 oder, etwas übersteuert und nicht so ganz bierernst: der »unvergessene Frankfurter Bockbierbaron, der hier um die Ecke, an der Saalburgallee, anno 1975 einen Sattelschlepper Binding Carolus ganz allein und in einem Zug ausgetrunken«39 hat, »schreibender Rebell«,40 »Underdog und verlorener Beat-Poet«,41 einer der »sich hartnäckig gegen den allgemeinen Literaturtrend stemmte und Asphalt-Geschichten erzählte«,42 »der Krimiautor und exzentrische Zocker«,43 »Kamikaze-Dichter, der den Airport-Blues hatte«.44 »Kein harter Kerl, sondern ein zarter Mann … als Kritiker ein radikaler Empathiker.«45 … »kein netter Mensch, sondern Schriftsteller« (Jörg Fauser).
Treffend jedenfalls und auch gern gesagt: Fauser als Journalist unter Schriftstellern, Schriftsteller unter den Journalisten; oder so ähnlich mal von Claudius Seidl gesagt. Sehr richtig, auch weil in dem klaren Statement die Widersprüchlichkeit steckt.
Morgens im Schlafzimmer, so glaubt die Freundin, die von der Nachtschicht kam, »lachten wir etwas darüber. Mag sein, dass er es als eine Art Experiment erklärte, aber so sehr komisch fand ich das gar nicht, eher gruselig.«
Und das Jahre bevor David Bowie, The Man Who Fell To Earth, geschminkt und im Rock posierte.
»Habe es auch vollkommen weggeschoben, nie erwähnt.«
Ist vielleicht auch ganz normal.
Was jedenfalls zwischen allen Interpretationen und Wertungen abzulesen ist: Zum einen meint jeder, dass seine Wahrnehmung der Welt und Wirklichkeit die einzig richtige ist, ob mit den eigenen Sinnen validiert oder durch eigenes Lesen angeeignet. Zweitens kann jede Charaktereigenschaft mit oder ohne Wertung gesehen und verstanden werden. Chamäleonhafte Charaktere mag man als lasche Anpassertypen ohne Rückgrat sehen oder als geschmeidige Teamplayer, sensibel genug, die Umwelt so wahrzunehmen, dass man in der Camouflage sein eigenes Ego zurücklässt.
Zum Vergessen? Das Werk offenbar nicht. Das Leben … noch viel weniger.
I.1944–1974
»Hier bist du her, dies ist dein Land«
Kapitel 1
KINDHEIT UND JUGEND
Vor-Geschichte
… daß ihr wahrscheinlich die besten Eltern seid, die ich mir für mich denken kann …
Jörg Fauser 1963
Es ist der Sommer 1944, jener Sommer, »als Stauffenbergs Bombe nicht hochging«. [BB, 1978, S. 28] Den Krieg haben die Deutschen längst verloren, aber sie machen einfach weiter, und der Holocaust hat gerade erst seinen mörderischen Höhepunkt erreicht. Vielleicht ist es diese unbewusste Erfahrung einer apokalyptischen Zeit, die Jörg Fauser »immer und immer wieder« sagen lässt: »44 ist ein toter Jahrgang.« Daran erinnert sich jedenfalls Astrid Litfaß, ebenfalls Jahrgang 44, Schriftstellerin und Ehefrau des engen Fauserfreundes Karl Günther Hufnagel.
Am 16. Juli um 22:00 Uhr – wie in einem Horoskop vermerkt, das Fauser sich 1979 für seine erste Kolumne im Berliner Stadtmagazin Tip anfertigen lässt – wird in einem Geburtsheim mit dem Namen »Goethehaus« in Bad Schwalbach/Taunus Jörg Christian Fauser2 geboren. Den Namen Jörg bekommt er auf Wunsch seines Vaters Arthur Fauser (1911–1990) vom Maler Jörg Ratgeb, einem Unterstützer der Aufständischen im Deutschen Bauernkrieg und deswegen um 1525 durch Vierteilung hingerichtet.46 Im ehemaligen Frankfurter Karmeliterkloster, das heute als Archiv der Stadt Frankfurt a.M. dient und den Nachlass von Arthur Fauser beherbergt, sind Fresken von ihm zu finden. Bis zum siebten Monat hat Jörg Fausers MutterMaria (1916–2007) noch in Frankfurt Theater gespielt, dann ist sie zu ihren Eltern in die Nähe des Kurstädtchens Bad Schwalbach gezogen. Dank ihrer Schwangerschaft ist sie von Arbeiten in Rüstungsbetrieben befreit. Bis zum Kriegsende wird sie dortbleiben.
»Wer in Bad Schwalbach lebt, wird dankbar empfinden, dass es in Zeiten von Hast und Hektik noch Oasen der Ruhe und Erholung gibt, zu denen diese Stadt uneingeschränkt gezählt werden muss«, warb die Stadt Anfang der 2000er-Jahre für sich. In Nazideutschland gibt es für Jörg Fausers Eltern einen solch entspannten Ort allerdings nicht. Denn die beiden gehören einer Minderheit an: Sie sind Antifaschisten.
Kennengelernt haben sich Maria und der Maler Arthur Fauser im mondänen Café Telschow am Potsdamer Platz in Berlin, kurz vor der Pogromnacht vom 9. November 1938. Sie werden ein Liebespaar für den Rest ihres Lebens, eine intensive Beziehung, die nicht zuletzt in Arthurs Briefen zu Geburts- und Hochzeitstagen sowie nächtlichen Notizen an sein »geliebtes Mariechen« Zeugnis findet.47 In Berlin lernen die beiden Brigitte Schönberg kennen, die dort auf ihr US-Ausreisevisum wartet, um als Jüdin Nazideutschland verlassen zu können. In ihrer Autobiografie schreibt sie über ihre »wichtigen Freunde« Arthur und Maria Fauser: »Als ich sie in Berlin traf, waren sie nicht verheiratet. Ich lernte sie auf einer Party kennen […] Arthur Fauser war ein Maler, aber wie Beckmann, Nolde und viele, viele andere durfte er nicht malen, weil seine Kunst als ›entartet‹ galt, und Hitler hatte entartete Kunst verboten. Er arbeitete als Karteiführer, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Da er nicht malen konnte, begann er stattdessen, Gedichte und Theaterstücke zu schreiben. Ich wurde eine sehr enge Freundin von Arthurs Freundin Maria, die eine Schauspielerin war. Sie war geschieden und hatte einen kleinen Sohn, der bei ihren Eltern wohnte. Durch sie kam ich in ihren Kreis von Menschen am Rande der Gesellschaft. Sie waren alle leidenschaftliche Anti-Nazis. Das war das letzte Jahr, das ich in Deutschland blieb.«
Zu Brigitte entsteht eine innige Freundschaft, so innig, dass ihre Tochter Barbara es später für unvermeidlich erklärt, dass sie und Jörg eine Zeit lang ein Paar werden, wo doch sein Vater und ihre Mutter sich schon so mochten. Und auch eine andere Verwandte von Brigitte Schönberg – die die Fausers nach dem Zweiten Weltkrieg durch eine Zeitungsanzeige in Frankfurt wiederfindet – wird eine wichtige Rolle in Jörgs Leben spielen: Ihre 1950 in München geborene Großnichte NadineMiller ist »Sarah« aus Rohstoff.
Die 1916 in Herborn als Maria Weisser Geborene weiß, was sie tut, aber auch, welche Gefahren ihr drohen. Ihr Vater Richard Weisser ist von den Nazis 1933 aus seinem Amt als Rektor der Frankfurter Glauburgschule gejagt worden. Nur wegen des durch die Einberufungen akuten Lehrermangels erhält er später wieder eine Stelle, zunächst als einfacher Lehrer in Strinz-Margarethä bei Bad Schwalbach, nach Kriegsende in Bad Schwalbach als Rektor.
Jörg Fausers Großvater mütterlicherseits ist ein aufrechter, »sehr lieber Mann«48 und neben seiner Lehrtätigkeit auch als Schriftsteller tätig – Jörg Fauser wird mit seinen historischen Werken lesen lernen. Bis zum Tod Richard Weissers 1950 bleibt Jörg bei den Großeltern – ein für die Nachkriegszeit nicht untypisches Kinderschicksal. Jörg Fausers Mutter wächst in Bad Wildungen auf und kommt mit elf Jahren nach Frankfurt. Dort besucht sie später auch die Schauspielschule und erhält ihr erstes Engagement, dort heiratet sie 1935 in erster Ehe den aus einer Berliner Handwerkerfamilie stammenden Dr. Hannes Razum (1907–1994), der seit 1934 als Dramaturg an den Städtischen Bühnen engagiert ist. Am 12. November 1935 wird der gemeinsame Sohn Michael geboren, der bei den Großeltern aufwächst. Hannes Razum, der nach dem Krieg das Schlosstheater in Celle zu einer kritischen Instanz formen wird,49 tritt 1937 der NSDAP bei und macht Karriere, unter anderem als Leiter des Schauspiels am Deutschen Theater in den von den Nazis besetzten Niederlanden in Den Haag. Die Ehe scheitert am »wechselhaften Theaterleben« und wird 1941 geschieden.50 Jörg Fauser wächst als Einzelkind auf, sieht in Michael aber durchaus seinen älteren »Bruder«, den er als Zehnjähriger in einem kindlichen Testament mit Büchern, einem Bild und Ersparnissen bedenkt und ihn damit »glücklich machen« will.
Michael Razum, der in Frankfurt studiert und kurzzeitig mit der neuen Familie der Mutter zusammenwohnt, wird Lehrer für Deutsch und Englisch und lebt später bei Karlsruhe. 1978 stirbt er mit 42 Jahren an Krebs. In einem Brief vom Dezember 77, in dem er sich für Jörg Fausers Genesungswünsche bedankt, heißt es: »Weißt du, wir zwei sind zu verschieden von der Lebensanlage her als daß viel mehr als ab und zu ein paar Grüße über die Distanz hinweg zustandekämen.« Aber es gebe doch »eine Verbundenheit«, die »nie ernstlich in Frage« gestanden habe, und ein Besuch wird freudig erwartet.51 Fausers lebenslange enge Freundin Dorothea Rein, geb. Hagert, betont, wie getroffen bis hin zu einer schweren Erkrankung Jörg Fauser vom frühen Tod des Bruders war.
Als Maria Weisser-Razum ihrem zweiten Mann begegnet, hat der schon etliche Schicksalsschläge hinter sich – seine beiden Geschwister sterben im Kindbett, sein Vater wird drei Wochen vor Ende des Ersten Weltkriegs als Soldat einer Transporteinheit von seinem Kommandeur erschossen – sowie eine Odyssee durch Verstecke in Nazideutschland und Abschiebegefängnisse in Italien und der Schweiz Arthur Fauser, 1911 in Kollnau/Baden geboren und in Reutlingen aufgewachsen, lernt nach der Mittleren Reife zunächst drei Monate bei einem Malermeister und beginnt dann eine Banklehre, die er nicht abschließt. Schon auf der Oberrealschule hat er zu zeichnen begonnen – gegen den Willen der Mutter und des Stiefvaters, aber mit Erfolg: 1931 stellt er im für junge Kunst wichtigen Reckendorfhaus in Berlin aus. Die Karriere wird jedoch harsch unterbrochen: 1933 erhält Arthur Fauser Ausstellungsverbot. Er versucht, in die Schweiz zu emigrieren, taucht im Hafen von Genua unter, wird ausgewiesen. Kurz findet er, wie schon Ende der 1920er-Jahre, in Zusammenarbeit mit HAP Grieshaber in Reutlingen bei der »Klischeeanstalt Sauter« Anstellung und Unterschlupf, aber auch dort wird seine Lage unhaltbar, er sei »an Leib und Leben bedroht gewesen und von seinen ehemaligen Mitschülern verprügelt worden«.52 Zudem engagiert sich Arthur bereits Mitte der Zwanzigerjahre in der kommunistischen Arbeiterbewegung. Die Verbindung zwischen politischem Engagement und künstlerischer Berufung reflektiert er in den 1980er-Jahren so: »Ich war Kommunist und glaubte steif und fest an die Gemeinschaft. Dieser Aberglaube war der tiefste Punkt meines Lebens als Maler. Ich war drauf und dran, mich für eine Illusion zu opfern […] Ein Leben kann auch darüber vergehen, daß man erst die selbstauferlegten Fesseln als Fesseln erkennt und dann versucht, sie nach und nach abzustreifen.«53 Man kommt nicht umhin, in Jörg Fausers Leben den Willen zu erkennen, diesen Fehler nicht zu wiederholen und dem Individuum und dem Werk absolute Priorität einzuräumen. Der Vater schließt seine biografische Notiz dann allerdings mit dem Satz: »Auf einen Irrtum folgt meistens unweigerlich ein anderer.«
In Berlin, wo sich Arthur Fauser 1937 mit einem Job als Karteiführer für die »Reichsstelle für Getreide, Futtermittel und sonstige Landwirtschaftliche Erzeugnisse« durchschlägt, wirkt er ab Juli 1938 zusammen mit dem Schriftsteller und Widerstandskämpfer Günther Weisenborn und anderen bei einem literarischen Kabarett mit, das erst Der Apfelbaum, dann Die Dachluke heißt. Nach »Riesenerfolg« im »überfüllten Saal« im November wird es drei Tage später von der Gestapo geschlossen. Als Die Dachluke1947 wieder gegründet wird, erinnert der Kabarettist Thierry alias Dieter Koch an den ersten Versuch: »Diese Dachluke ist keine gewöhnliche Dachluke. Vor Jahren schon schauten wir durch sie hindurch, durchschauten sie und manches andere. Wir waren so frei und sie so offen, dann wurde sie geschlossen und wir geschlossen überführt. Durch diese Luke sah man die totalitäre Sonnenfinsternis, die heute nun der demokratischen Morgenröte weicht – dämmert es schon?«54
1939 folgt Arthur Fauser Maria nach Frankfurt, 1940 wird er eingezogen und bleibt bis Kriegsende Soldat, zunächst im relativ ruhigen Frankreich, wo ihn Maria besucht und auch als Schauspielerin auftritt, dann ab Mai 1941 in Finnland. Dort ist der Einsatz ungleich härter, Fauser wird verwundet und heiratet während der Zeit in der Genesungskompanie am 29. Dezember 1941Maria Weisser in Frankfurt, deren erste Ehe im selben Jahr geschieden worden ist. Arthur Fausers Œuvre und seine Bibliothek gehen im Krieg verloren. Am 29.8.1945 wird er aus der Kriegsgefangenschaft in Frankreich entlassen und sieht bei seiner Rückkehr zum ersten Mal seinen schon mehr als einjährigen Sohn.
Die traumatischen Erlebnisse in Widerstand und Krieg, aber auch die Erfahrung der Kameradschaft unter unmenschlichen Umständen, in denen er »hunderte von Toten und verstümmelte Verwundete«55 gesehen hat, prägen Arthur Fauser als Mensch und als Künstler. »Die Vergangenheit«, sagt er 1983, »ist offenbar nicht vergangen, nicht so lange ich lebe; die Zukunft erscheint als Erinnerung, und alles wird zur dauernden Gegenwart: im Bild.«56 Den Fakten und Mythen dieser Vergangenheit etwas Neues und Eigenes entgegenzusetzen, ohne sie abzuwerten – damit tritt Jörg Fauser an.
My generation
Im Übrigen habe ich ein starkes Bewusstsein von dieser meiner Zeit, meinen Möglichkeiten in ihr, mich zu verwirklichen; und ein halbes Dutzend Leute, mit denen ich über Jahre verbunden bin: meine Generation.
Jörg Fauser 1970
In den Kriegsjahren kommt die Generation auf die Welt, die sich mit und nach 1968 in der deutschsprachigen Literatur als führende etabliert. 1946 wird Elfriede Jelinek geboren, 1945 Rainer Werner Fassbinder, 1944 Botho Strauß (und Gerhard Schröder), 1943 Wolf Wondratschek (und Andreas Baader), 1942 Peter Handke und Günter Wallraff, 1940 Rolf Dieter Brinkmann und Carl Weissner. Es ist Fausers Generation, zu der er sich oft geäußert hat. Auf die Frage, was für ihn 68 ausmache, antwortet er etwa 1985:
Viel. Mehr als viele Leute glauben. Das war für mich erstens meine Jugend. Und dann war das eine immerwährende Diskussion darüber, wie man leben könnte, was es über den Tellerrand hinaus noch gibt. Einfach ein unheimlich intellektueller Reiz. Da war in den Köpfen was los, und das vermisse ich heute. Wobei man sich ja auch anders entwickeln kann. Ich würde auch nie bei einem, der rechts ist, anzweifeln, daß in seinem Kopf nichts los ist. Solange überhaupt im Kopf etwas los ist, finde ich das toll. Ich diskutiere auch mit jedem. Und damals hat man auch mit jedem diskutiert. Man hat versucht, eine Art Leben herzustellen, von dem man glaubte, daß sich das drastisch von dem, was vorher war, unterschied. Was natürlich nicht stimmte. Wurde auch sofort von mir als lächerlich erkannt. Aber es war doch zumindest der Versuch. Und dazu bekenne ich mich.57
Fausers Generations-Emphase hat ein literarisches Vorbild, sie ist nicht schlicht der ›Wirklichkeit‹ entnommen, sondern artifiziell aufgeladen. Es sind die ihm von Kindheit an nahen Expressionisten, »eine Generation jäh blitzend, stürzend, von Unfällen und Kriegen betroffen, auf kurzes Leben angelegt«,58 wie Fausers lebenslanger literarischer Hausgott Gottfried Benn1955 resümierte. Auch eine der ersten Veröffentlichungen Jürgen Ploogs1964 wird sich mit Benn beschäftigen.59 Erst vor diesem avantgardistisch-traditionellen Hintergrund wird Fausers literarische Entwicklung verständlich. Er tritt ja eben nicht mit dem Mainstream seiner Generation hervor. Seine ersten Bücher bleiben weitgehend unbeachtet, und zwar nicht nur vom alteingesessenen Literaturbetrieb, sondern vom Großteil der doch angeblich so nahen Generationsgenossen selbst. Wie nah ist es an Fauser, wenn Kurt Pinthus, der Herausgeber von Menschheitsdämmerung – der zuerst 1920 erschienenen klassischen Sammlung expressionistischer Lyrik –, für die Neuausgabe 1959 vermerkt, dass fast alle expressionistischen Dichter sich später einfacheren, herkömmlichen Formen zugewandt hätten. Fauser folgt diesen Spuren. Wie der expressionistische Romancier Hans Fallada wandelt er sich beginnend mit den Gedichten und Stories und schließlich dem Bestsellerroman Der Schneemann zum populären Klartextautor, der sich immer seltener expressionistische Ausbrüche gestattet.
Vater, Mutter, Kind
Dass man aus seinem Leben etwas machen musste, war mir ziemlich früh eingebleut worden.
Jörg Fauser in Rohstoff
Arthur Fauser ist ein aufrechter, kompromissloser Mann mit einem verletzlichen Stolz und unerbittlich nachtragend. In einem Brief an Maria nennt er sich selbst »einen rechthaberischen Angeber«. Er hasst nette, glatte Höflichkeit und hält mit seiner Meinung selten hinterm Berg, auch wenn er sich damit Feinde macht. Ihm ist durchaus bewusst, wie schwierig der Umgang mit ihm sein kann, bedauert auch selbst mitunter seinen barschen Ton. Er ist aber auch ein humorvoller Mensch mit großer Neigung zu Ironie und Satire,60 schlicht »ein guter Typ« (Fausers Tip-Kollege Werner Mathes) – mit seinen ganz eigenen Problemen.
Zu den Zetteln und Briefen, die sich in seinem Nachlass finden und die »morgens im Badezimmer lagen«, notiert Maria Fauser: »A.F. konnte immer erst gegen Morgen einschlafen. Er hatte Angina Pectoris und daher viele Beschwerden.« Um seine »gräßlichen Anfälle« zu lindern und Schlaf zu finden, nimmt Arthur Fauser regelmäßig Nitrosprays und Valium – und weiß dennoch oft nicht, »wohin mit mir selber«, was er ausführlich, fast manisch in den Nachrichten an Maria festhält.
Jörg Fauser wächst zwischen zwei starken Persönlichkeiten heran, die eine Beziehung verbindet, in der das Kind seinen Platz finden muss. Das schließt ein, dass seine Krisen auch von Maria Fauser nicht immer mütterlich-freundlich interpretiert oder gelöst werden. Als Jörg Fauser 1967 sich aus seinem Zivildienst nach Istanbul absetzt, schreibt er in seinem ersten Brief vom 26. Januar an seinen Vater: »Ich habe einmal zufällig einen Brief von Mami – an Dich, sicherlich – gesehen, nur eine Zeile, die auf mich bezogen war – ich sei ein Psychopath. Nun gut, jetzt weiß ich es ja.«
1945 ist Frankfurt eine der am stärksten zerstörten Städte Deutschlands, das Fausers Freund und Kollege Martin Compart so charakterisiert: »Amoralische Spießer krochen aus den Bombenlöchern, um das Wirtschaftswunder zu erfinden. Blue Jeans und Lederjacken waren Werkzeuge des Teufels, und Rock ’n’ Roll war seine Musik. Das Land gehörte weiterhin den Kreaturen, die die Barbarei wissenschaftlich gemacht hatten. Die Bundesrepublik war nicht die Nachfolgerin der Weimarer, sondern der Friedhof des 3. Reichs, auf dem die Zombies rumirrten.«61 In einer notdürftig reparierten Ruine gibt es jedoch eine Ausstellung: »Neue Kunst in Frankfurt«. Rudi Seitz, ein fünfzehnjähriger städtischer Lehrling und späterer Mitarbeiter des legendären Frankfurter Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann, berichtet: »Ich ging neugierig hin – und war befremdet. Mein Verständnis von Schönheit wurde verletzt durch die kantigen Farbflecken, die als Kunst ausgegeben wurden. Unter einem besonders irritierenden Bild stand der Name des Malers: Arthur Fauser. Die Mittagspause war vorüber, mein erster Tag in der städtischen Lehre bald vorbei. Er war ein Tag des Umbruchs für mich geworden – die Rätsel dieser ungewohnten Bilder ließen mich nicht mehr los. An diesem Tag begann meine Liebe zur Kunst – ausgelöst durch ein Bild von Arthur Fauser.«62Seitz lernt auch Maria Fauser kennen, die für das Schauspielhaus in Tod eines Handlungsreisenden auftritt, »ab 1950; in einer Turnhalle«, denn Oper und Schauspielhaus sind zerstört. Ebenfalls dort beschäftigt, und zwar als Dramaturg, ist zu dieser Zeit Arthur Fauser, der schon vor dem Nationalsozialismus zu schreiben begonnen hatte. Eines seiner Theaterstücke wird in Hamburg aufgeführt, Hörspiele von ihm schaffen es in den Rundfunk3, doch nach zwei vom HR gesendeten Stücken überwirft er sich um 1950 mit dem zuständigen Vorgesetzten. Bis in die 1970er-Jahre hinein wird Arthur Fauser versuchen, einen Verlag zu finden für einen Roman und ein Kriegstagebuch, doch auch die Vermittlungsversuche des Sohnes bleiben ohne Erfolg. [BRFW, 1975, S. 100]
Den Hauptteil des Lebensunterhalts der kleinen Familie bestreitet Maria durch Arbeiten für den Rundfunk und später für das Fernsehen, damit Arthur sich vor allem der Malerei widmen kann. Das tut er zunächst mit Erfolg, doch Ende der Siebzigerjahre schreibt er bitter an seinen Sohn: »… immer habe ich gedacht, ich hätte einen Schutzengel, damals, als ich nichts wie Unrat war und in Genua von keinem der besoffenen finnischen Seeleute versehentlich abgestochen wurde, und in kein KZ kam, und nicht mal im Krieg, bei so viel Chancen, irgendwo liegen blieb, und heute werde ich sozusagen von Deiner Mama ernährt, und nicht erst seit heute, und wenn in zwei Jahren deine Mutter Rentenempfängerin wird, wird sie mich von ihrer kärglichen Rente ernähren müssen – eine Vorstellung, die mich nachts vor Scham fast erstickt, und diese Scham ist für meinen Stolz ein zu hoher Preis. Deshalb also hat mich der Schutzengel vor dem Krepieren bewahrt: es war kein Engel, sondern ein heimtückischer Teufel.«63Maria Fauser kommentiert, handschriftlich, am Rand: »Papi hat völlig antiquierte Anschauungen, aber ich kann sie ihm nicht nehmen. Dieser Männlichkeitswahn! Als wenn das nicht wurscht wäre, wer das Geld verdient.« Dieser »Wahn« ist bis heute Realität. So arbeiteten 2022 nur bei zwei Prozent der erwerbstätigen Elternpaare in Deutschland die Mutter in Vollzeit und der Vater in Teilzeit.64 Geld und Erfolg spielen durchaus eine Rolle bei den Fausers – nicht zuletzt ist Arthur Schwabe und gelernter Bankkaufmann. Am 18. Oktober 1954 verfasst der zehnjährige, oft kränkelnde Jörg auf einem Kellnerblock der Firma »Ronnefeldts Tee« das schon erwähnte Testament, in dem er Mutter und Vater je 135 Mark und dem Jugendfreund ThomasKirn »die Spielsachen im 1. Fach der Spieltruhe« vermacht – und alle anderen den »armen Kindern«.
Kunst ist bei den Fausers hart erarbeitet, mit Distanz zum Betrieb und seinen Moden, das Ergebnis nie ablösbar von moralischen Kriterien. Es ist dieses Berufsethos, das Jörg Fauser von beiden Eltern mitgegeben wird. Er wird es nie verleugnen, im Gegenteil, sogar dem Vater gegenüber darauf insistieren, dass beider künstlerische Arbeit in einer intensiven Verbindung steht. »Nur Dinge malen, die ich erlebt habe, die ich gesehen habe«65 – eine gesamtfausersche Maxime, gewiss, aber ursprünglich die von Arthur. Diese Eltern werden dem Sohn genug Anlass zu Protest und Streit geben, zu radikalen Abkopplungsbemühungen und libertären Experimenten. Aber das Gespräch wird nie abbrechen. Ihre politische und künstlerische Integrität bleibt von ihm unbestritten. Das unterscheidet Jörg Fauser wesentlich vom Mainstream seiner Generation. Er unterzieht sein Elternhaus, seine Erziehung, sein Heranwachsen keiner öffentlichen Kritik und keiner direkten literarischen Ausschlachtung. Er, der sein Leben als Rohstoff seines Schreibens sah, wollte oder konnte in seiner Kindheit davon nichts entdecken. Seine Analyse 1979 bleibt scheinbar unpersönlich, abstrakt:
Wohl nie war der Abstand zwischen zwei Generationen so groß wie der zwischen den um 1910 Geborenen [Arthur Fauser geb. 1911] und ihren Kindern. Wohl nie können diese Kinder vergessen, dass sie mit 12 oder 14 oder 16 Jahren sich bewusst zu werden hatten, Deutsche und umstellt von Mördern zu sein. Und wohl nie werden sie den Schrecken, die Scham und die Furcht vergessen können, die sie empfanden, als sie hörten, dass viele, ja die meisten ihrer Kameraden nichts wussten von den Mördern, von den Öfen, von den Opfern.66
Eine Darstellung der Kindheit und Jugend Jörg Fausers führt zu einem hochsensiblen, aber auch aggressiven, belesenen, frühreifen jungen Erwachsenen; einer, der weiß, dass zum Leben Leiden und Tod gehören und dass man nicht leben kann, ohne dem Tod im Rausch der Wörter und Substanzen für Augenblicke von der Schippe zu springen. Sein Kindheitsfreund ThomasKirn sagt, von irgendetwas sei Jörg immer abhängig gewesen, bis zu seinem »entsetzlich dummen Tod«.
Überleben in Sick City
… nur wuchs ich in Frankfurt/M. 50 auf.
Jörg Fauser in Rohstoff
1950 kommt Jörg Fauser rechtzeitig zur Einschulung zu seinen Eltern nach Frankfurt. Es wird das, was man eine Heimatstadt nennt. Hier hat ein linksintellektuelles, am klassischen Bildungskanon festhaltendes Bürgertum die Nazizeit überdauert. Kaum einer dieser Leute ist in der Nazizeit als Jude oder Kommunist verfolgt worden, ist emigriert oder hat sich dem Widerstand angeschlossen – im Gegensatz zu Arthur Fauser. Aber man engagiert sich in der Deutschen Friedensunion gegen den Atomtod, für die Anerkennung der DDR und der Oder-Neiße-Grenze, kämpft gegen die Wiederbewaffnung, immer in Erwartung eines dritten Weltkriegs; und man geht selbstverständlich davon aus, dass die Telefone vom Verfassungsschutz abgehört werden.67 Jörg Fauser wird dieses Milieu – wohl das liberalste, das die Fünfzigerjahre in Westdeutschland zu bieten hatten – später immer unter »die Rollkragenpullover« abbuchen. In diesen Kreisen kennt jeder jeden.
Jörgs neue Heimatstadt ist zudem Sitz der Frankfurter Schule und wird neben Westberlin die Hochburg der Studentenbewegung. Das Frankfurter Schauspiel fungiert als westdeutsche Außenstelle des Berliner Ensembles Bertolt Brechts, der ortsansässige Suhrkamp-Verlag ist seine Adresse im Westen.
Maria und Arthur Fauser versuchen, sich in der zerbombten Stadt eine Existenz aufzubauen. Von einer aus der Not der Umstände geborenen »WG« mit vier Familien in einer Wohnung ziehen sie in eine Villa in der Grillparzerstraße 66, wo sie aber auch in nur einem Zimmer leben. »Später bekam Arthur eine Mansarde zum Malen; dann bekamen wir eine zweite für Jörg zum Schlafen.« 1956 räumen die amerikanischen Truppen als letztes beschlagnahmtes Viertel die in den Zwanzigerjahren angelegte, acht Kilometer vom Zentrum entfernte Römerstadt-Siedlung von Ernst May. Die Fausers ziehen dort in einen modernistischen Bungalow, in dem die Eltern Fauser bis zu Marias Tod leben – mit Jörgs Kinderzimmer, dem Wohnzimmer mit Blick auf einen kleinen Garten und der »Frankfurter Küche« im Erdgeschoss, mit einem Schlafzimmer im ersten Stock und dem Atelier von Arthur. Ein weder beengtes noch besonders großzügiges Wohnen in einer Frankfurter Vorstadt.
Hat Maria Fauser ab 1949 in drei Dutzend künstlerischen Radioproduktionen mitgewirkt,68 so erwächst 1955 ihr und der Familie eine ganz andere regelmäßige Einnahmequelle: Maria spricht von da an bis 1980 einen morgendlichen fünfminütigen Ratgeber, dessen Anmoderation »Guten Morgen, meine lieben Hausfrauen« sie zu einer bis heute erinnerten – etwa von Fausers Jugendfreund ThomasKirn – lokalen Berühmtheit macht, nicht unbedingt zu Jörgs Gefallen. Nach und nach drängt dieser Broterwerb beim Rundfunk ihre künstlerische Arbeit in den Hintergrund, aber noch 1970 ist sie in einem ARD-Zweiteiler nach Eugene O’Neills Trauer muss Elektra tragen zu sehen. Eine wirklich erfolgreiche Schauspielkarriere ist das nicht unbedingt. Und auch Arthur Fauser ist von einer Karriere weit entfernt: Er malt, was er will, scheitert aber damit, sich dauerhaft als Künstler ökonomisch zu etablieren, auch wenn er bis 1976 mindestens alle zwei Jahre ausstellt.69 Sohn Jörg, so lässt sich dessen Lebensweg interpretieren, hat diese Lektion verstanden: Eine bürgerliche Existenz auf dem boulevard of broken dreams ist keine Option für ihn. Er wird Profi, der seine Kreativität zur Verfügung stellt, wenn gezahlt wird. Künstler sein heißt für ihn, von seiner Kunst leben zu können.
Zunächst aber läuft es bei Arthur Fauser. Er erhält für seine Malerei Auszeichnungen, 1956 den Darmstädter Kunstpreis, 1958 das Aufenthaltsstipendium in der Villa Massimo in Rom – wo der bildungsbegeisterte Sohn ihn besucht – und 1959 den Hans-Thoma-Staatsgedenkpreis. Letzteren nimmt er aus den Händen des CDU-Politikers und Nazijuristen Hans Filbinger entgegen, der von 1966 an Baden-Württemberg als Ministerpräsident regieren wird, bis er im Zuge der »Filbinger-Affäre« zurücktritt: Als Militärrichter bei der Marine hatte er mehrere Todesurteile gefällt, an denen er festhielt und bis zu seinem Ende nichts Falsches erkennen konnte.
Auch wenn zu jener Zeit Arthur Fauser regelmäßig im In- und Ausland ausstellt und auch verkauft, ist eine weitere Einnahmequelle dennoch nicht unwillkommen: Jörg wird durch Vermittlung der Mutter als »Purzel« ein Kinderstar in der ersten Kindersendung des HR, zunächst beim Radio – dort unter anderem im Hörspiel Wildwest zusammen mit dem späteren Starmoderator Hans Joachim Kulenkampff –, dann beim 1953 gegründeten Fernsehen.70Als Jörg auch in Werbespots Rollen spricht, verdient das Kind eine Zeit lang mehr Geld als seine Eltern. Überhaupt ist er ein altkluges Wunderkind, zart, »klein und schmächtig und sehr dreieckig mit dem Schädel« (ThomasKirn), oft krank, verschlossen und jähzornig. Wie besessen zeichnet er blutige Römer- und Ritterschlachten, schreibt Gedichte und dramaturgisch ausgefeilte, recht brutale Theaterstücke71 bis hin zu kompletten – dem Spiegel-Layout nachgestalteten – Zeitungen. »Er war wenig auf der Straße, muss ich sagen, da hat er wenig gespielt. Er hat viel zu tun gehabt mit seinem Schreiben. Das war ihm ein Bedürfnis«, erinnert sich seine Mutter. Im Gegensatz dazu erinnert sich die Schriftstellerin Eva Demski an ihren Schulkameraden und »Purzel«-Kollegen durchaus als einen prügelnden Jörg mit nicht unerheblichem Gewaltpotenzial, einen »aggressives Purzel«; und Kirn erzählt von langen, wilden Spielnachmittagen an der noch unverbauten Nidda.
Nachdem die Begabung des Kindes schon in der Grundschule aufgefallen ist, empfehlen die Lehrer 1954 den Übertritt auf ein humanistisches Gymnasium. Es wird das Lessing-Gymnasium sein, das älteste in Frankfurt. Maria Fauser: »Ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt, soll er auf die Waldorfschule, weil die doch sehr musisch ist, und da sagte mein Mann: ›Nein, er muss gerade auf eine gewöhnliche Schule, denn musisch ist er ja, da braucht er nicht noch unterstützt zu werden.‹«
In welchem konkreten Umfeld Jörg seine nächsten Jahre absitzt, schildert Fausers drei Jahre jüngere Mitschülerin, die Autorin Ulrike Heider, in ihren Erinnerungen so: »›Wir bei Lessings‹, war eine bei Lehrern wie Schülern beliebte Phrase, aus der der ›Geist‹ dieser Lehranstalt wehte. […] In den späten Fünfzigerjahren betrachtete man sich ›bei Lessings‹ als geistige Elite und blickte […] auf die ›Neureichen‹ herunter, die mit ihrem Geld protzten, aber eigentlich dumm und vor allem ›ungebildet‹ waren. […] Tatsächlich mußten die Oberschüler nirgendwo in Frankfurt so viele Hausaufgaben machen, so viel strenges Abfragen über sich ergehen lassen und so schwierige Klassenarbeiten schreiben wie am Lessing-Gymnasium.«
Bei der Einschulungsfeier schließt der Direktor mit den Worten: »Jetzt sehe ich noch viele von euch. Wenn euer Jahrgang Abitur macht, wird nur noch ein Drittel übrig sein.« Die soziale Auslese ist rigide, in Heiders sieben Schuljahren am Lessing-Gymnasium nehmen sich mehrere Schüler das Leben.72 Dementsprechend schnell schwindet auch Jörgs anfängliche Begeisterung für die neue Schule – er schreibt lateinische Verse, lernt gern Griechisch – und wandelt sich mit der Pubertät zu einer ausgeprägten Verweigerungshaltung.
Mit zwölf macht er seine letzte Hörfunk-Produktion, im August desselben Jahres 1956 hat er im Fernsehfilm Das Haus am Hirschgraben noch eine Sprecherrolle. 1957 publiziert er dann schon in Schülerzeitungen: nach Anläufen als Sportreporter (u.a. »Interview mit Manfred Grasse, dem Kapitän unserer Fußballmannschaft«) den in mehreren Fortsetzungen kreierten Kriminalroman Ein Fall wie jeder andere und im Sommer 1959 in Monokel einen letzten »Leitartikel« über den Zustand der Sozialdemokratie: Vorwärts, Genossen, wir müssen zurück!
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in Fausers Briefen aus den Jahren. Die innige Liebe zum Vater, sein Wunsch, ihm zu gefallen und sich an und mit ihm messen zu wollen, wird peu à peu ergänzt von Verve und Widerspruchsgeist sowie dem Willen zur Abgrenzung. »Ob ich ein guter Politiker werde, wird die Zukunft und werde ich entscheiden!!!!!!!!!! Und niemals Du!!!!!!!!!!«, schreibt er Arthur1958.
Mit Mann und Sohn zu Hause auf dem Sofa sei sie nie zu Wort gekommen, erinnerte sich Maria Fauser im Gespräch, die beiden hätten immer über Politik und Literatur debattiert. Sie beschreibt ihren Mann als »Autorität«, als vom Habitus, nicht von den politischen Ansichten her »rechts«.
War Jörg Fausers Kindheit nun glücklich, unglücklich, prägend, eintönig, bedeutungslos oder einfach normal? Abzuzeichnen scheint sich ein Leben zwischen künstlerischem Ehrgeiz, Abgrenzung und Willen zur Leistung sowie gerade der rauschhaften Verweigerung dieser Lebens-Leistung: Die Welt, die das Kind vorfindet, ist nicht ausreichend, nicht weit genug. Fauser wird so bald wie möglich versuchen, in andere Dimensionen vorzustoßen – um immer wieder zurückzukommen in das unverändert zur Verfügung stehende Kinderzimmer.
Frühe Fluchten
Mit Grabbehatte ich praktisch lesen gelernt.
Jörg Fauser in Kein schöner Land, 1979
Walter Gußmann4 ist Schauspieler und ein Neffe Arthur Schnitzlers. Maria hat ihn 1936 kennengelernt. Als er als Jude aus Nazideutschland fliehen muss, bittet er sie, seine Bibliothek zu verwahren. Nach Ende des Krieges kehrt er zurück und nimmt sie wieder an sich – mit einer Ausnahme: Seine zweibändige, von Schnitzler signierte Grabbe-Ausgabe schenkt er dem begeisterten Jörg.73
»Die Lebensangst, das Auffangen von Niederlagen und einfach was tolles bringen«74– das ist Fausers bleibende Faszination. In einer Schülerzeitung verleiht er 1957 seiner Begeisterung für Grabbe, »der zu Unrecht heute zu verkannt ist«,5 Ausdruck. Grabbe ist der Urschriftsteller des 13-Jährigen, noch zwölf Jahre später nennt er ihn den »Irrwisch, der im biedermeierlichen Muff seiner Umgebung krepiert war wie der sprichwörtliche arme Hund«, Grabbe ist der »Held meiner Kindheit, der Genosse meiner schlaflosen Nächte«, der »im finalen Säufer-Koma gelegen und an den Folgen der Welt krepiert war«.75Grabbe ist der im Provinzmief eingesperrte Schriftsteller, der seine gesamte Existenz in den Ring wirft, er ist der größenwahnsinnige Hypersensible, der die Spannung hält, bis es ihn zerreißt. Bei Grabbe lernt Fauser, dass Befreiung versucht werden muss, und auch, was sie kostet.
Der Heranwachsende darf lesen, was er will, und entwickelt eine Vorliebe für Geschichtsdramen, Penthesilea von Kleist liest er der Haushaltshilfe der Fausers beim Bügeln vor, Shakespeare rezipiert er als Krimiautor, indem er die Plots nacherzählt. Hier lernt er auch den Caliban kennen, den »Wilden«, den »brutalen Charakter« aus Der Sturm, mit dem er in den 1980er-Jahren seine Kolumnen für das Berliner Stadtmagazin Tip anonym zeichnen wird, bis er sie, wiederum shakespeareanisch, mit Wie es euch gefällt betitelt. Hinzu kommen früh Autoren wie William Carlos Williams und Ezra Pound, die Hausheiligen Gottfried Benn und Joseph Roth, Else Lasker-Schüler und andere Expressionisten, Arthur Rimbaud und Charles Baudelaire – der nach Maria Fausers Vermutung als Erster Jörgs Neugier auf Rauschgift weckt, wenn man den häuslichen Alkohol-, Tabak- und Medikamentengebrauch außen vor lassen will.
Als Jörg Fauser in die Erwachsenenwelt eintritt, ist ihm der klassische und moderne literarische Kanon vertraut. Er muss sich nach Neuem umsehen: Das Neue heißt Jack Kerouac.
Krise als Chance
Mein Leben ist traurig, ist schwer, eintönig, weil ich ein Künstler bin.
Anton Čechov, Motto aus Jörg Fausers Alles wird gut
Der Gymnasiast Jörg Fauser ist ein »Eigenbrötler«, »sehr kritisch«, »sehr bohrend« (Eva Demski). In der 6. Klasse etwa schreibt er in einem Aufsatz zum Thema ›Was bedeutet: Gott schuf den Menschen zum Bild Gottes?‹: »Früher und heute gab es Menschen, die absolut an Gott glaubten, aber grausam waren. Denken wir an die Spanier, als sie die uralten Schätze der Inkas raubten, Städte zerstörten, Greueltaten verübten. Es waren alles gottesfürchtige Leute, aber waren es Ebenbilder Gottes? Dann müßte ja Gott grausam und böse sein. Und er ist ja ziemlich grausam, denn diese Menschen können ja nicht dazu, wenn sie so böse sind, denn Gott schuf ja den Menschen! Wenn es so steht, möchte ich kein Ebenbild Gottes sein. Und deshalb ist es meiner Meinung nach falsch, wenn die Leute sagen, wir wären das Bild Gottes!«
Und der Kommentar des 14-Jährigen zur Bundestagsdebatte über die von Franz Josef Strauß geforderte atomare Aufrüstung der Bundesrepublik endet mit dem Diktum: »Aber sowie ich die Macht habe, lasse ich sie alle aufknüpfen. Und dann wird der Bundestag geschlossen. Nur kein Parlament!« Im selben Jahr 1958 hört er bei Richard Kirn, Journalist bei der Frankfurter Neuen Presse und Vater seines in den ersten Lessing-Jahren besten Freundes ThomasKirn, »zum ersten Mal die Internationale« – »Ein erhebender Augenblick!«
1959 und 1960 erscheinen in Vater Kirns Zeitung zwei Berichte Fausers über Klassenreisen nach Frankreich.6
Richard Kirn, Freund der Familie und Bewunderer von Arthur Fausers Kunst, versorgt Jörg mit politischen Büchern, u.a. Illustrierte Geschichte der Deutschen Revolution von 1918/19, erschienen 1929 im Internationalen Arbeiterverlag. Fauser liest auch Mein Kampf.ThomasKirn, später ebenfalls Journalist (bei der FAZ), erzählt, er habe es den 68ern nie abgenommen, dass sie in ihrer Kindheit nichts über die Nazizeit erfahren hätten: Von seinem zehnten Lebensjahr an sei er von seinem Vater mit Büchern und Filmen zum Thema aufgeklärt worden über die Verbrechen der Deutschen, ihm sei »das alles geläufig gewesen – wie auch Fauser«.
Rückblickend ordnet der diese Phase politischen Erwachens so ein: »Als ich beschloß, Politiker zu werden und nach Bonn zu gehen, war ich knapp vierzehn. Es war die Zeit der großen Bundestagsdebatten über die Atombewaffnung, und ich konnte mich kaum noch vom Radioapparat trennen, wo ich an einer Art politischem Initiationsfieber litt: ›Ruhig! Jetzt spricht Wehner!‹ Ja, Herbert Wehner war mein Abgott, obschon ich nach soviel Jahren nicht mehr recht nachvollziehen kann, was in meinem Kopf vorging, […] Schauer liefen mir über den Rücken, wenn ich in Kürschners Volkshandbuch Deutscher Bundestag – 3. Wahlperiode blätterte und entdeckte, daß es da oben in Kassel einen Abgeordneten gab, der noch keine dreißig war, Holger Börner, Betonfacharbeiter: Noch vierzehn Jahre, dachte ich dann, und du sitzt hinter Herbert Wehner und verteidigst ihn gegen diese Lümmel in der Mitte und rechts – und wenn du auch Betonfacharbeiter wirst.«76
Mit jedem Jahr geht es nun mit den Schulleistungen bergab. Flattern Weihnachten die blauen Briefe ins Haus, strengt er sich ein bisschen an. Die naturwissenschaftlichen Fächer interessieren ihn nicht, bei den geisteswissenschaftlichen sind ihm die Lehrer nicht gewachsen. Eine Aura von Lethargie und Verweigerung umgibt ihn. Schließlich muss er 1961 eine Klasse wiederholen. Aber was zählt das schon für einen, der seiner Freundin Dorothea Rein im November 1962 in einem Brief schreibt: »Ich bin Kommunist, weil ich die Welt, in der ich zu leben leider verurteilt bin, als fragwürdig und mehr als das: als verdorben, angefault und stinkend ansehe und empfinde. Ich wünsche mir also eine bessere Welt, eine reine Welt, eine gerechte Welt, eine Welt, in der es keinen Krieg und keinen Hunger und kein Mißtrauen gibt. Eine Welt, in der ich weniger über Trauer und Angst und Einsamkeit, mehr aber über Liebe, Freundlichkeit und Geborgenheit schreiben könnte. Diese Welt verspricht mir der Kommunismus. Ob er jemals sein Ziel erreichen wird, ist mehr als ungewiß, ist unwahrscheinlich. Aber darf das mich davon abhalten, daran zu glauben, dafür zu kämpfen, vielleicht dafür zu sterben? […] liebe weder Stalin noch Ulbricht noch ihr System, ich verachte sie beide (die Personen, nicht das System).«
Sein politisches Interesse verschiebt sich nach solchen Statusbeschreibungen von der kommunistischen Arbeiterbewegung hin zum Anarchismus. »Aus freien Stücken interessiert der Anarchismus alle, die die Beruhigung brauchen, dass es schon immer Unruhe gegeben hat, gibt und geben muß. Anarchismus interessiert und packt diejenigen, die noch keine Rezepte haben, noch keine sicheren Positionen, nirgendwo Fuß gefaßt haben – und das alles auch gar nicht wollen«,77 heißt es im Vorwort der Werke Bakunins, die 1975 im – aus der Berliner Linkeck-Kommune hervorgegangenen – Karin Kramer Verlag erscheinen. 1968/69 werden wir im Umfeld dieser Kommune Jörg Fauser begegnen. Bakunin selbst sagt: »Die wahre Schule für das Volk und alle erwachsenen Leute ist das Leben.«
Bakunin ist der einzige politische Theoretiker, der Fauser prägt und sein Leben lang, auch in Buch- und Filmprojekten, beschäftigt. Was Fauser bei ihm, bei den Anarchisten findet, hat Enzensberger in Der kurze Sommer der Anarchie geschildert, wenn er über die Veteranen des Spanischen Bürgerkriegs schreibt: »Diese Revolutionäre aus einer anderen Zeit sind gealtert, aber sie wirken nicht müde. […] Ihre Würde ist die von Leuten, die nie kapituliert haben. Sie haben sich bei niemandem zu bedanken. Niemand hat sie ›gefördert‹. Sie haben nichts genommen, keine Stipendien verzehrt. Sie sind unbestechlich. Ihr Bewußtsein ist intakt.«78
Fauser liest auch die französischen Autoren des Nouveau Roman und die deutschen der Gruppe 47. Aber dort ist nicht, was er sucht, »die paar vertrockneten Progressiven, Böll, Gott ja, konkret so aufregend wie Kirchenfunk, die Rollkragenpullover bei der Humanistischen Union, na und? Kultur als Käsestulle.«79
Silvester 1962/63 – da ist er 18, volljährig war man bis 1974 erst mit 21 – lernt Jörg Fauser auf einer Party in Frankfurt die junge Engländerin Stella Margrave aus proletarischem Londoner Milieu kennen und verliebt sich in sie. Im Sommer 1963 reist er zu ihr nach London – und hat nicht die Absicht, so schnell zurückzukommen. Davon zeugt der erste zugängliche Brief des erwachsenen Jörg an die Eltern vom 13.7.1963, der sich auch als eine Bilanz der vergangenen fast 19 Lebensjahre lesen lässt: »Ich weiß genau, daß mein Vater, er vor allen, davon überzeugt ist, ich sei einzig und allein nach London gefahren, um mich hier herumzutreiben, und wegen Stella. Diese Annahme ist falsch. Es wäre glaube ich, ziemlich gefährlich, auf ihr zu beharren: ihr könnt mich zwar mit gesetzlichen Mitteln dazu zwingen, noch zwei Jahre in Frankfurt und bei euch zubringen zu müssen: aber seid davon überzeugt, daß ich, sooft es nur ginge, wieder das täte, was ich gerade getan habe. Allmählich werde ich unempfindlich gegenüber anderer Leute Meinung von mir, auch eurer (da ich ohnehin weiß, daß mein Vater mich für eine Niete und einen Taugenichts und Versager hält, womit er, aus seiner Sicht, völlig recht hat). Ich bin hier zum ersten Mal in meinem Leben glücklich, auch ohne viel Geld, ohne warmes Essen und sonstigen Luxus. Ich könnte es überall sein, wo ich für mich leben kann und nicht für andere Leute. Soll ich euch zu Liebe etwas tun, das ich hasse? Die Zeiten sind vorbei.«
Obwohl Jörg Fauser diesen Fluchtversuch nicht durchhält, dem Druck des Vaters nachgibt und ihm verspricht, das Abitur zu machen, ist die Kindheit nun vorbei. Im November 1963 veröffentlichen die SPD-nahen Frankfurter Hefte – auf Vermittlung von Dorothea Rein, deren Mutter dort als Sekretärin arbeitet – die Rezension zu einer von Hans Magnus Enzensberger herausgegebenen Gedichtsammlung des Barockdichters Andreas Gryphius, Titel: Und was sind unser Taten, Autor: Jörg Christian Fauser. Es ist sein erster Text in einer überregionalen Zeitschrift, seine erste ›richtige‹ Veröffentlichung – die Würdigung eines Dichters, der sich durch seine Radikalität nicht »für einen Platz an der Sonne in der Gunst der Nachwelt« empfohlen habe. In der Nachfolge von Gryphius stünden sie alle, »von Brecht das Gefälle hinab zu Rühmkorf«. Enzensberger, »der die verletzte Trauer und den stolzen Zorn über die Erbärmlichkeit seiner Zeit mit Gryphius teilt«, kommt gut weg in dieser Besprechung, die einen hohen Ton anschlägt, den verkannten Poeten preist und versteckt-keck in der Schlussformel – einen Vers Enzensbergers aufnehmend – auf die eigentliche Berufung des Rezensenten verweist: »Wer immer diese ›unerhörte schrift‹ schreibt, wir haben sichere Hoffnung, daß er in künftigen Düsternissen ebenso wie in vergangenen irgendwo einige wird betroffen machen.«80
In derselben Ausgabe ist unter dem Titel Die Wende? die beginnende Emanzipation des Staatswesens Bundesrepublik angezeigt: Im Oktober 1963 ist nach vierzehnjähriger Amtszeit und mit 87 Jahren Bundeskanzler Adenauer zurückgetreten. Langsam kommt Bewegung auf. Jörg Fauser geht erst mal wieder zu Schule.
Die großen Städte und der kleine Tod
London, du weißt, ich muß noch eine Weile sein in der Specköde, wohinein mich mein Unglück geboren hat.
Jörg Fauser im Gedicht An London, 1964
Im August 1963 kehrt der Unterprimaner aus London zurück nach Frankfurt – mit Stella. Er will sie heiraten. Stella ist schwanger, im siebten Monat, aber nicht von Jörg. Arthur Fauser toleriert die Beziehung nicht, in einer Auseinandersetzung bezeichnet er Stella als »Flittchen«. Jörg und Stella ziehen zur Mutter seiner Freundin Dorothea.
Auch für Dorotheas Mutter Elisabeth Hagert eine groteske Erfahrung. Ihrer Schwester Senta Stillmark81 schreibt sie:
Hier bin ich wieder einmal – ohne es zu wollen – in den Sog dramatischer Ereignisse geraten. Das Original Kummerl Fauser ist nun doch aus England zurückgekehrt, aber nicht allein, sondern in Begleitung seiner dortigen 18jährigen Freundin, die im 7. Monat ist (aber nicht von ihm). Der alte Fauser hat sich wenig fein benommen, mit Polizei und Gericht gedroht, so daß das arme Wurm auf der Straße gesessen wäre, wenn ich mich nicht eingeschaltet hätte. Jetzt habe ich also eine Einquartierung am Hals, die mir bestimmt zu meinem Glück gefehlt hat. Aber Du kennst mich ja in dieser Hinsicht. Er, der Fauser, will unbedingt die Verantwortung für sie übernehmen, geht von der Schule ab und wird vielleicht im Fischer-Verlag unterkommen, wenn er Glück hat. Also ich kann Dir sagen – ein reiner Dostojewski-Roman. Bin gespannt, wie es weitergeht.82
Nach Maria Fausers Darstellung 2003 habe Elisabeth damals alles wieder eingerenkt. Einem weiteren Brief Elisabeth Hagerts zufolge blieb es aber erst mal kompliziert, Update an die Schwester zehn Tage später:
Unser Hauskummerl haben wir noch, wobei Kummerl eine beschönigende Umschreibung ist, denn das Hascherl hat das Programm der anarchistischen Partei in ihrem armseligen Gepäck. Das ist was, was es wohl nur in England gibt. Paßt zu unserer Stella wie die Faust aufs Aug. Die sieht nämlich aus wie ein verzeichneter Boticelli-Engel – hat hübsches honigblondes geringeltes Haar und schöne blaue Augen, dazu aber eine spitze lange Nase und überhaupt so ein kleines verknittertes Kellerkind-Gesicht. Ist aber sehr lieb und gut zu leiden. Auf meine in holprigem Englisch vorgebrachten guten Witze reagiert sie stets mit einem schallenden Gelächter, so daß ich fürchte, bei der Gelegenheit kriegt sie einmal ihr Kindlein. Gestern war ich mit ihr beim Arzt – es ist alles in bester Ordnung. Ende nächster Woche wird sie uns in Richtung London verlassen. Wir haben uns sehr an sie gewöhnt, so daß es uns fast etwas leid tut. Es ist ja wirklich merkwürdig, daß man in außerdeutschen Ländern die sogenannten sozialen oder bildungsmäßigen Unterschiede viel weniger spürt. Ein Mädchen dieser Herkunft würde in Deutschland vermutlich 30-Pfennig-Romänchen lesen und Peter-Kraus-Platten hören, aber Stella liest die gleichen Bücher wie ich und ist dankbar, wenn ich ihr die Neunte vorspiele (auf dem Plattenspieler versteht sich). Hoffentlich wendet sich ihr Schicksal noch zum Guten, ich würd ihr’s so wünschen.83
Mitte September geht Stella zurück nach England. Für den Rest seiner Schulzeit macht sich Jörg Fauser – von der englischen Geliebten als Christian bezeichnet84 – auf die Suche nach einem Milieu, das ihn der Öde entkommen lässt; Stella plant, nach der Geburt ihres Babys Nichole nach Frankfurt zu ziehen und bei einer US-amerikanischen Familie zu arbeiten.85 Stattdessen reist Fauser vermehrt nach England. »Ich hoffe«, schreibt er Dorothea, »Du wirst auch mal nach London fahren […] denn London und Ostberlin haben die erotischste Ausstrahlung, die ich kenne –«86 Mit der platonisch geliebten Schulfreundin geht er auf den Ostermarsch, worüber er im April 1964 in Freedom berichtet.87 Weitere Beiträge für das Londoner Anarchistenblatt folgen, zumeist abgedruckt im Ressort Briefe.
Ferner, so teilt er Dorothea am 5. Mai 1964 mit, geht »Stella jetzt wieder arbeiten, in irgendeinem Scheißbüro; liest fleißig FREEDOM, und wartet auf mich, hat schon einen Platz in einem Feld, unter einem Ginsterbusch, bei einer alten Arbeitersiedlung, wo wir liegen werden, irgendwann; und das hält mich halt aufrecht – das und meine tiefinnerste Überzeugung, daß ich doch, eines Tages, wenn ich nur bis dahin überlebe, schreiben werde, wie ich’s mir vorstelle«.
Es sind Gedichte, die er spürt, doch dafür müssen die Bedingungen stimmen. Was das Paar umtreibt, ist im Kleingedruckten von





























