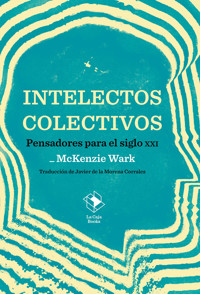Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: August Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Was wäre, wenn du trans wärst und es nicht wüsstest? Wenn es eine Lücke in deinem Leben gäbe, von der du nicht mehr als eine unbestimmte Ahnung hast, dass es sie gibt? Wenn du dich nur im Drogenhoch oder beim Sex in deinem Körper zu Hause fühlst? Vom Sydney der 1980er Jahre bis ins heutige New York, in den sich wandelnden politischen und medialen Landschaften des späten zwanzigsten Jahrhunderts, spinnt Reverse Cowgirl eine Komödie der Irrungen. McKenzie Wark ist dabei, als aus dem Aufbruch von 1968, aus Punk, Disco und schwul-lesbischen Subkulturen neue Identitätsentwürfe entstehen – doch sie muss feststellen, dass sich ihr Leben weiterhin den Namen und Kategorien entzieht. Zwischen dem Versuch, als schwuler Mann zu leben, und jenem, als Mann mit Frauen zusammen zu sein, erkennt Wark, dass sie ganz anderer als der etablierten Erzählungen bedarf. Mit Anleihen bei den Genres der Autofiktion und Fiktionskritik entsteht so das gleichermaßen drastisch wie berührende Memoir einer Nichtexistenz: die Autoethnografie der Undurchsichtigkeit unseres Selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gustave Doré, Arachne,Illustration zu Dante Alighieris
Göttlicher Komödie
, Fegefeuer/12. Gesang, 1868
MCKENZIE WARK
REVERSE COWGIRL
Aus dem Englischen von Johanna Davids
August Verlag
INHALT
Teil eins: Orpheus spricht
Teil zwei: Eurydike spricht
Chorus
Danksagung
Nachwort zur deutschen Ausgabe
Ausführliches Inhaltsverzeichnis
INHALTSSVERZEICHNIS
Teil eins: Orpheus spricht
Traumamonster
Ruf mich
Sherwood Forest
Cowboystiefel
Widerstand durch Rituale
Männer
Genoss*innen
Vorlieben
Locker Room Talk
Kreiswichsen
Ein Spion im Haus
Der Gaslighter
Das Mädchen
Wie du gefickt wirst (Anleitung)
Gebrauchsanweisung
Schlampen-Pride
Was uns nicht stärker macht, bringt uns um
Die Nachgeburt der Klinik
Transaktionskosten
Liebe und Geld; Sex und Tod
Meine Berufung
Direkteinspritzung
Die Ecstasy-Jahre
Penetration
Das Raum-Zeit-Kontinuum pervertieren
Beobachten, wie du beobachtest, wie er mich fickt
Mardi Gras
Femenin
Der diskrete Ekel der Bourgeoisie
Häute und Zeichen
Narrativ des Niedergangs
Libidinöse Ökologie
Vertrauen
Was machst du nach der Orgie?
Schwule Gesellschaft
Flussabwärts
Klassenanalyse
Dienstleistungsberufe
Straightes Leben
Die andere Seite der Verführung
Mirandas Film
Umrüsten
Pimmel-Tech
Die Rückkehr der Nichtexistenz
Du bist deine Aufmerksamkeit
Queen Bitch
Unidentified Flying Chicken
Frauen und Kleider
Purple Reign
Die Kunst der Zirklusion
Abspann
Latentes Schicksal
Teil zwei: Eurydike spricht
Lakehouse
Orphée et Eurydice et les autres
Gendereuphorie
Girldick
Rechnung, bitte!
Chorus
Danksagung
Nachwort zur deutschen Ausgabe
Ausführliches Inhaltsverzeichnis
TEIL EINS:ORPHEUS SPRICHT
Traumamonster
Mein Vater ruft mich zu sich und nimmt mich auf den Schoß. Das ist ungewöhnlich, denn in Körperkontakt ist er nicht besonders gut. Ich bin erst sechs, trotzdem ahne ich, irgendwas ist los. Wir sitzen auf dem schwarzen Vinylsofa, groß und kantig wie die durchgehende Sitzbank in einem Sechziger-Jahre-Auto. Er hält mich im Arm und sagt mir, dass meine Mutter tot ist.
Meine Mutter ist tot, sagt er mir. Die Welt schwankt in einem trägen Rhythmus, Wellen von Störgeräuschen im Wechsel mit Wellen von klarem Nichts. Das schwarze Vinyl des Sofas, die graue Wolle seiner Hose, meine eigene Haut, die Luft, die Wände, sie alle teilen eine schwummrige Komplizenschaft. Da ist ein schmatzendes Geräusch, aber ich höre nichts. Da ist eine Subtraktion, wie ein Schnitt in einem Film. Für einen Augenblick bin ich überhaupt nicht dort.
Und dann war ich zurück. Ich erinnere mich nicht, was danach passiert. Überhaupt erinnere ich mich an nicht viel. Vielleicht gibt es eine andere Art von Erinnerung. Eine Erinnerung nicht an ein Ereignis, sondern an eine Art Nicht-Ereignis. Eine Erinnerung an Nichts. Eine Leere. Es gibt Augenblicke, da existiere ich nicht. Diese Augenblicke will und fürchte ich gleichermaßen.
Ich hatte mal einen Freund, der das geschehen lassen konnte. „Fick mich, bis ich nicht existiere.“ Das war es, was ich von ihm wollte. „Du behandelst mich wie Dreck“, sagte er. „Das bin nicht ich, das ist das Nicht-Existieren“, sagte ich dann zu meiner Verteidigung. „Ich will, dass du mich fickst, bis ich nicht existiere. Ich will und fürchte diese Augenblicke.“ Diese Augenblicke, wenn die Welt in einem trägen Rhythmus schwankt. Dein Körper und meiner, Blut, Spucke, die zerfetzten Tapeten, sie alle in einem verschmierten Amalgam.
Also verließ ich ihn. Ich hatte eine Freundin, die auch diese Augenblicke hatte, Augenblicke, in denen sie nicht existierte. Diese Augenblicke wollte und fürchtete sie gleichermaßen. Es funktionierte so lange, wie jederzeit mindestens sie oder ich existierte. Es war eine Frage der Synchronisierung. Aber manchmal existierte niemand von uns beiden mehr. Oder schlimmer: Manchmal existierten wir beide zur gleichen Zeit. Wir konnten nicht beide in der Welt sein. Jemand musste kein menschliches Wesen sein.
Letztlich funktionierte es also nicht. Also hatte ich einen neuen Freund. „Fick mich, bis ich nicht existiere“, bat ich. Also fickte er mich, während ich schlief. Vielleicht hatte er sich verhört. Er fickte mich, als ich nicht da war. Ich entsinne mich nicht, ihm die Erlaubnis gegeben zu haben. Doch andererseits erinnere ich mich an viele Dinge nicht.
Eines Tages erzählte er mir: „Meine Großmutter ist gerade gestorben. Jetzt bin ich der einzige noch lebende Mensch, der unsere Sprache spricht.“ Es war eine sehr alte Sprache. Und nun war sie tot. Mit dem Tod seiner Großmutter war niemand mehr übrig, zu dem er in ihr hätte sprechen können. Seine Großmutter war tot. Seine Sprache war tot. Aber er war noch am Leben. Die Welt schwappt und gluckert mit einem Brechreiz erregenden Schlingern. Das Bett, die Lampe, seine sommersprossige Haut, alles verliert an Trennschärfe.
Nur bin ich jetzt, wo mein Vater war. Ich erlebe mit, wie sich eine Subtraktion vollzieht, eine Person aus der Welt herausgerissen wird. Nur ist es diesmal noch schlimmer. Es ist nicht eine Person, es ist ein Volk, aus der Welt geschnitten.
Dieses Miterleben ist beschämend. Ich wäre am liebsten vom Ort des Geschehens geflohen. Ich denke, mein Vater wäre am liebsten vom Ort des Geschehens geflohen. Man kann nicht anwesend sein, während eine andere Person aufhört, eine Person zu sein. Wenn die andere Person, und sei es bloß für einen Augenblick, nichts als zitterndes Fleisch ist. Ich denke, dieser andere Freund schämte sich. Obwohl ich die Abwesenheit nicht fürchtete, sondern ersehnte. Jener Zustand, wo zufällige Brocken von Fleisch, Holz, Stahl, Luft, was auch immer, einfach kreuz und quer durcheinander liegen, ein Haufen von pulsierendem Krempel.
Das ist das Problem am Menschsein. Wir existieren nur dann füreinander, wenn wir nicht existieren; und nicht füreinander existieren wir nur in jenen Augenblicken rohen Existierens. Wir sind Monster der Existenz und Nichtexistenz. Das wars.
Ruf mich
Ruf mich … Ach, ich weiß nicht. Ich weiß die Namen nicht. Ich wusste die Namen nie. Damals gab es keine Namen oder jedenfalls keine süßen. Ich war ein Kind der Sechziger, Teenager mit den Siebzigern, Universität in den Achtzigern. Möglichkeiten, Mensch zu sein, wurden geboren, aber sie bekamen nicht immer gute Namen.
Jetzt gibt es Namen, aber sie fühlen sich zu geeignet an, wie Dinge, die man in einem Profil posten könnte. Ich habe mich daran gewöhnt, nicht als irgendwas Eigenes oder Geeignetes zu existieren. Ich habe mich daran gewöhnt, als etwas Uneigentliches zu existieren, am Rand zum Überhaupt-nicht-Existieren. Als ob ich keinen Eigennamen hatte oder nur ungeeignete Namen. Ich wusste meinen eigenen Namen nicht oder gar meine eigene Nummer. Eine Geheimnummer. Ich wusste nicht, wen anrufen, um sie herauszufinden.
Ruf mich … Ruf mich jederzeit an. Wäre ich doch nur eine Nummer, die du anrufen könntest. Ich will, dass du anrufst. Ich will, dass du mich willst. Damit ich in deinem Wollen existieren kann. Doch es ist unmöglich, denn ich bin geheim. Muss in das Verzeichnis kommen. Muss bis an die Tür kommen. Entrée in die Welt. Du kannst mich mal, Welt. Komm rein, Welt.
Muss mir ein Sein ausdenken, um nicht nicht zu existieren. Es hat eine Weile gedauert, überhaupt anzufangen. Wenn man nicht weiß, was man will, wenn es nichts gibt, was du als gewollt benennen kannst, bist du nicht da. Du bist nicht zu Hause, selbst wenn sie anrufen.
Sherwood Forest
Es war eine provinzielle Zeit in einer provinziellen Kleinstadt. Newcastle war eine Hafen- und Kohle- und Stahlstadt in Australien, hundert Meilen von Sydney die Küste hoch. Nach und nach verstärkte sich das Bauchgefühl, sie verlassen zu müssen.
Die gesamte Stadt ruhte im Schatten der Stahlwerke. Ihre Anordnung und ihr Tempo waren bestimmt von der Hitze der Schmelztiegel, dem Schlüssel zu ihrer Körperschaft, wo verbrannte Kohle das Eisen weit genug erhitzte, um es mit dem Kohlenstoff oder exotischeren Elementen zu mischen und es fertig zu machen. Am Fluss, für niemanden sichtbar außer für die in den Arbeitsschichten, von nachts bis früh.
Dymphna Cusack: „Die Stange durchbohrte das Spundloch. Mit einem dumpfen Dröhnen brachen Flammen hervor. Funken erfüllten die wimmelnde Öffnung. Der Schwall weißglühenden Stahls quoll hervor. Dies war der Augenblick für den der ganze riesige Werkkomplex existierte. Dies war es, wofür man forschte, plante, arbeitete. Hier, jubilierte Keir, hier ist die glanzvolle Flut, die das ganze Gebäude erleuchtet, sie setzt die Träger der Kranschienen in Szene, füllt das hohe Dach mit sprunghaftem Licht und Schatten, umgibt die dunkle Gestalt des Helfers mit einer sonnengleichen Aura – hier war heute der Quell der Weltmacht. Stahl, sein Stahl. Der Schwall geschmolzenen Metalls versiegte.“
So geht die Familiensaga: Meine Mutter starb, als ich sechs war. Mein Vater war ein passabler Dad. Nahm mich auf den Schoß und las mir Geschichten von Edgar Allan Poe vor. Meist überließ er es meinem Bruder und meiner Schwester, beide älter als ich, sich um mich zu kümmern. Ich wurde aufgezogen von Teenagern. Aufgezogen von Wölfen. Sie gaben wirklich ihr Bestes. Leckten mich sauber. Holten mich pünktlich von der Schule ab. Nahmen mich sogar mit in die Oper. Rockoper: JESUS CHRIST SUPERSTAR und DIE ROCKY HORROR SHOW, die mit ihrer Theatralik in meinem behüteten Gemüt einen tiefen Eindruck hinterließen.
Aber eigentlich, wie fast alle, die in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts in der überentwickelten Welt geboren wurden, aufgezogen vom Fernseher. Rollt es in euren psychoanalytischen Joint und raucht es: Mein Vater war einmal im Fernsehen. In den Lokalnachrichten. Ich sah ihn gleichzeitig hier auf dem Bildschirm und dort am Tisch sitzend. Im Fernsehen wurde er für mich real.
Noch genauer, aufgezogen von Robin Hood und Emma Peel. Im Australien der Sechziger waren sie das Beste, was sich im Fernsehdickicht finden ließ. DIE ABENTEUER VON ROBIN HOOD wurde zwar in den Fünfzigern produziert, aber draußen in den Randgebieten der globalen Anglophilie kamen wir in den Genuss zahlreicher Wiederholungen. Richard Greene als Robin war bildhübsch und so geschmeidig in seinen waldgrünen Strumpfhosen. (Das Grün malte ich mir aus; es war alles in Schwarz-Weiß.) Später erfuhr ich, dass die Serie das Werk von exilierten amerikanischen Kommunist*innen und ihren Mitreisenden war, die auf der „Schwarzen Liste“ standen und nach London getürmt waren, um die Versorgung mit Arbeit und Alkohol zu sichern. Jede Folge war eine Allegorie für die Volksfront. Ich malte mir aus, solche Sendungen entsprängen einer glamourösen Großstadtwelt.
Doris Lessing: „Eine Veränderung trat in meinem gesellschaftlichen Leben ein, denn eine Zeitlang gehörte ich zu einer Gruppe von kanadischen und amerikanischen Schriftstellern. Die meisten waren auf der Flucht vor McCarthy nach London gekommen. Unsere Gruppe‘ war in schnellem Wandel begriffen. Zum einen brachen Ehen und Beziehungen auseinander. Die Frauen oder Freundinnen, die die schweren Anfänge mit durchgestanden und als Agenten und Berater, sogar als Geldverdiener fungiert hatten – fort mit ihnen. Alle in der Gruppe waren starke Trinker. Die Witze handelten meistens davon, wer ein CIA-Agent war.“
MIT SCHIRM, CHARME UND MELONE, die andere Serie, die ich liebte, war eine schwungvolle, London-gefüllte Praline der späten Sechziger mit Diana Rigg als Emma Peel und Patrick Macnee als John Steed. In geheimer Mission vereiteln sie surrealistische Verschwörungen gegen den guten Geschmack und die guten Sitten. In der Eröffnungssequenz hält John Steed eine Flasche Champagner, Emma Peel lässt den Korken knallen, Schaum spritzt in die Höhe.
Am Tag: ein kleinstädtischer Schuljunge mit Klumpfuß. Klumpfüßen, um genau zu sein. Beide Füße deformiert, nach innen gedreht, vor sich hin humpelnd, immer ein paar wackelige Schritte hinterher und außer Sichtweite der gleichaltrigen Jungs. Die Krüppelbewegung war noch lange nicht in Sicht.
Nachts: die leichtfüßige Emma Peel in Robin Hoods Bande von frisch-fröhlichen Männern, im Kampf für Wahrheit, Gerechtigkeit und die kleinen Leute, gekleidet in einen Catsuit aus Leder, rasant unterwegs mit angeklebten Wimpern und einem fetzigen Cabrio. Seite an Seite mit Steed und Robin, die mich stets wie perfekte englische Gentlemen behandelten.
Morgens versammelten wir uns immer in irgendeinem dunklen Schlupfwinkel des Sherwood Forest oder in Emmas Londoner Apartment der Swinging Sixties, was an sich das Gleiche war, wo es Sherry und Innuendo gab, die mir beide sowohl entgingen als auch nicht entgingen. Irgendwo anders gibt es einen Wald der Träume, der Sehnsüchte, wo Liebe und Stil und Kommunismus ihren Platz haben. Aber nicht in dieser Stadt. Nicht in den Sechzigern.
Cowboystiefel
Die Siebziger: Was für eine Zeit, Teenager zu sein, wenn alle Welt sich wie einer zu kleiden scheint.
Ich wollte diesen Körper jener Welt öffnen. Aber welcher Welt? Welchen Körper? Vielleicht muss der Weg mit Häuten, mit Zeichen markiert werden. Vielleicht ist dies die Geschichte dieser Markierung, ein neuerliches Markieren dieser Markierung.
Jordy Rosenberg: „Beim Schreiben über das eigene Selbst geht es im Kern darum, mit Sprache die Stellen zu markieren, wo Geschichte uns berührt. Und hört, sie berührt uns überall.“
Beim Umziehen in der Schulumkleide. Der Schweiß ihrer Teenager-Körper diffundiert in die feuchte Leere, beduftet sie mit Jungenblüte. Sie waren außer Rand und Band, doch schikanierten mich kaum, da ich Unterwäsche von der richtigen Marke trug. Wenn es losging, schubsten sie mich, der ich da mithumpelte, bloß zur Seite.
Ein Junge legte seinen Daumen und Zeigefinger um meinen Knöchel. Einen Mädchenknöchel nannte er ihn. Eher ein Krüppelknöchel. Ich korrigierte ihn nicht. Mir war nicht klar, dass es schlecht war, mädchenhaft zu sein, wenn doch Mädchen das waren, was Jungs begehren sollten.
Da ich diese andere Nullität – ein Kind der „Mittelklasse“ – war, kam ich an Unterwäsche der richtigen Marke, aber die grauen Arbeitsshorts von King Gee gab es nicht in der richtigen Größe für meine schmale Taille. Auch nicht Levis, die einzig akzeptablen Jeans. Auf diese Weise signalisierte man seine Existenz als Junge-Mann. Man verwandelte sein Taschengeld in den Look, der die eigene Existenz bezeugte, in diesem Augenblick, dieser Mode. Der Körper musste sich in die gültigen Häute und Zeichen der aktuellen Saison gehüllt präsentieren. Sonst war man niemand.
Also ging ich Mädchenjeans kaufen. Da ich in jeglichen öffentlichen Interaktionen unbeholfen war, kam mir gar nicht in den Sinn, wie absonderlich das war. Sie passten ziemlich gut, nur ein bisschen eng in der Taille.
Otto von Busch: „Wenn Mode an uns wirkt, verändert sie unsere Haltung. Wir fühlen uns gesehen und haben alles im Griff. Wir erweitern uns emotional, sozial und körperlich, öffnen unsere Sensibilitäten in Richtung Welt. Wir fühlen, wie plasmatische Energie unsere Wirbelsäule entlang und durch unsere Glieder pulst. Im besten Fall ist Mode mehr als ein tragbarer Signifikant: Sie ist eine nahtlose alloplastische Erweiterung der blanken Haut.“
Und ich besorgte mir Stiefel. Im Cowboystil mit Kuba-Absätzen. Genau das Richtige. Erkennungszeichen der Gesetzlosen aus dem sagenumwobenen Amerika. Die Absätze waren hoch für meine Krüppelfüße, aber beim Laufen kamen die Hüften auf magische Weise ins Spiel.
Es gab eine Phase in den Siebzigern, als Klamotten, Haare, Stil, all diese Dinge unisex sein konnten. In dieser Zeit kleidete ich mich durchweg wie ein Mädchen: die Farben, die Schnitte, die langen Haare. Fremde insistierten manchmal darauf, unbedingt wissen zu müssen: Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Als ob das Gewebe des Raum-Zeit-Kontinuums von meiner eindeutigen Zuordnung zum einen oder anderen abhing.
Ich lachte es weg. Was in der Welt von mir rüberkam, als Ich rüberkam, war so ein femme angehauchtes Ding, das Strahlung von Mädchenhaftigkeit aussandte und aufnahm. Nur war in den Siebzigern eben alles unisex, deshalb bekam niemand das mit – nicht einmal ich selbst.
Die Cowboystiefel überlebten das Ende des unisex Hippielooks und landeten in einer glamourösen Erweckung der Gendersignale. Aber dann kam der Scheideweg: Punk oder Disco? Ich musste mit den Stiefeln Schluss machen. Sie waren braun. Und nach zu vielen Drinks konnte man nicht mehr darin laufen.
Widerstand durch Rituale
In meiner Kleinstadt, wo alles sich um das Stahlwerk und die Fabriksirene drehte, behaupteten die Jungen und Rastlosen ihren Anspruch auf ein anderes Leben in der Freizeit. Und da es sich um eine Hafenstadt mit gemäßigtem Klima und einer geschwungenen Küstenlinie handelte, war Freizeit gleichzusetzen mit Strandzeit. Es gab für einen Jungen nicht viel anderes zu tun als Surfen.
William Finnegan: „Ich umkreiste das Line-Up am Point, paddelte ununterbrochen, konnte einfach nicht stillsitzen. Als dann endlich eine Welle auf mich zukam, schnappte ich sie mir. Mitten in meinem ersten Turn sprangen die Flutlichter an. Ich versuchte, nach vorn zu schauen, zu erkennen, was diese Welle am Ende der Line noch für mich bereithielt, und entsprechend zu planen, doch ich war ganz von türkisfarbenem Licht umgeben. Ich spürte so etwas wie den Rausch der Tiefe. Ich blickte nach oben. Über mir war ein silbrig glänzendes Dach. Es fühlte sich an, als ritte ich ein Luftkissen. Dann gingen die Lichter aus.“
Für Mädchen war damals vorgesehen, sich am Strand zu sonnen und ihren Jungs beim Surfen zuzuschauen. Unten im weltgewandteren Sydney, im Big Smoke, wie wir es nannten, konnten Mädchen vielleicht surfen, aber im kleinstädtischen Newcastle hätte das ungewollte Aufmerksamkeit erregt. Wer weiß, auf was für Ideen so ein nichtsnutziges Surfer-Girl kommen könnte?
Justine Ettler: „Diese Erzählung über Marilyn beginnt nicht mit ihrer halbwegs unbefleckten Empfängnis oder ihrer verwahrlosten Jugend voller Träumereien, ein Filmstar zu werden und nach Hollywood zu gehen, oder mit diesem Sommer, den sie damit verbrachte, sich jenseits der Brandung vor Australiens berühmtestem Strand an ein wippendes Surfboard zu klammern und einen Orgasmus nach dem anderen zwischen ihren gebräunten jugendlichen Schenkeln hervorzupressen.“
Unser Mark Richards sollte viermal hintereinander Weltmeister im Surfen werden, aber das kam später. Mitte der Siebziger kauften wir alle unsere Skateboards im Surfladen seines Vaters. Wenn man nicht surfen wollte, konnte man skaten. Das war Pseudo-Surfen, aber die Abgänge vom Brett waren viel realistischer.
Aber was tun, wenn man nicht skatete? Was tun, wenn man nicht teilhatte am Leben der Surfer-Boys und der von ihnen (jedenfalls laut ihren althergebrachten Jungsprahlereien) besurften Mädchen? Da blieb nichts anderes übrig, als mit denen abzuhängen, die schwul waren, kommunistisch, Gedichte schrieben. Und einen delinquenten Stil zu pflegen.
Mitte der Siebziger: Vor dem großen Schisma zwischen Punk und Disco war der delinquente Stil Glam. Und in meiner kleinstädtischen, antipodischen Welt glitt der Glam durch die zwei Davids in mein Blickfeld. Die zwei Davids, die es mir möglich machten, Mitte der Siebziger zu existieren.
Der heimische David war der Dichter. Schmächtig, bebrillt, langhaarig wie ich, aber blonder. Er schrieb Gedichte über die Spinnen vom Mars. Bei ihrer Invasion würden wir die Menschheit verraten und sie willkommen heißen. Es war David, der Dichter, der mich mit dem globalen David, David Bowie, und dem Glam bekannt gemacht hatte. Damals begann ich, Secondhand-Klamotten zu kaufen und umzunähen. Ich stickte kleine Muster in den Denim, die ich in einer Zeitschrift gesehen hatte. Diese femininen Hippie-Schnörkel mussten weg, als der Punk hereinbrach.
Als David Bowie starb, schienen alle sich zu erinnern, wie sehr sie ihn geliebt hatten. Mit meiner Erinnerung deckt sich das nicht. Das waren bloß wir, David und ich. Vielleicht liebten die anderen ihn im Geheimen. Diese Seite von sich gaben sie nie der Öffentlichkeit preis. Nicht mal einen kleinen Hinweis. Ich verschwand in der Masse, unsichtbar vor aller Augen. Unsichtbar sogar für mich selbst.
David Bowie rief uns, David und mich, wenn nicht mit Namen, so doch mit unserer Wesensart. Mit namenlosem Gefühl. Wir empfingen das Rufzeichen. Nahmen den Ruf an, gaben Antwort. Oder versuchten es. Zurück an Gender, Empfänger unbekannt.
Späte Siebziger: Die merkwürdigen späten Teenie-Jahre. Ich war eher Mod-Revival-mäßig unterwegs als Punk. Orientierte mich an den Plattenhüllen von The Jam und Erinnerungen an das Fernsehen der Sechziger. Ich klaute Klamotten in Secondhand-Läden und änderte sie. Nähte die Beine und Kragen um. Schnitt meine langen Haare ab. Ein Ersatz-Paul Weller.
Der Mod-Look radierte die kurze Girl-Look-Episode aus. Beide erforderten mehr oder weniger einen Körper mit schlanker Taille, schlanken Handgelenken, schmächtig und entrückt. Die Phantasmorgie der Häute und Bilder rief mich mit ihren Modellen dessen, was man sein und werden könnte, um zu existieren. Wieder einmal entschied ich mich für Sachen, die ein wenig abseits der Markenwelten lagen.
Otto von Busch: „Mode gehört der Wildnis zu, sie ist tierisch. Selbst wenn Kulturindustrie und ‚Techniken des Selbst‘ versuchen, die Kräfte der Mode zu domestizieren, zu kontrollieren und massentauglich zu machen, bleibt die Mode in ihrer Essenz etwas Lebendiges mit dem notorischen Potenzial, aus der Warenform auszubrechen. Mode ist kein Ding, sie ist nicht gebunden an Kleidung oder Güter, sondern ist ein Ort, an den man sich begeben kann, ein emotionaler Raum, den man in sich und in anderen betritt.“
In der Rückschau scheint es, als ob Mod ein Mittel gewesen wäre, das Problem der Genres und Gender, der Häute und Zeichen auszumanövrieren. Nach Glam kam nicht nur Punk, sondern das ganze Mode-Dilemma der späten Siebziger: Punk oder Disco? Die Welt des Teenager-Konsums, jener Teil davon, der für Häute und Zeichen empfänglich war, spaltete sich in diese beiden unversöhnlichen Lager.
Kodwo Eshun: „Disco ist hörbar der musikalische Ort, an dem das 21. Jahrhundert beginnt.“
Die Disco-Musik barg ein Versprechen. Eine Welt mit Liebe und Stil, mit Fleisch und Maschinen, die einander berühren könnten. Licht und Haut und Beats und Saiten im Einklang in einem pulsierenden Dunkel. Schweiß und zuckriger Glitter, es gleißt im zuckenden Licht. Ein Amerika ohne Regeln, eine Utopie von Schwarzem Glamour. Alles löst sich auf und wird ein Teil von allem anderen: Körper, Beats, Sounds, Gender.
In echt sah Disco in dieser Stahl-Surf-Stadt anders aus. Die Surfer-Boys trugen alle das gleiche Disco-T-Shirt von Golden Breed und Sternzeichen-Anhänger. Ein Massenprodukt in zwölf Ausführungen. Und die Mädchen in ihren engen Jeans, ihre Ärsche sahen so viel besser aus als meiner. Damit blieb Punk. Das war der Ort für hässliche Gefühle. Für die ohne Namen.
Sianne Ngai: „Im Ganzen behandelt das Buch Emotionen als ungewöhnlich verknotete oder verdichtete. ‚Interpretationen von Zwangslagen‘. Die vorliegenden Belege würden darauf hindeuten, dass der bloße Versuch, das Ästhetische und das Politische zusammenzudenken – eine Aufgabe, deren Dringlichkeit proportional zu ihrem Schwierigkeitsgrad in einer zunehmend anti-utopischen und funktional ausdifferenzierten Gesellschaft anzusteigen scheint – eine vorzügliche Gelegenheit für hässliche Gefühle bietet.“
Es gab nur einen Punkclub und nur eine Punkband. Die Band hieß Pel Mel. Jude McGee war Frontfrau, sang, spielte Klarinette und Saxophon. Sie war die Tochter meines Geschichtslehrers. Er versuchte einmal, uns zu verkuppeln. Kürzlich habe ich auf Facebook gehört, dass Pel Mel wieder zusammen spielt. Es freut mich immer zu hören, dass bestimmte Leute noch am Leben sind.
Jude McGee: „Singing with silence, when I wanted music. Lighting my cigarette, the dark didn’t show. Speeding to vanishing point, into my mirror. I hear her I hear her, secretive, low. No word from China. No sign from the keeper. I try to sleep. Excuses of mine.“
Das Grand Hotel machte seinem Namen wenig Ehre. Der Pub hatte drei Räume. Da er gegenüber vom Gericht lag, wurde die vordere Bar von Anwaltschaft und Polizisten frequentiert. Der hintere Teil mit dem Pool-Tisch war interessanter: Krankenpflegerinnen aus der Psychiatrie, Seemänner von Handelsschiffen, alle mit Zugang zu je speziellen Drogen. Neben der Bar war ein leerer Raum, der von einer einzelnen Neonröhre erleuchtet wurde. Dort spielte an Samstagen Pel Mel. Der gekachelte Boden hatte eine lose Kachel, die bei jedem Auftritt hin und her gekickt wurde. Die Band spielte in der Ecke, im Halbschatten. Der Geruch von Speed-Schweiß, Mottenkugeln, Äther und Bier.
Der lokale Punk-Klamottenstil gefiel mir nicht. Die Mädchen trugen unförmige Kleider aus dem Secondhandladen und zerrissene Strumpfhosen. Die Jungs trugen schlabbrige alte Anzüge aus den Fünfzigern in öden, blöden, spröden Abtönungen von Matsch. Sie sahen aus wie jugendliche Zitate ihrer Väter.
Ich mochte das Gefühl von neuen, engen Mädchen-Jeans, selbst wenn ich nicht den richtigen Arsch dafür hatte. Und ich hatte diese Cowboystiefel, aber die waren in Hellbraun, die Farbe war jetzt untragbar. Also verhandelte ich mit der Welt. Der Welt der Häute und Zeichen. Die alten Mod-Anzüge der Sechziger – dominiert von ihren schmalen Aufschlägen und Seitenschlitzen, mit nur ein oder zwei Knöpfen – verliehen wenigstens eine schlanke Silhouette. Enge Hosen mit einem kleinen aufgesprühten Detail. Ein klassischer Tennisschuh. Hemden, deren Kragen ich von Hand schmaler und eckiger nähte.
Ein Kompromiss, ein tragendes Element in den Genres und Gendern, Häuten und Zeichen. Was trägt es?
Männer
In meinen frühen Teenager-Jahren bemerkte ich die Aufmerksamkeit, die ich bei Männern erregte. Nach und nach fand ich heraus, was sie wollten. Sie fingen auf Bahnhöfen Gespräche mit mir an. Boten an, Süßigkeiten zu kaufen. Fragten, ob sie mir auf die Toilette folgen dürften. Wenn ich nachts allein nach Hause ging, fuhren Autos neben mir her. Dank meines starken Selbsterhaltungstriebs ließ ich mich nicht auf diesen Trip ein.
Ein Teil von mir fühlt: Hätte ich bloß gewusst, wie man mit ihnen umgeht. Wie man ihre Brieftaschen leert, einen Vorteil aus ihrer entblößten Bedürftigkeit zieht. Ich misstraute jeglichem Interesse, das die Welt mir entgegenbrachte. Aber selbst diese verzweifelte Aufmerksamkeit war etwas wert. Es war eine Art und Weise, in der Welt sichtbar zu werden. Eine Welt, in der man sonst verschwand als etwas, das niemanden interessierte, niemand wertschätzte.
Justin Vivian Bond: „So viele meiner Gedanken und Gefühle und Ideen bekamen Brüche, als ich jung war. So viel Hinterfragen prägte jede meiner Entscheidungen, dass ich in gewisser Weise ein Paradox wurde, eine Kombination aus Draufgängertum und Unsicherheit. Diese Art zu denken hat mein Leben durchdrungen und mich in den meisten Fällen davon abgehalten, schnell auf irgendeinen Impuls zu reagieren.“
Lebendig war ich nur im Imaginären, wo Emma Peel, Robin Hood oder David Bowie mich anschauten oder mit mir im Rundruf telefonierten, aber dann gab es auch noch das Alltagsleben. Familie, Schule und das alles. Der gewöhnliche Kram. Jemand war in alldem anwesend. Aber es gab ein anderes Ich. Dasjenige, welches sich einstellte, wenn bestimmte Männer mich beobachteten. Wenn ihr mich beobachtetet. Ich wusste, was ihr wolltet. Aber es war nicht ganz das, was ich wollte. Das Wollen kennt keine Symmetrie.
Genoss*innen
In meinem letzten Highschooljahr in Newcastle mied ich den Strand, mied die beliebten Bars, wo die Polizei Minderjährige kontrollierte, und hing nachts viel im Grand Hotel rum, tagsüber in der Bar der Universität. Dort konnte man ohne die Peinlichkeit, einen gefälschten Ausweis vorzeigen zu müssen, einen Drink bestellen. Man konnte Bücher aus der Bibliothek stehlen. Und ich konnte mit Glen rumhängen. Jede dieser Möglichkeiten war es wert, die Schule ausfallen zu lassen.
Er war die interessanteste Person in meiner Heimatstadt. Er war schön. Wie seine gerade geschnittenen Moleskin-Hosen seinen Arsch, seinen Schwanz konturierten. Sein schönes Lächeln. Seine braunen Augen mit den Andeutungen von Jaffa-Orange. Und dass er sich mit mir unterhalten wollte.
Also unterhielten wir uns. Bis spät in die Nacht in seiner kleinen Wohnung ohne Warmwasser in der Beaumont Street. Er erzählte mir von seinem Studium an der Universität. Erklärte mir ein bisschen Linguistik. Seit dem Tod seiner Großmutter war er der letzte Sprecher einer Aboriginal-Sprache.
Das habe ich meiner Welt nicht verziehen.
Bei Glen fühlte ich mich sicher. Er wollte mich gern ficken. Machte kein Geheimnis daraus. Er bestand nicht darauf. Die Aussicht schien ihn zu erregen und zugleich zu ängstigen. Glen war schwul. Aboriginal und Kommunist. Ich war sechzehn. Was zu der Zeit das zustimmungsfähige Alter gewesen wäre, hätte ich eine Vagina gehabt. Falls er mich in den Arsch ficken wollte, war es immer noch ein Fall von dem, was die Franzosen détournement de mineur nennen, außerdem unabhängig vom Alter gesetzeswidrig. Und obendrauf wollte er auch noch einen weißen Jungen …
Es war nicht nur das. Er wollte mich nicht nur ficken, er wollte mich haben. Mich zu seinem machen. Er wollte alles. Nicht für immer. Nur für eine Weile. Und nicht für ihn ganz allein. Das war für mich eine unbekannte Form des Wollens. Für den Moment teilten wir bloß Zigaretten und Gelächter und Gedanken und Eindrücke von der Welt. Wir waren eine Zweierfraktion. Verbannt in diese verfluchte Sprache, die er sich nicht ausgesucht hatte.
Er berührte mich, streichelte mich und, mehr als das, teilte sein zurückhaltendes Lächeln mit mir. Ich wurde ein Körper, den so ein umwerfender Mensch wie Glen wollen konnte. Und so ging es weiter. Dann ging ich fort, zur Universität in Sydney; er blieb in Newcastle. Ich sollte ihn für eine Zeit nicht mehr wiedersehen.
Bis ich die Stadt verließ, waren es zu gleichen Teilen Genosse Glen und Genossin Jenny, die mir halfen, meinen Gleichmut zu bewahren. Beide waren sie an der Universität; ich war noch in der Highschool. Zusammen bildeten wir eine Dreierfraktion. Jenny war groß und schlank, sehr hell mit feinem braunem Haar. Ihre schmalen Handgelenke waren genau wie meine.