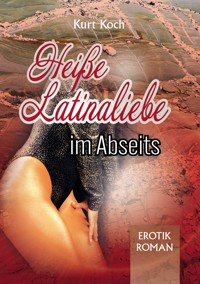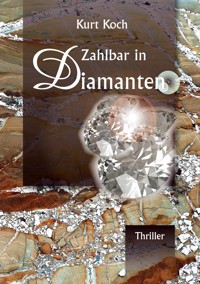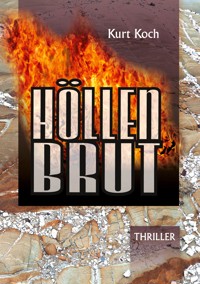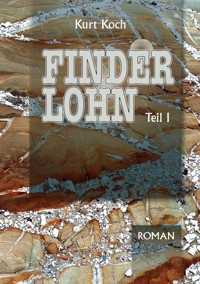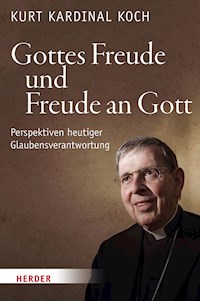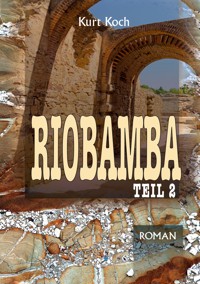
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
2. Teil von 3. - Eine Familiensaga. Dramatischer Roman mit wirklichem Leben Auswanderung einer Restfamilie in die neuen Länder in Südamerika. Hoffnung auf ein besseres Leben. Sie treffen auf Niedertracht, unbekanntes Klima, Ureinwohner/Indios, Korruption in der königlichen Verwaltung, Unterdrückung, Unterjochung, Ausbeutung der Indios. Militärs mit Religion mischen überall mit. Die katholische Kirche in einer Allmachtposition
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Inhalt - ein Geständnis
Ich gestehe und versichere jeder verehrten Leserin und jedem geehrten Leser, dass mich mein Textaufbau als auch meine Ausdrucksweise als echten Pfälzer ausweisen.
Der Autor Kurt Koch
Band 2
Der Inhalt
Andentäler
Daniels neue Welt
Daniels Einstieg als Patron
Eine neue Zeitrechnung
Der neue Großgrundbesitzer
Angelinas Weg
Daniels Welt
Die Witwe Angelica
Daniels Leben
Die Frau des ex-Kommandanten
Daniels Traum
Der junge Hernandez
Daniel der fünffache Vater
Sondereinsatz des Schicksals
Bei den Machados
Schwer erträgliche Wahrheiten
Start für die Mühlen der Justiz
Virreinato de Nueva Granada
Vergoldete Zeiten
Die Intrige
Der strahlende Sieger
Quito im Vizekönigreich NeuGranada
Register, Namen und Zuordnungen
Der dicke Diakon, Notar im bischöflichen Amt in Riobamba, ohne Namen
General Henrique Alvaro Rodrigo de Avila für den Goldtransport verantwortlich
Antonio Claudio Echeverria Sanchez Hafenkommandant in Guayaquil
Sanchez - der entlaufene Seemann
Kommandante - Juan Pablo Hernandez Palacios
Hilda - Daniels Indiafrau in Ecuador
Carlos Daniels Sohn - Erstgeborener
Humberto - 2. Sohn Daniels und Hilda
Anita - 1. Tochter Daniels und Hildas
Angela - 2. Tochter Daniels und Hildas
Christobal. - 3. Sohn Daniels und Hildas
Angelina - ihr Leben auf der Hacienda
Rosa - die Bedienstete Angelinas auf der Hacienda
Felipe - Sohn des Kommandanten und Angelinas
Riobamba, Band 1. Ein kurzer Rückblick
Im Königreich Spanien herrschte in den Dekaden zwischen 1700 und 1750 weiterhin der Geldadel. Die „eroberten(?)“ neuen Länder, hauptsächlich im südlichen Teil des amerikanischen Kontinents, spülten große Reichtümer in das „Mutterland“ Spanien. Diese materiellen Werte wurden aber kaum zur Verbesserung der oft unbarmherzigen Lebensumstände der Menschen in der landwirtschaftlichen Produktion genutzt. Und Spanien war, wie fast alle Länder der Epoche, ein Agrarland.
Die vorherrschende spanische Großmannssucht, verbunden mit den Weltmachtansprüchen der Staatsführung, schluckte einesteils, gestützt vom Militär, ungeheure Werte. Andererseits wurden die Weltmachtansprüche sehr aktiv von der katholischen Kirche unterstützt bis angefeuert.
Dazu wütete, wie in keinem anderen Land, die (un)heilige Inquisition. Viele materiellen Reichtümer flossen zudem in den Vatikan, der immer noch mehr finanzielle Mittel zum Führen der Religionskriege forderte.
Prunk und Protz häuften sich in den größeren Städten.
Die ländliche Bevölkerung lebte vielfach in Abhängigkeit, in einer Art Leibeigenschaft von ihrem Patron, in der Regel einem Großgrundbesitzer.
Dieses System wurde, auch und besonders aktiv, von den Machern der katholischen Religion gestützt, mitverwaltet und gefördert. Besonders in der großen Region der Extremadura gab es die erschreckendsten Auswüchse einer Knechtschaft oder auch Leibeigenschaft, bis zur totalen Unterdrückung und Ausbeutung. Keine Seltenheit war es, dass Familienverbände in Höhlen hausen mussten. Zeugen davon werden heute zum Teil Touristen vorgeführt.
Kurz: Die „Macher“ der katholischen Religion lebten durchweg sehr gut bis zu: „in Saus und Braus“. Sie machten schlicht gemeinsame Sache mit den Großgrundbesitzern, von deren Spenden (Abgaben) sie lebten und die bei ihren Gläubigen eine strenge Hand führten. „Im Namen Gottes und des Königs.“
Nach einem Unfall rettete die in äußerst prekären Umständen hausende Familie Machado dem Großgrundbesitzer, ihrem „Patron“, das Leben. Diese Familie fristete bis dato in der kargen Region ihr Leben, hatte sich aus „Tradition“ für ihren Patron aufzuopfern. Sie durften alle eine Höhle bewohnen.
Der genesene Patron bot aus Dankbarkeit der ganzen Familie Wohnstatt in Form eines Häuschens, nahe dem Herrenhaus der Estancia. Das galt für jeden der nahe am Haupthaus Lebenden als ein großes Privileg. Diese Bewohner hatten durchweg ihren Lebensunterhalt durch ihre Dienste im oder beim Haupthaus. Auch das war Tradition. Doch im Falle der eingesiedelten Familie Machado gab es eine Welle der Missgunst, des Neides und viel Hass. Trotz des Schutzes des Patrons machten andere Habenichtse den Kindern und ihren Eltern das Leben zur Hölle. Aufgehetzt von den Klerikern ging es immer wieder um einen Teufel, der in Mutter Machado stecken musste. Und sie musste eine Hexe sein, so krumm und gebeugt sie sich bewegte.
Ihre Kinder verschwanden nach und nach oder wurden misshandelt tot aufgefunden.
Mittlerweile hatte der Patron, statt „wie es sich gehörte“ Kirchen und ein Kloster aus Dankbarkeit für seine Rettung zu bauen, seinen Untertanen ein besseres Leben versprochen. Sie sollten nicht mehr in absoluter Knechtschaft vegetieren. Alle Kinder der Hintersassen, bisher Analphabeten, sollten lesen und schreiben lernen. Alle Menschen auf dem riesig großen Besitz, sollten freier leben und arbeiten können. Sie sollten besser wohnen und ihre Gesundheit betreut werden.
Doch dagegen rebellierten und agierten die Pfarrer und Bischöfe. Sie befürchteten Einbußen ihres von den Patrones durch Spenden garantierten Lebensstandards.
Sie ließen den Patron vor die „heilige Inquisition“ zerren, wo sein Leben nur noch an einem sprichwörtlichen seidenen Faden hing. Die hohen Herren in den Talaren und bunten Roben drohten mit Folter und Tod, sollte er seine Lebensweise gegenüber seinen Untertanen nicht wieder in die totale Ab- und Rückständigkeit zurückführen. Es sollte mit ihnen wieder zurück in die totale Ausbeutung gehen. Sie erpressten ihn in aller Offenheit. Sie würden ihm aber sein Leben schenken, wenn er seine Pläne zugunsten seiner Untertanen/Leibeigenen, aufgäbe. Obendrauf sollte er eine Kirche bauen und ein Kloster mit großzügigem Grundbesitz stiften.
Der älteste Sohn der leibeigenen Familie Machado hatte unterdessen eine Küchenmagd geehelicht. Auch sie, als neues Mitglied der gehassten und verfolgten Familie, war jetzt Zielscheibe von Gemeinheiten bis zu Übergriffen.
Inzwischen hatten des Patrons Großgrundbesitzerfreunde ihm den Rücken gekehrt, dies und auch ganz besonders, weil der den Sklavenhandel nicht mitfinanzieren wollte. Auch seine Frau mit den beiden Kindern kam von einem Besuch bei ihren Eltern nicht mehr zurück.
Der Druck auf den Patron wuchs von allen Seiten des Königreiches. Der Patron wähnte sich, wegen seiner beispielhaften sozialen Vorhaben für seine Untergebenen unter dem Schutz seines Gottes. Die Herrschenden und besonders die katholische Kirche waren da vollkommen anderer Meinung. Sie verstärkten ihren Druck gegen die „unnützen und auch für die Privilegierten gefährlichen sozialen Machenschaften“ des Großgrundbesitzers. Die gesamte Clique der Reichen in Spanien befürchtete Einkommenseinbußen. Die leitenden Angestellten und das Führungspersonal auf der Estancia stellten sich großteils ebenfalls auf die Seite der Kirche.
Der Schreiber und Vertraute des Patrons kehrte nicht mehr von einer Inspektionsreise zurück. Man fand ihn ermordet.
Zudem musste der Patron feststellen, dass sein oberster Verwalter insgeheim gegen ihn intrigierte. Und dass er im Verbund mit den Männern der katholischen Kirche paktierte und gegen ihn arbeitete.
Der Patron musste auf „Anordnung der Inquisition“ die Aussichtslosigkeit seiner guten Taten für die Familie, die ihm das Leben gerettet hatte, einsehen. Er ermunterte den ältesten Machado und seine Frau, zusammen mit dem letztendlich verbliebenen zweitältesten Sohn der Familie in die neuen Länder nach Südamerika auszuwandern, um dort ein neues Leben zu beginnen.
Noch vor Beginn ihrer Überfahrt verschwand der jüngere Bruder. Er wurde auf einem Segelschiff zwangsverpflichtet.
Die junge Ehefrau verlor auf der Überfahrt, in einem Sturm, ihre Leibesfrucht.
Es herrschte unter den spanischen Besatzern in den unterworfenen Gebieten Südamerikas ein Mangel an Frauen. Ein Kommandant der Kolonialverwaltung schmiedete einen äusserst niederträchtigen Plan, um dem Neuankömmling Machado seine Frau wegzunehmen.
Im Hafen Guayaquil, dem Ort der Ausschiffung, organisierte der verbrecherische Kommandant mit dem vorbestraften Hafenkommandanten einen gemeinen Aktionsplan. Der älteste Machado sollte verschwinden und wurde zwangsverpflichtet, um bei einer erfundenen Aktion gegen angeblich entlaufene Sklaven mitzumachen. Von dieser, als militärisch getarnten Operation sollte er nicht mehr zurückkehren. Der gemeine Plan des Kommandanten war, nach dem Soldatentod Machados dessen Frau zu „überzeugen“ mit ihm zu ziehen. Mit ihm ein „glückliches“ Leben zu führen.
Machado wurde gerettet und begann seine Frau in diesem weiten Land zu suchen. Und an dieser Stelle beginnt das vorliegende Buch „Riobamba Band 2“.
Riobamba Band 2 Teil 3
Andentäler und die Reise ins Hochland
Die geschrumpfte Reisegruppe hatte aus Guayaquil kommend und nach Auskunft ihres Führers, die höchstgelegene Stelle ihrer Reise erreicht. Sie bestand aus drei Männern, vier junge Rinder, ein Pferd und die Arbeitstiere Esel sowie das Maultier des Reiseführers. Der Hund blieb verschwunden, seit sie der ersten größeren entgegenkommenden Reisegruppe begegnet waren.
Sie erreichten eine breit ausgefahrene, staubige Piste. Es war ein verbliebenes Teilstück des uralten Wegenetzes der Inkas. Allerdings stammten die Räderspuren nicht aus dieser Zeit. Dieser Weg schlängelte sich, seit der Besetzung des Landes zum Teil neu angelegt, zwischen den beiden markanten Bergketten der Cordillera de los Andes. Er führte als Nord-Süd-Hauptverbindung von weit im Norden Ecuadors durch die unterschiedlichen Hochtäler bis zu den Zentren der ehemaligen Macht in Peru.
Jetzt befand sich dort in einer Wüstengegend und auf Meereshöhe die Hauptstadt des neuen Vizekönigreichs LIMA. So hatte es der „Eroberer“ Pizarro vor gut 2 Jahrhunderten bestimmt.
Das mit dem Schlängeln, dem Weg mit den zeitweisen vielen Kurven, war demnach keine Originalanlage der Inkas. Diese hatten ja für ihren Verkehr keine Wagen verwendet. Das Rad an sich war ihnen unbekannt.
Für ihre Lasten-Transporte hatten die Inkas in der Regel Lamas als Tragtiere eingesetzt. Steigungen waren daher nicht als ein Hindernis anzusehen. Die Wegeverbindungen zwischen zwei Verwaltungszentren wurden weitgehend in gerader Linie geführt. Teilweise bauten sie die besonders steilen Strecken mit Treppenstufen aus. Für Lamas, als ihre Transportmittel und das Fußpersonal waren sie allemal ausreichend.
Die spanischen Kolonisatoren hatten bereits an vielen Stellen des bestehenden Wegenetzes bedeutende Änderungen vorgenommen. So mussten die neuen Herren vielfach nachbessern, damit sie auch mit ihren Wagen und Zugtieren gefahrlos reisen und Waren transportieren konnten. Die wesentlich schmaleren Wege und steilen Anstiege hatten den Inkas für ihre damaligen Bedürfnisse ausgereicht.
Daniel konnte die beiden markanten, im Osten und Westen in Nord-Süd-Richtung parallel verlaufenden Bergketten klar unterscheiden.
Die Erhebungen zeigten in den Gipfelregionen oft eine weiße Bedeckung. Daniel kannte diesen Anblick von einigen Bergen in seiner Heimat, wenn sie im Winter ebenfalls weisse Mützen trugen. Schnee sei das, hatte man ihm erklärt. Und jetzt, wo er ihn am wenigsten vermutet hätte, sah er ihn wieder. Aber auch wie damals in seiner Heimat, nur aus der Ferne.
Zwischen diesen gewaltigen Gebirgsketten gab es in der Landschaftsbeschaffenheit so etwas wie Abwechslungsreichtum. Alle Hänge zeigten bis hoch an den Bergen hinauf Bewuchs. Üppigen Bewuchs, wie Daniel mit zunehmender Begeisterung feststellte. Alles schien fruchtbar. Ideal für einen geborenen Landarbeiter oder auch Bauer.
Seltsam nur, dass die weiter weg liegenden Berge blau erschienen. Blaues Gras? Blaue Blätter an den Bäumen? Das wäre etwas völlig Neues für Daniel gewesen. Aber, so erinnerte er sich, hatte er nicht schon bei der Annäherung an die Berge nördlich von Guayaquil einen blauen Bewuchs gesehen? Geglaubt zu sehen? Und beim Näherkommen war dann doch alles grün. So musste es auch hier sein, entschied er für sich. Er hatte aber für diese Erscheinung keine Erklärung.
Ungleich große Parzellen landwirtschaftlich genutzter Erde waren in unregelmäßiger Folge an den Flanken von Bergketten zu unterscheiden. Und immer wieder verwunderte Daniel dieses seltsame tiefe Blau, in dem die weiter entfernt einzusehenden Berge sich mehr und mehr verloren. Wie eingeflickt waren an den unteren Rändern diese offensichtlich landwirtschaftlich bearbeiteten Flächen zu erkennen.
Diese Anblicke wirkten beruhigend. Daniel spürte, dass er seinem Traum näherkam. Nur eine Frage trieb ihn noch um, wie denn wohl die Klimaunterschiede zwischen Winter und Sommer sein würden. Gab es Trockenperioden? Er würde sich zur rechten Zeit schlau machen müssen.
Dann Daniels Frage an das Schicksal: Würde das, im Bereich seines Überblicks, seine neue Heimat werden?
Sein Blick richtete sich wieder in Richtung des Sonnenaufgangs. Der Begriff Osten war Daniel noch nicht so geläufig. Dort ragten einige Berggipfel empor, weitläufig verteilt und mit Schnee bedeckt. Eben mit der weißen Mütze, wie sie es in der Extremadura bezeichneten. Weiter im Norden, aus seiner Sicht geradeaus, schaute ein ziemlich spitzkegeliger, majestätischer Gipfel mit ebenfalls weißer aber auch besonders großer Mütze aus den umliegenden, nicht bemützten Gipfeln heraus.
Der Führer hatte den intensiven Blick Daniels bemerkt und konnte sich auszeichnen. Er bemerkte aufklärend, dass dies der Tunguragua sei. Der spucke hin und wieder Rauch, Feuer und Asche. „Dem solltest du nicht allzu nahekommen,“ fügte er noch hinzu.
Und Daniel dachte für sich: <Was soll ich bei dem da oben?>
Ebenso geradeaus, etwas auf seiner linken Seite, war ein riesiger gleißend weißer Brocken von einem Bergmassiv zu erkennen. Es musste gewaltige Ausmaße und eine sehr grosse Höhe haben. Er hatte sie auch tatsächlich. „Das ist der Chimborazo,“ klärte ihn wieder sein Reiseführer auf. „Die Indios holen dort oben Eis und bieten es auf dem Markt an.“
Und wieder war es Daniel, der sich über diesen Brauch wunderte. Wer sollte Eis kaufen? Auf einem Markt Eis kaufen? Bei ihm zu Hause, er ertappte sich mit einer gewissen Verwunderung bei dem Gedanken, dass er ja noch niemals ein eigenes zuhause hatte. Dort wo er gelebt hatte, fürchtete man sich vor dem Eis. Wenn sie es hatten, dann war es immer bitter kalt gewesen. Sie gingen dann nicht einmal vor die Höhle. Und wieso sollte man Eis kaufen? Oder sammeln und es verkaufen? Wenn es in der Extremadura Eiszeit war, dann hatte jeder genug davon, mehr als genug. Dann hatte man Probleme und musste zuwarten, bis das Eis wieder zu Wasser geworden war. Und wenn keine Eiszeit war, dann sehnte sich gewiss keiner nach Eis. Und Eis kaufen? Wer käme auf eine solche Idee?
Daniel schüttelte kaum merklich seinen Kopf.
Wasserläufe waren aus der Entfernung meist nicht einzusehen. Sie verliefen, wie er es bereits erlebt hatte, relativ tief in der Erdkruste, in das Land regelrecht eingeschnitten. Die Erde war überall lose, locker. Es gab kaum Felsen, kein felsiger Boden, wie er solche bei ihrer Wanderung im Süden Spaniens ebenfalls kennengelernt hatte.
Rechts, hoch oben, dort wo offenbar keine landwirtschaftlich genutzten Flächen mehr waren, schien ein nicht enden wollender, dicht bewaldeter Saum bis in sehr hohe Regionen zu reichen. Ob dem wirklich so war, würde er sicher eines Tages erkunden können.
Der stille Begleiter, von dem man eigentlich kaum je merkte, dass er zu ihrer Gruppe gehörte, war wieder da. Er hatte, in weiser Voraussicht, die Nähe zur letzten Reisegruppe gemieden. Die war ja nach Guayaquil unterwegs und dort wartete ja der Hafenkommandant. Er glaubte sich nämlich an den fünf Fingern ablesen zu können, dass sie dieser nach ihm ausfragen würde. Er wollte ja einfach untertauchen. Besonders für die Behörden unsichtbar werden. Er schien kein Held, wenngleich er mit seinen, durch schwere Schiffsarbeit gestählten Muskeln sicherlich eine gute Arbeitskraft abgeben würde.
Daniel hatte ihm, der nach seiner Flucht sehr spärlich bekleidet war, und als sie die kühle Luft der Hochlagen der Anden erreicht hatten, von seinen Sachen etwas geborgt, geborgt, wie er ausdrücklich betonte. Ja er wollte ja hart werden. Hart im Nehmen und Geben. Doch Daniel wollte auch erkannt haben, dass er von diesem Menschen nicht betrogen werden würde. Würde es auch so sein?
Vorläufig würde er aber sein Misstrauen noch nicht ganz beiseitelegen.
An diesem kristallklaren Morgen war an dem etwas seltsam blauen Himmel kein Wölkchen zu sehen. Er war in der Frühe noch nicht tiefblau, zeigte etwas Hartes, durchaus Abweisendes. Nein, das stimmte nicht ganz. Sie hatten, immer in ihrer Reiserichtung gesehen, bald freien Blick auch nach Südosten, rechts unten, wie sie vereinfacht zu sagen pflegten. Dort schwebte über einem Bergkamm eine grauweiße Wolke.
Der Führer wusste es wieder und meinte, dass dies Rauch aus einem Vulkan sei. Es könne der Sangay oder vielleicht sogar der Altar sein. So genau kenne er die dortige Gegend auch nicht. Beide seien fast immer am Qualmen. Und das sei gut so. Denn es gäbe da eine sehr unangenehme Erfahrung mit diesen Burschen. Wenn sie aufhörten aktiv zu dampfen, dann sei Gefahr im Verzug. Dann stünde ein Ausbruch bevor, mit Erdbeben, Feuer und Ascheregen .... und so.
Daniel antworte nichts und fragte auch nicht weiter. <Erdbeben und so>? Da wusste er nichts mit anzufangen.
Der Führer fuhr aber unbeirrt fort: Je länger die Vulkane scheinbar ruhig seien, desto heftiger seien die zu erwartenden und mit Sicherheit kommenden Ausbrüche. Es sei nicht gerade selten, dass dann dunkelgrauer bis schwarzer Regen fiele.
Jetzt glaubte Daniel, dass der doch sicher gewaltig übertreibe. Oder selbst nicht wisse, was er da an vorgeblicher Weisheit von sich gab.
Waren sie in der Reisegruppe bisher ziemlich mundfaul gewesen, eine Unterhaltung hatte sich selten eingestellt oder anregen lassen. Jetzt schien der Führer geradezu inspiriert zum Reden. Und er fuhr fort:
„Das ergibt dann ein fürchterlich schweinischer Dreck, klebrig, schmierig, der scheint direkt aus der Hölle zu kommen.“
Ausbrüche außerhalb der Regenzeit, so habe er sich sagen lassen, hätten zur Folge, dass sich die Gegend teilweise verdunkle. Dabei setze sich ein pulverartiger, grauer Dreck überall hin. Auf Dächer, Straßen, Tiere - überall. Das Atmen soll schwer sein. Man sollte sich dann ein nasses Tuch vor das Gesicht binden. Wenn man ohne Kopfbedeckung erwischt wurde, sollte man sich danach bald die Haare waschen, sonst kleben die wie mit Maurermörtel behandelt zusammen. Sagt man. Ihm sei es gottseidank noch nicht passiert.
„Man sagt auch, dass deswegen die Indios immer Hüte auf ihren Köpfen spazieren trügen. Ihr werdet es sehen, alle haben wirklich Hüte auf. Schon den Allerkleinsten stülpen sie diese grässlichen Dinger über. Jeder Eingeborenenstamm hat seine eigene Hutmode, ja, daran kann man sogar erkennen, woher sie kommen und wohin sie gehören. Das weiß ich von meinen früheren Reisen weiter nach Norden und in den Süden. Also nach oben und unten.“ Der Führer hatte nun scheinbar die Geduld und auch Begeisterung den Reisenden immer wieder die Begriffe für die Himmelsrichtungen nahezubringen. Zumindest für Daniel. Von Sanchez nahm er an, dass der darüber offenbar Bescheid wusste. Sanchez gab dazu aber niemals einen Kommentar ab.
Und der Führer fuhr dort fort, wo er aufgehört hatte.
„Ein Indio ohne Hut das wäre so etwas wie ...“ der Führer suchte nach Worten, „na was soll ich sagen, das wäre wie eine Sau ohne Ringelschwanz.“
Er grinste verstohlen. Keiner der beiden Männer tat es ihm gleich. Möglich war, dass er selbst nicht ganz zufrieden war mit seinem gefundenen Vergleich. Aber sicher hatte er mehr Heiterkeit erwartet. So versuchte er so schnell wie möglich das Thema zu wechseln. Überhaupt war seine plötzliche Gesprächigkeit erstaunlich. Vielleicht beflügelte ihn das nahe Ende dieser Reise und die Aussicht bald die Restlöhnung für seine Dienste zu erhalten.
„Ich habe viele Indiostämme gesehen. Sicherlich leben alleine von hier bis zur Hauptstadt Quito vier verschiedene Stämme. Und alle haben sie unterschiedliche Hutformen. Dazu kommt auch die unterschiedliche Art sich zu kleiden. Insbesondere ist daran ihr Poncho auffällig. Alle tragen sie ihn, diesen farbigen Umhang ohne Löcher für die Arme. Jeder Stamm hat seine eigenen Farben, wobei die Formen und Größen fast alle gleich sind.“
Es entstand eine kleine Pause bis dann der Führer wieder fortfuhr.
„Apropos Farben, also da können wir diesen Wilden nichts vormachen. Die haben ihre Geheimnisse und die können wirklich für ihre Bekleidung alle Farben herstellen. Alles leuchtende Farben und die sollen auch noch mehrmaliges Waschen aushalten. Ich kann das auch bestätigen. Ich habe selbst einen Umhang gehabt. Aus dem waren die Farben nicht rauszukriegen. Allerdings hatten ihn die Motten oder anderes Ungeziefer in Guayaquil bald aufgefressen. Na ja, dort brauchte ich ihn ja sowieso nicht.“
Es trat eine kurze Stille ein, weil er an seinem Maultier eine etwas lose Bindung eines Riemens entdeckt hatte und zog den Verschluss mit Geschick straffer. Fuhr aber danach wieder fort sein Wissen an den Mann, in diesem Falle an die beiden Männer weiterzugeben.
„Hier aber an einem so kühlen Morgen wie heute, da kann man sowas gut gebrauchen. Muss mal sehen, dass ich wieder zu einem komme. Ich will aber nicht unbedingt einen von den Burschen totschlagen, um ranzukommen. Und auf dem Markt bieten sie kaum noch einen an. Schade“, kommentierte er beinahe für sich selbst. Verstohlen blickte er nach den Männern, um ihre Reaktion auf seine etwas radikale Bemerkung zu erkunden.
Da tat sich aber nichts. Hatten sie ihn vielleicht gar nicht recht verstanden? Und so es ging weiter:
„Die Männer, richtige Männer sind das ja nicht,“ fühlte er sich wie verpflichtet anzumerken, „das sind ja nur Stöpse, ´n guten Kopf kleiner als unsereins anständig gewachsenes Ebenbild Gottes.“ Das hatte ihm anscheinend Spaß gemacht, er lachte kurz laut für die Umwelt und dann kamen noch eine Reihe Gluckser, die aber dann sicher mehr für ihn selbst bestimmt waren.
Sein ungewöhnliches Mitteilungsbedürfnis, mehr ein Redeschwall, hielt an.
„Und die Weibsbilder sind noch gestutzter. Aber aufgedonnert. Die lieben es sich bunt zu kleiden. Und nicht nur das, viele von ihnen hängen sich pfundweise buntes Zeug um den Hals, ob das dann lästig ist oder nicht. Manche, da gibt es so einen Stamm noch weiter im Norden von Quito, die kriegen regelrecht einen steifen Hals von all dem Umgehängten. Sie können mir das glauben, das habe ich selbst gesehen.“
Er fühlte sich scheinbar genötigt diese Aufforderung an die Glaubwürdigkeit seiner Ausführungen loszuwerden.
„Sie werden es schon erleben und sehen, dass ich nicht schwindele. Sie werden die Frauen züchtig in Röcke gekleidet sehen, die immer bis auf den Boden reichen, so wie es auch bei den Christenfrauen ist und wie es auch sein soll. Die Indiofrauen scheinen es sogar zu übertreiben und ziehen sich manchmal bis zu einem Dutzend Röcke übereinander an.“
Er kicherte, bevor er fortfuhr.
„Da habe ich mir mal eine geangelt, um ihr die Methode zu erklären, wie man bei uns zivilisierten Menschen die Frage des Nachwuchses regelt. Wie ich dann so zugange war, dachte ich überhaupt nichts wesentlich Weibliches mehr unter den vielen Röcken zu finden. Ich kann ihnen sagen, wenn ich nicht so ein wirklich geiler Bock gewesen wäre, ich glaube meine Genusswurzel wäre verwelkt gewesen, bevor ich endlich den letzten Rockteil beiseitegeschoben hatte.“
Nun trug er ein breites Lachen für seine Umwelt vor. In einer Mischung aus Verlegenheit und Ungläubigkeit griente dann auch Daniel. Sanchez reagierte so gut wie gar nicht.
Der Führer holte tief Luft. Scheinbar war er etwas enttäuscht über den mangelnden Effekt seiner entschieden aufmunternden Erläuterungen. Er wollte jetzt das Thema rasch abschließen. So zerrte er ohne Not wieder an den unverändert gutsitzenden Gurten eines Esels und fuhr dann mit seiner oberflächlichen Einführung in die kulturellen Eigenheiten der Ureinwohner fort.
„Die Männer, na ja einesteils sehen sie gerade nicht wie solche aus, aber Schlappschwänze scheinen sie auch nicht zu sein, denn Kinder haben sie immer reichlich. Also die tragen helle, beinahe weiße Hosen, bei jeder Gelegenheit, weit und füllig. Sonderbar, die Hosenbeine gehen dabei gerade mal bis höchstens auf die Höhe der halben Waden. Festes Schuhwerk kennen sie alle nicht. Sie machen sich so was aus geflochtenen Gräsern oder Schilf. Auch aus Agaven sollen sie Fasern erzeugen. Genau weiß ich das aber auch nicht.“
„Ach und noch was,“ versuchte er noch etwas draufzusetzen, „die Weiber schleppen ihren Nachwuchs immer mit sich rum. Scheinen immer die passende Größe zur Hand zu haben. Sie binden die Kleinen einfach auf den Rücken. Überall kann man sie damit sehen. Wickeln sie in ein langes Tuch und schwupp mit ihnen auf den Buckel. Den Rest des Tuches binden sie vorne fest und ab geht die Reise.“
Sie querten in den gut erkennbaren Furten noch die eine oder andere der sehr unterschiedlich tiefen Schluchten. Es war erkennbar, dass diese vom Wasser ausgewaschene tiefe Einschnitte in die Erde waren. Meist war es mehr ein Rinnsal, es war aber auch ein größerer Wasserlauf dabei. Dann, der Führer verkündete es gegen Abend: Dort sei Riobamba, in der Richtung, in der er zeigte. Morgen seien sie da.
Das magische Wort Riobamba verging auf Daniels Zunge. Es weckte tiefgehende Gefühle und es schmerzte ihn, dass er nicht wie geplant, zusammen mit Angelina in diese Stadt kommen konnte.
Der gleichmäßig wehende Wind, der am Nachmittag stetig von hinten kam, hatte die Reisegruppe regelrecht auf die Stadt zugetrieben.
Sie waren aus einer kleinen Senke hinter einer Bodenerhebung hervorgekommen und konnten nun die Ansiedlung Riobamba vor sich sehen. Ein etwas tristes und recht einfarbiges Bild. Aber sie waren trotzdem alle glücklich über diesen Anblick. Nach der weiten Reise, einer sehr weiten, langen und mehrfach überaus gefährlichen Reise, hatte Daniel einen neuen Ausgangs- oder Bezugspunkt erreicht. Hier, im Einzugsgebiet dieser Stadt würde er gerne seine Existenz aufbauen und so schnell wie möglich, und unermüdlich, sagte er sich, nach Angelina suchen. Denn es konnte nicht anders sein. Schließlich war es ihr gemeinsames Ziel gewesen. Sie hatten sich die Umstände aber ganz anders vorgestellt.
Riobamba, der Name dieser Stadt war auch in einem Dokument aus Madrid erwähnt, sie sollte der Mittelpunkt ihres Lebens werden.
Ja, es war eine richtige Stadt, keine unwirkliche, verworrene Durchsiedlung wie Guayaquil, mit ihren vielen zerstreut liegenden primitiven Bambushütten und nur wenigen festen Bauten aus gemauerten Steinen. Riobamba lag auf einer gut überschaubaren Ebene, an der Stelle, von der sie kamen, leicht hügelig.
Es musste so kurz vor der Mittagszeit gewesen sein, als sie den Stadtrand erreichten und die Luft geriet in Bewegung. Keinesfalls wegen der kleinen Karawane mit Kühen, einem Pferd, Maultieren und Eseln. Es war einfach die Tageszeit, in der es jeden Tag die gleiche Luftbewegung gab. Der durchaus lästige Wind legte von Minute zu Minute an Kraft zu. Bis er über den vegetationslosen Stellen den Staub und auch Sand in kleinen Wellen vor sich hertrieb. Immer wieder erzeugte er auch so eine Art Trichter, in dem Staub und sicher auch Sand in die Luft hochgewirbelt wurden. Diese Trichter wanderten dann von alleine über das Land, bis sie sich irgendwo auflösten.
Der Wind war trocken und keinesfalls warm, wie man es sich für eine Gegend so kurz unter dem Äquator gedacht hätte. Jeder Indio brauchte seinen Umhang, Poncho, und viele weisse Machthaber oder die bereits zahlreichen Mischlinge taten es ihnen gerne nach. Nach der Mittagszeit würde dieser Wind noch mehr Staub und feine Erde mit sich bringen, und vor sich hertreiben, der Wind. Der ungeliebte Wind.
Wenigstens war es so in der trockenen Jahreszeit. Und die war keinesfalls genau kalendarisch eingegrenzt. Im Gegenteil.
Der Führer fühlte sich wieder gefragt und er erklärte die Situation so: „Wenn es regnerisch wird, sehr viel gibt es nicht, dann ist eben Regenzeit. Das bezeichnen sie hier als Winter. Heute ist mal wieder Winter, das kann man dann allenthalben hören. Die Nichtregenzeit ist der Sommer, wenn es warm und auch heiß ist. Wenn es nicht so ganz warm ist, dann nennt man die Zeit eben Sommerchen. Ist doch niedlich, schön ausgedrückt, oder?“
Der Wettervorgang sei einfach einzusehen. Wenn die Sonne hoch genug stehe, erwärme sie die Bergflanken der Andenketten. „Diese erwärmen dann die Luft, sie steigt nach oben und von irgendwo muss die verschwindende Luft wieder ersetzt werden, um den Platz der nach oben entweichenden einzunehmen. Unten in der Küstenebene, Guayaquil und so - da gibt es immer genug davon und die wird nach oben in die Bergtäler gezogen. Sie wird dann gewissermaßen durch ein paar Hochtäler geschleust aber auch an den Eismassen der hohen Berge vorbei. Wo sie sich abkühlt. Und das bekommen wir auch zu spüren.
Dann fallen diese Luftmassen in die Hochtäler ein, das ist dann mit Wind verbunden und der hält dann so seine traditionelle Marschrouten bei. Und eine dieser Routen, die Straßen der Luft, ist eben mitten durch oder über oder um Riobamba. Später am Nachmittag werden sich dann Wolken bilden. Die feuchte Luft aus der Küstenebene verklumpt in den Hochlagen und bringt Regen. Meist aber nur an den Hängen ringsum, weniger sonst wo und recht selten über Riobamba. Trotzdem ist es dann am Nachmittag sonnenarm und noch kühler.“ Ganz schön schlau dieser Führer. Daniel hatte aber nur bestenfalls die Hälfte der kostenlosen Riobamba-Heimatkunde verstanden.
Aber das war noch nicht alles, der Schlauberger wusste noch mehr. „Am späten Nachmittag, wenn die Talkessel mit neuer Luft gefüllt sind, beruhigt sich die Luftbewegung, der Wind schläft ein, eine längere Zeit vor dunkel werden. Das ist dann hier die schönste Tageszeit - meiner Meinung nach.
Nachts ist es ebenfalls schön windstill. Das ist dann die Zeit in der die Kälte aus den schneebedeckten Hochlagen sich in die Täler, zwischen die Häuser und auch in die Häuser schleicht. Dann braucht man ein paar Ponchos, um nicht zu frieren und dabei recht steif zu werden. Trotz aller Vorkehrungen sind die Bewegungen seiner Bewohner in den Morgenstunden mehr behäbig. Kein flinkes Huschen aber sachte Fuß vor Fuß setzen ist dann die allgemeine Fortbewegungsart.“
Der Führer beschrieb kurz seine Absichten für den nächsten und letzten Reiseabschnitt. Er wolle sie auf einen dafür vorgesehenen Sammelplatz für Menschen und Tiere führen. Es gäbe eine Herberge dabei, die aber nicht in Anspruch genommen werden müsse.
Daniel und Sanchez standen dann bald mit ihrem Führer in einer Art großem Hof.
Direkt angeschlossen, von dem Weg zugänglich, gab es ein Quartier für Durchreisende. Hier konnten sie sich von den Reisestrapazen erholen, auf einen Reiseführer warten oder einfach verbleiben, bis sie wussten, wie es mit ihnen weitergehen würde.
Der Platz war teilweise eingegrenzt von einer gut mannshohen Wand aus vorgeformten Lehmbrocken, die aufeinandergeschichtet und mit Lehm miteinander verbunden waren.
Angelehnt an diese Wände waren von entrindeten dünnen Baumstämmen abgestützte Überdachungen aus einer Schilfart. Auf dem gleichen Material, ausgebreitet auf dem Boden, der Führer nannte es Totora, würden auch Daniel und Sanchez nächtigten.
Zunächst aber mussten sie alsbald nach Tierfutter suchen oder es kaufen. Die Herberge, die sich an den Rastplatz anschloss, kümmerte sich nicht um solche Nebensächlichkeiten.
Der Führer wollte sich verabschieden, seine Dienste seien bis hierher vereinbart worden.
Daniel entlohnte ihn und verabschiedete sich.
Sanchez hatte zwar die Absicht sich in der Stadt umzuschauen und umzuhören, überlegte es sich dann aber anders und bat Daniel dies für ihn zu tun. Schließlich war er noch zu nahe an der Hafenstadt Guayaquil, dem Hoheitsgebiet seiner Flucht. Riobamba war die Stadt, in der sich die Reisewilligen aus dem Hochland für die letzte und gefährlichste Etappe nach Guayaquil aufhielten. Sie sammelten sich hier und suchten sich einen Führer. Oder sie schlossen sich einer Reisegesellschaft an. Ein Zusammentreffen mit Reisenden zum Hafen, konnte demnach für einen geflohenen Seemann gefährlich werden. Denn der Hafenkommandant würde sicher, wenn nicht alle, doch den einen oder anderen Reisenden nach seinem Verbleib ausfragen.
Hier, in Riobamba wollte er in Erfahrung bringen, wie er wohl seine Zukunft gestalten konnte. Daniel hatte ihm bereits angeboten, zumindest für den Anfang, bei ihm zu bleiben, mitzuhelfen den Grundstock einer Hacienda aufzubauen. Der Traum von Daniel und Angelina.
Morgen wollte Daniel, ohne weiteren Zeitverlust beim Gouverneur vorsprechen, um sich so bald wie möglich Land zuweisen zu lassen.
Als Daniel, nach einem kurzen Obstfrühstück zum Gouverneurspalast kam, erlebte er gar keinen guten Empfang.
Seine Excellenz hatte anderweitige Verpflichtungen. Er müsse wiederkommen, beschied man ihn in den Vorzimmern der Macht.
Schon kramte er nach seinen Empfehlungsschreiben, der Urkunde und der Bescheinigung. Diese, die ihn als Vorbild und Held der großen, die Welt beherrschende Nation und seiner Monarchie auswies. Ein junger Mann in einem ärmellosen, bestickten Jackett herrschte ihn barsch an, ob er nicht verstanden habe? Jetzt hatte er. Heute war nicht sein Tag.
Daniel führte dann mit Sanchez sein Vieh vor die Stadt, wo es Futter finden sollte. Sie hätten aber schon weiter in die Richtung des großen Eisberges gehen müssen, um großzügig Grünfutter zu finden. An den Namen dieses riesigen Bergmassivs konnte sich keiner der Beiden mehr erinnern.
In der Nähe der Stadt waren verständlicherweise alle Ländereien bereits in fester Hand, besonders die fruchtbaren und weniger staubigen. Es gab Einfriedungen mit einer saftig grünen Hecke und an anderen Stellen wuchsen als Zaun schlanke Kakteen. Und über die Eigenheiten der jetzigen Besitzer wusste er nicht annähernd Bescheid. Eine knappe halbe Tagesreise bis zu den Ausläufern der westlichen Andenkette laufen, dorthin wo sie hergekommen waren, dorthin wollten sie dann aber auch nicht gehen. Sie wussten ja auch nicht mit Sicherheit, was sie da alles erwarten würde. Nur, dass es da viel trockene Gegenden geben würde, das war noch in ihrer Erinnerung.
So blieb es beim spärlichen und vor allem staubigen Futter. Frisches Grün war eigentlich nur so andeutungsweise hinter der einen oder anderen windgeschützten Busch- oder Heckengruppe zu sehen.
Sanchez bot sich an etwas weiter gegen die Berge zu gehen, um Futter zu suchen und um es für die Nacht und den frühen Morgen bereit zu haben. So brauchten sie es nicht zu kaufen.
Sie waren nun auf sich allein gestellt. Sie hatten den Führer entlöhnt, sie mussten nun ihr Leben selbständig gestalten. Und so begannen sie Gemeinsinn und besseren Zusammenhalt zu entwickeln.
Ihr Führer, der in der Herberge genächtigt hatte, ließ unterdessen in allen Kneipen und Herbergen der Stadt verkünden, dass er in der Lage und bereit sei, jederzeit jede Reisegruppe sicher zum Hafen nach Guayaquil zu geleiten.
Der Mittag kam und damit auch der Wind mit seiner Staubladung. Es war eigentlich gar kein Staub wie ihn Daniel aus der Extremadura kannte, es war hier mehr ein Mix vom feinsten Pulver bis zu körnigem Geriesel. Gerade dieses spürte man auf nackter Haut. Es piekte und die Augen brannten.
Wie aus dem Nichts kam eine Gruppe Indios mit Frauen und einigen Kindern. Eine panikartige Stimmung kam in Daniel hoch. Es war das erste Mal, dass Daniel mit den Ureinwohnern zusammentraf. Sanchez war unterwegs nach Viehfutter suchen. Er allein und alles kam so überraschend und beängstigend fremdartig. So wagte er nicht einmal sie genauer zu betrachten oder zu beachten. Doch die aufkommende Furcht vor den Eingeborenen war unbegründet. Sie trotteten, ohne ihn sonderlich zu beachten, weiter. Daniel schaute ihnen hinterher.
Die Gruppe war als solche gar nicht wahrzunehmen. Die Männer trotteten voraus. Fünf bis zehn Schritte hinterher liefen die Frauen mit den Kindern. Ja, die Frauen hatten tatsächlich weit fallende und glockenförmig ausladende Röcke an. So wie es der Reiseführer angesagt hatte. Daniel konnte sich tatsächlich vorstellen, dass sie mehrere übereinander trugen - so wie es ebenfalls der Führer geschildert hatte.
Es gefiel ihm, dass die Röcke allgemein schön bunt bestickt zu sein schienen.
Alle in der Gruppe waren irgendwie mit Bündeln bepackt. Die Frauen hatten, das war klar zu erkennen, größere Lasten zu schleppen und gingen teilweise recht tief gebeugt. Alle hatten Hüte gleichen Stils und Farbe, auch die Kinder, die hinterhertrabten. Und auch sie schleppten das eine oder andere Bündel.
Die Hüte waren grob geformt, mit breitem Rand, aber nicht so breit wie die schwarzen Hüte der Patrones und Caballeros in Spanien. Die hier waren hellgrau bis schmutziggrau. Daniel schätzte, dass sie aus Rohwolle gewalkt und gesteift waren. Diesen Herstellungsprozess hatte er auch schon auf der Estancia in der Extremadura beobachten können.
Die Männer hatten die Ponchos auf beiden Körperseiten gelüftet und teilweise gefaltet auf ihre Schultern gelagert. Die Frauen trugen kleinere schwarz-weiße und bunt bestickte Umhänge.
Es waren tatsächlich kleine Menschen. Gegenüberstehend müsste er sicherlich auf sie herabsehen. Aber wie Wilde sahen sie nicht aus. Zumindest nicht wie jene in den Schauergeschichten, die sich Seeleute und die Begleiter auf dem Isthmus erzählten. Menschenfresser konnten das auf keinen Fall sein. Ob sie wohl bereits gezähmt und eventuell schon getauft waren? Demnach wirklich wertvolle Christenmenschen waren, fragte sich Daniel? Wohl kaum. Denn das müsste man ihnen doch ansehen, dachte sich Daniel.
Sanchez kam spät nachmittags mit einem Bündel Futter zurück. Er musste weit gelaufen sein. Das Gras sah noch recht frisch aus und keineswegs staubig. Er habe es an einem Uferabhang bei einem tief in die Landschaft eingeschnittenen Wasserlauf gefunden.
Sie führten die Tiere zurück in die Stadt zu ihrem Lagerplatz. Besonders die Jungtiere wollten sich diesmal nur widerwillig von ihrem Futterplatz wegbringen lassen.
Dann verbrachten sie die zweite Nacht in der so beschriebenen alten Königsstadt der zerschlagenen Inkakultur. Nichts erinnerte mehr an diese Zeit. Daniel hatte sie sich ganz anders vorgestellt. Später erfuhr Daniel, dass man angeblich alte Pracht- und Kultbauten eingerissen habe, um mit deren Steinen die Kathedrale zu errichten. Ein unbarmherziges, definitives Zeichen des Sieges über diese barbarischen Goldhamsterer.
Man hatte einen kleinen Teil des erbeuteten Goldes aus den prächtigen Kultbauten für die Ausschmückung der eigenen Kirchen und vor allem der Kathedrale genutzt. Den weitaus größten Teil allerdings hatte man der christlichen Krone nach Spanien geschickt. Sie hatte es verdient reich zu sein. Die Feldzüge gegen die Reformisten, Protestanten, Sektierer, Ungläubigen, Gotteslästerer und Ketzer kosteten halt leider Geld. Die Kriege, die gegen sie geführt werden mussten, waren teuer und auch Rom konnte nicht genug von den Reichtümern aus Südamerika bekommen. Aber anders war ein Sieg über das Böse, alle diese Teufelswerke nicht zu erreichen. Dazu war das Gold der Inkas, aus Kultgegenständen eingeschmolzen, gerade zur rechten Zeit nach Europa gekommen. Da konnte man es zur größeren Ehre des katholischen Gottes einsetzen, statt es in Kultstätten der Inkas im Dienst und der Ausschmückung von Götzenaltären zu verschwenden.
Am Abend kamen Daniel und Sanchez zu dem endgültigen Schluss, dass es doch fürs Erste besser sei, zusammenzubleiben. Sanchez konnte nämlich als sein Bruder durchgehen, der auf einem Schiff mit dem Namen <Santa Ceacilia> Dienst getan habe. Daniel konnte es sogar belegen, denn sein Bruder war in einem Empfehlungsschreiben seines ehemaligen Patrons ausdrücklich enthalten. So sei er als ein Humberto Machado freier in seinen Bewegungen und Fragesteller konnten eine klare Antwort erhalten. Auf diese Weise bekam der flüchtige, ehemals zwangsverpflichtete - gepresste - Seemann die Möglichkeit mit einem neuen Namen ein neues Leben zu beginnen.
Wo würde sich wohl in diesem Moment Humberto befinden? Daniel spürte einen Druck auf seinem Herzen. Für einem Moment erschien es ihm als hätte er einen Verrat begangen. Was hätte er nicht alles getan, um ihm zu helfen.
Nun würden er und Humberto, alias Sanchez, zusammen eine Hacienda aufbauen und, wenn er denn glaubte von diesem Leben genug zu haben, sollte er jederzeit seine eigenen Wege gehen können. Vielleicht sogar auch wieder nach Spanien zurück, was der Traum von Sanchez überhaupt war. Doch so viel wusste er, dass dies doch besser ein Traum bleiben sollte. Die Wirklichkeit wiedererkannt zu werden, müsste in Ketten, Kerker oder gar an einem Strick um seinen Hals enden. Jetzt aber gab es zunächst für beide eine Aussicht auf Zukunft. Morgen würde Daniel seinen neuen Bruder mitnehmen zum Gouverneur, um ihn vorzustellen. Dann überlegte er sich diese Absicht noch einmal. Es war vielleicht verfrüht. Er tat es dann doch nicht, noch nicht.
Andererseits, würde diese Art zu handeln nicht doch vielleicht eines Tages den Gouverneur verärgern? Sie beließen es dennoch bei ihrem Entschluss.
Daniel bekam seine Audienz. Seine Excellenz hatte schlecht geschlafen, hatte noch eine lange Zipfelmütze auf, die seine Glatze vor der Kühle schützte. Oder war seine Perücke noch nicht fertig herausgeputzt? Seine Füße steckten in bepelzten Hausschuhen aus weißem Fell die von dem langen bestickten Mantel beinahe noch verdeckt wurden.
Er beklagte sich breit über die Dienstboten, diese Halbwilden, die sich einfach nicht an disziplinierte Zeitvorgaben gewöhnen konnten. Sein Frühstück sei niemals zur richtigen Zeit auf dem Tisch, die Kleider nicht ordentlich gebürstet und bereitgelegt. Der Tee entweder zu heiß oder schon abgestanden.
Der korpulente Herr seufzte, was man da so alles mitmachen müsse, daran werde er sich niemals gewöhnen können. Das aber sei der Preis, den man an die eigene Überlegenheit zahlen müsse. „Wären diese trögen Indios so perfekt gewesen wie wir Spanier, wir hätten sie ja so einfach nicht besiegen und unterwerfen können“, meinte seine Excellenz hellsichtig und gleichzeitig großherzig herablassend.
In dem großen und ungewöhnlich hohen Raum brannte auf der, den Fenstern abgewandten Seite ein gewaltiges Kaminfeuer. Davor stand ein gewaltiger Tisch, rundum beschnitzt und in einem warmen Ton gebeizt. Gegenüber dem Herrschervertreter sollte Daniel Platz nehmen.
Seine Excellenz grollte noch dem einen oder anderen Diener, die er abwechselnd mit besonderen Klingelzeichen herbeirief. Mal klingelte er zweimal, mal einmal langanhaltend, mal nahm er das kleine Glöckchen und wiederholte das Spiel. Immer kamen vorbestimmte Diener, barfuß und sehr ärmlich gekleidet. Das war allerdings nur die Meinung Daniels.
„Man muss sie nur dressieren, einfachste Methoden helfen, mehr kann man von ihnen nicht verlangen,“ geruhte seine Excellenz unaufgefordert aufzuklären. „Irgendwann lernen sie wenigstens das Wesentlichste. Mehr brauchen sie auch nicht zu können. Doch dafür müssen sie immer wieder abgerichtet werden. Ein Klingelzeichen für das, ein anderes für dieses. So kann man sie ertragen. Niemals zu viele Aufgaben übertragen. Das, mit dem man sie beauftragt, das muss aber, zack-zack, klappen. Der Teufel mag sie holen, wenn sie sich zierten.“
Ein bemerkenswerter Mann, dachte Daniel. Eine abschließende Meinung wollte er sich jedoch noch nicht bilden. Seine eigene, irgendwie angeborene Scheu gegenüber Würdenträgern oder Vorgesetzten allgemein, wurde diesmal durch diese Vertraulichkeiten in keinem Fall vermindert.
Seiner Excellenz war angeblich bereits zu Ohren gekommen, dass ein verdienter Bürger seiner Majestät gewillt war hier Pionierarbeiten zu übernehmen. Dieser saß ihm nun gegenüber.
Der Herr wendete schweigend einige Papiere, bevor er sich direkt, und ohne weiter über sein unnützes Personal zu dozieren, an Daniel wandte.
Wann er denn ausgereist sei? Welche Abenteuer er auf See zu überstehen hatte? An welche Namen von Schiffen er sich erinnern könne - sie mussten doch mehrheitlich neueren Datums sein. Von den meisten hatte er noch niemals gehört.
„Ja, ja, die Zeit schreitet schnell voran. Spanien diktiert dem Rest der Welt seine Forderungen und Bedingungen. Wir haben die wichtigste Rolle auf dieser Erde übernommen. Und wir werden keinen Schritt mehr zurück machen. Um unsere Vorstellungen durchzusetzen, haben wir die Mittel und den Willen. Und wir haben den wichtigsten Verbündeten, nämlich Gott und seinen Stellvertreter auf Erden auf unserer Seite. Der Vatikan gibt uns für alle unsere Aktionen seinen Segen. Damit, junger Freund, sind wir unschlagbar.“
Damit hatte er schon wieder eine patriotische Rede gehalten.
Seine Excellenz griff wieder zur Klingel, schellte kurz, stellte sie ab und nahm die andere, um zweimal zu läuten. Ein abgemagerter, blasser, etwas gebeugt gehender Mann mittleren Alters kam und wurde sofort wieder hinausgejagt. Dahinter erschien aber bereits das nächste Gesicht und nahm eine Frage im Befehlston entgegen: „Was ist mit meiner Perücke? Wie lange soll ich denn noch warten?“
Der Diener stand dann noch eine Weile wie angewurzelt, bis der gnädige Herr mit einer Hand mehrere gut verständliche Handbewegungen machte. Danach verschwand der Diener wortlos.
Interessiert las seine Excellenz dann die Empfehlungsschreiben, die Urkunde aus Spanien und auch den Bericht aus Guayaquil. Der Inhalt war an sich relativ unwichtig für seine Excellenz. Aber aneinandergereiht stellten die Dokumente so etwas dar wie Nachrichten aus erster Hand. So erfuhr er nämlich über die Namen der ausfertigenden Personen Zusammenhänge, die er mit anderen Informationen zu verknüpfen wusste.
Ihm war die Familie von Daniels Patron bekannt. So ließen sich mit einigen Fragen zu Diesem und Jenem über die Entwicklung seines Bekanntenkreises, seinem Wissensstand immerhin neue Erkenntnisse hinzufügen. Über den Hafenkommandanten in Guayaquil stellte er keine weiteren Fragen. Seine Excellenz grunzte nur vernehmlich beim Lesen seiner Berichte.
Dann gab es wieder ein Donnerwetter, weil immer noch nichts zu trinken für ihn und seinen Gast bereitstand. Der verantwortliche Diener für die Perücke, der wahrscheinlich zunächst versehentlich in den Raum kam, stammelte irgendwelche Entschuldigungen. Oder waren es Verwünschungen? Daniel verstand nichts.
Der Nächste, der in einem ganz anderen Outfit erschien, erhielt barsch Aufträge, schnellstens diese und jene Getränke herbeizuschaffen. Es drehte sich um auszupressende Früchte, deren Bezeichnung Daniel bis jetzt nicht gehört hatte.
Über die entflohenen Negersklaven wollte er noch etwas wissen. Ob Daniel selbst die Besiegten oder Hingerichteten gesehen habe?
Daniel musste sich zunächst einmal eine unverfängliche Antwort zurechtlegen. Der Herr Excellenz geruhte auf eine Antwort Daniels zu warten.
Er habe sich ganz auf die Führung seines Kommandanten, seine Befehle und Anordnungen verlassen, versuchte Daniel das Gespräch nicht auf unsicheres Terrain verlaufen zu lassen.
Seine Excellenz vermerkte dies als gute Tradition eines disziplinierten königlichen Soldaten - zusammengefasst: Keine Vermutungen, sich an Befehle halten, keine Extravaganzen. Doch zum Erschrecken Daniels wollte seine Excellenz das Thema mit den N***rn immer noch nicht ruhen lassen. Denn nach einer Pause sprach er nochmals darüber, allerdings mehr wie zu sich selbst.
„Das muss aber doch schon Jahre her sein, das mit der Meuterei und Flucht. Meldungen zufolge, die allerdings unbestätigt blieben, hätten sie sich in einem unfruchtbaren Wüstental sesshaft gemacht. Seltsam, dass ich darüber dann keine weiteren Benachrichtigungen mehr erhalten habe.“ Das Letzte hatte er wieder mehr wie zu sich selbst gesagt.
Zu Angelina bisher kein Wort, keine Frage.
Er schaltete jetzt auf ein anderes Thema, auf das Hauptthema von Daniels Besuch. Letztendlich war ja das Weiterdenken und die Aussprache über solche militärstrategische Angelegenheiten bei der Anwesenheit von Untergeordneten oder nichtmilitärischem Personal unerwünscht.
Ob Daniel bereits eine besondere Örtlichkeit für seine Niederlassung ausgekundschaftet oder in eine nähere Wahl gezogen habe? Ob er Erfahrung habe im Umgang mit Indios? Ob er eine Frau mitgebracht habe oder beabsichtige eine nachkommen zu lassen? Ob ein zuzuweisender Besitz für Daniel allein oder auf beide Namen, auch der seines Bruders einzuschreiben sei? Was er an Handwerkszeug, Vieh, Baumaterial, Einrichtungen oder Waffen besitze? Über welches Startkapital er verfügen könne?
Bei diesem Punkt musste Daniel dann doch zugeben, dass es damit nicht berauschend bestellt sei. Sein Bruder habe so gut wie nichts, nein er habe gar nichts als seine Arbeitskraft, die er aber mit Begeisterung einzusetzen gedenke, genauso wie er, Daniel. Und der neue Besitz möge auf seinen Namen eingetragen werden.
Daniel war erleichtert, als der Gouverneur nicht weiter mit Fragen bohrte.
Doch dann erinnerte sich Daniel an sein Zuchtvieh, das ja ein beachtliches Startkapital darstellte. Bekanntlich ließ sich dieses über den Umweg des Futters, das es hier ja gottseidank ....
Seine Excellenz unterbrach Daniel in seinen hörbar geäußerten Gedankengängen und geruhte zu bemerken, dass dies meist nicht recht ausreiche. Denn es dürfe nicht sein, dass auch nur einer der Kolonnen schlechter behaust sei als seine zugewiesenen Leibeigenen. Das würde keine guten Voraussetzungen für eine respektvolle und zufriedenstellende Zusammenarbeit mit diesen Indios erbringen. Als verdienter Bürger seiner königlichen Majestäten stünden ihm Startkapital zur Verfügung. Er würde dies in angemessener Höhe erhalten und der Gouverneurspalast würde dafür bürgen. Anweisung erginge an die örtliche Bank <zum Heiligen Geist>. (Banco Espirito Santo) Dorthin möge er sich wenden.
Eine Menge gab es noch zu besprechen. Seine Excellenz bemühte sich das Wesentliche rasch hinter sich zu bringen. Er hatte zwischenzeitlich nach einem Sekretär geschickt, der einige Anweisungen schriftlich festzuhalten hatte.
Daniel schwindelte vor so viel Bürokratie und zitterte immer wieder vor nur vielleicht begründeter Angst, dass sich alles irgendwie doch noch als Irrtum herausstellen könnte. Und er eventuell, im schlimmsten Fall, im Gefängnis landen könnte.
Aber seine Excellenz geruhte anzuordnen, dass Daniel am übernächsten Tag mit drei Soldaten ausreiten solle. Gemeinsam würden sie sich zunächst zusammen im nördlichen Teil des Hochtales nach geeigneten Ländereien umzuschauen. Die Soldaten seien ortskundig und wüssten ihn dorthin zu führen, wo noch Land zur Verteilung zur Verfügung stünde. Danach, wenn die Entscheidung einmal gefällt wäre, würde man die übliche Kommission zusammenstellen, um Fakten zu schaffen, die Begrenzungen festzulegen und die Akten zu beglaubigen.
Das hörte Daniel aber nur mit halbem Ohr. Zu groß war die Begeisterung, dass er kurz vor seinem Ziel stand - er verbesserte sich: Vor ihrem Ziel, Angelinas und seinem Ziel.
Er glaubte, dass es richtig war, seiner Excellenz nichts vom Schicksal mit seiner Frau mitgeteilt zu haben. Weiß der Himmel, was das eventuell für Schwierigkeiten hervorgerufen hätte. Gut möglich, dass seine Excellenz auch ehemaliger Militär war, vielleicht sogar irgendwie dem Kommandanten verbunden. Gemeinsam wäre es den beiden dann sicher möglich gewesen - nein: todsicher möglich gewesen, ihn definitiv aus diesem Leben zu befördern und von Angelina endgültig zu trennen.
In diesem Punkt irrte sich Daniel gewaltig. Aber das konnte er zu diesem Zeitpunkt unmöglich wissen. In seiner jetzigen Position und gemäß seinem augenblicklichen Kenntnisstand, war aber eine andere Reaktion einfach nicht realistisch. Man könnte sich nun trösten, dass die Zeit sprichwörtlich <manche Wunde heilt>. Doch eben nur manche. Andere Wunden aber reifen weiter, eitern und können Menschen verzehren und vernichten.
Auch davon wusste Daniel noch nichts.
Nachdem Daniel aus dem Gouverneurspalast herausgekommen war, ging er die paar Schritte bis zur Kathedrale. Er wollte sich jetzt bei seinem Schöpfer für die letztendliche glückliche Fügung bedanken. Und, das nahm er sich auch vor, ihn daran zu erinnern, dass er es doch fügen möge Angelina zu ihm zurückzubringen. Bald und unversehrt. Allzu viel Optimismus spürte er nicht hinter seinem Anliegen. Denn, was mit Angelina geschehen war, hätte doch sein Gott verhindern können. Eine gewisse Bitternis trübte die gerade erlebte Freude.
Wie er so da stand und das große Gebäude bewunderte, bemerkte er nicht, wie eine alte Frau, eingewickelt von oben bis unten in schwarzes Tuch, zu ihm ungebeten sagte, dass die Hochmesse am Sonntag um zehn Uhr stattfände.
Daniel stand der Mund offen und er vergaß in seiner Überraschung sich darüber zu bedanken. Die Alte war aber bereits weitergeschlurft.
Und Daniel stand immer noch der Mund offen, als er sich erinnerte, dass er keinen blassen Schimmer hatte, welcher Wochentag heute war.
Ach, und eine Uhr hatte er auch nicht - noch nie in seinem Leben gehabt. Er würde also noch einige Fragen stellen müssen.
Dann ging er in das Gotteshaus, kniete vor dem Hauptaltar nieder und begann seine Zwiesprache mit Gott, sowie er es gelernt hatte. Dann kam doch seine Fürbitte wegen Angelina an erster Stelle. Den Dank für seine eigene Rettung wollte er dann doch erst an zweiter Stelle bringen. Gott sollte einesteils sehen, dass noch nicht alles für Daniel in Ordnung ging, dass da noch ein Anliegen unerfüllt war. Danach sollte Gott erkennen, dass er gleichwohl auch dankbar war, für das was er bis jetzt er- und überhaupt überleben durfte.
Nach seinem Besuch schaute er sich vor dem Gotteshaus wie suchend um. Er erkannte, dass in der näheren Umgebung der Plaza einige Gebäude über die weiter wegliegenden hinausragten. Rund um die Plaza selbst waren alle Gebäude mit soliden Steinmauern errichtet. Dahinter sah es nicht danach aus.
Was er aber jetzt im Weitergehen entdeckte war, dass alle weiteren Häuser und Baulichkeiten in einem quadratischen Grundmuster angeordnet waren. Das erleichtert die Orientierung, fand er.
Jetzt, mit dem guten Gefühl endlich erfolgreich zu sein, interessierte sich Daniel auch für die Umgebung und das Leben allgemein. Er fand die Ausführungen seines Reiseführers zutreffend, dass alle Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, denen er begegnete, bedeutend kleiner waren als er selbst. Und sie waren auch kleiner als alle Männer und Frauen in Spanien, mit denen er Umgang hatte oder die er gekannt hatte.
Er sah jetzt die Bewohner, die Eingeborenen mit anderen Augen. Sie hatten so fremdartige Gesichter und schienen von der Sonne extrem braun gebrannt zu sein. In Guayaquil hatte er niemanden von ihrem Aussehen gesehen. Alle, auch die Frauen und Kinder trugen Hüte, so gut wie alle immer die gleichen Hutformen. Bei Männern saßen sie auf dem Kopf, die Frauen trugen sie hoch oben auf einem Bündel Haare befestigt.
Und alle diese Menschen, er sah nur wenige mit dem Aussehen eines Spaniers, waren seltsam bekleidet. Sie hatten ihren bunten Umhang, der auch die Arme bis zu den Händen bedeckte. Darunter sah man bei den Männern das Beinkleid aus hellem Stoff, und diese Beinkleider endeten etwas unter dem Knie.
Schuhe kannten sie scheinbar nicht, sie hatten tatsächlich eine Art Sandalen - aus welchem Material wohl? Fragte sich Daniel.
Er sah sich die Häuser näher an. Es waren nach seinen Begriffen meist Hütten, die aus Lehmmauern mit eingeflochtenen Zweigen und Ästen bestanden. An einigen älteren Exemplaren, wo bereits Lehm herausgebröckelt war, konnte man eben diese Einflechtungen erkennen.
Keine dieser Hütten hatte Fenster, wenigstens nicht, soweit es Daniel einsehen konnte. Die Eingangstüren waren unterschiedlich verschlossen - wenngleich ihm der Begriff <verschlossen> völlig ungeeignet erschien. Sie waren verhängt mit geflochtenen Matten, aus einem Material, das ihm unbekannt war. Oder es gab vereinzelt auch eine Art doppelte Tür, zwei Türenteile aus grob bearbeitetem Holz, ein Teil unten, ein anderer oben. Der obere Teil stand meist offen.
Viele Straßen und Wege waren mit faustgroßen Kieselsteinen belegt und befestigt. Das war für Daniel neu - muss ich mir merken, sagte er sich.
Hocherfreut und stolz berichtete er seinem brüderlichen Freund Sanchez von den Ergebnissen beim Gouverneur.
Beide konnten sich zu Recht freuen.
Daniels neue WeltGeschichte, Politik, Macht und Religion
Daniel bekam von einem Boten bestätigt, dass er sich am nächsten Tag für einen Ausritt bereithalten sollte. Er werde, wie angeordnet, von drei erfahrenen Soldaten begleitet. Alles weitere sei von seiner Excellenz schriftlich festgehalten und an den Anführer der Soldatengruppe weitergeleitet worden.
Er fragte den Boten, ob er ihn auf seinem Weg zurück begleiten könne. So könne er auch den Treffpunkt kennenlernen. Daniel bedrückte aber etwas anderes. Er hatte für sein Pferd keinen Sattel. Er dachte daran sich einen ausborgen zu können.
Als er dem Leiter der Expedition vorgestellt wurde und ihm sein Problem geschildert hatte, gab es keine langen Diskussionen. Er bekam ein gesatteltes Pferd angeboten. Man wollte es sowieso anbieten, weil man gar nicht wusste, dass er überhaupt ein Pferd besaß.
Sanchez, nun Humberto, blieb zum Hüten, zur Pflege und Ernährung der Tiere zurück. Am Tage des Ausritts war wieder so ein stahlblauer Himmel, der jetzt Daniel bereits vertraut war.
Sie ritten auf dem Weg aus der Stadt, auf dem sie mit dem Führer aus Guayaquil gekommen waren. Allerdings bog dieser bald in nördliche Richtung, ziemlich genau in Richtung des riesigen Eisklotzes ab. Rechts hinter seinem Rücken, über Riobamba stand die Rauchwolke des Vulkans - Sangay oder war es der Altar? Keiner „seiner“ Soldaten wusste das genauer zu sagen. Die Krater selbst lagen hinter der Hauptkette der östlichen Anden.
Dort hinunter sei noch niemand gekommen. Die Berge seien dort zwar nicht mehr so hoch wie die rundum sichtbaren Gipfel, aber dort begänne eine grüne Hölle. Endlose Wildnis mit Bergen und immer tieferen Tälern, reißenden Wasserläufen. Es sei alles mehr und mehr undurchdringlich. Ein kaum zu durchdringender Dschungel oder Urwald.
Kopfjäger und Menschenfresser gäbe es dort. Leute seien verschwunden. Andere erzählten grauselige Geschichten.
Nun, dort wollte Daniel ja auch nicht hin. Sie bewegten sich weiter nach Norden. Ihr Reiseweg drängte sich mehr an die westliche Andenkette, die östliche lag weit entfernt und zeigte sich tiefblau. Beständig hatten sie die mächtige Eismasse des Chimborazo im Blick.
Die drei Soldaten, waren bei der Abreise aus der Stadt ordnungsgemäß gekleidet, wie es sich für Streiter seiner königlichen Majestäten gehörte. Jetzt begannen sie in der sich schnell erwärmenden Luft den Helm abzulegen und die gepanzerte Brust zu öffnen. Jeder Soldat führte an seinem Pferd ein Maultier mit Gepäck. Sie transportierten Zelt, Essen, Ersatzkleidung, Zeichenmaterial für die Landschaftserfassung usw. Zum Trinken, sagten sie, würden sie unterwegs immer mal wieder sauberes Wasser finden. Der Chimborazo würde es in grossen Mengen spenden.
Um die Mittagszeit, die Zeit, in der also in Riobamba der Wind schon unbequem war, ritten sie in einem recht paradiesischen Klima. Die Landschaft hatte sich komplett verändert. Die kaum bewegte Luft fühlte sich angenehm warm und weich an. Alles in der Natur präsentierte sich satt grün.
Dann begegneten sie einer größeren Reisegruppe mit mehreren Wagen. Sie waren mit Warennachschub für die Provinzhauptstadt Riobamba unterwegs. Die Begleitmannschaften waren Daniels drei Begleitern gut bekannt und alle freuten sich über die Abwechslung des Zusammentreffens. So saßen sie dann längere Zeit beisammen und tauschten Neuigkeiten aus.
Ihre bisherige Wegstrecke war stets leicht angestiegen. Links vor ihnen wurde jetzt der riesige Chimborazo immer grösser und wuchtiger. Daniel fand es faszinierend, wie dieses Eismassiv in rascher Folge sein Aussehen veränderte. Mal lag er glasklar, wie zum Greifen nahe vor ihnen. Dann zeigten sich zaghaft an einer Flanke weiße Wölkchen. Es waren eigentlich nur feine Striche.