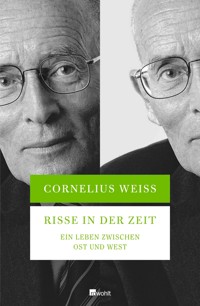
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Einundzwanzig Gramm Radium. Der deutsche Atomphysiker Carl Friedrich Weiss trägt sie bei sich, ihr Wert: rund 5 Millionen Dollar. Er soll das Radium sicher auf den Obersalzberg schaffen. Zu kostbar ist das Gut, das auch für die Rüstungsindustrie gebraucht wird. Cornelius Weiss beginnt seine Autobiographie mit der dramatischen Geschichte seines Vaters, der am Ende des Zweiten Weltkriegs das Radium vor den Nazis versteckt und es schließlich den Alliierten übergibt. Zugleich lehnt er das Angebot ab, künftig in den USA zu forschen. Als christlicher Sozialist entscheidet sich Carl Friedrich Weiss, mit seiner Familie in die Sowjetunion zu gehen. Was er nicht ahnt: Zusammen mit anderen Wissenschaftlern kommen sie nicht nach Moskau, sondern in das «Wissenschaftszentrum Obninsk» – ein Gulag. Erst nach Jahren darf die Familie Weiss zurück in die Heimat. Sie entscheiden sich für die DDR. Cornelius Weiss wird Chemiker. Nach dem Mauerfall wählt ihn die Leipziger Universität zum Rektor. Nach seiner Emeritierung tritt er in die SPD ein – und wird in den Sächsischen Landtag gewählt. Seine mutigen Auftritte gegen Neonazis machen ihn überregional bekannt. Dieses Buch erzählt eine fesselnde und nahezu unbekannte Geschichte über Wissenschaft im Dritten Reich, in der Sowjetunion und in der DDR – und über den demokratischen Umbruch ab 1989. Und es ist zugleich eine Familienchronik der besonderen Art.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Cornelius Weiss
Risse in der Zeit
Ein Leben zwischen Ost und West
Über dieses Buch
Einundzwanzig Gramm Radium. Der deutsche Atomphysiker Carl Friedrich Weiss trägt sie bei sich, ihr Wert: rund 15 Millionen Dollar. Er soll das Radium sicher auf den Obersalzberg schaffen. Zu kostbar ist das Gut, das man zur Herstellung von Atombomben braucht.
Cornelius Weiss beginnt seine Autobiographie mit der dramatischen Geschichte seines Vaters, der am Ende des Zweiten Weltkriegs das Radium vor den Nazis versteckt und es schließlich den Alliierten übergibt. Zugleich lehnt er das Angebot ab, künftig in den USA zu forschen. Als christlicher Sozialist entscheidet sich Carl Friedrich Weiss, mit seiner Familie in die Sowjetunion zu gehen. Was er nicht ahnt: Zusammen mit anderen Wissenschaftlern kommen sie nicht nach Moskau, sondern in das «Wissenschaftszentrum Obninsk» – ein Gulag.
Erst nach Jahren darf die Familie Weiss zurück in die Heimat. Sie entscheiden sich für die DDR. Cornelius Weiss wird Chemiker. Nach dem Mauerfall wählt ihn die Leipziger Universität zum Rektor. Nach seiner Emeritierung tritt er in die SPD ein – und wird in den Sächsischen Landtag gewählt. Seine mutigen Auftritte gegen Neonazis machen ihn überregional bekannt.
Dieses Buch erzählt eine fesselnde und nahezu unbekannte Geschichte über Wissenschaft im Dritten Reich, in der Sowjetunion und in der DDR – und über den demokratischen Umbruch ab 1989. Und es ist zugleich eine Familienchronik der besonderen Art.
Impressum
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2012
Copyright © 2012 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Mitarbeit Regina Carstensen
Lektorat Uwe Naumann
Umschlaggestaltung ANZINGER | WÜSCHNER | RASP, München
Foto des Autors: privat
ISBN Buchausgabe 978-3-498-07374-9
(1. Auflage 2012)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-01741-2
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Prolog
1 Familiengeschichte
2 Biesdorfer Idylle
3 Der Geruch des Krieges
4 Ausgebombt
5 Die Poloniumhalle
6 Kriegsende in Rittersgrün
7 Hunger
8 Verbrannte Erde
9 Die Scharaschka – ein Geheimobjekt des MWD
10 In der Lagerschule
11 Alltag in Obninsk
12 Eingesperrt!
13 Gerüchte, Lethargie und Verzweiflung
14 Quarantäne am Schwarzen Meer
15 Studium in Minsk
16 Rostow am Don
17 Willkommen in der Heimat
18 Neuanfang in Leipzig
19 Der 13. August 1961
20 Forschen in der DDR
21 Kollektiv der sozialistischen Arbeit
22 Prager Frühling 1968
23 Reisekader NSW
24 Leipzig-Blues
25 Wir sind das Volk!
26 Umbruchzeiten
27 Verantwortung für die Universität
28 Im Sächsischen Landtag
Epilog
Quellennachweis der Abbildungen
Familie Weiss, 1942: ...
Prolog
Einundzwanzig Gramm sind es genau, einundzwanzig Gramm Radium. Es ist die gesamte Radiumreserve des Deutschen Reiches mit einem Wert von rund fünf Millionen Dollar. Sie befindet sich, in einem schweren Behälter aus Blei, auf der Ladefläche eines Lkw. Mein Vater, Carl Friedrich Weiss, Leiter der Abteilung Atomphysik der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, wechselt sich am Steuer mit zwei zuverlässigen Mitarbeitern, dem Physiker Hans Westmeyer und dem Techniker Gustav Wauschkun, ab. Eine schwerbewaffnete SS-Wachmannschaft begleitet die drei, es geht nach Berchtesgaden. In diesem April 1945 hatte mein Vater vom Reichsverteidigungskommissar und Gauleiter von Thüringen Fritz Sauckel den militärischen Befehl erhalten, das Radium auf den Obersalzberg in Hitlers «Bergfestung» zu bringen. Weder die herannahende Rote Armee noch die westlichen Alliierten dürfen es in die Hände bekommen; zu kostbar ist das Material, das auch für die Rüstungsindustrie gebraucht wird.
Auf Nebenwegen geht es durch Bayern. Irgendwann hören sie aus der Ferne den Gefechtslärm der herannahenden Westfront. Die SS-Leute haben es plötzlich sehr eilig. Sie befehlen den drei Zivilisten, ohne sie weiterzufahren, und schlagen sich mit der Erklärung, nunmehr am Kampf um den «Endsieg» teilnehmen zu wollen, in die Büsche. Mein Vater atmet erleichtert auf. Als Beamter hat er dem Reich und Hitler zu Diensten stehen müssen, mit seinem Gewissen war das nicht immer vereinbar. Als christlicher Sozialist verachtet er das NS-Regime. Mit den «Wachhunden» an seiner Seite hätte er dennoch keine andere Chance gehabt, als den Befehl auszuführen. Aber jetzt …
Die drei Männer sind sich schnell einig: Auf keinen Fall darf das Radium in Hitlers Hände gelangen. Sie überlegen: Erst in ein paar Tagen erwartet man sie in Thüringen zur Vollzugsmeldung zurück. Aber vielleicht ist der Krieg bis dahin ja vorbei. Die Anzeichen dafür mehren sich. Inzwischen könnte man das Radium irgendwo verstecken. Dann wird man weitersehen.
Sie fahren durch das Isartal. Langsam. Sie suchen einen markanten, später wieder auffindbaren sicheren Platz für das Radium. Sie finden ihn etwa fünfzehn Kilometer südlich von Bad Tölz an einem dicht bewaldeten Steilhang zum Fluss. Mit dem Feldspaten graben die drei ein tiefes Loch in den Waldboden. Sie schauen sich um, alles ist still, niemand scheint sie zu beobachten. Sie versenken den gefährlichen Schatz in der Erde, beseitigen notdürftig alle Spuren, zuletzt zeichnet mein Vater eine grobe Lageskizze. Sie trägt das Datum 22. April 1945.
Nur die drei Männer wissen nun, wo sich das Radium befindet. Es ist sicher, jedenfalls sicher vor Hitler. Was die drei aber nicht wissen, ist die Tatsache, dass ganz Thüringen inzwischen durch die 3. US-Armee unter General George S. Patton besetzt ist und dass Sauckel und Konsorten längst geflohen sind. Sie könnten also gefahrlos nach Ronneburg zurückkehren. So aber fahren sie zunächst lieber vorsichtig in nordwestlicher Richtung. Als ihnen nahe der tschechischen Grenze der Treibstoff ausgeht, trennen sie sich. Westmeyer und Wauschkun wollen sich direkt nach Thüringen durchschlagen, mein Vater zu seiner Familie, zu uns nach Rittersgrün im oberen Erzgebirge. Er wählt den Weg über Böhmen und kommt nach abenteuerlicher Reise kurz nach Kriegsende bei uns an. Rittersgrün ist zu dieser Zeit ebenso wie der ganze Kreis Schwarzenberg durch ein Versehen der Alliierten immer noch unbesetzt und bleibt es bis zum 24. Juni – die legendäre «Freie Republik Schwarzenberg».
Wenige Tage vor der Besetzung des Kreises durch die Rote Armee fährt mein Vater weiter nach Ronneburg, um sich endlich bei seiner Arbeitsstelle zurückzumelden. Unmittelbar nach seiner Ankunft wird er vom US-Geheimdienst verhaftet. Der ist bestens über die deutschen Radiumvorräte und ihren «Hüter» informiert. Mein Vater berichtet den ihn verhörenden Offizieren, wo das Radium liegt. Die Amerikaner fordern ihn auf, mit ihnen zu dem Versteck zu fahren und das Radium auszugraben. Das Radium liegt tatsächlich noch an der Stelle, wo mein Vater es vergraben hat, er übergibt es gegen Quittung den Amerikanern – die Washington Post titelt am 27. Juni triumphierend: «All German Radium in American Hands». Danach wird er von Offizieren der US-Streitkräfte interniert. Sie wollen ihn für die amerikanische Atomforschung rekrutieren. Mein Vater lehnt jedoch alle Angebote ab. Schon in der Nazizeit fühlte er sich für politische und damit für kriegsbedingte Zwecke missbraucht. Er war nicht Physiker geworden, um anderen Menschen mit seinen Erkenntnissen den Tod zu bringen. Er wollte, wie er sagte, «Dorfschullehrer» werden oder lieber noch ein zweites Mal studieren. Medizin. Das einzige Fach, das seiner Meinung nach nicht für kriegerische Zwecke missbraucht werden könne.
Er entweicht aus der Baracke, in der die Amerikaner ihn relativ unbewacht festhalten, klaut ein Fahrrad und radelt los – den weiten Weg zurück bis nach Thüringen, wo inzwischen die Rote Armee einmarschiert ist. Auch für sie ist mein Vater kein Unbekannter, auch sie wollen ihn für die Atomforschung anwerben. Für die friedliche, wie man ihm immer wieder versichert. Und das NKWD[a], der damalige russische Geheimdienst, hat ein Argument, das sich nicht widerlegen lässt: «Nach Ihrer Flucht können Sie nicht mehr zurück zu den Amerikanern!» Das NKWD übt Druck aus, interniert ihn für Wochen im Schloss Albrechtsberg in Dresden und entlässt ihn mit einem Sack voller Pferde- und Rinderknochen. Für die Familie, die zu Rate gezogen wird, ist die beeindruckende Nahrungsmenge das entscheidende Argument. Einstimmig wird beschlossen, das Angebot des NKWD anzunehmen: Zwei Jahre vertraglich geregelter wissenschaftlicher Arbeit in der Sowjetunion, um die heimischen Nachwuchskräfte anzulernen und die russische Forschung zu modernisieren.
Daraus werden reichlich sieben Jahre hinter Stacheldraht.
1Familiengeschichte
Eine echte Schönheit war meine Mutter nicht. Wie so manche ostpreußische Frauen hatte sie etwas Stämmiges an sich, etwas Robustes, dabei gehörte sie noch zu den Zarteren innerhalb ihrer Familie. Auf den Fotos, die ich von ihr besitze, wirkt sie sehr mütterlich; dass sie viele Hemmungen hatte, vieles unterdrückte, sieht man ihr auf diesen Bildern nicht an.
Hildegard Joachim, geboren am 7. Februar 1900, stammte aus einer alten Pfarrersdynastie in Ostpreußen. In der Nazizeit, als der sogenannte Ariernachweis Pflicht war, verfolgte man die Familiengeschichte so weit wie möglich zurück, um Ahnentafeln aufstellen zu können. Durch die weiß ich, dass alle meine Vorfahren mütterlicherseits im Dienst der evangelischen Kirche standen. Und wenn sie nicht Pfarrer waren, trugen sie Titel wie «Superintendent» oder «Konsistorialrat». Nach der Familiensaga soll der Ursprung der Joachims eine uneheliche Tochter des Scharfrichters zu Heiligenbeil gewesen sein. Nun ja, es gab zwar die Stadt Heiligenbeil – sie lag an der litauischen Grenze –, und möglicherweise waltete dort irgendwann sogar ein Scharfrichter seines Amtes, aber ansonsten ist die Geschichte, auch wenn sie zu unserer nicht immer gesellschaftskonformen Familie passen würde, zu schön, um wahr zu sein. Vermutlich hat sie einer meiner Onkel frei erfunden.
Großvater Johannes Joachim war – ganz in der Familientradition – Pfarrer, und zwar in Ponarth, einem Vorort von Königsberg: ein imponierender Herr mit Vollbart, mächtig von Gestalt, der seine sieben Kinder streng patriarchalisch erzog. Das sah so aus, dass werktags nur der Vater zum Mittagessen Fleisch bekam, die Kinder nicht einen einzigen Brocken, und nach der Mahlzeit mussten sie sich bei ihm anstellen, um ihm nacheinander die Hand zu küssen und «Danke, lieber Vater, für das schöne Essen» zu sagen. Seine Frau Elfriede, geborene Salkowski, ordnete sich ihm völlig unter. Als Tochter eines wilhelminischen Standesbeamten kannte sie es wohl nicht anders.
Diese puritanische Erziehung sollte meine Mutter ihr Leben lang nicht abstreifen. Alle damaligen Neuerungen – Radio, Kino, später Fernsehen – empfand sie als Ausdruck der Leichtfertigkeit der Zeit, und selbst gegenüber den Dingen, die zu den schönen des Daseins zählen, legte sie eine für ihre Umgebung manchmal schwererträgliche Distanz an den Tag. Dazu trug sicher bei, dass sie als Älteste immer mitverantwortlich für sechs jüngere Geschwister war, die, streng nach dem Alphabet geordnet, neben ihr standen. Sie selbst hieß zwar Hildegard, aber dann ging es weiter mit Berthold, Christine, Dietrich, Eberhard, Frank und Gottfried. Die Kinder nannten sich selbst «Das Ponarther HBC».
Anfang der zwanziger Jahre verließ meine Mutter Königsberg, um in Breslau Theologie und Philosophie zu studieren – in ihrem Emanzipationsdrang wollte sie heraus aus der Enge ihres bürgerlichen Elternhauses, sie wollte mehr sie selbst sein dürfen. In Breslau traf sie dann auf einen Menschen, der völlig anderer Herkunft war und aus einer vollkommen anderen geographischen Region Deutschlands kam – das war mein Vater. Dessen Vorfahren waren durchweg hart arbeitende, bodenständige Kleinstbauern, Löffelschmiede, Bergleute und Handwerker aus dem sächsischen und vogtländischen Raum gewesen. Mein Großvater väterlicherseits, Carl Richard Weiss, geboren 1871 auf einem Kleinstbauernhof in Rittersgrün, einem Dorf am Erzgebirgskamm, passte schon nicht mehr ganz in die Familientradition. Er gründete eine zunächst durchaus florierende Handelsfirma, war aber nach der Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre eigentlich nur noch ein kleiner Handelsreisender und versuchte in Sachsen und Schlesien Waren anzupreisen, Kurzwaren, insbesondere Garne und Reißverschlüsse.
Sein erstgeborener Sohn Carl Friedrich sollte die Realschule besuchen, bestenfalls die kaufmännische Realschule, um den Weg des Vaters fortzusetzen. Weiss junior war über diesen vorgezeichneten Lebensplan aber nicht gerade begeistert. Und als mein Großvater im Ersten Weltkrieg als Soldat an der Front war, in der Schreibstube einer Kompanie – da lebte die Familie Weiss schon in Breslau –, konnte mein Vater seine Mutter Marie Ernestine, geborene Teichmann, überreden, ihn aufs Gymnasium zu schicken. Da er durchaus begabt war, als Autodidakt auch ganz gut Cello spielte und außerdem für das gerade neu gegründete Schulorchester dringend ein Cellist gesucht wurde, bekam er eine Lebensunterhaltshilfe, eine Art Stipendium. In Breslau studierte er nach dem Abitur, seinen Neigungen folgend, schließlich Philosophie, Physik, Psychologie und Pädagogik. Das Geld dazu verdiente er sich in den Ferien, indem er zunächst unter Tage als Bergmann arbeitete oder später als Hauslehrer bei schlesischen Gutsbesitzern.
Kennengelernt hatten sich meine Eltern im legendären philosophischen Seminar des Erkenntnistheoretikers Richard Hönigswald. Oft trafen sie sich auch im Haus des weltoffenen, liberalen Rabbiners Hermann Vogelstein. Dessen Kinder, die ebenfalls an der Universität in Breslau studierten, hatten Hildegard und Carl Friedrich zu sich nach Hause eingeladen. Am Freitagabend wurde dort der Sabbat mit Meditationen und Diskussionen über Religion, Geschichte und die damalige politische Situation begangen. Die meisten jungen Leute in diesem Kreis waren jüdischen Glaubens, aber meine protestantischen Eltern waren genauso willkommen. Zudem kannte man sich dort in der Thora genauso gut aus wie im Neuen Testament. Besonders für meine Mutter war das eine völlig neue Erfahrung, es war ihr nun möglich, sich ein wenig von dem strengen Protestantismus ihres Vaters zu lösen – auch wenn sie zeitlebens eine tiefreligiöse Frau blieb. Immerhin stellte sie fest, dass es noch andere Formen des Glaubens gab als die Königsberger Variante.
Aus den Erzählungen meiner Eltern weiß ich, dass sie in diesem Kreise auch erstmals mit den Ideen des Religiösen Sozialismus in Berührung kamen. Der Religiöse Sozialismus, dem seit dem Ersten Weltkrieg sowohl Christen als auch Juden verstärkt zuneigten, beruhte auf der Überzeugung, dass der auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Kapitalismus nicht die einzige mögliche Gesellschaftsform der Zukunft sein konnte. Unterdrückung, Ausbeutung, Egoismus und Konkurrenz, all das sollte durch gesetzgebende Maßnahmen begrenzt werden. Für Christen war der Religiöse Sozialismus eine modernisierte Variante der alten christlichen Soziallehre, die das politische Ziel – die Vergesellschaftung des Kapitals – mit religiösen Vorstellungen verband.
Meine Mutter war von den Gedanken, die im Salon der Vogelsteins kursierten, fasziniert. Und meinem Vater, der durch die Arbeit unter Tage und bei den Kindern von Gutsbesitzern, die zu fein waren, um in eine normale Schule zu gehen, gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft ohnehin sehr kritisch eingestellt war, kamen die neuen Ideen sowieso gerade recht. Bis zu seinem Lebensende hielt er an ihnen fest. Nach dem Zweiten Weltkrieg, der sechzig Millionen Menschen das Leben gekostet hatte, stellte er sogar folgerichtig einen Antrag, in die KPD einzutreten. Er war davon überzeugt, dass eine grundsätzlich neue gesellschaftliche Ordnung erforderlich sei, sonst würde es irgendwann wieder zu denselben Entwicklungen kommen, die erneut den Weltfrieden gefährden könnten. Hildegard war da etwas zurückhaltender, sie tendierte dazu, SPD-Mitglied zu werden – aber durch unseren Transport nach Russland kam alles anders.
In den zwanziger Jahren war mein Vater noch ein Suchender. Nachdem er es ausgeschlagen hatte, ins Kaufmännische zu gehen, konnten ihm seine Eltern keine weiteren Leitlinien mitgeben. Und er war ein Wilder, aktiv in der Wandervogelbewegung, bei deren Ausflügen es wohl recht abenteuerlich zuging. Fotos zeigen ihn mit Blumenkränzen auf dem Kopf, am Lagerfeuer wurden Lieder zur Gitarre gesungen, und im Sommer war es selbstverständlich, nackt zu baden. Für meine Mutter ein unüberwindbares Tabu. Trotzdem kamen sie sich langsam näher.
Meinen Vater muss an Hildegard das Bürgerliche fasziniert haben, denn sie verfügte über ein Allgemeinwissen, das ihm fehlte, ebenso wie die Kenntnis der in bürgerlichen Kreisen üblichen Verhaltensregeln. Als er seinen Antrittsbesuch in Königsberg machte, um offiziell um ihre Hand anzuhalten, wurde aus diesem Anlass im Pfarrhaus abends Rotwein eingeschenkt. Als Carl Friedrich das Glas hob, sagte er ganz unbefangen zu seiner künftigen Schwiegermutter: «Gluck, gluck, gnädige Frau!» Das verstand der Gute unter Höflichkeit. Und als er während eines Mittagessens einmal gefragt wurde, ob er noch einen zweiten Teller Eintopf haben möchte, antwortete er: «Danke, gnädige Frau, aber ich möchte mir noch ein wenig Appetit für den Hauptgang aufheben.» Dabei war der Eintopf das Hauptgericht. Es waren die Gegensätze, die beide anziehend fanden, dazu der gemeinsame Glaube und die sehr ähnlichen politischen Überzeugungen. Meine Mutter bewunderte den abenteuerlustigen, sehr gutmütigen Mann, mein Vater die wohlanständige Pfarrerstochter.
Sie waren ewig verlobt, bis sie heirateten, mindestens sieben Jahre. Wahrscheinlich hatte mein Großvater seinen zukünftigen Schwiegersohn mehrmals gefragt: «Können Sie überhaupt meine Tochter ernähren?» Und viele Male muss die Antwort negativ ausgefallen sein. So zog es sich, bis dann endlich im Mai 1929 geheiratet wurde.
Aus mir nicht näher bekannten Gründen brach meine Mutter ihr Studium ab und arbeitete als Sekretärin. Eine Erklärung dafür mag sein, dass sie plötzlich entdeckte, viel lieber Musikerin werden zu wollen. Sie nahm Gesangsstunden und träumte davon, Gesangslehrerin oder Klavierpädagogin zu werden. Vielleicht wollte sie auch früher Geld verdienen, damit mein Vater in Ruhe zu Ende studieren konnte. Der hatte sich immer mehr auf die Physik konzentriert, sie faszinierte ihn in ihrer logischen, experimentell gesicherten Strenge und erschien ihm zudem am aussichtsreichsten, um später eine Familie zu ernähren.
Nach seiner Promotion, die er mit summa cum laude bestand, ging er zu Walter Bothe an das Physikalische Institut der Universität Gießen, wo er eine Stelle als «1. wissenschaftlicher Assistent» erhielt. Oben im Institutsgebäude gab es eine freie Dachkammer, in der die beiden ihr erstes Heim einrichteten.
Lange blieben sie nicht in Gießen. Es folgte ein Angebot aus Berlin, das mein Vater – wenn auch schweren Herzens – annahm. Eigentlich wollte er nämlich die Universitätslaufbahn einschlagen und Wissenschaft mit akademischer Lehre verbinden. Aber die übliche «Durststrecke», bis man ihn als ordentlichen Professor berufen würde, schien ihm zu lange zu dauern. Die Arbeit an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR), einem staatlichen Forschungsinstitut, das auf Initiative der Physiker Herrmann von Helmholtz und Werner Siemens 1887 in Berlin-Charlottenburg gegründet worden war, schien dagegen weniger brotlos und damit etwas familienfreundlicher zu sein. An der PTR wurden damals alle physikalischen Untersuchungen, die zur Präzisierung von Messapparaten und Kontrollinstrumenten notwendig waren, durchgeführt; dort befand sich auch die damals genaueste Uhr, und hier wurden auch das Urkilogramm und der Urmeter, beide aus Platin, angefertigt und aufbewahrt. Mit diesen Dingen hatte mein Vater aber nichts zu tun, er sollte das Laboratorium für Radioaktivität, das noch in den Kinderschuhen steckte, übernehmen.
Zu dieser Zeit, Anfang der dreißiger Jahre, galt dieses Grenzgebiet zwischen Physik und Chemie in Wissenschaftskreisen noch als relativ uninteressant. Man hatte zwar schon radioaktive Elemente isoliert und erste Messungen an den Alpha-, Beta- und Gammastrahlen vorgenommen, aber allzu große praktische Bedeutung wurde diesem Bereich zunächst nicht beigemessen. Natürlich bedeutete das neue Arbeitsgebiet auch für meinen Vater eine Umstellung. Vorher hatte er auf dem Gebiet der Atomspektroskopie gearbeitet, und daher wusste er auch einiges über die Quantenphysik der Atome, über die damals noch neuen Gesetze der Schrödinger-Gleichung und die Heisenberg’sche Unschärferelation, aber das war es dann fast schon. Immerhin war er nun als Beamter materiell abgesichert, was die Familienplanung erleichterte.
2Biesdorfer Idylle
Tatsächlich: Ich wurde – im März 1933 – als erstes Kind geboren, und knapp zweieinhalb Jahre später, im August 1935, folgten meine Geschwister, die Zwillinge Bettina und Clemens. Als meine Mutter von der Charlottenburger Klinik mit den beiden Babys nach Hause kam, hatte sie für die Heimfahrt ein Taxi genommen. Als das vor unserer Haustür hielt und mein Vater die Babys an sich nahm, damit meine Mutter aussteigen konnte, soll ich gefragt haben: «Und wo ist das Dritte?»
Die erste Berliner Wohnung der Eltern befand sich in der Togostraße im «Afrikanischen Viertel» des Stadtbezirks Wedding. Ich hab mir das viel später einmal angesehen: ein für damalige Verhältnisse großzügiges und modernes Wohnviertel im Bauhausstil. Carl Hagenbeck hatte hier vor dem Ersten Weltkrieg einen exotischen Park geplant, in dem er unter anderem Tiere aus den damaligen deutschen Kolonien präsentieren wollte. Der Ausbruch des Krieges machte diese Pläne zunichte – nur die Straßennamen, die schon vergeben waren, blieben erhalten.
Als meine Geschwister dann da waren, wurde es für uns fünf dort jedoch zu eng. Meine Eltern wagten das finanzielle Abenteuer, bei einer Arbeiterwohnbaugenossenschaft, die gerade am östlichen Stadtrand, im ländlich wirkenden Biesdorf, eine Siedlung errichtete, eine winzige Doppelhaushälfte auf Ratenzahlung zu kaufen: im Erdgeschoss zwei relativ kleine Zimmer und Küche, oben, im ersten Stock, zwei Mansarden, das Bad im Keller. Die Adresse war Weizenweg 64, die anderen kleinen Straßen in der neuen Siedlung hießen Roggenweg, Gerstenweg, Haferweg, Erntedankweg oder – nazistisch eingefärbt – Erbhofweg.
Die Häuser waren alle gleich: Doppelhäuser mit parallelen Giebeln zur Straßenseite hin und Terrassen nach hinten zu den Gärten. Dazwischen dunkelbraune Jägerzäune. Da die Siedlung auf einem Flurstück von Marzahn, auf ehemaligen Feldern gebaut worden war, bestand unser Garten zunächst aus nichts weiter als sandiger Erde, und damit fangen im Grunde auch meine ersten Erinnerungen an. Meine Eltern säten Rasen und pflanzten Blumen und einige Bäumchen, es wurde schnell eine kleine grüne Idylle. Da das Haus abbezahlt werden musste und das Gehalt eines Regierungsrats an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt dazu nicht ausreichte, wenn gleichzeitig eine mittlerweile fünfköpfige Familie zu ernähren war, nahm mein Vater an der Gauß-Schule in Tegel, einer Ingenieur-Abendschule, noch ein zweites Arbeitsverhältnis als Lehrer für Mathematik und Physik auf.
Es fing die wahrscheinlich einzig wirklich glückliche Zeit meiner Eltern an. Sie führten ein sehr offenes Haus, alte Freunde kamen zu Besuch, und sie fanden viele neue, vor allem über die Musik. Meine Mutter nahm wieder Gesangsstunden, ihre Lehrerin hieß Julia-Lotte Stern, eine damals bekannte Altistin, die aber wegen ihrer jüdischen Abstammung durch die Reichskulturkammer unter der Leitung von Propagandaminister Joseph Goebbels Auftrittsverbot erhalten hatte. Bei den Hausmusikabenden wurden die Blockflötensonaten von Georg Philipp Telemann gespielt, Streichquartette von Haydn und Beethoven, meine Mutter sang Franz Schuberts Winterreise, Lieder von Johannes Brahms und – geradezu avantgardistisch – das Marienleben von Paul Hindemith. Wir Kinder, die wir oben in einem der Mansardenzimmer im Bett lagen, fanden die Musik und das Stimmengewirr sehr beruhigend. An diesen Abenden schlief ich jedes Mal besonders gut ein.
Viel später, als Erwachsener, habe ich meinen Vater für seine Disziplin bewundert, auch für seine Geduld. Niemals sagte er: «Hildegard, es kann nicht sein, dass du zu Hause sitzt und Klavier spielst und abends ein gastfreundliches Haus führst, und ich muss malochen.» Nie hat er so etwas gesagt. Er sah seine zwei Berufstätigkeiten wohl als preußische Pflicht an und fügte sich still in sein Schicksal. Sie setzte seiner Belastung sogar noch eins drauf, indem sie ein Dienstmädchen verlangte, ein sogenanntes Pflichtjahrmädchen, das meiner Mutter den Haushalt abnehmen sollte. Auch dieser Wunsch wurde ihr erfüllt. Carl Friedrich versuchte offenbar unter den Wolken des heraufziehenden Krieges seiner Familie so viel Geborgenheit und Wärme wie möglich zu geben, ihr das Leben irgendwie schön zu machen, solange es nur möglich war. Immerhin genoss auch er die Hausmusikabende: So konnte er mit Kollegen und Freunden einen Kreis – heute würde man sagen: ein Netzwerk – von Menschen aufbauen, die ähnlich dachten wie er. Bei uns zu Hause trafen sich Gleichgesinnte, diese Menschen einte eine tiefe Abneigung gegen den Nationalsozialismus. Jedenfalls trug keiner der Gäste in unserem Haus das Parteiabzeichen der NSDAP, den «Bonbon», am Revers – als Kind wäre mir das sicherlich aufgefallen.
Damals habe ich meinen Vater wenig gesehen. Morgens hörte ich, wie er im Kessel der Zentralheizung herumkratzte, um die über Nacht angesammelte Schlacke zu entfernen, und abends, wenn er nach Hause kam, lag ich längst im Bett. An den Sonntagen kümmerte er sich aber um uns Kinder, ging mit uns viel spazieren. Während eines solchen Ausflugs verpasste er mir einmal eine sehr nachhaltige Lehre. Kleine Kinder finden auf diesen Spaziergängen immer etwas, weil sie näher am Boden sind und noch einen Blick fürs Detail haben. Ich fand mehrfach Geld, und einmal mehrere Münzen hintereinander, verteilt über einem Abstand von drei, vier Metern. Wahrscheinlich waren sie einem angeheiterten Nachtschwärmer aus der Tasche gefallen. Ich las die Geldstücke auf, und nachdem jedes einzelne eingesammelt war, sagte mein Vater: «Das Geld hast du dir aber nicht verdient, Cornelius. Du hast jetzt die Wahl: Entweder du wirfst es in den nächsten Briefkasten, oder du kaufst davon Winterhilfsabzeichen.» Die «Winterhilfe» war eine Erfindung der Nazis, überall auf den Straßen standen Mitglieder vom NS-Frauenbund, BDM-Mädel oder Rentner mit Sammelbüchsen herum, um Geld für die Armen einzutreiben, mit dem Heizmaterial, warme Mahlzeiten oder Unterkünfte bezahlt werden sollten. Steckte man etwas in die Sammelbüchse – oft wurde man dazu regelrecht genötigt –, bekam man als Gegenleistung ein Abzeichen. Und nun lagen diese Münzen, die mir nicht gehörten und die ich keinesfalls behalten durfte (was ich natürlich gern getan hätte), in meinen Händen. In den nächsten Briefkasten wollte ich sie auf keinen Fall stecken. Das fand ich vollkommen ungerecht – der Briefkasteninhaber war doch genauso wenig Eigentümer der Geldstücke wie ich. Da ich aber scharf auf die Abzeichen war – um die Winterhilfe-Kampagne in Gang zu halten, wurden jeden Monat neue herausgegeben, mal waren diese Kunstgewerbedinger aus Holz gedrechselt, mal aus Ton gebrannt –, war mein Entschluss schnell gefasst. Jede Münze kam in eine andere Büchse, und so hatte ich am Ende eine Monatsserie dieser Abzeichen beisammen.
Meine Eltern nahmen mich frühzeitig zu Konzerten ins Charlottenburger Schloss mit, ich war da vielleicht fünf oder sechs Jahre alt. In dem prächtigen Saal hingen Kronleuchter, an den Wänden leuchteten festlich Kerzen und Wandlampen. Hier hörte ich zum ersten Mal die Brandenburgischen Konzerte und die Orchestersuiten von Johann Sebastian Bach. Ich entwickelte regelrecht eine Vorliebe für die wundervolle, streng gegliederte Musik des Barocks. Wie berauscht war ich in dieser Welt, die so hell und unbeschwert schien.
Vom vierten Lebensjahr an hatte ich Klavierunterricht, zunächst bei meiner Mutter. Später gab mir Margarete Riedel, eine sehr gutherzige Kammermusikerin, Stunden auf dem Cembalo. Frau Riedel war die Leiterin der «Berliner Spiel-Einung», eines gemischten Profi- und Laienensembles, das sich voll und ganz der Barockmusik verschrieben hatte und in dem auch mein Vater gelegentlich das Cello strich. Sie hätte mich auch mit den üblichen Czerny-Etüden am Klavier quälen können, aber sie erkannte sehr schnell meine Leidenschaft für Bach, und Bachs Sinn für Phrasierung und Rhythmus kamen auf dem Cembalo besser zum Ausdruck. Ein Klavier hat ja durch die Filzhämmerchen einen eher weichen, für mich nervigen Anschlag, das Cembalo besitzt kleine Häkchen, die jeden Anschlag gleich klingen lassen, und zwar exakt zum vorgesehenen Zeitpunkt – perfekt für ein strenges Zeitmaß. Mit dem Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach fing ich an, und dann ging es schnell aufwärts, bis hin zu den Präludien, Fugen und Inventionen für Cembalo des großen Kirchenmusikers.
In dieser Zeit fing ich auch an zu lesen: zuerst die Märchen von Grimm, Hauff und Andersen. Von der Kleinen Meerjungfrau war ich zutiefst angerührt; ich hatte mich so intensiv in die handelnden Figuren hineinversetzt, dass ich zum ersten Mal eine (völlig unklare) Sehnsucht und mehr noch den brennenden Schmerz einer unerfüllbaren Liebe spürte. Sehr beschäftigt haben mich auch Der letzte Mohikaner von James Cooper und Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Später verschlang ich alles, was mir in die Hände kam: mit Vorliebe die Zukunftsromane von Hans Dominik, viel Karl May, Bergsteiger-Bücher (Deutsche am Nanga-Parbat) und – zum Entsetzen der Eltern – auch Landser-Hefte, die es für zehn Pfennig überall zu kaufen gab und mit denen in der Schule schwunghaft Tauschhandel getrieben wurde.
Irgendwann fing ich dann auch an, populärwissenschaftliche und einfache technische Bücher zu lesen, was mich dazu brachte, erste (allerdings völlig ergebnislose) chemische Experimente zu machen – mit Backpulver, blauer Kreide, Teer und dem scharf riechenden flüssigen Inhalt einer kleinen Flasche, die ich auf der Müllhalde gefunden hatte (es wird wohl Salmiakgeist gewesen sein). Außerdem fasste ich den Plan, ein Herbarium mit allen Berliner Pflanzen anzulegen. Den ganzen Sommer über sammelte ich alles, was so an Kräutern und Unkräutern im Garten und rechts und links vom Schulweg wuchs und legte es zum Pressen und Trocknen zwischen die Seiten der Bücher der Eltern (ich selber hatte ja nicht genug ausreichend schwere Bücher) – mit der verheerenden Konsequenz, dass die Seiten der gehüteten Klassiker feucht und irreversibel wellig wurden und sich zum Teil braun-grün verfärbten. Aber die Eltern haben das wohl nie gemerkt, so oft schauten sie halt auch nicht in ihre Klassiker.
Mein Vater war von meinen «wissenschaftlichen» Unternehmungen sehr angetan, daher bekam ich zu meinem neunten Geburtstag ein kleines Mikroskop mit Zubehör, also Objektträgern, Deckgläschen, Pinzetten und Kanadabalsam (zum Einbetten und Konservieren der Objekte). Mit Interesse besah ich mir nun Blütenstaub, Fliegenbeine, Hausstaub und die wimmelnden Pantoffeltierchen in abgestandenem Regenwasser. Leises Grauen rief in diesem Zusammenhang bei meinen Freunden ein Geschenk meines Großonkels Gerhard Joachim hervor, der in Königsberg ein angesehener Kinderarzt war. Es war eine Mappe mit zwanzig mikroskopischen Demonstrationspräparaten, die wohl noch aus der Zeit seines Medizinstudiums stammten. Mit altmodischer Schrift war auf den Objektträgern neben dem Datum festgehalten, worum es sich handelte: Querschnitt durch ein Affenauge, Saugrüssel des Leberegels, Ei des Bandwurms etc.
Zur großen Leidenschaft wurde für mich auch das Sammeln von Briefmarken. Die Schwester meiner Mutter, in der Familie genannt Tante Tinchen, die damals bei der Exportabteilung der Bakelite GmbH in Berlin-Erkner arbeitete, brachte auch in den Kriegsjahren immer wieder spanische, französische, englische, schweizerische und sogar amerikanische und australische Briefmarken mit, sodass die Sammlung schnell anwuchs. Aus den Motiven und Beschriftungen der Marken, die zum Teil ja auch ästhetisch sehr anspruchsvoll gestaltet waren, lernte ich viel mehr über fremde Länder und fremde Sprachen als in der Schule. Und die üppige Nackte Maja auf einer spanischen Marke zog mich eine Zeitlang in ihren Bann und weckte jedes Mal beim Betrachten ganz eigentümliche angenehme Gefühle. Weshalb ich sie mir auch sehr oft ansah.
Überhaupt spielte Tante Tinchen in der Familie und besonders für uns Kinder eine wichtige Rolle. Sie war damals Mitte dreißig, alleinstehend und das, was man heute eine emanzipierte junge Frau nennen würde: freche Ponyfrisur, geschminkt, superschick gekleidet, stolze Besitzerin und Fahrerin eines offenen Dixi mit Speichenrädern, damals ein Kultauto aus der Automobilfabrik Eisenach. Sie hätte als Zeichnerin für die Koralle arbeiten können, eine populäre NS-Illustrierte. Sie lehnte das Angebot jedoch ab, weil sie dann jede Woche Karikaturen – womöglich gar politische – hätte liefern müssen, was für sie einer Zwangsjacke gleichgekommen wäre. Sie wollte geistig unabhängig bleiben. Lieber zeichnete und malte sie aus freien Stücken, ohne Anstellung, und verdiente ihr Geld stattdessen als Sekretärin.
Tante Tinchen war aber nicht nur unglaublich modern, was Autos in Frauenhand betraf, sie besaß auch all das, was meine Mutter ablehnte: ein Radio etwa und ein mechanisches Grammophon. Letzteres schenkte sie uns Kindern einmal zu Ostern zusammen mit drei Schallplatten. Unsere Mutter war entsetzt. So musikalisch sie auch war, sie wetterte ganz allgemein gegen «Konservenmusik», sodass es bei uns auch keinen Plattenspieler gab. Beide Eltern waren davon überzeugt: «Musik muss man selber machen, denn nur dann kann man sie erleben.» Leider brachten Bettina und Clemens es fertig, das schöne Ostergeschenk noch am selben Tag durch ein zweifaches Aufziehen mit der speziellen Kurbel zu zerstören – zur großen Erleichterung meiner Mutter, zu meinem ewigen Schmerz.
Die unkonventionelle Tante brachte uns Kindern Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Entwicklungen in der Mode, der Technik und der Gesellschaft bei, brachte uns auch immer wieder, wenn sie uns in Biesdorf besuchte, kleine Scherzartikel mit. Sogenannte Vexierbilder, die sich, wenn man sie seitlich zusammendrückte, auf witzige Weise veränderten. Auf einem war eine streng dreinblickende und züchtig bekleidete Dame zu sehen, die dann plötzlich ein kurzes Röckchen trug, dazu ein leicht verrutschtes Oberteil, und ein Auge zusammenkniff. Tante Tinchen hatte auch einen täuschend echt aussehenden Tintenfleck aus Blech, und Brieftaschen, in die man Geldscheine hineintun konnte – und dann waren sie weg, Schachteln, in denen ein blutiger Finger lag oder aus denen beim Öffnen eine Faust hervorschoss. Sie hörte und sang Schlager, die meine Mutter nicht nur verachtete, sondern aus ihrer verklemmt-konservativen Grundeinstellung heraus regelrecht hasste. «Für eine Nacht voller Seligkeit» – dieses relativ harmlose Lied empfand sie als höchst unanständig und drohte mir Ohrfeigen an, wenn ich es nur einmal singen würde. Ich kann es natürlich noch heute auswendig.
Wir Kinder vermuten heute, dass unser Vater der heimliche Schwarm unserer Tante war – oder umgekehrt. Jedenfalls kam sie auch später oft zu uns zu Besuch – wo wir auch wohnten – und folgte uns später in die Sowjetunion. Bis zu ihrem Tod blieb sie solo. Zwar hatte sie später in Russland einen Freund. Wie viele dieser Beziehungen, die hauptsächlich auf der Grundlage des Eingesperrtseins entstanden, zerbrach sie aber auch wieder.
Alle, die uns in Biesdorf besuchten, begrüßten wir Weiss-Geschwister strahlend, wir empfanden eine ungetrübte Freude, wenn Gäste kamen. Doch längst hatte diese heile Welt verborgene Risse bekommen. Auf den Gesichtern der Freunde meine Eltern spiegelte sich gelegentlich Verstörtheit, viele von ihnen blieben plötzlich fern. Das waren die jüdischen Bekannten und Freunde, die nach und nach auswanderten. Dem Gästebuch meiner Eltern kann ich entnehmen, dass anfangs noch gelegentlich ihr väterlicher Freund Rabbiner Vogelstein aus Breslau zu uns nach Hause in den Weizenweg kam, er emigrierte 1938 über London in die USA. Völlig andere Konsequenzen hatte der Nazi-Rassenwahn für das Schicksal eines befreundeten Physikerkollegen meines Vaters, Friedrich Georg Houtermans. Wegen seiner jüdischen Abstammung und seiner kommunistischen Weltsicht verlor er gleich 1933 seine Oberassistentenstelle an der Technischen Hochschule in Berlin. Er emigrierte über Kopenhagen und London in die Sowjetunion. Dort wurde er 1937 vom NKWD wegen angeblicher Spionage verhaftet und nach zweijähriger Lagerhaft an die Gestapo ausgeliefert. Der Physiker Max von Laue konnte jedoch seine Freilassung erwirken, und Houtermans fand eine Anstellung im privaten Forschungsinstitut von Manfred von Ardenne, später in der PTR. Auch der verehrte Lehrer meiner Eltern Richard Hönigswald wurde während der Novemberpogrome 1938 im KZ Dachau inhaftiert und emigrierte später in die USA. Nie vergesse ich auch einen Nachmittag, an dem mich meine Mutter mit ins Café Kranzler an der Ecke Unter den Linden/Friedrichstraße nahm. Wo meine jüngeren Geschwister an diesem Tag waren, habe ich vergessen, wahrscheinlich passte eines der mürrischen Pflichtjahrmädchen auf sie auf.
In dem Café traf meine Mutter einen vornehm gekleideten Mann im Anzug und mit Hut. Sie begrüßten sich auffallend herzlich, tranken Kaffee, ich wurde irgendwie beschäftigt. Mir fiel auf, dass sie französisch miteinander sprachen, wie dies die Eltern in letzter Zeit auch immer häufiger taten – für uns Kinder war das ein Zeichen, dass das, was die Erwachsenen besprachen, uns nichts anging. Schließlich verabschiedeten sich der Mann und meine Mutter unter Tränen. Erst viel später habe ich erfahren, dass der elegant gekleidete Herr Freddy Cohn war, einer der Freunde aus Studienzeiten meines Vaters und wohl auch ein Verehrer meiner Mutter, denn sie sagte einmal etwas kryptisch zu mir: «Der wäre um ein Haar dein Vater geworden, Cornelius.» Dass ich dann auch nicht ich gewesen wäre, das war ihr in diesem Moment nicht klar. Dieser Beinahe-Vater ging am nächsten Tag nach Israel ins Exil. Schließlich war fast die Hälfte der Freunde meiner Eltern ausgewandert.
Unverändert oft aber – fast jede Woche – waren mein Patenonkel Harald Poelchau und seine Frau Dorothee bei uns. Mit ihnen sprachen meine Eltern mit Sicherheit auch am intensivsten und vertrautesten über die politischen Zustände in Deutschland, über die verheerenden Folgen des Aufstiegs des Nationalsozialismus. Meine Eltern hatten Harald Poelchau vermutlich schon in Breslau kennengelernt, wo er 1927 sein erstes theologisches Examen abgelegt hatte und wohl auch zu den vielen Gästen im Hause Vogelstein gehörte. Inzwischen hatte er bei dem protestantischen Theologen und Religionsphilosophen Paul Tillich, einem der maßgeblichen christlichen Theoretiker des Religiösen Sozialismus, promoviert. Aber auch sein Doktorvater musste 1933 in die USA auswandern. Poelchau selbst wollte nicht nur predigen, sondern helfen und nahm daher kurz vor der Machtergreifung durch die Nazis eine Stelle als Gefängnispfarrer in Berlin-Tegel an. Sein Dienst erweiterte sich später auch auf die Zuchthäuser und Hinrichtungsstätten Plötzensee und Brandenburg. In diesem schrecklichen Amt musste er weit mehr als tausend Menschen, die von den Nazis zum Tode verurteilt worden waren, größtenteils Angehörige des Widerstands, auf ihrem Weg zur Hinrichtung begleiten und ihnen in ihren letzten Stunden beistehen. Nach Kriegsbeginn war er als Mitglied des Kreisauer Kreises um James Graf von Moltke selbst eine Schlüsselfigur des Widerstands in Berlin. Daneben baute er zusammen mit seiner Frau ein Netzwerk auf, das vielen politisch und rassisch Verfolgten Unterschlupf bot und damit ihr Leben rettete. Er erhielt dafür von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem den Titel «Gerechter unter den Völkern».
All diese Zusammenhänge hab ich natürlich erst viel später von den Eltern erfahren. Damals interessierte ich mich für ganz andere Dinge. In der anderen Hälfte unseres Doppelhauses wohnte die Familie Kleinschmidt mit fünf Kindern. Der zweitälteste Sohn hieß Adolf (!), er war so alt wie ich. Meine Eltern hatten mir aus Protest gegen den Nazi-Rummel und zugleich zur Sicherheit, um gar nicht erst Zweifel aufkommen zu lassen, den lateinischen Namen Cornelius gegeben (bei meinen Geschwistern hatte sie ihre Logik aber verlassen – die Namen Bettina und Clemens stammten nicht aus der Antike, eher aus der deutschen Romantik). Ich war als Kind nicht gerade glücklich über diesen Vornamen, er klang doch sehr unzeitgemäß und wurde von meinen Mitschülern zu «Corneliensoße» verballhornt. Was allerdings immer noch besser war als mein zweiter Spitzname «Fliegenohr». Mit Adolf und seinem älteren Bruder Wolfgang gründeten wir eine Gang, die «Weizenweg-Clique». Chef («Hauptmann») war natürlich Wolfgang, dazu qualifizierte ihn allein schon die ehrfurchtgebietende Tatsache, dass er gleich in der ersten Klasse sitzengeblieben war. Ich, ein eher braver Schüler, durfte mich aber immerhin «Major» nennen. Natürlich waren wir mit der Haferweg- und der Roggenweg-Clique verfeindet. Doch da deren Mitglieder älter und damit stärker waren als wir, mussten wir zusehen, dass wir möglichst ungesehen an ihnen vorbeikamen, wenn wir unsere Expeditionen in die Umgebung starteten.
Uns gegenüber lebte Frau Graul, eine dicke, schwatzhafte Vorstadt-Berlinerin, die niemand von uns Kindern mochte – wir nannten sie unter uns «Dickmadam». Eines Tages beschwerte sie sich bei meiner Mutter, weil ich sie angeblich nie grüßte. Ich wurde streng belehrt:
«Cornelius, ein für alle Mal, wenn du Frau Graul siehst, hast du höflich guten Tag zu sagen. Verstanden?»
«Und wenn ich sie nicht sehe?»
«Frag nicht so dämlich, dann natürlich nicht.»
Eine Woche später erkundigte sich Frau Graul mitleidig bei meiner Mutter, ob der arme «Cörnchen» eine Augenkrankheit habe, er liefe ja seit einiger Zeit mit geschlossenen Augen herum.
Bis heute bin ich durchaus stolz auf diese Episode: Zum ersten Mal hatte ich gegenüber einer allmächtig scheinenden Obrigkeit, ohne sie unnötig herauszufordern, meine Prinzipien durchgesetzt.
3Der Geruch des Krieges
Urplötzlich fingen die Luftschutzsirenen an zu heulen. An diesem 1. September bummelten Adolf Kleinschmidt und ich gerade an der großen Ziegelsteinmauer entlang, die das Anstaltsgelände umfriedete. Zur «Anstalt» gehörten ein Waisenhaus, eine psychiatrische Klinik, andere Krankenhäuser und meine Volksschule, in die ich Ostern 1939 eingeschult worden war. Alles war im wilhelminischen Klinkerstil gebaut. Und nun waren wir auf dem Nachhauseweg, in den Schulranzen unsere Schiefertafeln und die spitzen Griffel, außen an den Ranzen baumelten an Bändern die kleinen nassen Schwämme, die man zum Löschen des auf die Tafel Geschriebenen brauchte. Dazu hatte jeder noch eine Riementasche, die man über der Schulter trug. Sie beherbergte die Pausenbrote, nun war sie leer. Jeden Tag war ich stolz auf diese «Ausrüstung», zumal die Zwillinge so etwas nicht besaßen.
Als wir das schaurige Auf und Ab der Sirenen hörten, zuckten wir erschrocken zusammen. Ich fand das instinktiv irgendwie bedrohlich, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was genau es zu bedeuten hatte. Schon im Sommer hatte ich gespürt, dass etwas Unheimliches heraufzog. Es gab Verdunkelungs- und Luftschutzübungen, die Butter wurde rationiert, die Eltern wirkten beklommen und legten heimlich Vorräte an Hülsenfrüchten, Graupen und Zucker an. Einmal kam mein Vater mit einem ganzen Sack voll wurmstichiger Erbsen nach Hause. «Notvorrat», kommentierte er sein Mitbringsel.
Wir rannten so schnell wie möglich nach Hause. Dort sagte meine Mutter unter Tränen: «Cornelius, es ist Krieg.» Darunter konnte ich mir als Sechsjähriger nur wenig vorstellen. Der Erste Weltkrieg war zwar erst etwas mehr als zwanzig Jahre vorbei, aber für mich war das schon ferne Vergangenheit. Als kleiner Junge hatte ich die politischen Hintergründe natürlich nicht zu deuten gewusst. Ich wusste zwar, dass mein Vater keine braune Uniform trug, auch keine besaß, weil er nicht Mitglied der NSDAP war. Er war auch in keiner anderen Nazi-Organisation, ebenso wenig wie meine Mutter. Instinktiv hatte ich auch geahnt, als ich eingeschult wurde, dass ich möglichst nichts darüber ausplappern darf, was für Bücher meine Eltern zu Hause besitzen und lesen. Thomas Mann war die Lieblingslektüre meines Vaters. Bücher, von denen meine Klassenkameraden erzählten, wie Hitlers Mein Kampf, Hans Grimms Volk ohne Raum oder gar diese illustrierte Schmähschrift Deutschland erwache! standen nicht in unserem Bücherregal.
Dennoch war ich von der allgegenwärtigen nationalsozialistischen Propaganda, die ich aufgeschnappt hatte, ob ich wollte oder nicht, nicht unbeeinflusst geblieben. Das Soldatentum wurde verherrlicht, selbstverständlich hatte ich wie alle anderen Kinder mit Soldaten aus Pappmaché gespielt, und natürlich träumte ich auch von Heldentaten. Lief ich mit meinem Tornister auf dem Rücken zur Schule, stellte ich mir oft vor: Wenn ich jetzt die Beine ordentlich schmeiße, so richtig im Stechschritt, dann denken alle, ich wäre ein Soldat. Natürlich grinsten die Leute nur oder tippten sich vielsagend an die Stirn.
Deshalb war ich überrascht und verwirrt, als meine Mutter bei den Sirenensignalen weinte. Ähnlich erging es mir später, als alle fünf Brüder unserer Mutter und viele Freunde der Reihe nach in Feldgrau zu uns kamen, um sich an die Font zu verabschieden. Die Männer versuchten zwar, lässig zu bleiben, frotzelten mit uns Kindern herum, aber wenn sie dann gingen, verabschiedeten sie sich doch mit nassen Augen. Nur einer der Onkel, ausgerechnet der Theologe, hielt es tatsächlich für richtig, aus diesem Anlass markige Sprüche über den Endsieg und den «größten Feldherrn aller Zeiten» – von den Berlinern spöttisch verkürzt zu Gröfaz – abzulassen. Aber zu ihm und seiner ebenso hitlergläubigen Frau hatten die Eltern ohnehin schon lange Abstand gehalten.
Mich faszinierten eher die Uniformen. Und ich fand es furchtbar spannend, wie in der Folgezeit Soldaten in unsere beschauliche Stadtrandsiedlung kamen, auf Lanz-Bulldog-Treckern oder Lkws, und jedes einzelne Haus inspizierten. Unser Keller wurde mit Balken abgestützt, darin stellten sie zwei eiserne Doppelstockbetten auf, das Kellerfenster betonierten sie zu, wobei sie die Betonelemente mit Sand auffüllten. «Splitterschutz», erklärte man mir, als ich fragte, wofür das denn gut sein solle. Die Gashähne wurden mit einer besonderen Farbe angestrichen, damit man sie schneller finden und im Notfall zudrehen konnte. Und vor dem S-Bahnhof von Biesdorf kampierte eine ganze Pionierkompanie mit schwerem Gerät und errichtete ein verzweigtes System von holzverschalten unterirdischen Notbunkern. Dass wir in der Schule über Feuerpatsche, Eimerspritze und Volksgasmaske aufgeklärt wurden, war dagegen fast langweilig.
Während mein Vater und meine Mutter immer bedrückter wirkten, steckte ich täglich in eine Landkarte, die in meinem Zimmer hing, Nadeln – dorthin, wo die deutschen Truppen schon vorgerückt waren. Das war uns in der Schule als vorbildlich gepriesen worden. Zu gern wäre ich öfter ins Kino gegangen, um den Vorstoß der Panzer nach Warschau oder Smolensk in den Wochenschauen zu verfolgen, aber meine Eltern waren überhaupt nicht begeistert, wenn im dunklen Saal bei jeder Sondermeldung von der West- oder Ostfront die Zuschauer in frenetischen Jubel ausbrachen. Sie weigerten sich auch, ein Radio zu besitzen. Mit dem erlaubten «Volksempfänger» – im Volksmund «Goebbelsschnauze» genannt – ausländische Sender («Feindsender») zu hören war strengstens verboten, und so verzichteten sie lieber ganz auf ein solches Gerät. Die bombastischen Sondermeldungen über Schlachten und Siege blieben also bei uns weitgehend ungehört.
Aber es dauerte gar nicht lange, und der Krieg kam auch nach Berlin. Die ersten vergleichsweise noch harmlosen Luftangriffe fanden wohl im Herbst 1940 statt. Seitdem rissen uns nachts die Sirenen immer öfter aus dem Schlaf und hetzten die ganze Familie in den Keller. Als Großstadtkind lernte man schnell, die grausigen Geräusche des Luftkriegs zu unterscheiden: das Knallen der schweren Einrohr-Fliegerabwehrkanonen, das schnelle hohe Bellen der Zwillings- und Vierlingsflak, das kontrapunktartige Brummen der Flugzeugmotoren, das schrille Heulen der Bomben, danach ihre Einschläge, die Erschütterungen, sodass manchmal sogar der Kellerboden zitterte. Dazu die Luftminen, die nicht heulten, sondern rauschten. Bei ihren Einschlägen wackelte wirklich alles, dann tanzte das ganze Haus wie bei einem Erdbeben. Nach dem erlösenden Sirenensignal «Entwarnung» stellten wir uns manchmal ans Fenster, sahen am Himmel die Brandröte, und in der Luft lag ein merkwürdiger bitterer Geruch – für mich bis heute der Geruch des Krieges. Die Geräusche, die wir so merkwürdig entfernt im Keller wahrgenommen hatten, waren also die Zeichen von etwas Schrecklichem. Schauer liefen mir über den Rücken, und noch heute wird mir eiskalt beim Klang einer Sirene, egal, ob real oder nur im Fernsehen.
Doch was ein Bombenangriff wirklich bedeutet, erlebte ich erst ein knappes Jahr später. Ich war auf dem Weg zu meiner Cembalo-Lehrerin Margarete Riedel. Von Biesdorf aus war ich wie immer mit der S-Bahn zum Bahnhof Zoo gefahren, dort musste ich umsteigen, um noch mit der Straßenbahn durch die Kantstraße zu fahren. Insgesamt eine Strecke von einer Dreiviertelstunde. In der Nacht vor diesem Nachmittag hatte es wieder einen größeren Luftangriff gegeben. Nun sah ich rechts und links der Gleise noch rauchende Brandruinen, am Bahnhof Zoo waren alle Stockwerke eines Geschäftshauses eingestürzt, in der Kantstraße brannte in einem Vorgarten immer noch lichterloh ein Baum und – an ein ausgebranntes Haus angelehnt – merkwürdigerweise auch das obere Ende einer vergessenen Feuerwehrleiter. Überall waren Feuerwehrleute und Soldaten im Einsatz, überall roch es furchtbar nach Verbranntem, und in der Straße, in der ich meine Cembalo-Stunde haben sollte, wurde von einem Dach Schutt nach unten geschaufelt. Es war Winter, langsam wurde es dunkel, und die Atmosphäre hatte etwas Gespenstisches an sich. Nackte Angst war es nicht, die ich spürte. Solange die Eltern irgendwo erreichbar erscheinen, haben Kinder wohl keine Angst. Es war eher etwas zwischen Schaudern und Faszination.
Im selben Jahr zog anstelle der ewig mürrischen Pflichtjahrmädchen ein rundliches junges Mädchen, das kaum Deutsch konnte, in unsere kleine Dachkammer ein: Fronia Butschekowskaja, eine Ukrainerin, die mit kaum 17 Jahren als sogenannte Ostarbeiterin ins Reich verschleppt worden war. Die Eltern hatten sie völlig verstört irgendwo aufgelesen und bei den örtlichen Behörden durchgesetzt, dass sie bis auf weiteres bei uns bleiben durfte. Fronia war unglaublich kinderlieb, wir Kinder schlossen sie sofort in unsere Herzen, und von ihr bekamen wir die zärtliche Zuwendung, die es von unserer Mutter kaum gab. In deren Weltbild kam es offenbar nicht vor, die eigenen Kinder in den Arm zu nehmen oder zu streicheln, vermutlich hatte sie es auch selbst nie erlebt.
Zum Jahresanfang 1943 wurde unsere Schule in ein Lazarett umgewandelt und die ganze Klasse in der anderen Biesdorfer Volksschule am Bahnhof untergebracht. Unser Klassenlehrer war nun ein von der Ostfront zurückgekehrter schwerverwundeter Offizier, der in einer abgewetzten Uniformjacke mit leerem linkem Ärmel unterrichtete. Er war sehr streng, aber gerecht und wollte so gar nichts von seinen Kriegserlebnissen erzählen, obwohl wir Schüler ihn sehr bedrängten. Er wird seine Gründe gehabt haben. Ich erinnere mich noch an sein bleiches Gesicht, als er eines Morgens im Februar bei einem Appell in der Aula die Sondermeldung des Oberkommandos der Wehrmacht über den Untergang der 6. Armee unter Generalfeldmarschall Friedrich Paulus in Stalingrad verlesen musste.
Am 30. März 1943 traf zum ersten Mal ein Bombenangriff auch unsere Siedlung. Die war sicherlich nicht das eigentliche Ziel gewesen, sondern der im Bau befindliche Rangierbahnhof in der nahen Wuhlheide. Aber durch den starken Wind waren die «Christbäume», wie die von den Pfadfinder-Bombern zu Beginn des Angriffs abgesetzten Zielmarkierungen genannt wurden, abgetrieben. Zum Glück krachten die meisten auf dem Feld zwischen der Siedlung und den Anstalten nieder. Am nächsten Morgen auf dem Weg zur Schule sah ich aber, dass viele Häuser kein Dach mehr hatten – durch den Luftdruck waren die Ziegel zerborsten oder weggeflogen. Und je näher ich der Schule kam, desto größer wurden die Zerstörungen. Zwei Doppelhaushälften in der Nähe der S-Bahn-Station waren komplett verschwunden, an ihrer Stelle gähnten riesige Krater, und auf der Straße lagen überall Trümmer und Kleidungsstücke herum, auch ein Barometer, das in einem der Häuser einmal an der Wand hing. Dass die Menschen, die hier gewohnt hatten, nicht mehr leben konnten, dazu reichte meine Phantasie noch nicht. Ich dachte: Wo sind die Leute denn jetzt? Die haben ja jetzt kein Zuhause mehr.
In der Schule war unser Lehrer noch ernster als sonst, was uns aber nicht davon abhielt, uns nach Unterrichtsschluss in ein spezielles Abenteuer zu stürzen: Bomben- und Granatsplitter der Luftabwehrgeschosse zu sammeln, auch die Kupferteile von den Führungsringen. Wir Jungen rannten aufs Feld hinaus, und dort sah ich wieder diese Krater, richtig tief, fünf Meter im Durchmesser, unten stand in ihnen ein wenig Wasser. Und wir entdeckten auch große graue Blechteile, die überall herumlagen. Später erfuhr ich, dass dies die Leitwerke der Luftminen waren, notwendig dafür, dass sie senkrecht fielen. Sie sahen aus wie Flossen von Walen, die auf dem Trockenen gestrandet waren. Meine schöne Granatsplittersammlung fand übrigens ein profanes Ende: Irgendwann musste ich feststellen, dass unsere gute Fronia sie kurzerhand der Alteisensammlung übergeben hatte.
Richtig unheimlich war sogar für mich als Kind die NS-Trauerfeier für die Bombenopfer, zu der wir Schüler zwei Tage später gehen mussten. Die Reihe der mit Hakenkreuzfahnen bedeckten Särge. Erst jetzt begriff ich, dass bei dem Angriff ganze Familien mit ihren Kindern ums Leben gekommen waren. Das Jungvolk stand aufgereiht da, mit seiner schwarzen Fahne mit der weißen Siegesrune, und irgendein «Goldfasan», ein Funktionär der NSDAP in seiner braunen Uniform, hielt eine Rede. «Jetzt erst recht!», hörte ich, und «Heimatfront». Anschließend wurde das Deutschlandlied gesungen, das üblicherweise nahtlos in das Horst-Wessel-Lied «Die Fahne hoch!» überging, wobei die rechte Hand zum «deutschen Gruß» erhoben werden musste.
Seit dem Frühjahr 1943 gehörte ich selbst zum Jungvolk, mit zehn Jahren war der Eintritt in die Hitler-Jugendorganisation Pflicht. Ich fand es durchaus attraktiv, eine Uniform anziehen zu dürfen: das «Braunhemd», relativ sportlich mit aufgesetzten, in der Mitte gefalteten Taschen, das schwarze Halstuch, das von einem geflochtenen Lederband, dem «Knoten», zusammengehalten wurde, dazu eine militärisch geschnittene kurze Hose in Schwarz für den Sommer, im Winter eine Skihose, unten gebündelt. Besonders toll fand ich die vielen Aufnäher und Abzeichen, die zu erkennen gaben, zu welcher Einheit man gehörte und welchen Rang man bekleidete, und das Lederkoppel mit dem «Fahrtenmesser» an der Seite. Insgesamt eine verführerisch abenteuerliche Aufmachung.
In den großen Berliner Kaufhäusern gab es spezielle Abteilungen, in denen man all diese Dinge kaufen sollte, aber meine Mutter versuchte das immer wieder zu boykottieren. Das war ihr gutes Recht, wollte sie doch auf diese Weise verhindern, dass ich beim Jungvolk Karriere machte, wie ich es gern getan hätte. Natürlich bemerkte ich ihre Umgehungsstrategien und nahm ihr das sehr übel. So wollte sie partout in kein anderes Kaufhaus, als es nicht gleich im ersten die schwarzen kurzen Hosen in meiner Größe gab. Stattdessen musste ich Bleylehosen anziehen – der Schrecken eines jeden jungen Menschen und besonders jeden Berliner Großstadtkindes. Sie waren durch das Strickgewebe so körperbetont, und dazu noch dunkelblau. Das war die erste Schande, und die zweite bestand darin, dass meine Mutter die Achselklappe – zur Uniform des Jungvolkes gehörte merkwürdigerweise nur eine – falsch herum annähte, also nicht mit dem Knopf nach innen, wie es sich gehörte, sondern nach außen.
In diesem Aufzug erschien ich zum feierlichen Eröffnungsappell, was den Zugführer, der nur vier Jahre älter als ich und auch ein Schüler meiner Schule war, maßlos irritierte. Ich musste vortreten, der Zugführer erteilte mit schneidender Stimme den Befehl «Dreimal kurz gelacht!», und die Mannschaft brüllte: «Ha, ha, ha!» Gegenstand dieses Spotts zu sein, das war schwer auszuhalten. Zu Hause tobte und heulte ich, nie wieder zog ich diese Bleylehose an, die auch noch kratzte. Mit aller Kraft versuchte ich meine Blamage wettzumachen, was mir aber nicht gelang. Zwar war ich wenigstens blond, aber ich war ein dünner Junge und überhaupt keine Sportskanone. Doch Sport und besonders Wehrsport gehörte zum Wichtigsten beim Jungvolk. Im Handgranatenweitwurf war ich eine Niete, beim Geländespiel war ich eine Niete, beim Völkerball war ich eine Niete. Da nützte auch kein noch so lautes Singen beim Marschieren.
Immerhin hatte meine Mutter mit ihrem Vorgehen erreicht – zum Glück, kann ich heute nur sagen –, dass meine Euphorie als «Pimpf» begrenzt blieb. Sie ging aber noch einen Schritt weiter und verbot mir einfach ein paarmal, zum «Dienst», also zu den angeordneten Nachmittagsveranstaltungen und vor allem zu den «Heimabenden», zu gehen. Auf den Letzteren wurden wir NS-ideologisch bearbeitet («Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder, flink wie Windhunde»), mussten uns gemeinsam Radiosendungen anhören, in denen mit patriotisch zitternder Stimme Heldenepen von der Ost- und Westfront vorgetragen wurden. Ein- oder zweimal wurden dort sogar Landser leibhaftig vorgestellt oder Ritterkreuzträger, die höchstpersönlich irgendwelche Heldentaten vollbracht hatten. Auch Hitlers Lebenslauf – demnach hatte er sich einmal erfolgreich gegen dreizehn Kommunisten verteidigt, nur mit Füßen und Händen, wobei er mit dem Rücken zur Wand stand – mussten wir auswendig lernen. Und in der Weihnachtszeit ging es auf NS-Manier heiter-besinnlich zu, da wurde «Hohe Nacht der klaren Sterne» zur Blockflötenbegleitung der Jungmädel gesungen.
Meine Mutter wollte verhindern, dass ich mir diesen Unsinn anhörte oder mitmachte – und ließ mich einfach nicht gehen. Dreimal ging das gut, dann kreuzte bei uns zu Hause eine Art jugendlicher Militärstreife auf, ein HJ-Führer, der durch eine spezielle Armbinde zu erkennen war, und mein Zugführer. Meine Eltern wurden ziemlich massiv verwarnt, und am Ende gaben sie nach. Sie sahen wohl ein, dass sie auf diesem Wege auch nichts am Regime hätten ändern können. Dass sie so dachten, lag auch an Harald Poelchau, der ihnen sagte: «Hildegard, keine Opfer an der falschen Stelle, das bringt niemandem etwas.»
Mein Patenonkel war aber auch derjenige, der sie dazu überredete – man könnte auch sagen: moralisch dazu zwang –, jüdische Kinder, deren Eltern deportiert worden waren, zu verstecken. Da sie ohne Ausweispapiere und Lebensmittelmarken nicht überleben konnten, suchte seine Untergrundorganisation Pflegeeltern auf Zeit. Aus Sicherheitsgründen blieben die Kinder nie länger als vier Wochen, dann stand der Wechsel zu einer anderen Familie an. Der ständige Wechsel garantierte, dass dieses Rettungssystem nicht aufflog, Nachbarn sich nicht plötzlich wunderten, warum eine Familie aus unerklärlichen Gründen Zuwachs bekommen hatte. Den Besuch eines Kindes einer Schwester oder eines Cousins konnte man immer rechtfertigen, ohne Misstrauen zu erwecken.
Und so hatten wir zweimal «Cousinen aus dem Schwarzwald» zu Besuch. Eines der Mädchen war etwa acht Jahre alt und sah meiner Schwester Bettina sehr ähnlich. Während dieses sehr schüchterne Mädchen bei uns war, wurde Bettina zu unseren Verwandten ins Erzgebirge gebracht, «zur Erholung». Meine Mutter ging dann mit Tina, wie wir die Namenlose nannten, zur Polizei und erklärte den Beamten, Bettinas Papiere, also die meiner Schwester, wären verlorengegangen. Das stimmte natürlich nicht, aber so konnte meine Mutter neue Papiere für Tina beantragen. Mit denen konnte sie zwar halbwegs in die Legalität zurückkehren, sie wurde aber aus Sicherheitsgründen bis zum Kriegsende vom Kantinenpächter des Zuchthauses Plötzensee, Willi Kranz, und seiner Frau in deren Haus versteckt. An den Namen des zweiten Mädchens erinnere ich mich nicht mehr, wahrscheinlich haben ihn meine Eltern uns Kindern auch nicht verraten, damit wir gar nicht erst irgendetwas Falsches sagen konnten. Nach dem Krieg meldete sich Tina, die nun in Holland lebte, bei meinem Patenonkel. Rational wusste sie, dass sie durch seine Hilfe überlebt hatte. Doch ihre Haltung blieb distanziert, weil sie ihm tief in ihrem Herzen übelnahm, dass sie nicht bei ihrer Mutter hatte bleiben dürfen. Bis zum Ende des Krieges wurde sie nach ihrem Empfinden immer wieder von einer Familie zur nächsten herumgeschubst.
In diesem Zusammenhang muss ich über eine Begegnung berichten, die ich 1995 in Israel hatte. Ich war dienstlich dort, gehörte zu einer Gruppe von Gästen, die eingeladen worden waren, um an der feierlichen Eröffnung einer Reihe neuer Laboratorien der Weizmann-Institute in Rehovot teilzunehmen. Dabei ergab es sich, dass ich mit einer israelischen Wissenschaftlerin ins Gespräch kam. Nachdem sie mich gefragt hatte, woher ich denn stamme, und ich ihr antwortete: «Aus der vormaligen DDR», wurde ihr Ton plötzlich fast aggressiv.
«Ach, Sie kommen aus der Ex-DDR, dann sind Sie ja Atheist. Und die DDR war doch klar israelfeindlich. Sie sind wahrscheinlich mehr wegen der Früchte und des blauen Himmels hier.»
«Nein», antwortete ich, völlig irritiert über ihre schroffe Reaktion. Ich verstand das nicht, sie kannte mich doch gar nicht. Woher wollte sie wissen, dass ich «israelfeindlich» war? «Nein, ich war schon öfter dort, wo der Himmel blau ist, und Khakifrüchte und Mangos esse ich auch nicht zum ersten Mal. Ich bin hier, weil ich ein Freund der Weizmann-Institute bin und mich dieses Land Israel sehr interessiert.»
Plötzlich blieb sie stehen und wandte sich mir direkt zu: «Entschuldigung, aber ich bin in Deutschland geboren. In Berlin.»
«O Gott, wie haben Sie dann überlebt? Sie durften keine Schule mehr besuchen, auf keiner Parkbank sitzen, nicht ins Kino – und am Ende wurden die Juden deportiert, verschleppt, ermordet.»
«Das trifft auch auf fast alle meine Verwandten und die Freunde meiner Familie zu. Aber es gab da einen Menschen in Berlin, einen Pfarrer …»
«Bitte, sagen Sie den Namen dieses Mannes nicht», unterbrach ich sie. «Sie meinen Harald Poelchau?»
«Ja, woher wissen Sie das?»
«Das ist mein Patenonkel.»
Dieser eine knappe Satz führte dazu, dass die Wissenschaftlerin mich in den nächsten zwei Stunden vor unfassbarem Glück immer wieder umarmte. Kurz nachdem wir uns herzlich voneinander verabschiedet hatten, traten vier Männer auf mich zu, die aussahen, als seien sie Agenten vom Geheimdienst, hochgeschlagener Kragen, Schlapphut, Sonnenbrille.
«Sind Sie Professor Weiss?», fragte einer von ihnen.
Ich nickte.
«Dann kommen Sie mit uns, wir haben eine Einladung für Sie.»
Schnell rief ich einem Kollegen, einem Physiker, zu: «Sollte ich heute nicht mehr auftauchen, dann kümmere dich bitte darum.»
Ich stieß aber abends wieder wohlbehalten zu meinen Kollegen. Die «Geheimdienstler» hatten mich zu einem Mittagessen mit dem damaligen Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin nach Jerusalem geholt! Alles nur wegen dieses Hintergrunds mit meinem Patenonkel, mit einer Biographie, an der ich selbst keinerlei Verdienst hatte, sondern nur meine Eltern.
Rabin wurde wenige Wochen später in Tel Aviv von einem Rechtsextremisten ermordet. Ich hatte ihn als einen wachen, interessierten und gebildeten Menschen erlebt, der sogar über die Situation der ostdeutschen Hochschulen nach der Wiedervereinigung Bescheid wusste.
4Ausgebombt
Die Luftangriffe auf Berlin häuften sich. Jede zweite oder dritte Nacht wurden wir durch die Sirenen aus dem Schlaf gerissen und mussten in den Keller. Langsam machten sich bei uns Kindern die Folgen der nervösen Daueranspannung bemerkbar, und die Eltern konnten nicht mehr viel dagegen tun, weil auch sie nicht mehr richtig in der Lage waren, während der Angriffe ihre Nervosität zu verbergen und uns ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Dennoch fuhr ich weiter regelmäßig in die Innenstadt von Berlin zu meinen Musikstunden.





























