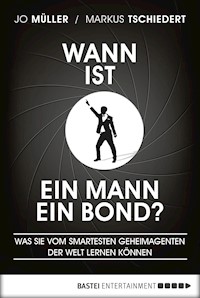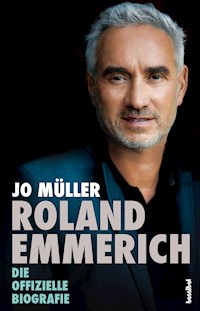
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hannibal Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Film-Literatur
- Sprache: Deutsch
Seit seinem Blockbuster "Independence Day" ist er einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Regisseure der Welt. Als "Master of Desaster", als Meister filmischer Apokalypsen: Roland Emmerich - Deutschlands Erfolgsfilmer in Los Angeles. Aber er ist mehr als das. Nicht nur, dass er in vielen seiner Filme ein ausgeprägtes Gespür für den jeweiligen Zeitgeist beweist. Emmerich hat gleichfalls ein Händchen für aufregende Kinostoffe und weiß diese bildgewaltig und wirkungsvoll umzusetzen. Unvergesslich sind die bedrohlichen Bilder der gigantischen Alien-Raumschiffe in "Independence Day", die über Los Angeles schweben. Während Emmerich in seinem bislang erfolgreichsten Film die Erde von Außerirdischen bedrohen ließ, konfrontierte er die Menschheit in "The Day After Tomorrow" mit den fatalen Folgen einer Klimakatastrophe: Eine gigantische Flutwelle und eine darauf folgende Eiszeit bedrohen New York, lange bevor die Gefahren der Klimaerwärmung zum Dauermedienthema geworden sind. In "2012" widmete sich Emmerich einer uralten Maya-Prophezeiung, die den Untergang der Erde am Tag der Wintersonnenwende vorhersagt. Neben seiner Action- und Phantastik-Spektakeln drehte er aber auch kleine, feine Filme wie den verschachtelten Historienkrimi "Anonymus" oder seinen bisher persönlichsten Film "Stonewall", über den Aufstand der Homosexuellen in New York City. Diese persönlich gehaltene Emmerich-Biografie von Jo Müller, der die Karriere des Starregisseurs seit über 25 Jahren begleitet, erzählt die faszinierende Geschichte eines Kino-Enthusiasten, der von Sindelfingen auszog, um die Welt der Kinos zu erobern und zu revolutionieren. Keinem anderen gewährte der Hollywoodregisseur einen so tiefen Einblick sowohl in seine Arbeit als Filmemacher als auch in sein Privatleben. Zu Wort kommen nicht nur Emmerich selbst, sondern auch langjährige Mitarbeiter und Verwandte wie seine Schwester Ute, die mit ihm einst nach Amerika auswanderte und seither seine Projekte als Produzentin begleitet. Aktuell bereitet Roland Emmerich unter anderem die lang erwartete Fortsetzung von "Independence Day" vor, die im Sommer 2016 in die Kinos kommen soll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
www.hannibal-verlag.de
Impressum
Originalausgabe
© 2016 by Hannibal
Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen
www.hannibal-verlag.de
ISBN 978-3-85445-478-6
Auch als Hardcover erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-477-9
Lektorat/Korrektorat: Dr. Matthias Auer, Bodman-Ludwigshafen
Fotos Innenteil (außer anders angegeben): © Jo Müller
Coverfoto: © Claudette Barius, Photography/SMPSP, Los Angeles, California 2015, claudettebariusphotography.com
Coverdesign und Buchsatz: Thomas Auer, www.buchsatz.com
Hinweis für den Leser:
Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Es kann jedoch keinerlei Gewähr dafür übernommen werden, dass die Informationen in diesem Buch vollständig, wirksam und zutreffend sind. Der Verlag und der Autor übernehmen weder die Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch den Gebrauch von in diesem Buch enthaltenen Informationen verursacht werden können. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.
Inhalt
Vorwort von Harald Kloser
Zum Geleit
Vorgeschichte
Besuch in Roland Emmerichs Villa I
Interview mit Roland Emmerich
Das SOLO-Imperium und der Emmerich-Clan
Interview mit Hilde Emmerich
Vom Hobby-Künstler zum Kino-Enthusiasten
Interview mit Roland Emmerich
Das Arche Noah Prinzip
Interview mit Roland Emmerich
Das Centropolis-Projekt
Interview mit Hans Emmerich
Joey
Interview mit Roland Emmerich
Hollywood Monster
Interview mit Roland Emmerich
Moon 44
Interview mit Malcolm McDowell
Besuch in der Trick-Hexenküche
Interview mit Roland Emmerich am Set von Moon 44
Centropolis reloaded
Interview mit Ute Emmerich
Universal Soldier
Interview mit Roland Emmerich
Stargate
Bildstrecke 1
Interview Roland Emmerich
Independence Day
Interview mit Volker Engel
Master of Desaster
Interview mit Roland Emmerich
Godzilla
Es kommt doch auf die Größe an!
Interview mit Roland Emmerich
Interview mit Dean Devlin
Der Patriot
Das Acabar
Interview mit Roland Emmerich
The Day After Tomorrow
Interview mit Roland Emmerich
Besuch bei Ute Emmerich
Interview mit Ute und Roland Emmerich
10.000 B.C.
Interview mit Harald Kloser
2012
Die Mutter aller Desaster-Filme
Bildstrecke 2
Interview mit Roland Emmerich
Emmerich im Kontext
Anonymus
Besuch in Emmerichs Villa II
Interview mit Roland Emmerich
White House Down
Stonewall
Interview mit Roland Emmerich
ID4: Wiederkehr
Interview mit Roland Emmerich
Filmografie Roland Emmerich
Das könnte Sie interessieren
The Man Who Taught Me Cause And Effect or/oder Zuerst machen wir jetzt mal gar nichts!
Harald Kloser (links) mit Jo Müller
Roland hatte nie Angst vor Hollywood. Sein Wunsch war es immer, eines Tages dorthin zu gehen, um Hollywood-Filme zu drehen. Amerikanische Filme.
Rolando, du bist ein einmaliger Freund. Deine Bandbreite reicht vom charmanten, liebenswürdigen und großzügigen kleinen Jungen, der die verrücktesten Geschichten herbeiträumen kann, bis hin zum kompromisslosen Genie, das seinem Team alles abfordert und für das ein „Nein“ als Antwort ein Fremdwort ist. You definitely have the heart of a warrior. And the memory of an elephant … on steroids.
The Roli I like best is the one that comes with a nice meal and a glass of Bordeaux … or two. Those times when we’re riffing on the most insane ideas. Stuff, that people where we come from, would send us to a brain doctor for. Like, we thought it would be great to make an epic film about the lives and times around the year 10,000 BC. A film with saber-tooth tigers, terror birds, the guys who built the pyramids, a toothless shaman, a God that lost his hearing, and of course a gaggle of shirtless mammoth hunters roaming the prehistoric prairies.
As you can clearly see, Roland is definitely not dreaming strictly by the history books, by hard science or even the laws of physics. His stories only have to have „the aura of plausible believability“. With that approach, he actually convinced a huge media giant, in this case Warner Bros., to give us the funds to start making the movie 10,000 BC. Really? Is it that easy? It’s not. That’s where the uncompromising determination and proverbial wit of a Swabian business man comes into play. Because the path from script to movie is a long and winding road, paved with obstructions, distractions and seduction. 10,000 BC was shot on three continents, dealing with freezing temperatures, torrential rain, fog in the desert, with kids, horses, blizzards, injuries and breakdowns. And let’s not forget the panicking studio executives back in Burbank …
Als ich Roland kennenlernte, waren wir beide schon einige Zeit im Filmgeschäft. Er weit oben, ich weit unten. Mein vierzigster Geburtstag steckt mir heute noch in den Knochen. Ich sitze im Kings Road Cafe, direkt neben einem riesigen Zeitungskiosk. Vor mir baumeln Variety und der Hollywood Reporter und überschlagen sich mit Superlativen: „Independence Day about to dethrone Jurassic Park.“ Der damals erfolgreichste Film aller Zeiten. Im selben Moment klingelt mein Telefon. Ein Produzent bringt mir schonend bei, dass meine Filmmusik für A Further Gesture nicht gefalle und man bereits einen neuen Komponisten angeheuert habe. Wow, mein Freund Roland besteigt gerade den Olymp, während ich ernsthaft überlege, den nächsten Flieger nach Hause zu nehmen, um mein Glück wieder als Musiklehrer zu versuchen. Das wär’s fast gewesen für mich damals. War schon faszinierend, mit jemandem befreundet zu sein, dessen Karriere gerade zu den Sternen stieg. Schwer war’s auch. Warum er und nicht ich? Wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das habe mich kaltgelassen.
Dann kam der Tag, als mich Roland fragte, ob ich Lust hätte, ein „music demo“ für The Patriot zu komponieren. Meine Stunde. Nicht nur ein, sondern gleich sechs Tracks waren auf der Demo-CD, die ich ihm zum Drehort in South Carolina fedexte; samt CD-Player und Kopfhörer. Danach konnte ich ein paar Nächte nicht schlafen. Aber da kam nichts. Drei Wochen lang nichts. Zwei Monate nichts. Nur hin und wieder hörte ich um vier Ecken, dass Roland meine Musik gefallen habe.
The Patriot kam ohne mich raus. Stattdessen hatten sie den großen John Williams genommen. Can you blame them? Dass Roland sich nicht bei mir persönlich gemeldet hatte, tat mehr weh. Funkstille. Zwei Jahre lang. Mit „Hey, es tut mir so leid, dass ich nicht den Mut hatte …“ war unser Falling-out dann beendet. Roland gab mir noch am selben Abend den Auftrag für die Filmmusik von The Day After Tomorrow. Per Handschlag.
Mein bester Tag mit Roland beginnt mit Regen in Südkalifornien. Februar 2008. Wir hatten unsere erste Drehbuch-Fassung von 2012 an alle Studios gleichzeitig geschickt. Was wird’s wohl werden? „Nein, danke, ist nichts für uns“ oder „Wow, we need this movie!“? Anspannung total. Ich weiß nicht mehr genau, wo sich Roland an diesem Tag versteckt hatte; ich sperrte mein Telefon weg und buchte mir eine Massage, wohl wissend, dass Hollywoods Studiobosse unser Skript lesen, während mir die Knoten im Nacken weggeknetet werden. Die un-entspannendste Massage meines Lebens.
Nach 90 Minuten stand ich wieder im Umkleideraum und schaltete mein Handy an. Nur ein „missed call“ von Roland. Auweia. Die Hoffnung zerbröselte innerhalb von Sekunden und machte Selbstzweifel und Enttäuschung Platz. Kurzwahltaste 3. Roland. „Und?“
An diesem Tag wollten gleich fünf Hollywood-Studios unseren Film produzieren. Nicht schlecht für einen Vorarlberger. Surreal. Das Schöne daran war, dass wir unsere Geschäftsbedingungen gleich mit dem Drehbuch eingereicht hatten. Der Deal war auf dem Tisch.
Am nächsten Morgen holt mich eine Limo zu Hause ab. Roland sitzt schon drin. Wir werden an diesem Tag die Chefs von Fox, Universal, Warner Bros., Paramount und Sony treffen. Nicht, um ihnen etwas zu verkaufen, sondern um buchstäblich „angebettelt“ zu werden, 2012 mit ihrem Studio zu realisieren.
Um neun Uhr abends ist unser Deal mit Sony besiegelt. Done and done.
Cause and effect. Ein Glück, dass ich den Flieger nach Hause doch noch nicht genommen hatte … Aufgeben tut man einen Brief. Oder ein „Päckle“.
Zu Anonymus und Stonewall, Rolands Herzens-Projekten. Jedes Mal, wenn er über diese beiden Geschichten redete, leuchteten seine Augen. Jeder hat irgendwann versucht, ihm diese beiden Filme auszureden. Agenten, Anwälte, Businessmanager, Studiobosse, Familie, Freunde und Feinde. Auch ich dachte mir, das würde schwierig werden. Ein Deutscher, der den Engländern beweisen will, dass der größte ihrer Dichter, vielleicht der größte Dichter überhaupt, ein Scharlatan und Betrüger war. Und ein Film über ein geschichtsträchtiges Ereignis der US-Bürgerrechtsbewegung. „Willst du dir das wirklich antun, Rolando?“ Jetzt erst recht!
Beide Filme sind Geschichte. Mit Herzblut verwirklicht, liebevoll-besessen, künstlerisch ausgefeilt und akkurat bis ins kleinste Detail, wunderbar die Schauspieler, Kamera, Ausstattung und Musik. Und trotzdem von den Kritikern verschmäht und zerrissen. Oft herzlos und unter der Gürtellinie. Unfair bis zum Gehtnichtmehr. For me, Anonymous is one great piece of film-making, by anyone’s standard. Congratulations my friend.
„Rolands größte Schwäche ist seine Leidenschaft“, hat einer seiner Agenten mal zu mir gesagt. Da ist was dran. Wenn ich eines über ihn weiß, dann ist es, dass er keinem wehtun will. Naja, klappt halt nicht immer.
„Rolands größte Stärke ist seine Leidenschaft“, sagt einer seiner treuesten Freunde und Bewunderer. Ich.
März 2016. Wir sind im Endspurt für das Sequel von Independence Day. Alle Hände sind an Deck. Chaos. Jeden Tag eine Krise. Jede Nacht ein Albtraum. Dann kommt am Schluss noch die Musik dazu, dann Abgabe. Und dann hoffen und beten. Und am Schluss die E-Mails mit den BoxOffice-Zahlen anstarren – und entweder mit einer guten Flasche Bordeaux feiern … oder „oh well“ sagen.
Cause and effect. I got it, Roli. Die Frage ist, was machen wir jetzt als Nächstes? Wir beide kennen die Antwort:
Zuerst machen wir jetzt mal gar nichts!
Harald Kloser
(Produzent, Drehbuchautor, Filmkomponist)
März 2016
Zum Geleit
Roland Emmerich mit Jo Müller
Frühmorgens 03:40 Uhr. Der künstliche Regen prasselt auf die Straßen von New York City.
Von den Stuntspezialisten wurde eine Rampe aufgebaut, über die gleich im Höllentempo ein Taxi rasen wird, das dann durch die Luft fliegt. Im Film sitzen darin unsere Helden, die vor Godzilla fliehen, doch beim Dreh sind es Stuntleute, da diese Aufnahme sehr gefährlich ist. Vom Monster ist hier natürlich nichts zu sehen, das wird erst später digital einkopiert …
Seit Wochen bin ich bei den Dreharbeiten von Roland Emmerichs Godzilla dabei, da ich eine TV-Dokumentation über dessen Entstehung drehe.
Ich freue mich, dass gleich richtig was los sein wird. Mein Kameramann ist in Position gegangen und auch ich bin mit einer Kamera bewaffnet, es soll ja auf keinen Fall etwas schiefgehen.
Und dann geht’s endlich los. „And … Action“, ruft der Regisseur. Reifen quietschen. Das Auto fährt los, schießt über die Rampe und landet nur wenige Meter von mir und meinem Kameramann entfernt mit einem dumpfen Schlag auf dem Asphalt.
Während die Szene gedreht wird, höre ich hinter mir, dort, wo sich Emmerich mit seiner Crew vor Monitoren platziert hat, jemanden schreien: „Are these guys crazy?“ In diesem Augenblick schwant mir nichts Gutes und ich hoffe inständig, dass weder ich noch mein Kameramann mit diesen Worten gemeint sind. Aber wenige Momente, nachdem das „Cut“ zu hören war, steht auch schon der Erste Aufnahmeleiter vor mir. Sein Gesicht wirkt wie versteinert. Er zeigt anklagend auf mich und spuckt die schlimmsten Worte aus, die einem bei einem solchen „Hinter den Kulissen“-Drehgesagt werden können: „You were in picture!“ Das Gleiche muss sich auch mein Kameramann anhören.
Der Aufnahmeleiter erklärt uns unmissverständlich, was wir jetzt tun sollen – sofort den Drehort verlassen! Hastig suchen wir das Weite, ohne ein Wort zu verlieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dies das Ende für meine Dokumentation bedeutet und ich mit meiner Crew nach Hause fliegen kann.
Am Nachmittag dann habe ich ein Gespräch mit Ute Emmerich, der Schwester von Roland, die als Produzentin bei dem Projekt mit dabei ist. Glücklicherweise schickt sie uns nicht nach Hause, sondern erklärt, dass es nicht unsere Schuld gewesen sei, schließlich hätte man uns warnen müssen. Ich kann mein Glück kaum fassen …
Als wir dann später wieder am Set auftauchen und Roland Emmerich mich erspäht, hält er kurz inne, nennt mich „Troublemaker“ und fängt dann an zu lachen.
Die Sache ist vergeben und vergessen.
Inzwischen habe ich fünf TV-Dokumentationen über den Regisseur und seine Filme gedreht und unzählige Radioshows zum Thema gemacht. Seit über 25 Jahren führe ich Interviews mit ihm, blicke hinter die Kulissen seiner Blockbuster und besuche ihn regelmäßig zu Gesprächen in seiner traumhaften Villa in Los Angeles.
Ich habe miterlebt, wie er unter größten Mühen seine ersten Filme in der schwäbischen Provinz zu realisieren versuchte und wie er dafür von der deutschen Kritik mit Hohn und Spott übergossen wurde; wie er nach Amerika übersiedelte, dort Fuß fasste und schließlich seinen großen Triumph mit Independence Day erlebte.
Heute gilt er als einer der erfolgreichsten Regisseure der Traumfabrik. Aber obwohl er zu einem filmischen und finanziellen Schwergewicht wurde, hat er sich vom Charakter her nicht verändert und ist einfach der nette Kerl geblieben, der er immer war. Ein bodenständiger, witziger, extrem belesener und kluger Zeitgenosse, für den es kein Problem ist, über das Leben, den Job oder sich selbst zu lachen.
Aber natürlich besitzt er auch noch andere Charaktereigenschaften, wie etwa ein überaus starkes Durchsetzungsvermögen, sonst könnte er nicht bereits so lange und so erfolgreich dermaßen gigantische Kino-Produktionen realisieren …
Um sich seiner Persönlichkeit und seinen Werken zu nähern, hätte man eine ganz „normale“ Biografie schreiben können, die für den Leser alles bewertet, einordnet und interpretiert. Ich habe mich aber für eine andere Form entschieden, weil ich glaube, dass sie der Person von Roland Emmerich wesentlich näher kommt – und einfach auch mehr Spaß macht: Die verschiedenen Facetten von Emmerichs Persönlichkeit sollen hier mit Hilfe unterschiedlicher Darstellungsformen reflektiert werden und ganz wichtig: Roland Emmerich soll selbst zu Wort kommen!
Ein Großteil der Interviews sind brandneu, andere entstanden im Laufe vieler Jahre bei Dreharbeiten und wurden in ihrem historisch-situativen Kontext belassen. Dadurch, so glaube ich, erlebt man die Entwicklung dieses Ausnahme-Regisseurs hautnah mit und kann sich vor allem selbst ein Bild von ihm machen.
So finden Sie denn also in dieser Biografie Reportagen und Besprechungen, Gespräche und Analysen vor. Und natürlich soll das Buch dabei auch denjenigen nützliche Tipps geben, die sich selbst für das Filmemachen interessieren, schließlich halte ich immer noch François Truffauts Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? für das beste Filmbuch aller Zeiten. Sie haben hier also die Möglichkeit, einem der großen Kinomagier unserer Zeit in die Karten zu schauen, seine Tricks und Kniffe kennenzulernen.
Nicht zuletzt kann diese Biografie aber auch in Sachen Fotos mit exklusivem Material aufwarten: Roland Emmerich gewährte Einblick in sein privates Foto-Archiv, das seine Mutter Hilde verwaltet. Von ihr habe ich mehrere Dutzend Familien-Alben und viele Kilos Bilder zur Durchsicht bekommen, von denen ich die schönsten und wichtigsten ausgesucht habe.
Und jetzt kann die Reise losgehen: Willkommen im Kino-Universum von Roland Emmerich!
Jo Müller
März 2016
Vorgeschichte
Der Stammbaum der Familie Emmerich reicht weit zurück. Er lässt sich bis ins Jahr 1766 zurückverfolgen, in dem Anton Emmerich geboren wurde. Der Name soll vom Ort Emmerich am Rhein her stammen, der ursprünglich eine Missionsstation war und um 700 n.Chr. gegründet wurde. Zur Stadt erklärt wurde er schließlich 1233.
Die Vorfahren der Emmerichs sollen aus der Eifel kommen, dem sogenannten Rhein-Mosel-Dreieck. Das Wappen: ein roter Schild, darin ein mit drei roten Rosen belegter silberner Balken, auf dem Helm eine Krone aus Flügeln, auf denen ebenfalls Rosen zu sehen sind.
Aus dieser Familien-Linie stammt auch der am 16. Februar 1923 in Stuttgart geborene Hans Emmerich. Als dieser aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, lernte er in Stuttgart-Obertürkheim eine gewisse Hilde Klein kennen, die er 1950 heiratete. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kaufmann Hans mit seinem Bruder Heinz, der als Ingenieur arbeitete, schon eine Firma gegründet, die mobile Sprühgeräte entwickelte. Bereits vor dem Krieg hatten sie sich als passionierte Flugmodellbauer für die Entwicklung von Kleinmotoren begeistert. Dieses Wissen konnten sie jetzt in bare Münze umsetzen.
Auf die Idee zu ihren Sprühgeräten waren sie gekommen, als sie Winzer beim Besprühen der Reben beobachtet hatten. Diese verwendeten schwerfällige stationäre Motorpumpen sowie kilometerlange Schläuche, die sie in die Weinberge ziehen mussten, wofür viele Helfer notwendig waren. Der ebenso simple wie brillante Einfall von Hans und Heinz Emmerich: Die beiden wollten dieses Sprühverfahren vereinfachen, so dass weder lange Schläuche noch viele Mitarbeiter für die Arbeit benötigt wurden. So entwickelten sie eine auf dem Rücken tragbare Motorpumpe. Der Grundstein für die international erfolgreiche Firma SOLO, die später auch Rasenmäher und Mofas herstellte, war gelegt.
In dieses Umfeld hinein wurden vier Kinder geboren: Wolfgang, Andreas, Roland und Ute. Während Wolfgang und Andreas später in die väterliche Firma einstiegen, entschieden sich Ute und Roland für einen anderen, einen eigenen Weg: Sie wollten mit Filmen die Welt erobern und träumten von Hollywood.
Besuch in Roland Emmerichs Villa I:
Von Memorabilien und Sammlerstücken
Links neben dem großen hölzernen Tor befindet sich eine Sprechanlage. Dort hat man sich ordnungsgemäß anzumelden. Lautlos schwingen dann die Tore auf. Es geht steil nach oben. Überall üppiger Pflanzenwuchs. Eine grüne Oase mitten in Los Angeles. Hier hört man nichts mehr vom Autolärm der Stadt, allein das Dröhnen von Helikoptern oder Flugzeugen stört manchmal die märchenhafte Ruhe.
An diesem Ort, an dem einst die Traumfabrik ihren Anfang nahm, lebt Roland Emmerich seit mehreren Jahren. Er wollte, dass sein Anwesen aussieht wie das Domizil eines Stummfilmstars und einen Hauch von Boulevard der Dämmerung verströmt: Fährt man die Auffahrt hoch, sieht man über sich ein gewaltiges, voluminöses Gebäude thronen. Emmerich hat es selbst gestaltet, was nicht weiter verwundert, wollte er doch ursprünglich einmal Production Designeroder Architekt werden.
Sein Haus ist prall gefüllt mit afrikanischer Kunst, ungewöhnlichen Gemälden, schrillen Sammlerstücken, bizarren Möbeln und Memorabilien seiner eigenen Werke. Im Wohnzimmer steht die Freiheitsstatue aus Independence Day, die im Film vom gigantischen Schatten eines Alien-Raumschiffes verdunkelt wird. Neben ihr befindet sich ein Kunstwerk namens Dogs on Stills No.1, eine Bildhauerarbeit, die einen Hund auf Stelzen zeigt. Auf seinem Tisch stehen Totenköpfe, Büsten von Mao oder Matroschkas von Osama Bin Laden. An den Wänden hängen bizarre Masken. Überall Schnitzereien, Antiquitäten, beinahe wie in einem Museum. In einer Ecke steht eine Lampe, die er ganz neu erworben hat: Ein aus Holz geschnitzter Affe, der einen Lampenschirm auf dem Kopf trägt.
Emmerich mag es skurril. Wer das Gästebad betritt, erblickt ein Waschbecken, dessen unterer Teil aus einem Sarg gefertigt wurde. Auf einer Anrichte kann man eine ganze Sammlung ungewöhnlicher Steinschleudern bestaunen, die er aus Afrika mitgebracht hat. Am meisten mag er die Schleuder, deren Griff wie eine Pistole geformt ist. Auch ein Feuerwehrhelm aus dem Jahr 1900 hat den Weg in sein Haus gefunden, er sieht aus wie ein runder Kübel mit zwei großen runden Fenstern. Stolz ist der Regisseur auch auf die zahlreichen Spielzeugwaffen, aus alten Flash Gordon-Filmen. Kino-Memorabilien dieser Art liebt er und würde sie am liebsten gleich dutzendweise kaufen. Am ungewöhnlichsten freilich ist seine Penis-Sammlung, die viel Platz einnimmt. Hier findet man männliche Geschlechtsteile aus allen erdenklichen Materialien und in allen vorstellbaren Formen, Farben und Größen. Roland Emmerich hat sie überall auf der Welt gesammelt. Er weiß, dass seine Mutter davon gar nicht begeistert ist, aber von dieser Leidenschaft will er nicht lassen. Deshalb hat er eine weitere Sammlung in seinem Haus in London angelegt.
Interview mit Roland Emmerich:
„In L.A. fühle ich mich zu Hause“
Wie lebt es sich denn als Schwabe in Los Angeles? Haben Sie sich schon perfekt assimiliert oder sich ihre deutsche Skepsis bewahrt?
RE: Im Kern bin ich natürlich noch Deutscher. So etwas kriegt man nicht los. Seine Wurzeln kann niemand verleugnen. Das geht auch meiner Schwester Ute so. Das wird sich auch niemals ändern. Wir sind aber natürlich amerikanisiert. Heißt: Wenn wir zu einem Restaurant fahren und da ist kein „Valet Parking“,dann nervt uns das. Und wenn wir eine Pizza bestellen und sie ist nicht innerhalb von 20 Minuten geliefert, dann wird natürlich auch gemeckert. Meine Schwester sagt immer, dass einem das Leben hier in L.A. wirklich sehr einfach gemacht werde – wenn man das Geld hat. Ich habe auch schon mal ein Jahr in London gelebt und fand es dort – was den Alltag angeht – schon wesentlich schwieriger. Autofahren kann man in London völlig vergessen. Zu viele Einbahnstraßen, zu viel Verkehr. Deshalb müssen Sie jeden Tag ein Taxi rufen. Und dann natürlich das ständig wechselnde Wetter. In meinem Haus in London bin ich ein Gast. In meinem Haus in L.A. fühle ich mich zu Hause. Das ist so etwas wie meine Heimat.
Wenn man sich in Ihrem Haus umguckt, fallen einem die vielen historischen Bösewichte auf, man findet Osama Bin Laden und andere, die Sie als Büsten oder Porzellanfiguren haben …
RE: … in meinem Haus in London habe ich da noch mehr. Das hat ästhetische Gründe. Mir gefällt einfach Propaganda-Kunst. Mir gefällt das Plakative daran! Es ist für mich einfach faszinierend, z.B. zu sehen, wie viele Formen und Figuren von Mao gegossen wurden. Es gibt ihn aus Metall oder aus Porzellan. Aber ich sammle nicht nur Diktatoren, sondern auch Penisse aus Holz oder Stahl, groß oder klein, manche mit Schrift, manche ohne. Ich habe irgendwann mal zwei gekauft, fand diese sehr witzig. Dann begann ich, eine Sammlung aufzubauen. Das sind Fruchtbarkeitssymbole, eine uralte Tradition. Vor allem in Asien. Ich habe hier in Los Angeles eine ganze Menge, aber in London noch viel mehr. Jedes Mal, wenn meine Mutter die sieht, verzieht sie das Gesicht und ist empört. (lacht) Ich bin tatsächlich ein Sammler. Vor unserem Interview hatte ich kurz Zeit und mich im Blackman Cruz Store umgeguckt, die haben Sachen, die ich mag. Was ich dort gefunden habe und extrem witzig finde: eine Pistole zur alten Flash Gordon-Serie. Ein Kinderspielzeug aus den 1950er Jahren – aber es sieht aus wie ein Kunstobjekt. Oder einen Feuerwehrhelm, Jahrhundertwende. Er sieht aus wie der Helm von Darth Vader,nur viel schöner.
Sie sind jetzt seit über 25 Jahren in Los Angeles. Fühlen Sie sich inzwischen als Amerikaner?
RE: Ich würde sagen, ich bin Kalifornier. Dennoch behält man seine Nationalität. Interessanterweise kommen mir die 25 Jahre hier in Kalifornien wesentlich länger vor als die 34 Jahre in Deutschland. In dieser Zeit ist für mich einfach wesentlich mehr passiert. Als ich damals hier ankam, versuchte ich mich erst mal zu orientieren. Wollte wissen, wie man hier lebt, was man so macht. Es ist ein ganz, ganz langsamer Prozess. schließlich ist es nicht so, dass man sagt: „Yeah, jetzt bin ich in Amerika.“ Bis man wirklich ankommt, dauert das seine Zeit. Erst ist es natürlich wahnsinnig aufregend. Alles ist neu, man fühlt sich lebendig. Dann, nach vier oder fünf Jahren, kippt es ins Gegenteil. Sie sind von allem genervt und überlegen sich, ob es nicht besser wäre, woandershin zu ziehen. Und dann stellen Sie fest: Hier in Kalifornien ist es perfekt. Das Wohnen ist toll, das Klima herrlich und es wird einem alles einfach gemacht. Das Gefühl ist irgendwie, als sei man auf einer Insel. Ein Filmemacher wie ich muss ja auch viel reisen. Wenn ein neuer Film von mir Premiere hat, muss ich um die ganze Welt reisen. Außerdem reise ich auch privat sehr gerne und viel. Aber es ist für mich immer ein schönes Gefühl, wieder zurück, nach Hause zu kommen. Ich fühle mich hier wirklich wohl.
Können Sie sich noch erinnern, wann Sie zum ersten Mal in Amerika waren?
RE: Das war schon als Kind. Mein Vater sagte zu mir, dass mein Bruder Wolfgang nach Irland und mein Bruder Andy nach Frankreich gehen würden. Und nun wollte er von mir wissen, wohin ich wolle. Aus Jux sagte ich: „Amerika.“ Und so kam ich hierher zu einem Geschäftskollegen meines Vaters. Diese Erfahrung hat mich wirklich geprägt. Ich war damals acht Wochen hier. Ich habe tolle Erinnerungen an diese Zeit. Ein Highlight war der Besuch in Washington D.C., da war es wahnsinnig heiß und wir standen vor dem Weißen Haus und dem Capitol. Toll! Großartig war auch der Ausflug nach Chesapeake Bay, wo sie alte Schiffe einmotten, oder in die Cherokee Mountains, ins Indianerreservat. Das hat mich alles geprägt. Darüber habe ich mich auch viel mit Ossi von Richthofen unterhalten, der mit mir zusammen eine Art amerikanischer Fraktion auf der Filmhochschule in München bildete. Auch er war als Teenager oft in Amerika. Während unserer Studienzeit besuchte er einmal Verwandte in Kalifornien und brachte einen Sticker zurück: HFF – see you in Hollywood. Den klebten wir auf mein Auto und es haben sich alle furchtbar darüber aufgeregt. Dabei war es von uns nur als Spaß gemeint. Wir provozierten da aber natürlich schon ein bisschen. Es gab auf der HFF immer endlose Diskussionen, wenn Filme neu herauskamen. Und als Star Wars gestartet war, wurde er von den meisten Studenten als purer Kommerz abgetan. Wir aber sagten: „Es ist auch ein guter Film!“ Das war die Zeit, in der ich mich an der Filmhochschule, sehr zum Entsetzen vieler, zu meinen US-Vorbildern bekannte. Ich sagte, dass ich nichts mit Wim Wenders oder Rainer Werner Fassbinder anfangen könne. Meine Helden waren Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg oder George Lucas. Sie waren mir wesentlich näher als die deutschen Filmemacher. So unglaublich das heute klingen mag: Aber wenn man so etwas damals auf der HFF offen sagte, ging ein Aufschrei durch die Klasse. In dieser Zeit begann sich eine kleine Gruppe zu bilden, die sich zum Hollywood-Kino bekannte. Ossi von Richthofen, Gabi Walther oder Egon Werdin. Wir waren Studenten, die kommerzielle Filme machen wollten, keine Kunst. Als Provokation antwortete ich immer auf die Frage, wer mein Regievorbild sei: Harald Reinl. Der hatte Winnetou- und Edgar-Wallace-Filme gemacht. Natürlich war er nicht mein Lieblingsregisseur, aber ich wollte mir diese Provokation nicht entgehen lassen.
Das SOLO-Imperium und der Emmerich-Clan:
Die Wurzeln
Vielleicht war es Liebe auf den ersten Blick. Sehr wahrscheinlich sogar. Aber so genau weiß sich Hilde Klein nicht zu erinnern. Denn 1947 tauschte sie noch romantische Briefe mit einem anderen jungen Mann aus, einem Grenzer, den sie erst kurz zuvor im Urlaub kennengelernt hatte. Da stand eines Tages plötzlich Hans Emmerich vor ihr. Er kam als ehemaliger Leutnant aus der französischen Kriegsgefangenschaft zurück und suchte eine Bleibe. Und im Hause Klein war eine Wohnung freigeworden, die tatsächlich an ihn vermietet werden konnte. Auch Hans hatte während des Krieges, als er verwundet im Krankenhaus lag, jemanden kennengelernt, dem er schrieb.
Hilde, die damals Anfang 20 war, zeigte sich jedoch schon bald von dem „klapperdürren“ Neuankömmling sehr angetan. Denn der packte überall mit an, war hilfsbereit und sich für nichts zu schade. Ein echter Macher eben! Er half auch mit, den hauseigenen Wein zu verarbeiten. „Mir hat gefallen“, so erinnert sie sich heute, „dass er sehr spontan, witzig und ein echter Workaholic war. Wie ich auch.“
Bald schon begann er mit seinem älteren Bruder Heinz in der Scheune der Familie Klein zu basteln und zu tüfteln. Die beiden hatten sich nach dem Krieg zusammengesetzt, um zu überlegen, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen könnten. Heinz war der Ingenieur, Hans der Kaufmann. Eine perfekte Kombination. Sie kamen dann auf die Idee, leichte Verbrennungsmotoren zu entwickeln, die in tragbare Geräte eingebaut werden konnten. Und so kam es zur bahnbrechenden Erfindung mobiler Motorsprühgeräte, die beide reich machten.
Und weil diese tragbaren Sprühgeräte von Einzelpersonen benutzt werden konnten, kam es zum Firmennamen SOLO. Am 10. Februar 1948 wurde die eigene Firma gegründet. Die beiden Brüder hatten sofort riesigen Erfolg und reisten von Messe zu Messe. Die Geräte wurden ihnen dabei regelrecht aus den Händen gerissen. Damit war der Grundstein für ein kleines schwäbisches Firmenimperium gelegt, das schließlich in der ganzen Welt bekannt wurde. SOLO eröffnete Filialen und Werke u.a. in den USA, Südamerika, Australien, Frankreich und der Schweiz. Neben Sprühgeräten stellte die Firma aber auch schon bald andere Gerätschaften her, ob Rasenmäher, Motorsägen oder Mofas, und eroberte damit den Markt. 1972 z.B. brachten die Brüder mit dem Solo 720 das erste Elektro-Mofa der Welt auf den Markt, wofür sie später vom Bundeswirtschaftsminister ausgezeichnet wurden. Durchsetzen konnte es sich aber auch in der Zeit der Ölkrise nicht, was mit dem hohen Preis von damals 1.100 Mark zu erklären ist.
Hilde Klein erlebte den Aufstieg der Firma hautnah mit, denn sie wurde am 25. Februar 1950 zu Hilde Emmerich. Schon nach kurzer Zeit waren Hans und sie sich in der Blautopfstraße 18 in Stuttgart-Obertürkheim näher gekommen. Immer, bevor er sich auf den Weg zu einer Messeveranstaltung machte, schrieb Hans ihr kleine romantische Briefchen. Wovon freilich Hildes Eltern anfangs nichts wissen durften. Gleichzeitig beendeten die beiden ihre Korrespondenzen mit ihren früheren Bekanntschaften. Und nachdem auch Hildes Vater sich von dem hilfsbereiten jungen Mann begeistert zeigte, stand einer Heirat schließlich nichts mehr im Wege.
In der Blautopfstraße kamen schließlich auch die vier Kinder auf die Welt: 1951 Wolfgang, 1954 Andreas, 1955 Roland und schließlich 1961 Ute.
Später ließ sich das Ehepaar Emmerich eine ebenso große wie moderne Flachdach-Villa auf einer Anhöhe im schwäbischen Industrieort Sindelfingen bauen. Ein wundervolles Areal mit eigener Quelle, Hallenbad, üppig bepflanztem Garten und herrlichem Blick über die Stadt. Die perfekte Idylle. Vor allem auch für Kinder. Dorthin zog die Familie 1963. Hilde Emmerich lebt noch heute dort. Sie sei hier „einfach fest verwurzelt“ und liebe den Garten, das ganze Terrain, nach wie vor heiß und innig. Ihr Mann Hans verstarb überraschend am 1. Januar 2005. Er erlag einem Herzinfarkt. Die Söhne Wolfgang und Andreas hatten zu diesem Zeitpunkt schon längst die Geschäftsführung von SOLO übernommen.
Roland und Ute wiederum leben und arbeiten bereits seit 1990 in der Film-Traumfabrik von Los Angeles.
Interview mit Hilde Emmerich:
„Kein Durchschnittskind“
An welche Anekdoten erinnern Sie sich, wenn Sie an Ihren Sohn als kleinen Jungen denken?
HE: In besonderer Erinnerung ist mir folgende Situation: Wir waren erst kurz zuvor in unser neues Haus in Sindelfingen umgezogen, das sich auf einem Hügel befindet. Damit die Kinder richtig spielen konnten, haben wir vieles begradigt – aber trotzdem kam es zu einem Unfall. Roland spielte Fußball, rannte den Garten hinunter und fiel über die Mauer. Er brach sich dabei das Handgelenk und musste ins Krankenhaus. Weil ihm später oft der Arm auskugelte, dachte ich lange Zeit, dass das vielleicht eine Folge des Sturzes war …
Wie war er als Kind?
HE: Roland war kein Durchschnittskind, wie ich finde. Er fiel schon im Kindergarten durch seine künstlerische Begabung auf und konnte wirklich toll zeichnen und malen. Während seiner Schulzeit half er auch einer Klassenkameradin, die Mode studieren wollte, indem er ihr für die Bewerbungsmappe alle Zeichnungen erstellte. Er hatte immer großartige Ideen und lief nie mit der Masse mit. Auch war er alles andere als ein Rowdy. Im Gegensatz zu seinem Bruder Andy hatte er auch keinen riesigen Freundeskreis, sondern verhielt sich eher zurückhaltend. Roland suchte seine Freunde genau aus. Allerdings war er schon sehr lebendig, unruhig und hatte immer was am Laufen. Als Kind ist er manchmal mit seinen Geschwistern und seiner Cousine Renate auf Friedhöfen herumgewandert und hat sich über die absurden Namen auf manchen Grabsteinen amüsiert. Renate erzählt immer, das sei gewesen wie bei Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Er hat später mit 15 oder 16 immer Grabsteine und Särge gemalt. An seinem 21. Geburstag ließ er sich schließlich in einem Sarg beerdigen. Er hat das damals im Geheimen zelebriert, auf einem angemieteten Gartengrundstück, mit engen Freunden. Mein Mann und ich wussten nichts davon. Als ich es später erfahren habe, war ich geschockt. Aber es hat wohl mit seinem schwarzen Humor zu tun, vielleicht auch mit Surrealismus, der ihm sehr gefiel. Was Roland vor allem war: Ein absoluter Bücherwurm. Ich kann mich erinnern, dass er z.B. schon als Steppke alles von Hermann Hesse gelesen hatte. Aber auch wenn Roland manchmal etwas eigen war, zu den Familien-Ausflügen ging er immer mit, selbst wenn er vielleicht das eine oder andere Mal gar nicht so viel Lust darauf hatte. Beispielsweise waren wir lange Zeit jeden Samstag auf der Teck, weil unser Sohn Wolfgang gerne Modellflugzeuge steigen ließ und später auch zum Segelflieger wurde. Im Übrigen erlebten wir viele klassische Familienurlaube, an die ich immer noch wundervolle Erinnerungen habe. Im Winter waren wir oft im Engadin Skifahren, im Sommer in Spanien, an der Costa Brava.
Wie haben Sie die ersten filmischen Gehversuche Ihres Sohnes erlebt?
HE: Wir konnten zuerst nicht so viel damit anfangen. Weil es halt so was ganz anderes war. Andererseits war auch beispielsweise mein Mann Hans sehr filmbegeistert. Er drehte viele Super-8-Filme. Immer wenn wir im Urlaub waren, rannte Hans mit der Kamera herum.
Lebhaft in Erinnerung sind mir die ersten Filme von Roland deshalb, weil ich oft für die ganze Crew kochen musste. Bereits bei seinem Studentenprojekt Franzmann wuselten hier viele herum. Ich machte ihnen Boeuf Stroganoff mit Spätzle und es schmeckte ihnen wunderbar. Bei Das Arche Noah Prinzip kochte ich Kartoffelsuppe mit Würstchen und brachte das Ganze in Kochtöpfen zum Drehort. Manchmal mussten wir hier auch 40 bis 50 Butterbrezeln schmieren. Natürlich haben viele hier zudem übernachtet, weil niemand von der Filmproduktion Geld besaß. Aber ich muss sagen, dass ich mich sehr gerne an diese Zeit zurückerinnere. Ich bin mit diesen Leuten wunderbar ausgekommen, es war ein Riesen-Spaß. Und ich habe mit vielen von ihnen heute noch Kontakt, weil sie sich regelmäßig bei mir melden. Das finde ich natürlich sehr erfreulich. Ich habe damals natürlich auch mitgekriegt, dass irgendwann mal das Geld ausging und mein Mann einspringen musste. Rolands Ideen waren immer phantastisch, aber sie kosteten eben auch Geld.
Wie haben Sie darauf reagiert, als Roland und Ute Ihnen erklärten, dass sie nach Amerika ziehen wollten?
HE: Die beiden hatten ja schon immer ein Faible für die USA und waren auch schon vorher mehrfach dort. Das war eine logische Konsequenz. Hier in Deutschland wurde Roland als „Spielbergle“belächelt und hatte einfach ab einem bestimmten Moment keine Lust mehr, sich das anzuhören. Zumal er von Mario Kassar nach Moon 44 ein Angebot bekam, das er nur schwerlich hätte ausschlagen können. Und weil er bei all seinen Filmen mit Ute eng zusammengearbeitet hatte, war klar, dass auch sie mitgehen würde. Zuerst war es schwierig für mich, das zu akzeptieren, fast ein Schock. Schließlich sind es ja meine Kinder. Ich erinnere mich daran, dass Roland eines Abends seinen Vater aus den USA anrief und ihm erklärte, er habe ein lukratives Angebot bekommen. Mein Mann meinte zu ihm: „Es kann dir gar nichts Besseres passieren. Nimm das Angebot an!“ Mein Mann war lange Zeit für Roland ein enger Vertrauter, mit dem er alles besprechen konnte.
Es fällt auf, dass Ihr Sohn Sie in ganz vielen Interviews oder Ansprachen erwähnt. Schmeichelt das?
HE: Natürlich schmeichelt mir das. Ich bin auch wirklich stolz auf Roland und das, was er erreicht hat. Natürlich höre ich eher selten von ihm, meistens telefoniere ich mit Ute. Roland ist ständig im Stress und umringt von einem Tross von Leuten. Es ist etwas schwierig, sich mit ihm in Ruhe unterhalten zu können. Deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, wenn er mich immer an Weihnachten besuchen kommt – sofern es ihm möglich ist. Er hat mich auch schon auf sein Schiff in Thailand mitgenommen, die MaidMarian II. Das war herrlich. Zusammen mit meinen fünf Enkeln. Einmal reservierte er mir eine Hotel-Suite in Bangkok, die so überwältigend groß war, dass ich dachte, ich könnte darin tanzen.
Vom Hobby-Künstler zum Kino-Enthusiasten:
Roland Emmerich entdeckt seine Leidenschaft
Nein. Die Schule hat ihn alles andere als begeistert. Er war ein höchst durchschnittlicher Schüler und am Lehrstoff wenig interessiert. Um einen Streber hat es sich bei ihm wahrlich nicht gehandelt. Zwar hatte er erkannt, dass es wichtig war, Abitur zu machen, war dieses doch die Eintrittskarte in ein späteres Berufsleben. Aber der Unterricht langweilte ihn einfach. Während der Mathelehrer sich darum bemühte, den Satz des Pythagoras detailliert zu erläutern, oder im Physikunterricht der Faraday-Effekt besprochen wurde, pflegte Emmerich seine Gedanken um andere, wesentlich aufregendere Dinge kreisen zu lassen: Er träumte von den phantastischen Welten der Malerei.
Seit frühester Kindheit war er ein begeisterter Freizeit-Künstler, malte viel und gern, einerseits surreale, teils düstere Ölgemälde im Stil von Dalí, andererseits traditionelle Portraits. Bereits als 16-jähriger Steppke machte er in seinem Heimatort Sindelfingen durch sein ausgeprägtes künstlerisches Talent von sich reden. Mit präzisen Strichen zeichnete er Portraits von Nachbarskindern und besserte damit sein Taschengeld auf. Wobei ihn der Spaß an der kreativen Arbeit wesentlich stärker reizte als die Entlohnung, schließlich entstammte er einem gutsituierten Elternhaus und war der Sohn des erfolgreichen Fabrikanten Hans Emmerich, der in den Nachkriegsjahren zusammen mit seinem Bruder Heinz für eine Revolution im Kaffee-, Kakao- und Weinanbau gesorgt hatte. Bevor die beiden Brüder damals ihre Erfindung auf den Markt brachten, mussten sich die Kaffee- und Kakao-Pflanzer ebenso wie die Weinbauern mit handbetriebenen Maschinen abplagen, um ihre Schützlinge zu besprühen. Das mobile Gerät mit Benzinmotor war dann natürlich zum Verkaufsschlager geworden und machte Hans und Heinz Emmerich zu Millionären.
Das Erfolgsrezept: Erfindungsreichtum und Tüchtigkeit gepaart mit Geschäftssinn und Durchsetzungsvermögen. Die gleichen Eigenschaften scheinen sich später auch auf Sohn Roland übertragen zu haben. Als 20-Jähriger brachte Emmerich seine Lehrer etwa zur Weißglut, weil er ausgerechnet in der Zeit des schriftlichen Abiturs eine große Kunstausstellung in einer Galerie organisierte, bei der er seine Gemälde der Öffentlichkeit vorzustellen gedachte. Die herbe Kritik der Pädagogen ließ den selbstbewussten Pennäler indes völlig kalt und der Erfolg gab ihm recht: Erstens konnte er bei der Ausstellung die Hälfte der Bilder verkaufen und zweitens schaffte er es, die Abiturprüfungen zu bestehen.
Ebenso wie für Malerei begeisterte er sich schon früh auch für Literatur. Als Halbwüchsiger verschlang er Romane von Novalis, Joseph von Eichendorff, E.T.A. Hoffmann und Hermann Hesse. Besonders hingezogen fühlte er sich zur deutschen Romantik. Sie prägte seine Gedanken und machte einen nachhaltigen Eindruck auf ihn.
Tiefe Spuren hinterließ, wie gesagt, auch seine erste Reise nach Amerika. Als 13-Jähriger besuchte er einen kleinen Ort namens Newport News, an der Ostküste der Vereinigten Staaten, wo Geschäftsfreunde der Familie lebten. Es war das erste Mal, dass er alleine, ohne seine Eltern, auf Reisen ging. Die Sommerferien, die er dort verbrachte, erlebte er wie einen Traum von gigantischen Städten, Highways und Drive-ins. In sein Gedächtnis brannte sich besonders das Bild einer geheimnisvoll funkelnden Lichterkette ein, die er am Horizont entdeckte: Das nächtliche New York.
Bei seinem ersten USA-Besuch verschlug es ihn aber auch ins Kino und seine Leidenschaft für die bewegten Bilder begann langsam in ihm zu keimen. Als überzeugter Bücherwurm wollte er sich dann natürlich auch mit den Werken amerikanischer Autoren vertraut machen und so las er in späterer Zeit Romane von Tom Wolfe, Jack Kerouac, William S. Burroughs oder J. D. Salinger.
Es waren jedoch nicht nur seine Amerika-Besuche, die ihn den Zelluloid-Träumen näherbrachten, sondern auch seine regelmäßigen Aufenthalte in einer südfranzösischen Ferienschule. Die Lehranstalt war in einer alten Villa untergebracht und verströmte den Hauch vergangener Geschichte, was ihm sehr gut gefiel. Die Villa wurde für Emmerich zur zweiten Heimat. In ihren Mauern begann er sich eingehend mit dem französischen Literaten, Dichter, Theaterautor und Filmregisseur Jean Cocteau zu beschäftigen. Mit Begeisterung verschlang er dessen Bücher, studierte dessen Werke auf Zelluloid – und wurde damit auch durch sie mit der magischen Welt des Kinos vertraut gemacht.
Seine Begeisterung für die bewegten Bilder wurde bald so groß, dass er fast jeden Tag Stunden im Kino verbrachte und sein ganzes Taschengeld für diese neue Leidenschaft ausgab. Besonders beeindruckten ihn dabei amerikanische Musicals. An der Spitze seiner persönlichen Hitliste standen Tanzfilm-Klassiker von Vincente Minnelli mit den beiden Musical-Legenden Ginger Rogers und Fred Astair.
Emmerich las in dieser Zeit zudem alles an Filmliteratur, was ihm in die Hände fiel: Drehbücher von Federico Fellini, Biografien über Fritz Lang und Truffauts legendäres Buch Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?. Besonders begeistert zeigte er sich dabei von den Tricks des genialen „Master of Suspense“. Beeindruckend fand er etwa jene Szene in dessen Klassiker Verdacht, in der Cary Grant seiner Filmgattin Joan Fontain ein Glas Milch bringt, das wie der Zuschauer vermutet, vergiftet ist. Um die Aufmerksamkeit des Zuschauers ganz auf das Glas zu lenken, versteckte Hitchcock ein Lämpchen darin. Deshalb leuchtet es auf geheimnisvolle, aber nicht aufdringliche Weise …
Den jungen Kinofan interessierten alle Aspekte der Filmproduktion: die Technik, das Handwerk, die Effekte. Trotz seiner Begeisterung für das Medium Film bedeutete ihm in dieser Zeit die Bildende Kunst aber immer noch sehr viel. Nach wie vor malte und zeichnete er mit großem künstlerischen Enthusiasmus. Er versuchte sich zudem auch als Designer und entwarf für die väterliche Firma einen Messeaufbau, der ein großer Erfolg und auch viele Jahre später noch benutzt wurde. Und eine weitere Leidenschaft kam hinzu: die Fotografie.
Nachdem er sich eine Dunkelkammer eingerichtet hatte, begann er mit fotografischen und grafischen Arbeiten für seinen Vater und andere, die sich für sein Schaffen interessierten. So dauerte es nicht lange, bis er nebenher auch in einer Werbeagentur zu arbeiten begann. Schon in dieser Zeit zeigte sich, dass der Kopf des begeisterungsfähigen Nachwuchskünstlers prallgefüllt war mit unorthodoxen Ideen und Einfällen. Wie bizarr diese zum Teil waren, zeigte sich im November 1976. Zu seinem 21. Geburtstag verschickte er Einladungen in Form von Trauerkarten und bat seine Gäste, dem traurigen Ende seiner von ihm innig geliebten Jugend beizuwohnen. Zur Überraschung der Besucher wurden sie dann tatsächlich Zeugen einer Beerdigung: Emmerich hatte keine Kosten und Mühen gescheut, um dem Spektakel einen realistischen Anstrich zu geben, weswegen er sich weiß schminken ließ und in einen Sarg legte. Vollends verblüfft zeigten sich die Zuschauer, als der Sarg geschlossen und zu Grabe getragen wurde. Die irritierten Gäste erfuhren später, dass das Behältnis leer gewesen sei. Schon damals hatte Emmerich eben erkannt, wie sich mit einfachen Tricks große Wirkung erzielen lässt.
Sein Schaffensdrang aber war, auch nachdem er seine Jugend zu Grabe getragen hatte, ungebrochen, weshalb er sich in die Arbeit zu einem Kinderbuch stürzte: Der Planet Himmelblau handelte von einem Jungen, der im Traum zu einem anderen Planeten fliegt, auf dem es keinen Regenbogen, sondern nur drei Farben gibt, die gleichzeitig Völker repräsentieren: die Blauen, die Roten und die Gelben. Die Blauen beherrschen die anderen. Aber der Junge zeigt einen Ausweg aus der Tyrannei auf, indem er den Völkern erklärt, dass sich die drei Farben mischen lassen und so neue Farben entstehen können. Derart kehrt der Regenbogen schließlich auf den Planeten zurück.
Das Buch hatte Roland Emmerich für Fünf- bis Achtjährige konzipiert. Er schrieb den Text, zeichnete für die Illustrationen verantwortlich und bemühte sich, das in mühevoller Arbeit entstandene Bilderbuch auch zu veröffentlichen. Aber das wollte nicht klappen. Alle Verlage, die er anschrieb, sagten ihm ab. Was ihn an diesem Projekt trotzdem fasziniert hatte, war das Zusammenwirken von Text und Bild. Er musste sich dann jedoch selbst eingestehen, dass das Buch nicht mehr als ein Notbehelf für ihn war: Sein eigentlicher Traum handelte davon, Filme zu drehen, aber eben nicht nur Super-8-Urlaubserinnerungen, sondern professionelle Produktionen mit einem talentierten Team und ordentlichem Budget. Dazu fehlte ihm zu diesem Zeitpunkt allerdings das nötige Kleingeld.
Nachdem er schließlich das Abitur hinter sich gebracht hatte, machte er sich über seine Zukunft ernsthafte Gedanken: Er war an einem Kunststudium interessiert, zog jedoch auch ein Studium in den Bereichen Publizistik und Grafik in Betracht. Aber es gelang ihm nicht, sich zu entscheiden, was seine Eltern verständlicherweise nervös werden ließ, hätten sie doch gern gewusst, welchen Beruf ihr Sohn zu ergreifen gedachte.
Aber dieser drückte sich erst einmal vor der Entscheidung und fuhr mit einem Freund nach Paris. Während er behaglich auf dem Beifahrersitz lümmelte und weiter über seine Zukunft nachgrübelte, packten ihn Erinnerungsbilder und Zukunftsvisionen, die auftauchten und wieder verschwanden, wie Rückblenden in einem Film. Bewegte Bilder schwebten in seinen Gedanken vorüber, wie im Kino. Als er in dieser Nacht mit seinem Freund die französische Grenze passierte, fühlte er sich wie der Zuschauer in einem Kinosaal: In der Dunkelheit lief eine Art innerer Film vor ihm ab. Ihn durchzuckte die Erkenntnis, dass sich weder mit Worten noch mit Gemälden Gefühle erzeugen ließen, die mit denen eines guten Films vergleichbar wären.
Ihm kam Mike Nichols Liebesdrama Reifeprüfung mit Dustin Hoffman und Anne Bancroft in den Sinn. Schnelle Schnittfolgen zeigen dort den Protagonisten an verschiedenen Orten: im Hotelzimmer, Swimmingpool oder Elternhaus. Diese blitzschnellen Wechsel, diese totale Freiheit von Ort und Zeit, gewährt als Möglichkeit nur der Film. Als Emmerich von Paris nach Hause zurückkehrte, entschloss er sich, eine Karriere als Filmemacher einzuschlagen.
Zuerst einmal gelang es ihm dann dank einer Freundin seiner Eltern, ein Praktikum beim Süddeutschen Rundfunk zu ergattern. Dort konnte er zwei Monate lang hinter die Kulissen des TV-Geschäfts blicken. Doch die Arbeit beim Abendjournal war letztlich nicht das, was er sich vorgestellt hatte. Er zeigte kein Interesse daran, ein Fernsehjournalist zu werden, der davon lebt, jeden Tag einen zweiminütigen Bericht abzuliefern. Weil er schon damals viel Wert auf ausgetüftelte Bildgestaltung legte, befriedigten ihn die schnell produzierten und formal unausgereiften TV-Nachrichten nicht.
Immerhin bekam er die Empfehlung, sich doch für ein Studium an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) zu bewerben. Eine angesehene Institution, die schon viele Filmschaffende von Rang und Namen hervorgebracht hatte. Allerdings machte sich Emmerich keine allzu großen Hoffnungen, schließlich waren die Chancen, einen der begehrten zwölf Studienplätze zu erobern, sehr gering, gingen die Bewerberzahlen doch in die Tausende. Trotzdem bewarb sich der junge Filmfan mit einem aufwendig gestalteten Lebenslauf. Er schaffte es in die engere Auswahl und wurde sogar zur Aufnahmeprüfung geladen. Ohne zu wissen, ob er diese bestanden hatte, reiste er anschließend quer durch Europa. Er wollte einfach nochmals ausgiebig Urlaub machen, bevor er sich ins Berufs- oder Studentenleben stürzte.
Gerade als er in Griechenland angekommen war, klingelte dann das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldete sich seine Mutter, die ihm mit vor Aufregung zitternder Stimme mitteilte, dass er von der HFF angenommen worden sei und dort mit dem Studium sofort beginnen könne. Die Reise hatte ein abruptes Ende gefunden.
An der HFF informierte sich der frischgebackene Student erst einmal über die verschiedenen Studienschwerpunkte. Er hatte ein besonderes Interesse für die Ausstattung von Filmen entwickelt und sah in dem Beruf des Production Designers die Möglichkeit, seine Vorliebe für das Kino und die Malerei miteinander zu vereinen. Für das Design und den Look eines Films verantwortlich zu sein, war ein Gedanke, der ihn durchaus faszinierte.
Tatsächlich arbeitete er während des Studiums auch sehr engagiert als Ausstatter für Projekte anderer Studenten. Doris Dörries Der erste Walzer gehörte ebenso dazu wie Tomy Wigands Lotte. Auch als Darsteller versuchte er sich u.a. in dem Übungsfilm Verlieben vielleicht von Gabriele Walther, die dann nach dem Studium Produktionsleiterin seiner ersten Kinofilme wurde. An der HFF lernte Emmerich auch Karl Walter Lindenlaub kennen, der viele seiner späteren Kinofilme fotografieren sollte, u.a. auch Independence Day.
Aber nicht nur, dass der filmbegeisterte Schwabe während des Studiums viele seiner späteren Mitarbeiter kennenlernte, er stellte auch recht bald fest, dass ihn die Arbeit als Production Designerzu unterfordern begann. Und da er sich bei zahlreichen Studenten-Projekten so stark über seine Arbeit als Ausstatter hinaus engagiert hatte, gaben ihm Kommilitonen schließlich den Tipp, ins Regiefach zu wechseln.
Obwohl dieses Betätigungsfeld Emmerich anfänglich irritierte, drehte er doch erste eigene Übungsfilme zusammen mit Ulrich Möller und Oswald von Richthofen. Mit Letzterem inszenierte er den aufwendigen Schwarzweiß-Film Franzmann, bei dem er auch seine Schwester Ute für eine kleine Rolle engagierte. Auf den 14. Internationalen Hofer Filmtagen wurde der Streifen uraufgeführt und später in den dritten Fernsehprogrammen ausgestrahlt.
Der inzwischen 27-jährige Filmstudent fühlte sich jedoch wie ein Außenseiter, weil er im Gegensatz zum Großteil seiner Kommilitonen nichts mit dem hyperintellektuellen, zuschauerfeindlichen Autorenkino anfangen konnte, sondern sich für große Unterhaltungsfilme Hollywood’scher Prägung interessierte. So verfiel er schließlich auf die Idee, als Abschlussarbeit für die HFF einen großen Ausstattungsfilm zu inszenieren, der vor allem durch eine ausgefeilte Optik überzeugen sollte. Dafür schwebte ihm ein Science-Fiction-Spektakel mit eindrucksvollen Tricks vor, so wie man das eigentlich von der Traumfabrik gewöhnt war.
Als Emmerich Mit-Studenten von seinem Vorhaben erzählte, erntete er nichts als Gelächter: Science-Fiction-Kino made in Germany? Das hielten die meisten für ein absolut absurdes Unterfangen. Aber genau diese ablehnende Haltung seiner Kommilitonen entfachte Emmerichs Ehrgeiz und spornte ihn noch mehr an. Es galt die Spötter und Zweifler eines Besseren zu belehren und so machte er sich daran, ein Drehbuch für ein Projekt mit dem Titel Das Arche Noah Prinzip zu schreiben. Obwohl auch ihm nur das übliche Abschlussfilm-Budget von 20.000 Mark zur Verfügung stand, ließ er sich nicht davon abhalten, das Unmögliche möglich zu machen und dieses ambitionierte Projekt zu realisieren, das, wie er von Beginn an wusste, um ein Vielfaches teurer werden würde. Er bemühte sich erfolgreich um Gelder von Filmfördergremien und bekam außerdem Unterstützung von Fernsehanstalten. So konnte er schließlich seinen ersten Spielfilm auf Zelluloid bannen. Am Ende kostete Das Arche Noah Prinzip rund eine Million Mark, sorgte bei der Berlinale für viel Aufsehen und wurde zu einem der erfolgreichsten Abschlussfilme in der Geschichte der HFF.
Interview mit Roland Emmerich:
„Neues Deutsches Kino – Nein, danke!“
Trügt der Eindruck oder haben Sie tatsächlich ganz andere Vorstellungen vom Medium Film als die Vertreter des Neuen Deutschen Kinos?
RE: Ich bin wesentlich jünger als die Regisseure des sogenannten Neuen Deutschen Films, was bedeutet, dass ich in eine andere Zeit hineinwuchs. Wenn ich in den politischen 1960er Jahren großgeworden wäre, hätte ich mich sicherlich für andere Filme interessiert. Man ist einfach immer ein Spiegelbild seiner Zeit. Bei mir war es auf der HFF so etwas wie ein Trotzverhalten. Ich wollte mich von dem distanzieren, was alle anderen gut fanden. Ich dachte einfach, nie solche Filme machen zu wollen wie die der verehrten Regisseure Werner Herzog, Alexander Kluge oder Wim Wenders. Selbstverständlich habe ich bei meinen Filmen auch viele Fehler gemacht und ärgerte mich nach dem Dreh über diese oder jene dramaturgische Unzulänglichkeit. Trotzdem bin ich froh, es damals riskiert zu haben, Unterhaltungsfilme zu drehen. Wichtig war mir allerdings etwas, das sich in dieser Zeit sonst niemand traute: Ich wollte von Anfang an selbst produzieren! Deshalb sorgte mein Vorgehen auch für sehr viel Aufmerksamkeit. Es war mir möglich und wichtig, schon frühzeitig bei der Finanzierung mitreden zu können. Dadurch verschaffte ich mir große Unabhängigkeit.
Haben Sie einen Bezug zum Oberhausener Manifest, in dem deutsche Regisseure Opas Kino für tot erklärten?
RE: Das ist alles inzwischen sehr weit weg für mich. Ich besitze überhaupt keinen Draht zu diesen jungen deutschen Filmemachern von einst. Allerdings bewundere ich die Allianz dieser Leute. Sie halten auch heute noch fest zusammen. Diese Allianz wünsche ich mir manchmal unter uns Jüngeren. Wir könnten sicher sehr viel mehr erreichen, würden wir uns besser untereinander austauschen und Verbindung zueinander halten. Das Forum des Regieverbandes ist dafür, aus meiner Sicht, völlig ungeeignet. Das müsste eher etwas sein, das auf privater Ebene abläuft, so etwas wie eine Selbsthilfegruppe. Das ist leider aber nicht der Fall.
Was für eine Stellung haben Sie bei den deutschen Filmemachern?
RE: Ich werde von Journalisten oft gefragt, was denn die arrivierten neuen deutschen Filmkollegen von mir halten würden. Aber genau besehen, sind das ja die alten deutschen Filmkollegen. Ich bin eine Art Repräsentant des neuen neuen deutschen Kinos. DieRegisseure der alten Garde habe ich bisher kaum kennengelernt. Aber diejenigen, die ich traf, meinten meist: „Das, was du machst, ist richtig.“
Waren Sie als Kind ein Kinofan?
RE: Ich war schon immer ein Filmfan. Als Kind bin ich sehr häufig ins Kino gegangen. Am liebsten mochte ich die Karl- May-Verfilmungen aus den 1960er Jahren. Mein persönlicher Rekord war, mir an einem Tag dreimal hintereinander Winnetou anzugucken. Auf der Filmhochschule wurden wir alle mal gefragt, welche Filme oder Regisseure wir bevorzugen würden. Während die meisten Kommilitonen Wim Wenders angaben, nannte ich Horst Wendlandts Winnetou-Filme. Überhaupt: Horst Wendlandt war ein Produzent, dessen Filme über Jahrzehnte hinweg großen Umsatz an der Kinokasse machten und mehr einspielten als die problembeladenen Autorenfilme.
Sie scheinen nicht nur eine Vorliebe für Unterhaltungsfilme, sondern auch für Visual Effects zu haben?
RE: Für Tricks begann ich mich schon während meiner Studienzeit auf der HFF zu interessieren. Ich schrieb Geschichten, die sich eben nur mit Visual Effectsrealisieren ließen. Deshalb setzte ich mich mit meinen Freunden zusammen und wir überlegten, wie wir dieses oder jenes auf die Leinwand bringen könnten. Wir bauten Raumschiff-Modelle und drehten drauflos. So erschlossen sich für uns nach und nach die Geheimnisse der Trick-Hexenküche. Es war einfach notwendig, alles über die Herstellung von filmischen Effekten in Erfahrung zu bringen, anders hätte ich Das Arche Noah Prinzip nicht machen können. Da der größte Teil der Handlung in einer Raumstation spielt, war mir bewusst, dass ich viele Dekorationen brauchen würde. Mir war allerdings nicht ganz klar, wie ich die Außenaufnahmen im All überzeugend verwirklichen könnte. Wir besorgten uns schließlich Fotos von der NASA und bastelten uns danach unser Raumschiff-Modell. Den Weltraum stellten wir mit einem durchlöcherten schwarzen Pappkarton her, der von hinten beleuchtet wurde. Die getrennt aufgenommenen Aufnahmen des Raumschiffs und die des Alls kombinierten wir durch eine Mehrfachbelichtung miteinander. Eine uralte Methode des Trickpioniers Georges Méliès. Das war ein ziemlich nervenaufreibender Prozess. Da wir alles In-camera drehten, mussten wir beim geringsten Fehler wieder von vorne anfangen.
Das Arche Noah Prinzip:
Aufbruch in neue Kinowelten
Die gigantische Raumstation Florida Arklab schwebt 189 Kilometer über der Erde. Ausgerüstet mit modernster High-Tech besteht ihre Aufgabe darin, Einfluss auf das Klima- und Wettergeschehen zu nehmen. Das Gemeinschaftsprojekt amerikanischer und europäischer Raumfahrtbehörden soll durch Wetter bedingte Naturkatastrophen verhindern. An Bord befinden sich Max Marek (Franz Buchrieser), ein Wissenschaftler, der diesem neuen Projekt skeptisch gegenübersteht, da es sich leicht für militärische Zwecke missbrauchen lässt, sowie sein Kollege, der Techniker Billy Hayes (Richy Müller), der in dieser Hinsicht weniger argwöhnisch ist. Er interessiert sich ausschließlich für seinen Job und will von Mareks Warnungen nichts wissen.
Als es jedoch eines Tages zu einem Putsch in Saudi-Arabien kommt, wird den beiden Astronauten auf Befehl der Bodenstation aufgetragen, ein Gebiet im Persischen Golf einer verstärkten Infrarotstrahlung auszusetzen. Auf diese Weise sollen die Radarstationen der Gegner blockiert werden, um US-Truppen den Einmarsch in das Land zu ermöglichen. Mareks Bedenken bestätigen sich durch diesen Vorfall: Aus Angst vor den schwerwiegenden klimatischen Folgen einer solchen Wettermanipulation entschließt er sich zu einem Sabotageakt: Ohne Hayes’ Wissen blockiert er das Computerprogramm. Doch der Eingriff bleibt nicht unbemerkt. Die Bodenstation schickt eine neue Crew ins All, um das Kommando über die Florida Arklab zu übernehmen. Kaum aber haben die Neuankömmlinge mit ihrem Space Shuttle angedockt, beginnt ein mörderischer Kampf ums Überleben …
Roland Emmerich wollte als Abschlussarbeit seines Studiums an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film etwas inszenieren, das in dieser Art in Deutschland in jener Zeit einmalig war: einen Science-Fiction-Thriller. Nicht nur, dass er, ganz gewitzter Geschäftsmann, dabei mit einer solch spektakulären Produktion geschickt auf sich aufmerksam und eine Marktlücke schließen konnte, ihm schwebte auch vor, diesem in Deutschland seit vielen Jahrzehnten vernachlässigten Genre zu neuer Popularität zu verhelfen. Längst war nämlich in Vergessenheit geraten, dass hierzulande während der Stummfilm-Ära die größten Meisterwerke des phantastischen Kinos entstanden waren. In den 1920er Jahren ließen viele deutsche Regisseure ihrer Phantasie freien Lauf und in ihren Filmen geheimnisvolle Märchen- und Zukunftswelten entstehen. Auf der Leinwand tummelten sich blutrünstige Vampire, übernatürlich begabte Verbrecher, teuflische Dämonen, künstliche Menschen. Friedrich Wilhelm Murnau schockierte das Publikum mit den beklemmend-faszinierenden Licht- und Schatteneffekten seines Blutsauger-Dramas Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens, während Regisseur Robert Wiene den expressionistischen Zelluloid-Albtraum Das Cabinett des Dr. Caligari kreierte und Fritz Lang das gigantische Zukunftsspektakel Metropolis erschuf.
Mit großer Verwunderung hatte Emmerich während seines Studiums zur Kenntnis genommen, dass die meisten seiner Kommilitonen sich um die Tradition des phantastischen Kinos nicht im geringsten kümmerten, sondern sich ausschließlich dem Neuen Deutschen Kino verpflichtet fühlten, obwohl dieses sich, seiner Meinung nach, längst überlebt hatte, zumal die meisten Produktionen dieser Art unter Ausschluss der Öffentlichkeit liefen. Emmerich seinerseits hielt nichts von den ichbezogenen Kinovisionen vieler seiner Kollegen, die sich von Fördertöpfen nährten und mit ihren Werken dem eigenen Ego schmeicheln wollten. Weil er schon früh das Selbstverständnis entwickelt hatte, eher ein Handwerker als ein Künstler zu sein, keimte in ihm die Vorstellung, ein publikumsorientiertes Kino zu erschaffen, das sich auch verpflichtet sieht, die eigenen Produktionskosten wieder einzuspielen.
Konfrontiert mit zahlreichen Berichten über Space-Shuttle-Flüge und Satellitenbildern in den Fernsehnachrichten, entwickelte er so die Idee zu seinem Aufsehen erregenden Debüt Das Arche Noah Prinzip. Bereits in der Entwicklungsphase stellte sich heraus, dass der Film die üblichen Dimensionen einer HFF-Abschlussarbeit sprengen würde. Dem jungen Regisseur wurde daher empfohlen, sich um Fördergelder zu bemühen. Und so reichte er denn sein Drehbuch beim Kuratorium Junger Deutscher Film ein, ohne sich jedoch große Hoffnungen zu machen, schließlich war sein Projekt zu aufwendig und zu ungewöhnlich: eine Pionierarbeit, die mit vielen Risiken verbunden war.
Ebenso außergewöhnlich wie das Projekt selbst war auch die Form des Drehbuchs. Emmerich hatte sich nicht an die Maßgaben gehalten, wie Scripts normalerweise verfasst zu sein hatten, sondern schrieb einfach einen Roman. Diese Form reflektierte seiner Meinung nach am besten den Stil des Films. Dazu legte er Skizzen des Raumschiff-Modells und Fotos von ersten Konstruktionen. Was letztlich das Kuratorium Junger Deutscher Film bewog, das Projekt zu fördern, liegt bis heute im Dunkeln. Ob dies aufgrund des außergewöhnlichen Themas oder der ungewöhnlichen Form des Buches geschah – Emmerich vermochte es nie in Erfahrung zu bringen.
Das Glück blieb ihm indes auch später bei diesem Projekt hold und er wurde nicht nur mit weiteren Fördergeldern unterstützt, sondern konnte zudem einen Co-Produzenten für seinen Film finden. Schließlich beteiligten sich an der Produktion auch noch das Bundesministerium des Inneren sowie die Filmförderungsanstalt. Emmerich und seiner Crew standen zu diesem Zeitpunkt damit 450.000 D-Mark zur Verfügung – immer noch zu wenig, um die Geschichte so auf die Leinwand zu bannen, wie sie sich der Regisseur vorgestellt hatte.
Dieser suchte derweil in München nach geeigneten Hallen, die er in ein Filmstudio verwandeln konnte. Doch sämtliche Versuche, dort einen geeigneten Drehort zu finden, schlugen fehl. Die Gebäude, die in Betracht gezogen wurden, entpuppten sich entweder als zu klein oder zu teuer.
Als die Location-Suche komplett in eine Sackgasse zu münden drohte, entschloss sich Emmerich, seine Sindelfinger Connection spielen zu lassen. Und tatsächlich fand sich in seiner alten Heimat innerhalb weniger Wochen eine für das Projekt perfekt geeignete Halle: eine ehemalige Waschmaschinenfabrik, die eigentlich abgerissen werden sollte. Für eine geradezu lächerliche Monatsmiete von 600 Mark konnte die Crew diese in ein Filmstudio umwandeln. Sie tauften das Gebäude DL-Studio – DL für Deadline –, um daran zu erinnern, dass das Gemäuer nach den Dreharbeiten abgerissen werden würde. Mit Unterstützung professioneller Schreiner, Maler und Zimmerleute arbeitete die junge Filmcrew unter Anleitung Emmerichs mehrere Monate an den aufwendigen Dekors der Florida Arklab. Die Inneneinrichtung wurde aus Styropor-, Holz- und Kunststoffteilen hergestellt. Des Weiteren besorgten sich die Filmbastler von verschiedenen Firmen ausrangierte Computer-Monitore, die geschickt in die Kulissen integriert werden konnten. Zahlreiche Lämpchen, die ringsum drapiert wurden, verstärkten den erstaunlich realistischen Eindruck einer Raumschiff-Kommandozentrale.
Bald schon war die 1.000 Quadratmeter große Halle vollgestopft mit Kulissen, Maskenräumen und Garderobe, Produktionsbüros und einem kleinen Trickstudio, in dem verschiedene Aufprojektionen von Weltraum-Dias eingerichtet wurden. Emmerich engagierte für seine ambitionierte Filmproduktion zahlreiche Kommilitonen der HFF, die sich mit Begeisterung in das Projekt stürzten: Egon Werdin übernahm die Kameraarbeit, Gabriele Walther die Produktionsleitung, Tomy Wigand den Schnitt. Seinem Schulfreund Hubert Bartholomae, der eigentlich mit dem Kinogeschäft bis dahin nichts zu tun gehabt hatte, übertrug er vertrauensvoll die Realisation der Visual Effectssowie die Komposition der Musik. Schon während die erste Drehbuch-Fassung entwickelt worden war, hatte der Elektrotechniker damit begonnen, den Sound zu diesem Science-Fiction-Film zu kreieren. Bartholomae war jedoch auch mit der Herstellung des Raumschiff-Modells betraut und bastelte dieses aus Cola-Dosen zusammen.
Im Herbst 1981 fiel dann endlich die erste Klappe. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Crew nicht ahnen, welch brutaler Überlebenskampf ihr bevorstehen würde. Täglich 16 bis 18 Stunden musste das Team in der von Kunstnebel geschwängerten Luft des Studios zubringen, von Set zu Set wechseln, Kabel und Kameraschienen verlegen, Kulissen umbauen, Scheinwerfer neu einstellen. Abends erwartete die Mitglieder kein gemütliches Hotelzimmer, sondern ein Matratzenlager im Gebäude der Ortskrankenkasse. Statt einer Gage gab es Gulasch in der Kantine von Vater Emmerich, eine Auslagen-Erstattung sowie ein kleines Taschengeld. In den Genuss einer Entlohnung im üblichen Rahmen kamen nur die Schauspieler: der aus Österreich stammende Franz Buchrieser, der den kritischen Wissenschaftler Marek spielte und mit seinen 41 Jahren der Älteste des Teams war, sowie Richy Müller, der für die Rolle des Billy Hayes engagiert worden war.